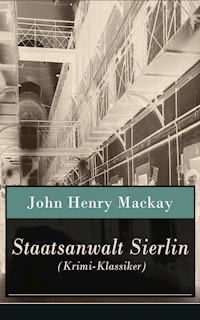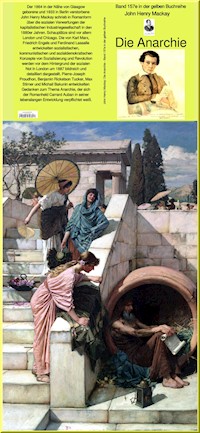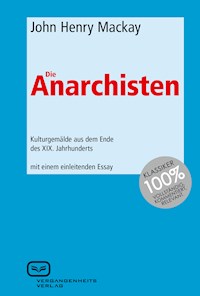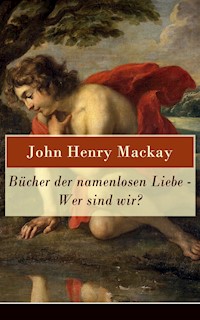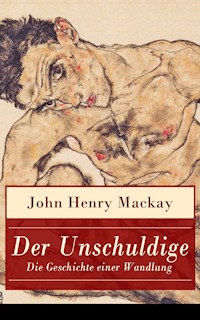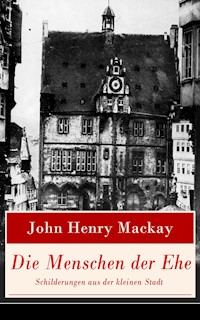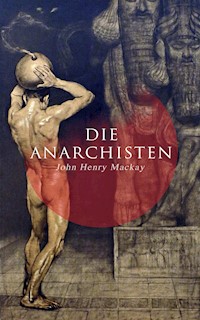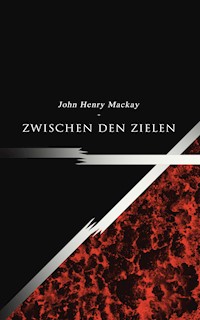1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
In 'Der Unschuldige' von John Henry Mackay taucht der Leser in die düstere Welt des Protagonisten Franz Leopold ein, der aufgrund einer unglücklichen Verkettung tragischer Ereignisse seine Unschuld verliert. Mackay, ein bekannter Vertreter des Anarchismus, präsentiert das Werk in einem fesselnden, fast poetischen Stil, der den Leser von der ersten Seite an packt. Das Buch ist von einer tiefen Melancholie durchdrungen, die die zerrüttete Psyche des Protagonisten einfängt und den Leser auf eine emotionale Achterbahnfahrt mitnimmt. Mackays Werk ist nicht nur als literarische Meisterleistung anzusehen, sondern auch als Sozialstudie über die Verlorenheit des Individuums in einer zunehmend entfremdeten Gesellschaft. Der Autor selbst war ein radikaler Denker seiner Zeit, der durch eigene Erfahrungen inspiriert wurde, um das Buch zu verfassen. 'Der Unschuldige' ist ein Buch, das den Leser dazu bringt, über die Grenzen von Schuld und Unschuld, Recht und Unrecht, Moral und Gesetz nachzudenken. Es ist ein Werk, das in jedem Bücherregal einen besonderen Platz verdient und Leser aller Genre anspricht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Der Unschuldige
Books
Inhaltsverzeichnis
Auch das ist nun schon wieder eine ganze Reihe von Jahren her, und doch steht der Tag noch so deutlich vor mir, als sei er gestern gewesen, der Tag, in dessen Nachmittagsstunden er (der jetzt auch nicht mehr ist) mir die Geschichte seines Freundes erzählte, nachdem uns der Zufall an dem frischen Grabe zusammengeführt.
Denn es war ein reiner Zufall. Es war nicht meine Absicht gewesen der Bestattung beizuwohnen. Dazu hatten wir uns, der Verstorbene und ich, in den langen Jahren zu wenig mehr gesehen, und bei diesen seltenen Gelegenheiten war mir nur allzu deutlich gezeigt worden, daß eine Fortsetzung unserer früheren Bekanntschaft aus der Studentenzeit nicht gewünscht wurde.
Was mich an diesem klaren und trockenen Herbsttag um dieselbe Stunde auf den Kirchhof von Marien führte, war ein anderer Grund: das von Zeit zu Zeit immer wieder auftauchende Gerücht, der schwere Stein, der dort das Grab eines einsamen Denkers deckte, sei von der Friedhofverwaltung entfernt worden (oder drohe doch, entfernt zu werden). Ich überzeugte mich dann jedesmal, daß er noch immer fest und sich auf seinem alten Platze lag.
So sah ich denn, für die Teilnahme an einem Begräbnis auch gar nicht gekleidet, nur aus der Ferne der Bestattung des ord. Professors der Kunstgeschichte an der Universität, Dr. Heinz von Solden, zu. Sie war, wohl auf seinen eigenen hinterlassenen Wunsch, von äußerster Kürze. Auch die Trauerversammlung war wenig zahlreich: ein paar ältere Herren, Kollegen von der gleichen und den anderen Fakultäten, fast sämtlich Träger bekannter Namen; fünf oder sechs junge Leute, zweifellos seine Hörer; und – als einzige Frau unter den Männern – eine tief verschleierte Dame. Nicht seine Frau, denn von Solden war unverheiratet geblieben, und wohl auch keine Verwandte, denn sie hielt sich betont abseits. Doch trat jetzt, wo der Geistliche fast fluchtartig den Ort verließ, fast jeder der Herrn auf sie zu, um sich von ihr zu verabschieden, und die Art, wie sie – bei aller Ehrerbietung – es taten, zeigte, daß sie mit ihr gut bekannt sein mußten. Auch ich erkannte sie jetzt. Es war Frau Professor Rudorff, die Gattin des berühmten Chirurgen.
Wahrend ich mich einem anderen, entfernteren Teile des Kirchhofes zuwandte, um das Grab mit dem schweren Stein unter den vielen anderen neu aufgeschütteten zu suchen, stiegen die Erinnerungen an Heinz von Solden in mir auf, und er stand wieder vor mir, wie er mir – vor dreißig Jahren – erschienen war; stand in voller Lebendigkeit vor mir, so wenig ich auch seitdem Gelegenheit und Lust gehabt, mich seiner zu erinnern und ihn heraufzubeschwören.
Es mußte wohl schwer fallen ihn ganz zu vergessen, für den, der ihn einmal gekannt, wie er damals war: in dem strahlenden Glanze der Jugend; schlank und beweglich; mit den leuchtenden, blauen Augen; der edlen Stirn, über die das blonde Haar in einer so eigensinnigen Locke fiel, daß er es immer wieder mit einem Ruck des Kopfes zurückwerfen mußte; der zarten Nase in dem klugen, gelblichen Gesicht; den schmalen Händen und Füßen; und jener vollkommenen Liebenswürdigkeit des Wesens, sowie einer bezaubernden Gabe des Zuhörens, die sich selbst dem langweiligsten Gesellen gegenüber nicht ganz zu verleugnen vermochte – es wäre schwer gewesen, es ganz zu vergessen, dieses Bild einer reinen und schönheit-trunkenen Jugend, dachte ich wieder, wie ich mich durch die engen Gänge zwischen den Gräbern wand, um endlich das Gesuchte zu finden.
Er war es denn auch gewesen, der unseren kleinen Kreis – (alles noch nicht Zwanzigjährige) – zusammenhielt, in dem wir uns zu Sang und Trunk, ohne Sauferei und Schlägerei, ein oder zweimal wöchentlich zusammenfanden, um (mit Ausnahme von Politik) so ziemlich über alles in der Welt zu reden und zu disputieren. Und vor allem darüber, wie wir sie gemacht hätten, diese Welt, wenn ...
Wir liebten ihn alle. Er war unser anerkanntes Haupt, wenn er es in seiner Bescheidenheit auch abgelehnt hätte, dafür zu gelten. Wenn einem von uns, so paßte auf ihn, was der Name unserer Vereinigung besagte. Denn wir nannten uns, stolz und herausfordernd, die ›Zukünftigen‹.
Er stand, wie wir alle, in einem frühen, wenn ich nicht irre, sogar im ersten Semester und studierte Philosophie, vor allem aber in dieser Fakultät Kunstgeschichte.
Immer sprach er von Piranesi. Von Giambattista Piranesi, dem großen italienischen Kupferstecher und – wie er sich selbst nannte – »architetto veneziano« des achtzehnten Jahrhunderts (Architekt allerdings nur in seiner eigenen Phantasie) ... Ihm sollte die Hauptarbeit seines Lebens gelten. Für ihn suchte er auch uns zu begeistern, und wir gingen mit (wie wir überall hin mit ihm mitgegangen wären), wenn wir auch nicht recht gegriffen, was grade diesen bis in die Fingerspitzen kultivierten Menschen zu der düsteren, wilden Welt des verschollenen Rom mit ihren umgrünten Ruinen und ihren zerlumpten unheimlichen Gestalten zog, diesen »macchiette«, die – mit den langen Stäben in der Hand – so wunderlich auf den heutigen Betrachter wirken müssen. In den Untertiefen dieser jungen Seele mußten doch wohl Kräfte am Werk sein, die ihn magisch zu dem großen Zeichner hinzogen, und dort, in diesen Tiefen mußte liegen, was ihn hier, in den unzähligen Blättern einer ungebändigten Phantasie, als verwandt ansprach.
Wie es schwer gewesen wäre, die Erscheinung Heinz von Soldens in jenen glücklichen Tagen zu vergessen, so unmöglich war es, sich nicht – auch nach so vielen Jahren nicht – dessen zu erinnern, was dann geschah; an das Unerklärliche und nie Aufgeklärte. ›Was dann geschah‹ ... ein ganz unzutreffender Ausdruck. Es geschah eben – nichts!
Nur dieses: daß er eines Tages fortblieb. Einfach, von heute auf morgen, ohne ein Wort der Erklärung oder Entschuldigung, fortblieb. Nicht nur aus unserem Kreise. Auch von den Vorlesungen in der Universität.
Er war wie in den Erdboden versunken.
Bei Besuchen auf seiner Bude war er nicht anzutreffen oder ließ sich von seiner Wirtin verleugnen.
Traf man ihn aber wirklich einmal auf der Straße – und immer in ganz abgelegenen Gegenden – ging er entweder grußlos vorüber und so schnell weiter, daß es unmöglich war, ihm zu folgen, oder er war in seinem Wesen so merkwürdig verändert gegen früher, und dabei, im Gegensatz zu seiner früheren Art, so schroff abweisend, daß jede Frage verstummen mußte.
Einen eigentlichen, intimen Freund – das stellte sich jetzt und zu allgemeinem Erstaunen heraus –, dem er hätte Rede und Antwort stehen müssen, besaß er nicht.
Er war und blieb fort und keiner von uns wußte oder hatte auch nur eine Ahnung: weshalb.
»Grade als ob er sich die Krankheit geholt habe ...« meinte einer.
Aber sofort protestierte ein anderer heftig: Heinz von Solden gehöre nicht zu denen, die sich mit käuflichen Weibern einließen.
Was einem dritten Gelegenheit zu der weisen Bemerkung gab, daß grade die (wenn sie einmal ...) am ersten hereinfielen ...
Im Grund waren wir alle überzeugt, daß es nicht das war, was ihn von uns und aller Welt fernhielt.
Aber was war es? – Was konnte es sein? –
Inzwischen wurden wir unserem müßigen Fragestellen und Rätselraten schon nach wenigen Wochen durch den Semesterschluß enthoben. Die großen Sommerferien begannen, und mit ihnen zerstreuten wir uns nach allen Himmelsrichtungen. So viel wir – die wenigen Zurückbleibenden, weil Ansässigen – wußten, verließ Heinz von Solden ebenfalls die Stadt.
Als wir zu Beginn des Herbstes wieder zusammenkamen, blieb er fort und alles, was wir von ihm ab und zu noch in den nächsten Jahren hörten, war: daß er zunächst, in Unterbrechung seiner akademischen Laufbahn, eine mehrjährige Reise nach dem Süden angetreten habe; sich dann an einer anderen, süddeutschen Universität habe immatrikulieren lassen; und endlich, nach dem Tode seiner Mutter, und einem nochmaligen längeren Aufenthalt im Auslande (wohl Griechenland) promoviert habe.
Was dann die drei oder vier noch Übrigen aus dem damaligen Kreise – ich unter ihnen – von ihm selbst sahen, als er, nach zwanzig Jahren, als Professor der Kunstgeschichte hierher zurückkam, war nur: daß der Zurückgekehrte ein völlig Anderer geworden war, als der, den wir einst gekannt und geliebt und der einst so schweigend von uns gegangen, ein frühgealterter, stiller und müder Mann, den wir erst so wenig wiedererkannten, wie er uns noch zu kennen schien, mit Vierzig schon grau an den Schläfen, ein Fremdgewordener, der denen, die ihn dennoch anzusprechen den Mut fanden, mit eisiger Höflichkeit und einem so offensichtlichen Bestreben in nichts, aber auch in nichts an das einst gewesene erinnert zu werden, begegnete, daß es schon einer außergewöhnlichen Aufdringlichkeit bedurft hätte, ihn nicht dort zu lassen wo er so offensichtlich sein wollte – bei sich. Einer solchen Zudringlichkeit aber war keiner von uns fähig und so brach jeder Verkehr von selbst ab. Wir grüßten ihn kaum mehr, wenn wir ihn sahen, und hatten es aufgegeben, ein Rätsel zu lösen, das mit der Zeit auch jedes Interesse verlieren mußte und verloren hatte.
Seine Vorlesungen hielt er, wie ich hörte, mit großer Gewissenhaftigkeit und Gründlichkeit, aber ohne jeden Schwung und ohne Begeisterung, ja ohne innere Teilnahme, ab. Sie waren schwach besucht, und die Zahl seiner Hörer blieb bis zuletzt wohl nur ganz gering. Er war weder beliebt, noch unbeliebt. Das geistige Feuer schien gänzlich erloschen.
Von Piranesi war nie die Rede. Sein Werk über ihn erschien natürlich nicht (und war wohl auch nie ernsthaft begonnen) ...
Wie die meisten Leute, die nicht von sich reden machen, blieb er unbeachtet.
Ich selbst dachte kaum mehr an ihn, da mir jede Veranlassung dazu fehlte.
Erst heute sollte ich wieder an ihn erinnert werden.
Ich wunderte mich über mich selbst, wie tief doch noch die Erinnerungen an ihn in mir gelegen haben mußte, und wie stark, fast gegen meinen Willen, mit ihnen der alte Zauber wieder zu wirken begann, den er einst auf mich und Alle ausgeübt.
Nun war er dahingegangen, kaum fünfzig, und hatte sein Rätsel mit sich genommen in das Grab, dem ich mich jetzt wieder näherte, und das jetzt auch gewiß von dem letzten der Leidtragenden verlassen war, um verlassen zu bleiben auf immer. Denn wer sollte sich wohl um seine Pflege kümmern? Professor von Solden hatte niemand hinterlassen und sein Andenken würde bald in Vergessenheit geraten sein.