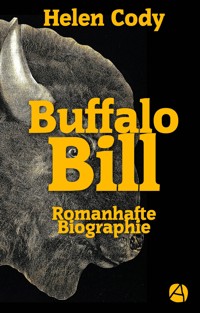
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: apebook Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Lebensgeschichte von Colonel William F. Cody, „Buffalo Bill”, erzählt von seiner Schwester Helen. Dieser biographische Roman beginnt mit Bills Jugend in Iowa und seiner ersten Begegnung mit einem Indianer. Wir sehen ihn als Pony-Express-Boten, dann in der Nähe von Fort Sumter als Chef der Scouts und später in den gefährlichsten Begegnungen mit den Indianern. Es gibt auch einen Bericht über die Reisen von Codys berühmter Wild-West-Show. Nur wenige andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens regen die Fantasie der Amerikaner so sehr an wie Buffalo Bill, der durch seinen Wagemut und seine Tapferkeit berühmt wurde. Helen Codys reiche und anschauliche Prosa erweckt die spannenden Abenteuer und die schillernden Charaktere, die den Westen im 19. Jahrhundert prägten, zum Leben. Das Buch basiert auf umfassenden Recherchen und zeichnet ein fesselndes Porträt von Buffalo Bills Vermächtnis und seinem Einfluss auf die amerikanische Kultur. Es ist damit ein Muss für Geschichtsinteressierte und Western-Fans gleichermaßen. Codys literarischer Stil verbindet historische Genauigkeit mit einem Hauch von Erzählkunst und macht das Buch sowohl informativ als auch fesselnd. Vor dem Hintergrund des Wilden Westens bietet „Buffalo Bill” eine einzigartige Perspektive auf eine entscheidende Periode in der amerikanischen Geschichte. Helen Cody bringt eine persönliche Verbindung zum Thema mit und verleiht der Erzählung Tiefe und Authentizität. Ihre Leidenschaft für die Bewahrung des Vermächtnisses ihres berühmten Verwandten ist auf jeder Seite spürbar und macht dieses Buch zu einer Pflichtlektüre für alle, die sich für die Geschichte des amerikanischen Westens interessieren. Illustrierte Ausgabe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Helen Cody
Buffalo Bill
Romanhafte Biographie
BUFFALO BILL wurde zuerst veröffentlicht im Meidinger Verlag, Berlin 1902.
Diese Ausgabe wurde aufbereitet und herausgegeben von
© apebook Verlag, Essen (Germany)
www.apebook.de
2024
V 1.0
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-96130-633-6
Buchgestaltung: SKRIPTART, www.skriptart.de
Übersetzung: Alwina Vischer
Books made in Germany with
Bleibe auf dem Laufenden über Angebote und Neuheiten aus dem Verlag mit dem lesenden Affen und
abonniere den kostenlosen apebook Newsletter!
Du kannst auch unsere eBook Flatrate abonnieren.
Dann erhältst Du alle neuen eBooks aus unserem Verlag (Klassiker und Gegenwartsliteratur)
für einen kleinen monatlichen Beitrag (Zahlung per Paypal oder Bankeinzug).
Hier erhältst Du mehr Informationen dazu.
Follow apebook!
ROMANE von JANE AUSTEN
im apebook Verlag
Verstand und Gefühl
Stolz und Vorurteil
Mansfield Park
Northanger Abbey
Emma
*
* *
HISTORISCHE ROMANREIHEN
im apebook Verlag
Der erste Band jeder Reihe ist kostenlos!
Die Geheimnisse von Paris. Band 1
Mit Feuer und Schwert. Band 1: Der Aufstand
Quo Vadis? Band 1
Bleak House. Band 1
Am Ende des Buches findest du weitere Buchtipps und kostenlose eBooks.
Und falls unsere Bücher mal nicht bei dem Online-Händler deiner Wahl verfügbar sein sollten: Auf unserer Website sind natürlich alle eBooks aus unserem Verlag (auch die kostenlosen) in den gängigen Formaten EPUB (Tolino etc.) und MOBI (Kindle) erhältlich!
Inhaltsverzeichnis
Buffalo Bill
Impressum
Erstes Kapitel: Die alte Heimstätte in Iowa.
Zweites Kapitel: Wills erster Indianer.
Drittes Kapitel: Der Schatten der Parteikämpfe.
Viertes Kapitel: Die Verfolgung dauert fort.
Fünftes Kapitel: Der Expreßjunge.
Sechstes Kapitel: Der Beschützer und Plagegeist der Familie.
Siebentes Kapitel: Indianergefecht und Schulerlebnisse.
Achtes Kapitel: Türks Tod und Begräbnis.
Neuntes Kapitel: Will als Pony-Expreßreiter.
Zehntes Kapitel: Das Echo aus Fort Sunter.
Elftes Kapitel: Ein kurzer, aber erfolgreicher Zug gegen die Indianer.
Zwölftes Kapitel: Der Mutter letzte Krankheit.
Dreizehntes Kapitel: Im Geheim-Kundschaftsdienst.
Vierzehntes Kapitel: Eine Rettung und darauffolgende Verlobung.
Fünfzehntes Kapitel: Will als junger Ehegatte.
Sechzehntes Kapitel: Wie Will zum Spitznamen Buffalo Bill kam.
Siebzehntes Kapitel: Satanta, der Häuptling der Kiowas.
Achtzehntes Kapitel: Will wird zum Oberkundschafter ernannt.
Neunzehntes Kapitel: Militärisches Leben in Fort McPherson.
Zwanzigstes Kapitel: Pa-has-ka, der langhaarige Häuptling.
Einundzwanzigstes Kapitel: Die Jagd des Großfürsten Alexis.
Zweiundzwanzigstes Kapitel: Theatralische Versuche.
Dreiundzwanzigstes Kapitel: Politisches Vorgehen der Regierung gegen die Indianer.
Vierundzwanzigstes Kapitel: Literarische Arbeiten.
Fünfundzwanzigstes Kapitel: Der erste Besuch im Big-Horn-Tale.
Sechsundzwanzigstes Kapitel: Die Rundreise durch Großbritannien.
Siebenundzwanzigstes Kapitel: Die Rückkehr des »Wilden Westen« nach Amerika und zweite Europareise.
Achtundzwanzigstes Kapitel: Der letzte große Kundschafter.
Eine kleine Bitte
Buchtipps für dich
Kostenlose eBooks
A p e B o o k C l a s s i c s
N e w s l e t t e r
F l a t r a t e
F o l l o w
A p e C l u b
ApePoints sammeln
Links
Zu guter Letzt
Erstes Kapitel: Die alte Heimstätte in Iowa.
Ein hübsches, geräumiges, sonnenbeschienenes Landhaus, umgeben von schattigen Wäldern und bunten Wiesen – dies ist das Bild, an das sich meine frühesten Kindheitserinnerungen knüpfen. Dorthin waren meine Eltern, Isak und Mary Cody, bald nach ihrer Heirat gezogen.
Die Besitzung trug den Namen Scottfarm und lag im Staate Iowa in der Nähe der historisch gewordenen kleinen Stadt Le Clair, die noch vor wenigen Jahren ein Indianerdorf gewesen war, wo Blank Hawk seine tausend Streiter zu ihrem letzten Kriegstanz versammelt hatte; wo General Scott sein Feldlager errichtet, den Vertrag mit den Sac- und Foxindianern abgeschlossen und wo, infolge einer Übereinkunft mit den Häuptlingen der Sacindianer, der berühmte Mischling Antoine Le Clair, der Gelehrte und Dolmetscher der Indianer, seine Hütte erbaut und dem Ort den Namen gegeben hatte. Hier, in dieser vom Kriegslärm der Indianer und von den bahnbrechenden Kämpfen der Weißen geschwängerten Luft, im sonnigen, waldumrauschten, wiesenumsäumten Landhause erblickte mein Bruder William Frederick Cody am 26. Februar 1846 das Licht der Welt.
Unsere von einem alten irländischen Hause abstammende Familie, die ihren Stammbaum bis auf einen der ersten schottländischen Könige zurückführt, bestand aus fünf Töchtern und zwei Söhnen – Martha, Samuel, Julia, William, Eliza, Helen und May. Samuel, ein ungewöhnlich schöner und reichbegabter Knabe, verlor noch vor zurückgelegtem vierzehnten Jahre durch einen Unglücksfall sein Leben.
Er ritt »Betsy Baker«, eine unter den alten Ansiedlern von Iowa als edles Rassepferd bekannte Fuchsstute von feurigem, zugleich aber auch etwas bösartigem Temperament. Will begleitete seinen Bruder, und obwohl der Kleine kaum sieben Jahre zählte, so saß er doch schon mit jener Leichtigkeit und Anmut, wodurch er sich auch später als erfahrener Reiter auszeichnete, auf seinem Pony. Da plötzlich wurde Betsy Baker widerspenstig und versuchte, ihren Reiter abzuwerfen. Allein vergebens bäumte sie sich und schlug nach allen Seiten aus – Samuel blieb sattelfest. Endlich gab das Tier anscheinend den Kampf auf, und voll kindlichen Frohlockens rief Samuel: »Na, Betsy Baker, diesmal ist es dir doch nicht gelungen!«
Das waren seine letzten Worte. Als ob das Tier etwas von der sorglosen Unachtsamkeit seines Besiegers geahnt hätte, stieg es plötzlich kerzengerade in die Höhe und überschlug sich, den verwegenen Knaben unter seiner Last begrabend.
Wir jüngeren Kinder freilich konnten uns nur dunkel an Bruder Samuel erinnern, unsere Eltern aber hatten ihre ganze Hoffnung und ihren höchsten Ehrgeiz auf diesen Sohn gesetzt. Diese Gefühle übertrugen sie nun natürlicherweise auf den jüngeren, nun einzigen Sohn, und diese Hoffnungen, die hauptsächlich unsere Mutter nährte, wurden durch die Erinnerung an eine seltsame Prophezeiung, die ihr vor Jahren von einer Wahrsagerin gemacht worden war, unterstützt. Meine Mutter war zwar eine viel zu kluge und gebildete Frau, um einem törichten Aberglauben nachzuhängen, erfüllte Prophezeiungen müssen jedoch auch den starrköpfigsten Skeptiker, wenn nicht ganz bekehren, so doch immerhin etwas mildern. Unserer Mutter gemäßigte Zweifel aber vermochten gegen die wunderbare Erfüllung einer Prophezeiung nicht standzuhalten, die folgendermaßen gelautet hatte. In einer südlich gelegenen Stadt Nordamerikas, wo meine Mutter als Mädchen zu Besuch war, erregte eine berühmte Wahrsagerin, zu der die Menschen massenhaft hinströmten, großes Aufsehen. Auch meine Mutter und meine Tante ließen sich aus Neugierde verleiten, die Sibylle aufzusuchen.
Beide nahmen unter ungläubigem Lachen die Prophezeiung hin, daß meine Tante mit ihren beiden Kindern innerhalb zwei Wochen vom Tode ereilt würde. Und doch traf das Entsetzliche ein, denn alle drei wurden vom gelben Fieber ergriffen und starben noch vor Ablauf der angegebenen Zeit. Diese unheimliche Bekräftigung der prophetischen Macht der Wahrsagerin veranlaßte natürlicherweise meine Mutter, auch dem sie selbst betreffenden Teil der Prophezeiung mehr Glauben zu schenken. Auf dem Dampfer, der sie nach Hause zurückbringen würde, sollte sie nämlich ihrem künftigen Gatten begegnen, dann ihn nach Verlauf eines Jahres heiraten und drei Söhne zur Welt bringen, von denen nur der zweite am Leben bleiben würde. Der Name dieses Sohnes aber sollte über die ganze Welt verbreitet und eines Tages derjenige des Präsidenten der Republik werden. Der erste Teil dieser Prophezeiung erfüllte sich, und Samuels Tod bildete ein neues Glied in der Kette seltsamer Zufälle. War es unter diesen Umständen zu verwundern, wenn sie ungewöhnliche Erwartungen auf ihren zweiten Sohn setzte?
Ob es für einen Knaben ein Glück ist, der einzige Bruder von fünf Schwestern zu sein, ist fraglich. Die älteren Schwestern verhätschelten Will, die jüngeren betrachteten ihn als ein höheres Wesen, und wir alle zweifelten keinen Augenblick daran, daß unserem einzigen Bruder noch große Dinge beschieden sein würden. Voll Zuversicht sahen wir der endgültigen Erfüllung der Prophezeiung entgegen und betrachteten Will mit kindischer Verehrung als zukünftiges Staatsoberhaupt.
Die Gesundheit meiner Mutter, die ohnedies immer etwas zart gewesen war, wurde durch den plötzlichen Tod Samuels so sehr erschüttert, daß man uns einen Wohnungswechsel anriet. Zu jener Zeit hatte die kalifornische Goldwut ihren Höhepunkt erreicht. Auch mein Vater wurde von dem Fieber gepackt, wenn auch in milderer Form, da wir auf unserer Farm nicht nur ein behagliches Heim, sondern auch unser reichliches Auskommen hatten. Getrieben von dem Wunsche, unserer Mutter Gesundheit zu kräftigen, und ohne Zweifel auch von der Sehnsucht nach den goldenen Schätzen, die so viele anlockten, verkaufte er seine Farm und befahl uns, die Vorbereitungen zu einer Reise nach dem Westen zu treffen. Ehe jedoch seine Pläne endgültig festgesetzt waren, kam er mit einigen Goldsuchern, die soeben voller Enttäuschung von der Küste zurückgekehrt waren, zusammen, was einen solchen Eindruck auf ihn machte, daß er sich zu einer Niederlassung in Kansas anstatt in Kalifornien entschloß.
Die alte Heimstätte in Iowa
Unser Vater hatte eine ganz besondere Vorliebe für schöne Wagen und Pferde, dabei eine wahre Leidenschaft für alle Reitkünste, und so kam es nicht selten vor, daß unser Stall voll prächtiger Vollblutpferde stand, während die Speisekammer leer war. Für unsere Auswanderung nach dem Westen hatten wir außer drei sogenannten Prärieschonern F1 eine große Familienkutsche, die von einem prächtigen Doppelgespann mit silberbeschlagenem Zaumzeug gezogen wurde. Dieser Wagen war auf besondere Bestellung in der Hauptstadt angefertigt, mit feinstem Leder ausgepolstert, poliert und lackiert worden, als sollte er einem König zur Reise durch sein Land dienen.
Bruder Will machte sich zu unserem bewaffneten Geleitsmann und ritt mit seiner am Sattelknopf befestigten Flinte voll Stolz neben uns her, während der Hund Türk die Nachhut bildete.
Wills Phantasie knüpfte an diesen Zug nach dem Westen tausend mögliche aufregende Kämpfe und Abenteuer mit Indianern, obwohl er von den wirklichen Gefahren, die uns auf diesem Wege bedrohten, keine Ahnung hatte. Die erste Woche unserer Reise bot indes nur wenig Interessantes für ihn, da wir fortwährend auf Ansiedlungen und Farmen stießen, wo wir die Nacht zubringen konnten. Allein von Meile zu Meile wurden die Niederlassungen von Weißen seltener, bis Will uns Kindern endlich eines Tages voll freudiger Erregung zuflüsterte: »Ich hörte eben, wie der Vater zur Mutter sagte, daß wir heute voraussichtlich die Nacht im Freien zubringen müßten. Das wird einen Spaß geben!«
Wills Hoffnungen erwiesen sich als berechtigt. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit erreichten wir ein Flüßchen, und da die nächste Ansiedlung noch etwa zwölf englische Meilen entfernt war, so wurde beschlossen, am jenseitigen Ufer zu nächtigen. Zuerst setzte man die Familienglieder über, worauf dem achtjährigen Knaben die Aufgabe zufiel, einen zum Aufschlagen der Zelte geeigneten Platz aufzusuchen.
Die Laufbahn meines Bruders liefert den deutlichsten Beweis, daß die Umgebung, in der ein Mensch aufwächst, den größten Einfluß auf die Bildung seines Charakters ausübt. Es ist ja immerhin möglich, daß Wills Vorliebe für das freie Leben in der weiten Ebene auch zugleich eine von irgend einem Vorfahren herzuleitende Erbschaft ist, jedenfalls aber verdankt er seine spätere hohe Gewandtheit als Kundschafter in erster Linie den Erfahrungen, die er schon in seiner Kindheit gesammelt hat. Die Fähigkeit, Quellen, wichtige Fußpfade der Indianer und günstige Lagerungsplätze ausfindig zu machen, schien ihm förmlich angeboren zu sein.
Nachdem die Zelte an einer befriedigenden Stelle aufgeschlagen waren, rief Will den Hund Türk herbei und machte sich mit der Flinte in der Hand auf die Suche nach Wildbret zum Abendessen. Der Erfolg übertraf seine kühnsten Erwartungen. Kaum hatte er das Lager hinter sich, so schlug der Hund an, und im gleichen Augenblick sprang ein prächtiger Hirsch aus dem Gebüsch heraus. Wohl jeder Jäger wird zugeben müssen, daß ihn beim Anblick seines ersten Hirsches eine mächtige Erregung erfaßt hat, und so ist es kein Wunder, wenn Will in seinem Alter das plötzlich vor ihm aufgetauchte stolze Tier so lange und unbeweglich anstarrte, bis es seinen Blicken entschwunden war. Türk setzte ihm nach, kam aber bald wieder zurückgetrottet und bellte seinen Herrn vorwurfsvoll an. Will wurde indes gleich darauf Gelegenheit geboten, sich Türks Achtung wiederzugewinnen, denn nachdem der Hund mit erneutem Anschlägen davongeschossen war, tauchte ein zweiter Hirsch in Schußweite auf, und diesmal zielte der junge Jäger, seine Erregung niederkämpfend, mit fester Hand und erlegte seinen ersten Hirsch.
Am darauffolgenden Sonntag schlugen wir wieder bei einem tiefen, rasch fließenden kleinen Flusse unser Lager auf. Türk, der, ermüdet und erhitzt von einer wütenden Kaninchenjagd, über das Flüßchen zu schwimmen versuchte, bekam in dem kalten Wasser plötzlich eine Art Starrkrampf und wäre untergesunken, wenn Will ihm nicht zu Hilfe geeilt wäre. Der Fährmann, der bemerkte, wie der Knabe mit dem erstarrten Hunde gegen das Wasser ankämpfte, fuhr ihm mit dem Schiffe nach, Will aber erreichte ohne Beistand das Ufer.
»Daß Hunde Kinder retten, davon habe ich wohl schon gehört, doch nie von einem umgekehrten Fall,« rief der Fährmann aus. »Wie alt bist du denn?«
»Acht, bald Neun,« antwortete Will.
»Du bist ein großer, stämmiger Bursch für dein Alter,« sagte der Mann. »Aber es ist trotzdem ein Wunder, daß du mit dieser Last nicht untergesunken bist. Was für ein Riesentier,« fuhr er, sich Türk zuwendend, fort, der, auf drei Füßen stehend, heftig das Wasser von seinem Fell abschüttelte. Will kniete sofort neben ihm nieder, und das in die Höhe gezogene Bein in seine Hände nehmend, bemerkte er: »Türk muß sich beim Schwimmen an einem Stein das Bein verletzt haben, aber der winselt nicht gleich bei jedem Schmerz wie eure erbärmlichen Köter.«
»Da muß er also wohl von ganz besonders edler Rasse sein,« sagte der Mann. »Wie heißt man denn diese Art Hunde?«
»Es ist eine Ulmer Dogge,« antwortete Will.
»Diesen Namen habe ich allerdings noch nie gehört. Du selbst aber bist ein forscher kleiner Kerl und hast Grütze im Kopf. Du wirst deinen Weg durch die Welt schon finden. Doch jetzt mach, daß du trockene Kleider an den Leib bekommst.«
Will und der hinkende Hund stiegen darauf ins Boot und wurden vom Fährmann zum Lager zurückgebracht.
Türk spielte eine solch wichtige Rolle in unserer Kinderzeit, daß er eine nähere Beschreibung wohl verdient. Er war ein großes, gewaltiges Tier, das von jener Hunderasse abstammte, die im alten Germanien zur Eberjagd benützt worden war. Später wurden die Hunde dann nach England verpflanzt, wo man sie hauptsächlich als tüchtige Wächterhunde hochschätzte, denn wenn sie richtig dressiert werden, sind sie noch wilder und grimmiger als die englischen Bulldoggen. Allein nicht nur Will, sondern auch die anderen Familienglieder würdigten Türks vorzügliche Eigenschaften, und er verdiente die Liebe, die man ihm schenkte, vollkommen. Durch seine Treue und fast menschliche Klugheit rettete er uns nicht selten Leben und Eigentum; auch war er im Notfall stets bereit, seine eigene Haut in unserem Dienste zu opfern.
In jenen stürmischen Zeiten mußte man auf den Pfaden durch den wilden Westen jeden Augenblick auf Räuber und Mörder gefaßt sein, und da war es Türks beständige, nimmer ruhende Wachsamkeit, die meinen Vater im rechten Augenblick veranlaßte, sich und uns vor nächtlichen Überfällen zu schützen. Energie, Kraft, Mut und Zuverlässigkeit, das waren die Eigenschaften, die Will vor allen anderen schätzte – jetzt bei Türk und in späteren Jahren bei Menschen. Und wenn es auch bis heute nicht in der Art meines Bruders liegt, seine Zuneigung Menschen und Tieren gegenüber verschwenderisch zu äußern, so weiß er dafür verdienstvolle Handlungen und Taten umsomehr anzuerkennen. Die Geduld und edle Selbstlosigkeit, die er in diesem treuen Hunde, dem Freunde seiner Kindheit, entdeckte, suchte er freilich in seinem späteren Leben oft vergebens bei den mit einer Seele ausgestatteten Geschöpfen. Trotzdem aber hat er den Glauben an die Menschheit und an ihre hohe Bestimmung niemals verloren, ein wohl allen bedeutenden Männern eigener Charakterzug.
In unser aller Gedächtnis blieb diese Reise für immer haften, den lebhaftesten Eindruck aber mochte sie doch wohl auf Bruder Will gemacht haben, da sie ihm nicht nur sein erstes Zusammentreffen mit einem Hirsch, sondern auch mit einem Neger brachte.
Als wir uns der Grenze des Staates Missouri näherten, kamen wir an eine schöne Farm, wo sich der Vater nach einem Nachtquartier erkundigte. Sie gehörte einer Witwe, und als diese erfuhr, daß mein Vater der Bruder Elias Codys aus Missouri sei, nahm sie uns mit der herzlichsten Gastfreundschaft auf.
Noch befanden wir uns, die Rückkehr des Vaters von der Farm erwartend, auf der Landstraße, als plötzlich dicht neben uns aus einem Gebüsch eine für uns Kinder höchst seltsame Erscheinung auftauchte. Ein Vollblutafrikaner war es mit schwülstigen Lippen, wolligem Haar, riesig großen Füßen und spärlicher Kleidung. Mit erstaunten, weit aufgerissenen Augen starrten wir diese für uns Kinder ganz fremde Menschengattung an; selbst Türk verharrte in schweigender Überraschung. In diesem Augenblick kam der Vater zurück und ergötzte sich ebenso wie die Mutter an unseren entsetzten Gesichtern, brach dann aber den Bann, indem er den Neger freundlich anredete, worauf dieser ehrfurchtsvoll und mit einem freundlichen Grinsen antwortete. Es war ein auf den Plantagen der Witwe angestellter Sklave.
Ermutigt durch dieses Grinsen streckte Will ihm die Hand entgegen und genoß voll Stolz das Glück, von dem großen Schwarzen mit »Massa« angeredet zu werden. Nur mit Mühe konnten wir den kleinen »Massa« überreden, sich von seinem neuen Freunde zu trennen und zum Abendessen zu kommen.
Nach einer stärkenden Nachtruhe setzten wir unseren Weg fort, und nach wenigen Tagen erreichten wir den Wohnort meines Onkels. Eine Unterbrechung der Reise wurde mit Freuden begrüßt, da sie trotz der mancherlei interessanten Erlebnisse und trotz des guten Humors sämtlicher Familienglieder doch immerhin lang und ermüdend gewesen war.
* * *
Planwagen.
Zweites Kapitel: Wills erster Indianer.
Mein Onkel lebte in der im Kreis Platte in Missouri gelegenen Stadt Weston, die zu jener Zeit eine der größten des westlichen Nordamerikas war. Da mein Vater so bald als möglich wieder einen eigenen Wohnsitz aufzuschlagen wünschte, so ließ er uns in Weston zurück und machte sich jenseits des Missouri, von Will und einem Führer begleitet, auf die Suche nach einer für uns passenden Ansiedlung. Mehrere Tage waren bereits erfolglos verstrichen, da ließ der Vater eines Morgens den von den anstrengenden Ritten ermüdeten und noch schlafenden Will in dem für die Nacht aufgeschlagenen Lager zurück, während er mit dem Führer einen neuen Rekognoszierungsritt unternahm.
Als Will die Augen aufschlug, fiel sein Blick auf die interessanteste Erscheinung, die die Welt ihm in diesem Augenblick gerade bieten konnte – auf einen Indianer.
Der »edle Indianer«, wie die Rothäute von Leuten, die sie nur von weitem kannten, poetisch genannt wurden, war im Begriff, Wills Pferd zu besteigen, während seine eigene dürre Schindmähre daneben stand.
Wills knabenhaftes Sehnen war nun erfüllt – er befand sich seinem ersten Indianer gegenüber. Auch jetzt wäre es wohl nicht zu verwundern gewesen, wenn er bei der unerwarteten Begegnung vor Schrecken erstarrt wäre, zumal diese nicht wie damals ein stolzer, flüchtiger Hirsch, sondern eine schmutzige Rothaut war, die allem Anschein nach versuchte, sich so rasch als möglich aus dem Staube zu machen. Mein ohne die geringste Scheu sprang Will auf und fragte, die Flinte in der Hand: »Halt, was machst du da mit meinem Pferde?«
Verächtlich sah der Indianer den Knaben an.
»Tausche Pferd mit Bleichgesichtknaben.«
Der Indianer war stark bewaffnet, und Will wußte nicht, ob sich sein Vater und dessen Führer in Rufweite befanden oder nicht. Allein der Rothaut erlauben, mit Onkel Elias' schönem Pferde davonzureiten, hieß so viel, als seines Vaters Vertrauen einbüßen und seiner Mutter und Schwestern Glauben an den Familienhelden erschüttern. So nahm er denn eine beherzte Miene an und sagte in gleichgültigem Tone, als handle es sich um ein ernstgemeintes Tauschgeschäft: »Nein, ich will nicht tauschen.«
»Bleichgesichtknabe ist ein Narr,« antwortete der Indianer gelassen.
Ohne sich auf diese schmeichelhafte Bezeichnung einzulassen, sagte Will ruhig, aber fest: »Ich will nicht, daß du mein Pferd nimmst.«
»Pferd von Bleichgesicht nichts wert,« geruhte der Indianer einzuwenden.
»Gut genug für mich,« erwiderte Will lächelnd, trotz des Ernstes der Lage. Der Indianer schien ja ein ganz erbärmlicher Pferdekenner zu sein. »Gut genug für mich,« wiederholte Will. »Du kannst also dein altes Knochengerüst beruhigt mitnehmen und dich zum Kuckuck scheren.«
Zu Wills höchster Überraschung ließ der Indianer die Zügel los, schwang sich auf sein eigenes Pferd und ritt davon. Das ganze stolze Bild, das sich Wills Phantasie von dem Indianer gemacht hatte, stürzte damit in sich zusammen, denn wenn es für einen Helden schon eine recht schlimme Eigenschaft ist, Pferde zu stehlen, so ist es vollends unverzeihlich, vor einem noch nicht zehnjährigen Knaben zu entfliehen. Allein schon wenige Augenblicke später erstanden die Trümmer des zerstörten Bildes wieder, denn Will hörte die Stimme unseres Führers in nächster Nähe und mußte daraus schließen, daß der Indianer den Feind entdeckt und nicht vor dem Knaben, sondern vor dem Manne die Flucht ergriffen hatte.
Der Führer war zurückgekommen, um Will an den Ort zu bringen, den der Vater endlich zu unserer Niederlassung ausgesucht hatte. Das Stück Land lag im Salzflußtale, einem fruchtbaren, von terrassenförmig ansteigenden Hügeln begrenzten Wiesengrund. Der alte sogenannte Salzseepfad führte durch dieses Tal. Zu jener Zeit gab es nämlich zwei Hauptverkehrswege durch den Westen: den Santa Fé- und den Salzseepfad; später wurde dann auch noch der Oregonpfad von Bedeutung. Der älteste und historisch berühmteste Pfad aber war der von Santa Fé, auf dem schon vor dreihundert Jahren die Forscher ins Land gedrungen waren. Zu Anfang des vorigen Jahrhunderts hatte man ihn hauptsächlich zum Handelsverkehr benützt. Seiner Richtung folgend, machte Zebulon Pike feinen berühmten und erfolgreichen Zug durch den Westen. Der Pfad lief südlich von Leawenworth in westlicher Richtung zum Arkansasflusse, dessen Lauf er bis zum Fort Bent folgte, wo er dann den Fluß durchkreuzte, sich zuerst scharf nach Süden und dann bei Las Vegas wieder westlich nach Santa Fé wandte. Auch die Erforschungen längs des Salzseepfades wurden zu Anfang des vorigen Jahrhunderts ausgenommen. Zur Zeit der Auswanderung der Mormonen von Nauvoo nach ihrem gegenwärtigen Wohnort ist er ein vielbenützter Verkehrsweg geworden. Er führte über den Missouri nach Leawenworth, lief dann in nördlicher Richtung bis zu dem am Platte River gelegenen Fort Kearny, folgte dem Lauf jenes Flusses, bis er sich bei Fort Bridger wieder westwärts wandte und endlich zur Salzseestadt führte. Tausende von stolzen Hoffnungen erfüllte Goldsucher wandelten auf diesem Pfade nach Kalifornien, um, zum größten Teil enttäuscht und niedergeschlagen auf demselben Wege zurückzukehren. Lastwagen, Viehtreiber, Auswanderer – fast der ganze Verkehr nach dem Westen durch das neue Land spielte sich auf diesem Pfade ab. Ein Mann namens Rively hatte den klugen Einfall gehabt, um die Erlaubnis nachzusuchen, auf diesem Wege eine Post- und Handelsstation, verbunden mit einem Proviantmagazin, drei Meilen südlich vom Missouri zu errichten. Da die Nähe dieser Station unfehlbar große Annehmlichkeiten bringen mußte, so erschien die Wahl des von meinem Vater einstwellen in Besitz genommenen Stückes Staatsland, das nur zwei Meilen von der Poststation entfernt lag, recht praktisch.
Die Kansas-Nebraska-Gesetzesbill, worin diese beiden Gebiete der freien Ansiedlung überlassen werden sollten, wurde im Mai 1884 genehmigt. Dieses Gesetz stand nun aber dem Missourivertrag, der auf allen südlich vom 36° 30' nördlicher Breite gelegenen Gebieten die Sklaverei verbot, direkt entgegen. In einer Klausel der Kansas-Nebraskabill wurde nämlich gesagt, daß die Ansiedler selbst entscheiden sollten, ob sie in den neuen Gebieten die Sklaverei einführen wollten oder nicht. Schon vor Genehmigung der Bill hatten Hunderte von Ansiedlern bereits ihr Lager an den Ufern des Missouri aufgeschlagen und erwarteten dort die Entscheidung, ehe sie vom Lande Besitz ergriffen. Meilenweit schimmerten, gleich einem breiten Bande, die flackernden Lagerfeuer längs dem Flüßchen durch die Schleier der Nacht.
Kaum hatte der Vater das von ihm gewünschte Gebiet mit Beschlag belegt, als das Gesetz, das den Ansiedlern die Besitzergreifung des Landes gestattete, in Kraft trat. Bald aber entbrannte ein heftiger, blutiger Streit zwischen den Ansiedlern, von denen die einen für, die anderen gegen die Einführung der Sklaverei waren.
Da mein Vater bei Genehmigung der Bill sein Stück Land bereits ausgewählt und abgemessen hatte, so war er einer der ersten, die sich die nötigen Papiere verschafft und ein provisorisches Absteigequartier für uns fertiggestellt hatte. Was auch unsere gute Mutter über die nur aus einem einzigen Zimmer bestehende Behausung gedacht haben mag, durch deren Spalten die Sonne bei Tag und Mond und Sterne bei Nacht hereinschauten, und deren Boden vom grünen Samtteppich der Natur bedeckt war – für uns Kinder reihte sich dort ein Festtag an den anderen. Mittlerweile arbeitete der Vater mit einigen Knechten emsig an unserem Heim, und ehe der Sommer dahinschwand, waren wir in einem großen, von außen zwar grob und einfach aussehenden, aber soliden und im Innern höchst behaglich ausgestatteten Blockhause untergebracht.
Im Laufe des Herbstes trug sich ein Ereignis zu, das sich so tief in mein Gedächtnis eingeprägt hat, daß die Zeit auch nicht den kleinsten Umstand zu verwischen vermochte. Jane, unser treues »Mädchen für alles«, das uns nach unserer neuen westlichen Heimat begleitet hatte, fand nur wenig Zeit, das Kindermädchen zu spielen. Häusliche Pflichten nahmen sie den ganzen Tag in Anspruch, umsomehr, als unsere Mutter ziemlich schwächlich und die Familie groß war. So versah Türk bei uns Kindern zugleich die Stelle eines Wächters und Spielgefährten.
An einem herrlichen Septembertage begaben sich Eliza und ich in Begleitung Türks auf die Suche nach Feldblumen. Wohl hatte die Mutter uns anempfohlen, uns nicht zu weit fort zu wagen, da in den nahegelegenen Wäldern wilde Tiere hausen sollten, allein die schönsten Blumen standen immer wieder noch ein Stückchen weiter ab. So kamen wir endlich an den Saum eines etwa eine englische Meile vom Hause entfernten Waldes und ließen uns im Schatten der Bäume nieder. Die Mutter aber, die inzwischen ängstlich geworden war, hatte Will den davongelaufenen kleinen Dingern nachgeschickt.
Türk, der, wie wir uns später erinnerten, unser Weitergehen schon immer hatte verhindern wollen, wurde vollends unruhig, als wir den Wald betraten. Plötzlich begann er erregt das dürre Laub aufzuscharren, und wenige Augenblicke später tönte der gellende Schrei eines Panthers durch die Luft.
Eliza war kaum sechs und ich noch nicht vier Jahre alt. In sprachlosem Entsetzen klammerten wir uns aneinander an. Da vernahmen wir, allerdings von weit her, ein bekanntes Pfeifen – es war Wills Ruf nach seinem Hunde. Das beruhigte uns unerfahrene Kinder – nun unser Bruder in der Nähe war, was hatten wir da zu befürchten? Türk aber fuhr fort, die Blätter aufzuwühlen, nachdem er seinem Herrn mit einem kurzen, lauten Kläffen geantwortet hatte. Hierauf zerrte er heftig an unseren Kleidern, uns auf diese Weise das Versteck bezeichnend, das er für uns gegraben hatte. Wir legten uns auch sofort nieder, worauf uns der Hund mit dem Laub bedeckte. Und nun stellte er sich mit dem Mut eines Löwen als Wächter vor uns auf.
Von unserem Blätterversteck aus konnten wir des Panthers schwarzbraune Gestalt auf uns zuschleichen sehen. Da plötzlich bemerkte er Türk, machte sich zum Sprunge bereit und schoß wie ein Pfeil auf ihn los. Türk wich ihm aus, stürzte dann aber mit einem Schrei, wie ich ihn weder vorher noch nachher je wieder von einem Hunde gehört habe, auf den Feind los.
Türks Kampf mit dem Panter
Türk war zwar sehr stark und sein Mut bewunderungswürdig, aber mit der Kraft eines Panthers konnte er sich doch nicht messen. Nach wenigen Augenblicken schon lag der treue Hund durch einen einzigen Schlag der eisernen Tatze des wilden Tieres betäubt und blutend am Boden. Die grausame Bestie aber mußte wohl andere Beute wittern, denn sie ließ Türk liegen und lief, nach uns suchend, hin und her. Wir wagten kaum zu atmen, und jeder Schlag unserer erschrockenen kleinen Herzen war ein Gebet, Will möchte noch rechtzeitig zu uns kommen. Schließlich richteten sich des Panthers rollende Augen doch auf unser Versteck, und als er zum tödlichen Sprunge ansetzte, versteckten wir, von Grausen geschüttelt, unser Gesicht.
Türk aber war wieder aufgesprungen. Trotz seiner Wunde machte er einen letzten, verzweifelten Versuch, uns zu retten, indem er des Panthers Aufmerksamkeit von neuem auf sich selbst lenkte.
Da plötzlich wurde der hoffnungslose, entsetzliche Kampf durch einen wohlgezielten Flintenschuß unterbrochen. Ins Herz getroffen, brach der Panther zusammen, und aus dem schützenden Laubwerk heraus stürzten sich zwei zitternde kleine Mädchen mit todesblassen, tränenüberströmten Gesichtern in die Arme ihres Bruders.
Will, selbst noch ein Kind, streichelte und beruhigte uns in recht väterlicher Weise. Kaum war indes die erste Erregung vorüber, so wandten wir uns voller Besorgnis nach Türk um. Zum Glück war seine Verletzung nicht gefährlich, er winselte nur leise, als sein Herr auf ihn zukam.
»Bravo, guter Kerl!« rief Will. »Du hast sie gerettet, ohne dich wäre ich zu spät gekommen.« Dabei kniete er neben unserem treuen Freunde nieder und schlang die Arme um den zottigen Nacken.
– Lieber, alter Türk! Wenn es jenseits der Sterne ein besseres Land für deinesgleichen gibt, so möge das wärmste, behaglichste Eckchen und die besten Knochen dein Lohn sein! –
* * *
Drittes Kapitel: Der Schatten der Parteikämpfe.
Selbstverständlich waren unter den Ansiedlern in Kansas alle Arten von Gesellschaftsklassen vertreten. Neben ehrlichen, fleißigen Farmern und wohlhabenden Handelsleuten machten sich eine Menge mittelloser Taugenichtse, Abenteurer und Landstreicher breit. Wohl manchmal mochte meinem Vater der Gedanke kommen, ob es wohl klug gewesen sei, in dieses neue, wilde Land gezogen zu sein, doch sprach er nicht darüber, sondern sah tapferen Mutes der Zukunft entgegen.
In Iowa hatte er in politischen Dingen eine gewisse Rolle gespielt und auch öffentliche Vertrauensämter bekleidet. In die Parteikämpfe, die in Kansas wüteten, wünschte er aber durchaus nicht hineingezogen zu werden. Er gehörte zu den Freibodenmännern F2, und die gegen die Sklaverei stimmenden Ansiedler waren bedeutend in der Minderheit. In unserer Nachbarschaft gab es überhaupt nur zwei Farmer, die, wie der Vater, die Sklaverei verwarfen. Ein Jahr lang behielt der Vater seine politischen Grundsätze für sich, schließlich aber verbreitete sich auch in Kansas sein Ruf als gewandter öffentlicher Redner. Die Sklavereianhänger vermuteten bei ihm natürlicherweise dieselbe Ansicht wie bei seinem Bruder Elias Cody, einem bekannten Verfechter der Sklaverei, und betrachteten meinen Vater bereits als vielversprechenden Parteiführer. Geschickt war er bis jetzt einer öffentlichen Entscheidung für die eine oder andere Partei ausgewichen, in seinem Schicksalsbuche aber stand geschrieben, daß er einer der ersten auf dem Altar der Freiheit geopferten Männer werden sollte.
Die Poststation war ein beliebter Versammlungsort für alle Ansiedler der Umgegend. Eines Tages, im Sommer 1855, besuchte auch mein Vater, wie gewöhnlich von Will und Türk begleitet, das Gast- und Handelshaus. Unter der Menge, bei der die Wogen der Erregung schon sehr hoch gingen, bemerkte mein Vater mehrere der Gegenpartei angehörende Hitzköpfe, aber auch Onkel Elias und unsere beiden Freibodennachbarn Hathaway und Lawrence.
Vaters Erscheinen wurde mit der stürmischen Aufforderung, eine Rede zu halten, begrüßt. Vor dieser Zuhörerschaft zu sprechen, hieß aber so viel, als sein Leben aufs Spiel setzen; allein so sehr sich mein Vater auch sträubte, er wurde zum Reden gezwungen.
Es stand in den Sternen geschrieben, da gab es kein Entweichen! Festen Schrittes ging der Vater auf die Schnittwarenkiste zu, die als Rednerbühne diente. Als er an Hathaway vorüberkam, zupfte ihn der gute alte Mann am Ärmel und bat ihn, die Menge mit Gemeinplätzen abzuspeisen und seine wirklichen Ansichten zu verheimlichen.
Unser Vater aber war nicht der Mann, sich mit allgemeinen Redensarten zu befassen.
»Freunde,« sagte er, seine Zuhörerschaft scharf ins Auge fassend und sich zu seiner ganzen Höhe aufrichtend, »Freunde, ihr täuscht euch vollkommen in mir. In meiner Absicht lag es nicht, mit euch zu streiten, aber ihr habt mich zum Sprechen gezwungen, und es bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als euch meine Meinung unverhohlen kundzutun. Ich bin und war immer ein Gegner der Sklaverei, denn sie ist eine Einrichtung, die nicht nur den Sklaven, sondern auch den Sklavenhalter entwürdigt, und ich gebe euch mein Wort, daß ich meine ganze Kraft, ja, wenn es not tut, sogar mein Leben einsetzen werde, damit dieser Fluch nicht auf dem Boden von Kansas Wurzel faßt. Es ist genug, daß die schönsten Teile unseres Landes bereits von dieser Pest verseucht sind. Möge sie sich nicht weiter ausbreiten! Alle meine Energie und Klugheit soll dem Streben gewidmet sein, Kansas als einen von der Sklaverei freien Boden zu erhalten.«
Die Versammlung war durch diese Kühnheit so verdutzt, daß sie eine Zeitlang in starrem Schweigen verharrte. Dann aber brach der Sturm los. Eine wutschnaubende Menge umgab den Sprecher. Mehrere Hitzköpfe drängten sich mit mörderischen Absichten vor, und einer, Charles Dunn mit Namen, stieß sein Messer in die Brust des tapferen Mannes, der so freimütig seine Ansichten zu bekennen gewagt hatte.
Um das Leben des Vaters
Als der Vater niederstürzte, sprang Will auf ihn zu und rief, sich zu dem Mörder wendend, in knabenhafter Wut: »Sie haben meinen Vater gemordet! Wenn ich ein Mann bin, werde ich Sie töten.«
Die Menge, die den Vater für tot hielt, wich zurück. Die Tat erschreckte sie nun doch, denn noch waren sie nicht ganz gegen eine verbrecherische Handlung verhärtet.
Hathaway und Will trugen meinen Vater nun in ein Versteck im hohen Grase abseits vom Wege. Die Menge verlor sich indes nur langsam, so daß sich die Abenddämmerung bereits herniedersenkte, als endlich die Bahn frei war und der Vater, auf Will gestützt, mühsam und noch blutend, den Heimweg anzutreten vermochte.
Auftritte wie dieser konnten nicht ohne tiefen Eindruck auf die Seele des heranwachsenden Jünglings bleiben; sie bildeten jenen Cody der späteren Jahre aus ihm, der sich, je nachdem es der Augenblick erforderte, stets kaltblütig und erfinderisch in der Bedrängnis, rasch im Entschluß und kühn und schlagfertig im Handeln erwies.
Dieses traurige Erlebnis war indes nur der Anfang unserer Sorgen, denn des Vaters Genesung machte nur langsame Fortschritte, und nie hat er sich wieder vollständig erholt. Seine Feinde hielten ihn für tot, eine Zeitlang gelang es uns auch, das Geheimnis zu wahren; kaum aber konnte er wieder umhergehen, so begannen die Verfolgungen von neuem.
Ungefähr eine Woche nach jener stürmischen Zusammenkunft auf der Poststation kam Will eines Abends mit der Nachricht nach Hause gelaufen, daß sich ein Trupp Reiter nähere. In ihrer Angst warf die Mutter dem Vater einen ihrer Röcke über, stellte ihm einen Eimer auf den Kopf und bat ihn, sich im Kornfeld zu verstecken. Kühn trat er aus dem Hause, und im Schutze der hereinbrechenden Dämmerung gelang es ihm, unbehelligt an den Reitern vorüberzugehen, die aufs Haus zuritten und dort abstiegen.
»Wo ist Cody?« fragte der Anführer, worauf man ihm antwortete, daß der Vater nicht zu Hause sei.
»Da kann er von Glück sagen,« lautete die freche Antwort, »das nächste Mal soll er dafür umso sicherer ins Gras beißen.«
Ärgerlich über die mißglückte Absicht, suchten sich die Schurken dadurch schadlos zu halten, daß sie das Haus alles dessen beraubten, was ihnen gerade in die Augen stach. Dann setzten sie sich mit dem angekündigten Vorhaben nieder, die Rückkehr ihres Opfers zu erwarten.
Da die Mutter fürchtete, die Nachtluft könnte trotz des Sommers einen schädlichen Einfluß auf den Vater haben, so machte sie Will ein Zeichen, worauf sich dieser sofort aus dem Zimmer schlich und, begleitet von Türk, Decken ins Kornfeld trug und zurückkehrte, ohne daß man seine Abwesenheit bemerkt hatte. Die Schurken wurden des Wartens übrigens bald müde und ritten, nachdem sie der Mutter nochmals ihre beabsichtigte Heldentat angekündigt hatten, brummend wieder fort. Schon begann der Tau niederzufallen, als der Vater ins Haus zurückkehrte.
Noch am selben Morgen wurde Will unter dem Vorwand, Spezereien einzukaufen, zum Auskundschaften nach der Poststation geschickt, und da er Augen und Ohren offen hielt, erfuhr er, daß die Feinde dem Vater scharf auflauerten. Er durfte also sein Versteck im Kornfeld nicht verlassen. Lange aber konnte ein solches Leben nicht durchgeführt werden, und so beschloß der Vater, sich bei Nacht nach dem vier Meilen entfernten Fort Leawenworth zu begeben. Es war ein trauriger Abschied, da niemand wußte, ob wir den Vater jemals wiedersehen würden.
»Ich hoffe,« sagte er zur Mutter, »daß diese Wolken bald vorüberziehen werden und wir dann unser altes glückliches Leben wieder aufnehmen können.« Dann fuhr er, die Hand auf Wills Kopf legend, fort: »Du aber mußt jetzt bis zu meiner Rückkehr der Hausvater sein. Doch weiß ich, daß ich Mutter und Schwestern beruhigt deinem Schutze anvertrauen kann.«
Was Wunder, daß Will, auf dessen Schultern man solche Verantwortung legte, und dem man solches Vertrauen schenkte, in seinem Denken und Fühlen ein Mann wurde, ehe er es den Jahren nach war.
Der Vater erreichte glücklich Leawenworth. Da der Streit zwischen den Freibodenmännern und den Sklavereianhängern aber immer erbitterter wurde, so hielt er es für klüger, einen noch entfernter gelegenen Ort aufzusuchen. Zu Schiff begab er sich nach dem zwanzig Meilen stromaufwärts gelegenen Doniphan, zu jener Zeit nichts weiter, als ein gewöhnlicher Landungsplatz. Dort traf er auf eine kleine, mit Abkochen beschäftigte, etwa dreihundert Mann starke militärische Abteilung. Sie stand unter dem Befehl von Oberst Jim Lane und befand sich auf dem Wege von Indiana nach dem Westen.
Oberst Lane, eine interessante Persönlichkeit, war ein Freund des im Jahre 1836 wegen der Herausgabe einer in Illinois gegen die Sklaverei gerichteten Zeitung ermordeten Elias Lovejoy gewesen. Als der Kampf in Kansas dann immer erbitterter wurde und für die Freibodenmänner einen bedrohlichen Charakter annahm, hatte er eine Schar kühner Männer angeworben, um seine gefährdeten Gesinnungsgenossen zu beschützen und zugleich den an Elias Lovejoy verübten Mord zu rächen.
Das Zusammentreffen meines Vaters mit Lanes Leuten gestaltete sich zu einem freundschaftlichen Verkehr, so daß er sein Schicksal mit dem ihrigen zu vereinigen beschloß. Bald darauf nahm er an der Schlacht von Hickory Point teil, bei der die Sklavereianhänger unter großen Verlusten geschlagen wurden.
Der Name Jim Lanes aber wurde von diesem Tage an von der Gegenpartei mit Schrecken, von unserer Familie dagegen voll Dank und Vertrauen genannt.
Die Anstrengungen und Aufregungen der Schlacht hatten indes die schwachen Kräfte des Vaters so stark mitgenommen, daß er unter dem Schutze des mit seinen Leuten in der Nähe lagernden Obersten Lane bei Nacht heimlich nach Hause zurückkehren mußte, wo er sofort wieder aufs Krankenlager niedergeworfen wurde.
Dies war ein harter Prüfstein für die Gesundheit unserer armen Mutter, denn während der Abwesenheit des Vaters hatte sich unserem Geschwisterkreis noch ein Brüderchen zugesellt, und außer der Wartung des kleinen Charlie und der Pflege eines kranken Mannes lastete auch noch die beständige Angst um dessen Sicherheit auf ihr.
* * *
Gegner der Einführung der Sklaverei.
Viertes Kapitel: Die Verfolgung dauert fort.
Die Besorgnis unserer Mutter war nur zu sehr begründet. Wenige Tage nach der Heimkehr des Vaters kam ein Mann namens Sharpe, der das Amt eines Friedensrichters in schmachvoller Weise herabwürdigte, in angetrunkenem Zustand auf unsere Besitzung geritten und teilte meiner Mutter mit, daß er den Auftrag habe, das Haus nach ihrem Manne, »dem verfluchten Sklavenfeind«, zu durchsuchen. Hierauf verlangte der betrunkene Schurke zu essen. Während die Mutter ihm mit anscheinender Gastfreundlichkeit das Abendessen bereitete, vertrieb sich Sharpe die Zeit mit Wetzen seines Dolches an der Schuhsohle.
»Mit diesem hier,« sagte er zu dem ihn beobachtenden Will, »soll nämlich deinem Vater nachher das Herz aus dem Leibe geschnitten werden.«
Wills stumme Antwort bestand darin, daß er seine Flinte von der Wand nahm und sich an der zum Zimmer seines Vaters führenden Treppe aufstellte. So ganz leicht sollte es Sharpe denn doch nicht werden, diese Stufen hinaufzusteigen.
Allein wie die Mutter richtig vermutete, hatte der Richter keine Kenntnis von der Rückkehr des Vaters, sonst wäre er nicht allein gekommen. Nachdem er dem Essen und Trinken tüchtig zugesprochen hatte, schlief er ein, fiel vom Stuhl herunter und verließ, seinen angeblichen Auftrag vergessend, taumelnd das Haus. So weit aber reichte seine Betrunkenheit doch nicht, daß ihm der Blick für ein gutes Pferd abgegangen wäre, denn er fand plötzlich großes Gefallen an »Prinz«, dem Lieblingspony der Familie. Mit einem höhnischen Grinsen sagte er zu Will: »Ein hübsches Pferdchen das, mein Junge. Weißt du was, das nehme ich mir mit.« Dabei schickte er sich an, den Sattel von seinem eigenen Pferd zu nehmen, um ihn auf Prinz' Rücken zu legen.
»Infamer Schurke!« murmelte Will, kochend vor Wut. »Mit dir will ich schon noch einmal Abrechnung halten.«
Der Richter war ein großer, dicker Kerl, der mit seinen den Boden fast berührenden Füßen eine solch drollige Figur auf Prinz' Rücken machte, daß Will nicht umhin konnte, laut aufzulachen, zumal er bereits einen Plan zur Rettung seines Ponys gefaßt hatte.
Ein scharfer Pfiff rief Türk heran, der seine Aufgabe sofort begriff und Sharpe fünf recht wenig erbauliche Minuten bereitete. Er versuchte, ihn in das herunterbaumelnde Bein zu beißen, sprang dann, laut bellend, aus dem Bereich der Peitsche, um im nächsten Augenblick dasselbe Spiel mit dem anderen Bein vorzunehmen. Höchlichst belustigt beobachtete Will, der in angemessener Entfernung gefolgt war, diese Szene. Als sich Sharpe aber einmal besonders anstrengte, Türk zu treffen, ließ Will einen für Prinz verständlichen Pfiff vernehmen, den das Tier sofort damit beantwortete, daß es seinen Reiter in den Staub warf. Im nächsten Augenblick stand Türk zähnefletschend über ihm.
»Schaff mir deinen Hund vom Leibe, du Lümmel,« schrie der Richter, »dann sollst du auch dein kleines Schaf wieder haben, das ja doch nichts taugt.«
»Es gilt!« rief Will, nun wieder gut gelaunt. Diensteifrig half er seinem besiegten Feinde auf dessen eigenes Roß, indem er ihm versicherte, daß er Türk nicht zu fürchten brauche, solange er sein Wort halte. Sharpe ritt davon, doch waren wir durchaus nicht für immer von ihm befreit.
Eines Abends, etwa vierzehn Tage später, hatten wir uns alle um den in einem Lehnstuhl sitzenden Vater geschart. Unsere schöne Mutter hielt den kleinen Charlie auf dem Schoß, während Martha und Julia nähten, und Will, an der Mutter Stuhl gelehnt, ihr zärtlich das Haar aus der Stirne strich und Türks neuesten klugen Streich erzählte. Plötzlich unterbrach er seine Geschichte und rief: »Ich höre Reiter auf der Straße. Rüsten wir uns für alle Fälle!«
Mit der unserer Mutter eigenen Geistesgegenwart traf sie sofort ihre Vorbereitungen zur Verteidigung. Martha und Julia wurden angewiesen, dem Vater ins Bett zu helfen und sich dann selbst mit schweren Stiefeln in das uneingerichtete vordere Zimmer im oberen Stockwerk zu verfügen. Will mußte den Knecht und die Dienstmagd Jane, die fast ebenso groß und stark wie ein Mann war, herbeirufen, worauf die drei bewaffnet und mit besonderen Aufträgen betraut wurden. Alle waren zum Kampf bereit, die Mutter aber hoffte durch Kriegslist zu siegen. Mittlerweile hatten die Reiter das Gittertor erreicht. Ihr Führer war der gefürchtete Sharpe. Er ritt dicht heran und schlug mit dem Peitschenknopf ans Tor. Die Mutter öffnete das obere Fenster.
»Wer ist da, und was wünschen Sie?«
»Ihren Mann, den verfluchten Sklavenfeind. Tot oder lebendig, wir müssen ihn haben!«
»Gut, Herr Sharpe,« lautete die ruhige Antwort, »ich will Oberst Lane und seine Leute fragen, ob sie Ihnen zu Dienst sein wollen.«
Der Knecht, der den mexikanischen Krieg mitgemacht hatte, gab ein lautes Kommandowort ab, worauf sich im oberen Stockwerk das Getrampel schwerer Stiefel vernehmen ließ, dann rief der vermeintliche Oberst Lane zum Fenster heraus den Reitern zu: »Ein Schritt weiter, und meine Leute werden auf euch losfeuern.«
Sharpe, ein elender Feigling, war schon beim ersten Laut einer männlichen Stimme zurückgewichen, und nach einer kurzen Verhandlung mit seinen ihm ebenbürtigen Gefährten zog er mit ihnen wieder ab. Ein Weib hatte ihn überlistet.
Gewissermaßen als Ersatz für seinen mißglückten Streifzug entführte er Prinz. Wills Kummer darüber aber sollte nicht lange dauern, denn schon am Nachmittag kam das kluge Tier, das sich vom Halfterband losgemacht hatte, zurückgejagt.
Diese Erfahrungen hatten nun aber doch zur Folge, daß sich der Vater um unserer und seiner eigenen Sicherheit willen entschloß, sein Heim von neuem zu verlassen. Sobald es seine Kräfte halbwegs wieder gestatteten, begab er sich nach den dreißig Meilen westlich von Leawenworth gelegenen Graßhopper Wasserfällen. Dort errichtete er eine Sägemühle und hoffte nun endlich vor der Verfolgung seiner Feinde gesichert zu sein. Von Zeit zu Zeit besuchte er uns, richtete seine Ritte aber so ein, daß er erst bei hereinbrechender Dunkelheit unsere Besitzung erreichte und sich vor Sonnenaufgang wieder auf den Rückweg machte.
Eines Tages, als wir einem solch nächtlichen Besuche entgegensahen, erschien plötzlich gegen elf Uhr Vormittags unser alter Freund Hathaway.
»Es ist nicht angenehm, der Überbringer schlechter Nachrichten zu sein, allein der für heute beabsichtigte Besuch Ihres Mannes muß bekannt geworden sein, denn es ist eine neue Verschwörung gegen sein Leben im Gange. Einige seiner Feinde haben sich in der Nähe des Big Strangercreek mit der Absicht gelagert, Ihren Mann beim Vorüberreiten niederzuschießen.«
Eine lange, ängstliche, aber ergebnislose Beratung folgte.
Dies alles wurde von Will, der an einem Fieberanfall zu Bett lag, mitangehört. Er allein, so dachte er, konnte den Vater retten. Rasch kleidete er sich an und erschien mit fieberglühendem Gesicht vor seiner Mutter. Ihr ein Taschentuch hinhaltend, sagte er: »Binde es mir fest um den Kopf, Mutter, dann tut er weniger weh. Ich reite nach den Graßhopper Fällen zum Vater.« Dabei vermochte er kaum zu stehen, ein Gewitter war im Anzug, und dreißig Meilen lagen zwischen ihm und seinem Vater. Trotzdem vermochte man ihn nicht von seinem Vorhaben abzubringen. Julia und Martha sattelten Prinz und halfen dem vom Fieber geschüttelten Eilboten in den Sattel.
Die frische Luft und Erregung belebten Will, so daß er hoffte, das Unternehmen durchführen zu können. Noch war es nicht zwölf Uhr, und der Vater würde sicherlich nicht vor dem späten Nachmittag fortreiten. Prinz schien etwas von der Wichtigkeit des Rittes zu ahnen, denn in raschem, gleichmäßigem Tempo flog er davon.
Der Big Strangercreek durchkreuzt auf halbem Wege den zu den Wasserfällen führenden Pfad, und da sich die Sonne hinter Wolken versteckt hatte, so hoffte Will unerkannt am Hinterhalt vorüberzukommen. Nachdem er jedoch das Flüßchen erreicht hatte, entdeckte er mehrere hinter Buschwerk gelagerte Männer, von denen ihm einer in nachlässigem Tone zurief: »Was hältst du von der Sklaverei?«
»Hab' mich noch niemals drum bekümmert, meine Herren,« lautete die Antwort.
»Das ist der junge Cody!« schrie eine andere Stimme, und der Ruf »Halt!« ertönte gerade in dem Augenblick, als Will glücklich am Lager vorbeigaloppiert war.
Wills Erwiderung bestand darin, daß er Prinz die Sporen gab und, von einem förmlichen Kugelregen verfolgt, davonsauste.
Eine wütende Jagd begann, bergauf und -ab, durch Wälder und Wiesen, über Brücken und Bäche, bei der Will seine Krankheit vergaß und nur von dem einen Gedanken erfüllt war, die Wasserfälle noch rechtzeitig zu erreichen.
Da brach das schon lange drohende Unwetter los und verwandelte den harten Weg in ein schlammiges Flußbett. Die Verfolgung wurde aufgegeben, und im gleichen Maße wie die Nervenanspannung bei Will nachließ, fühlte er auch Fieber und Schwäche zurückkehren. Er war bis auf die Haut durchnäßt, kaum vermochte er sich noch im Sattel zu halten, doch fest biß er die Zähne aufeinander, entschlossen, sein heldenmütiges Vorhaben durchzuführen.
Da endlich schimmerte ein ersehntes Licht durch den Regen – er hatte sein Ziel erreicht, rechtzeitig erreicht, denn der Vater war eben im Begriff, sich aufs Pferd zu schwingen.
Die Anstrengung des tollen Rittes aber war zu groß für Wills Kräfte gewesen. Erschöpft brach er zusammen. Einige Tage später begab sich der Vater mit ihm nach Topeka, dem Hauptsitz der Freibodenpartei. Der Mutter sandte er beruhigende Nachrichten über sein und Wills Ergehen und teilte ihr mit, daß er nach Topeka gegangen sei, da er sein Leben bei den Graßhopper Fällen nicht mehr für sicher halte.
Mühselige Heimkehr
Der Parteikrieg in Kansas hatte jetzt seinen Höhepunkt erreicht. Es sollte über die Einführung der Sklaverei abgestimmt werden, und Hunderte von Männern wurden von den benachbarten Sklavenstaaten herbeigelockt, um ihre Wahlstimme abzugeben. Nachdem die Wahl dann zu Gunsten der Sklavenpartei ausgefallen war, errichtete diese einen gesetzgebenden Körper, dessen erste Sitzung in Le Compton stattfand. Die Wahl aber war von der Freibodenpartei wegen betrügerischer Umtriebe als rechtsungültig erklärt worden, und bei einer im Winter 1855 auf 1856 tagenden Versammlung wurde eine die Sklaverei ausschließende Urkunde verfaßt und eine Gegenregierung eingesetzt. Der Vater war Mitglied dieser ersten Körperschaft der Freibodenmänner.
So stand auch jetzt wieder der Krieg auf der Tagesordnung, bis endlich ein militärischer Statthalter ernannt wurde, der, mit allen Machtbefugnissen ausgestattet, Ruhe und Ordnung im Staate Kansas schaffen sollte.
Neue Ansiedler, besonders solche aus nördlichen Freibodenstaaten, waren zum Teil auf Veranlassung unseres Vaters, der sich im folgenden Frühjahr zu diesem Zweck nach Ohio begeben hatte, in Kansas eingetroffen. Unter anderen auch der Richter Delahay, der sich mit seiner Familie in Leawenworth niederließ und in Kansas die erste gegen die Sklaverei gerichtete Zeitung herausgab. Wohl war durch die Ernennung des militärischen Statthalters eine relative Ruhe hergestellt, trotzdem aber kamen noch Hunderte von Gewalttätigkeiten vor. Eine der ersten wurde an dem Richter und seiner Zeitung verübt. Man brach in sein Bureau ein, raubte Lettern und Handpresse und warf sie in den Missouri. Der Richter jedoch ließ sich dadurch nicht abschrecken, sondern kaufte eine neue Presse, und die Zeitung erschien nach wie vor.
Immerhin aber herrschte jetzt doch wenigstens eine gewisse Ordnung in unserem Landstrich. Der Vater nahm seine Arbeit bei der Sägemühle wieder auf, und wir alle hofften auf eine baldige, andauernde Wiedervereinigung. Doch es sollte nicht sein. Der Messerstich hatte Vaters Lunge beschädigt. Bei gehöriger Sorgfalt und Pflege hätte die Wunde wohl wieder ausheilen können, aber die Leiden und fortgesetzten Aufregungen der letzten Jahre ließen keine wirkliche Genesung aufkommen. Im Jahre 1857 kehrte er zwar wieder nach Hause zurück, doch nur um sein letztes Krankenlager aufzusuchen.





























