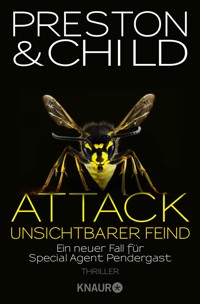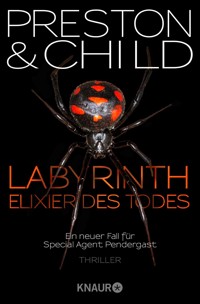9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Special Agent Pendergast
- Sprache: Deutsch
Ist der Teufel in die Welt zurückgekehrt, um Sünder zu richten? Eine Sekte schürt die Panik der Menschen, als kurz hintereinander zwei verbrannte Leichen gefunden werden – und prophezeit, dass als Nächstes das moderne Sodom in Flammen aufgehen wird: New York City! FBI Special Agent Aloysius Pendergast hat eine Menge Erfahrung mit bizarren Mordfällen – und glaubt nicht, dass das Jüngste Gericht kurz bevorsteht. Stattdessen folgt er ganz irdischen Spuren. Sie führen ihn in die Vergangenheit der Opfer und nach Italien. Sind die rituellen Morde nur Ablenkungsmanöver? Burn Case von Lincoln Child, Douglas Preston: Spannung pur im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 758
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Douglas Preston / Lincoln Child
Burn Case
Geruch des Teufels Roman
Aus dem Amerikanischen von Klaus Fröba
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
Epilog
Eine Randnotiz für die Leser
Danksagungen
Douglas Preston widmet dieses Buch Dawa und Granddaddy
Lincoln Child widmet es seiner Tochter Veronica
1
Agnes Torres stellte ihren weißen Ford Escort auf der schmalen Parkfläche vor der fast vier Meter hohen Hecke ab, stieg aus und atmete tief die kühle Morgenluft ein. Ein kurzer Blick nach oben bestätigte ihr, was sie ohnehin wusste: Mehr als das spitze Schindeldach war von dem großen Haus nicht auszumachen. An der dichten Hecke prallten neugierige Blicke wie an einer Backsteinmauer ab.
Sie verschloss sorgfältig den Wagen – eine Vorkehrung, die ihr selbst in dieser gepflegten Wohngegend geboten schien –, suchte den passenden Schlüssel an ihrem umfangreichen Schlüsselbund und schob ihn ins Schloss. Das wuchtige, schmiedeeiserne Tor schwang auf und gab den Blick auf die Rasenfläche frei, die sich knapp dreihundert Meter weit bis zu dem von zwei Dünen gesäumten Strand erstreckt.
Doch dann fing auf einem Tastenfeld direkt hinter dem Tor ein rotes Lämpchen zu blinken an – ein Warnzeichen, das ihre Nerven flattern ließ, denn von nun an blieben ihr nur dreißig Sekunden, um den Code einzugeben. Danach würde der Alarm ausgelöst. Einmal war ihr der Schlüsselbund aus der Hand gerutscht, und weil sie deshalb den Code nicht rechtzeitig eingeben konnte, hatte prompt die Alarmsirene losgeheult und die ganze Nachbarschaft aufgeweckt. Die Polizei war mit drei Streifenwagen angerückt, und Mr Jeremy hatte vor Wut Gift und Galle gespuckt – es war einfach schrecklich gewesen!
Diesmal schaffte sie es, alle Kennziffern rechtzeitig einzutippen, die Kontrolllampe zeigte grünes Licht, das Tor schloss sich. Sie atmete erleichtert auf und bekreuzigte sich dankbar. Alsdann griff sie zum Rosenkranz, fasste die erste Perle mit zwei Fingern, und da sie wusste, dass sie nun gegen alle Unbill gerüstet war, schickte sie sich an, den Rasen zu überqueren. Wie immer, wenn sie das Grove’sche Anwesen betrat, ging sie langsam und betete dabei leise und auf Spanisch ein paar Perlen des Rosenkranzes.
Das weitläufige, düstere Haus war in Dunkel gehüllt, nur aus dem winzigen Fenster im Dachgiebel fiel ein gelber Lichtschimmer, der Agnes ein wenig an das missgünstig blinzelnde Auge eines Zyklopen erinnerte. Während über ihr unablässig mit schrillem Schreien die Seemöwen kreisten, wunderte sie sich ein wenig über den gelblichen Schimmer, denn sie hatte im Giebelfenster noch nie Licht gesehen. Was um alles in der Welt mochte Mr Jeremy morgens um sieben auf den Dachboden gelockt haben, obwohl er doch gewöhnlich nie vor der Mittagszeit aufstand?
Sie beendete ihr morgendliches Gebet und steckte den Rosenkranz ein, freilich nicht, ohne die in vielen Putzfrauenjahren rau gewordene Hand von der Stirn über den Mund zum Herzen huschen zu lassen.
Hoffentlich war Mr Jeremy noch nicht aufgestanden. Sie hatte es lieber, wenn sie ihrer Arbeit allein und ungestört nachgehen konnte, alles andere bereitete ihr nur zusätzliche Mühe. Mal ließ er da, wo sie eben gewischt hatte, Zigarettenasche auf den Boden fallen, mal stellte er ihr, wenn sie gerade mit dem Abwasch fertig war, sein Frühstücksgeschirr in die Spüle. Und die gotteslästerlichen Flüche, die er bei der Lektüre der Morgenzeitung ausstieß, waren ihr genauso zuwider wie seine Angewohnheit, nach dem Frühstück zum Telefon zu greifen und mit irgendeinem Freund – lautstark und wieder von grässlichen Flüchen begleitet – die politische Lage zu diskutieren. Wie sollte ein Christenmensch da seinen Seelenfrieden finden?
Mr Jeremys Stimme hörte sich wie ein rostiges Messer an, sie ging ihr durch Mark und Bein. Er war von hagerer, mittelgroßer Gestalt, stank nach Zigarettenrauch, trank zum Lunch Branntwein und frönte Tag und Nacht Vergnügungen, die Agnes samt und sonders für verderbt und unschicklich hielt. Einmal hatte er partout Spanisch mit ihr sprechen wollen, aber dem hatte sie rasch und ein für alle Mal einen Riegel vorgeschoben. Sie war durchaus in der Lage, sich hinlänglich auf Englisch zu verständigen, also hatte außer ihrer Familie und ein paar guten Freunden gefälligst niemand Spanisch mit ihr zu sprechen! Andererseits, unter den vielen Arbeitgebern, die sie im Laufe der Jahrzehnte kennen gelernt hatte, war keiner so korrekt gewesen wie Mr Jeremy. Er zahlte gut und pünktlich, verlangte nie von ihr, bis spät in den Abend hinein zu bleiben, hielt sich an die vereinbarten Tage und Stunden und wäre nie auf den Gedanken gekommen, ihr zu unterstellen, sie mache womöglich lange Finger. Anfangs hatte er bei seinen Flüchen oft in ihrer Gegenwart den Namen des Herrn missbraucht, aber nachdem sie mit ihm darüber gesprochen hatte, war es nie wieder vorgekommen.
Sie folgte dem gewundenen, gepflasterten Weg zum Dienstboteneingang des Hauses, schob einen weiteren Schlüssel in das Schloss der Hintertür und durchlitt wieder tausend Ängste, bis das flackernde Warnlicht erlosch und sie sicher sein konnte, den richtigen Code eingegeben zu haben. Die hinteren Räume kamen ihr jedes Mal bedrückend düster und grau vor. Auch dem Blick aus den unterteilten Fenstern konnte Agnes nichts abgewinnen. Aufgewühltes Meer und angeschwemmter Seetang, so weit das Auge reichte. Außerdem war es hier hinten sehr warm, um nicht zu sagen unangenehm heiß.
Sie schnüffelte. Ein merkwürdiger Geruch lag in der Luft, wie von einem Braten, der zu lange im Ofen geblieben und angebrannt war. Sie ging in die Küche, aber dort schmorte und brutzelte nichts. In der Spüle türmte sich wie üblich das benutzte Geschirr, doch war dies nicht die Quelle des Geruchs. Mr Jeremy hatte offenbar Fisch gekocht. Normalerweise hatte sie dienstags ihren freien Tag, aber am Abend zuvor hatte er wieder eine seiner unzähligen Dinnerpartys gegeben und hatte sie deshalb gebeten, heute zu kommen. Die Saison dafür war zwar schon lange vorüber, aber wie sie Mr Jeremy kannte, würde er seine Partys sicher noch bis in den November hinein feiern.
Sie trat ins Wohnzimmer und schnupperte abermals. Irgendwo brutzelte etwas, da gab es nichts zu deuteln. Und jetzt mischte sich noch ein anderer Geruch darunter – als habe jemand mit Streichhölzern gezündelt.
Nicht, dass sie alarmiert gewesen wäre, aber eine gewisse Unruhe konnte sie nicht leugnen. Bis auf die übervollen Aschenbecher, die leeren Weinflaschen, das schmutzige Geschirr und den auf dem Teppich breit getretenen Weichkäse sah alles so aus, wie sie es von gestern Nachmittag kurz nach zwei in Erinnerung hatte. Trotzdem, irgendwie kam ihr das Ganze nicht geheuer vor.
Sie reckte ihren plumpen Hals und schnupperte noch einmal. Der seltsame Geruch kam zweifellos von oben.
Ohne einen Laut stieg sie die gewundene Treppe hinauf, wobei sie von Zeit zu Zeit stehen blieb, um abermals zu schnuppern. Nachdem sie leise wie auf Katzenpfoten am Arbeitszimmer des Hausherrn und seinem Schlafzimmer vorbeigeschlichen war, lag vor ihr die Tür zum Dachgeschoss. Der Geruch war beißender und die Hitze noch drückender geworden. Sie versuchte ihr Glück mit der Türklinke, stellte aber verblüfft fest, dass die Tür verschlossen war.
Wieder zog sie ihren Schlüsselbund hervor, fummelte nach dem passenden Schlüssel und öffnete die Tür. Madre de Dios – der Gestank war kaum auszuhalten. Sie erklomm die steile Treppe. Ihren arthritischen Beinen zuliebe legte Agnes auf der obersten Stufe eine kleine Verschnaufpause ein, riskierte aber schon mal einen neugierigen Blick ins Dachgeschoss.
Der lang gezogene Flur schien kein Ende zu nehmen. Hier oben wäre reichlich Platz für ein Dutzend Kinderzimmer, ein großes Spielzimmer und etliche Badezimmer gewesen, nur, für all das hatte Mr Jeremy nie Verwendung gehabt.
Im nächsten Augenblick zuckte sie erschrocken zusammen. Unter der Tür am Ende des langen Flurs entdeckte sie einen gelblichen Lichtschimmer. Widerstrebend ging sie langsam darauf zu.
Ihr Herz hämmerte laut, aber weil sie mit der Linken den Rosenkranz umklammert hielt, wusste sie sich sicher. Der beißende Geruch wurde stärker, je näher sie der Tür kam.
Sie klopfte so leise wie möglich an, denn es konnte ja sein, dass einer von Mr Jeremys Gästen hier oben seinen Rausch ausschlief. Drinnen rührte sich nichts. Sie fasste nach dem Türknauf, der sich ungewöhnlich warm anfühlte. In der Dachkammer war doch hoffentlich kein Brand ausgebrochen? Nicht auszudenken, wenn jemand mit einer brennenden Zigarette in der Hand eingeschlafen war! Es roch eindeutig nach Rauch, aber irgendwie kam es ihr vor, als mische sich noch ein anderer, stärkerer Geruch dazu.
Sie rüttelte am Türknauf, aber der war verschlossen. Unwillkürlich musste sie an ihre Zeit in der Klosterschule und die Nacht denken, in der die kauzige Schwester Ana gestorben war. Da war ihnen auch nichts anderes übrig geblieben, als die Tür aufzubrechen. Wer weiß, vielleicht lag dort drin auch jemand, der krank war und Hilfe brauchte?
Es half alles nichts, sie musste ihr Glück wieder mit ihrem Schlüsselbund versuchen. Ein mühseliges Puzzlespiel, erst beim zehnten Versuch traf sie ins Schwarze. Sie wagte vor Aufregung kaum zu atmen, aber dann fasste sie Mut und wollte die Tür aufschieben. Nur, die verflixte Tür war durch irgendetwas blockiert. Sie stemmte sich mit aller Kraft gegen das Hindernis, bis es in der Dachkammer auf einmal laut zu rumpeln und zu poltern begann.
Santa Maria, bei dem Lärm musste Mr Jeremy ja aufwachen! Erst als alles still blieb, wagte sie, sich noch einmal gegen die Tür zu stemmen, diesmal so lange, bis sie ihren Kopf durch den Türspalt schieben konnte.
Ein übler Gestank schlug ihr entgegen. Es war heiß wie in einem Backofen. An den Spinnweben konnte sie sofort sehen, dass der Raum seit Jahren nicht mehr benutzt worden war.
Es sah so aus, als wären sämtliche Möbel als Barriere vor die Tür geschoben worden. Bis auf das Bett, das an der gegenüberliegenden Wand stand. Und auf diesem Bett lag eine Gestalt, genauer gesagt ein Mann. Nicht etwa im Schlafanzug oder im Nachthemd, nein, im korrekten Abendanzug.
»Mr Jeremy?«
Aber Agnes Torres wusste bereits, dass er nicht antworten würde. Er lag nicht schlafend da. Niemand schläft mit offenen Augen und weit aufgerissenem Mund, aus dem die Zunge – schwarz und zur Größe eines Chorizowürstchens angeschwollen – aufragt wie ein Fahnenmast. Niemand schläft mit hoch gereckten Armen und zur Faust geballten Händen, zwischen deren Fingern das Blut hervorquillt. Schlafende lagen nicht mit verkohltem und in sich zusammengefallenem Oberkörper da wie ein Scheit Kaminholz. Agnes kannte sich aus, sie hatte während ihrer Kindheit in Kolumbien viele Tote gesehen. Und Mr Jeremy war so tot, wie Tote nur sein können.
Während sie noch auf den Leichnam starrte, hörte sie plötzlich jemanden sprechen. Es dauerte eine Weile, bis ihr klar wurde, dass sie selbst es war, die zu murmeln begonnen hatte: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo … Um ganz sicherzugehen, schlug sie rasch das Kreuzzeichen und griff eilends nach ihrem Rosenkranz. Im selben Moment entdeckte sie das Brandzeichen am Fußende des Bettes. Und da wusste sie, was Mr Jeremy Grove widerfahren war.
Ein lautes Seufzen, ähnlich einem erstickten Schrei, dann hatte sie die erste Panik überwunden. Sorgfältig verschloss sie die Tür der Dachkammer, und genauso gewissenhaft verfuhr sie bei allen anderen, die sie geöffnet hatte. Was ihr freilich, wie sie sehr wohl wusste, nur gelingen konnte, weil sie den Rosenkranz fest umklammert hielt, von Zeit zu Zeit das Kreuzzeichen schlug und unermüdlich vor sich hin murmelte: Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
Erst als die letzte Treppenstufe hinter ihr lag, erlaubte sie sich die Schwäche, vor Erleichterung zu schluchzen – aber nur ganz leise, fast lautlos.
Sie hatte das Zeichen mit eigenen Augen gesehen: ein eingebrannter Hufabdruck. Der Teufel persönlich hatte Jeremy Grove seine Aufwartung gemacht.
2
Der Sergeant richtete sich auf. Es war der 16. Oktober in Southampton auf Long Island und erst wenige Stunden her, dass der prominenteste Anwohner dieses noblen Viertels ermordet aufgefunden worden war …
Er hörte damit auf, gelbes Absperrband auszurollen, und warf einen ärgerlichen Blick auf die immer größer werdende Meute der Gaffer. Wenn da nicht bald jemand eingriff, endete das Ganze in einem Fiasko. Die Absperrungen hätten viel früher aufgestellt werden müssen, jetzt war die Flut nicht mehr aufzuhalten. Hinz und Kunz kamen mit ihren Landrovern angeprescht, behaupteten, sie hätten einen unaufschiebbaren Termin beim Frisör oder seien zum Tennismatch verabredet oder weiß Gott was, und die ganz Rabiaten zückten bereits das Handy und drohten, ihren Anwalt anzurufen.
»Sergeant, Sie haben sich nicht um die Hecke gekümmert!« Aha, Lieutenant Braskie, der hatte ihm gerade noch gefehlt! »Habe ich Ihnen nicht ausdrücklich aufgetragen, den gesamten Sicherheitsbereich abzusperren?«
Ohne seinen Chef einer Antwort zu würdigen, stiefelte der Sergeant mit seiner Rolle Absperrband auf die Hecke zu, die das Grove’sche Anwesen begrenzte. Idiotischer ging es nicht! Als könnte er mit seinem Absperrband etwas bewirken, was eine vier Meter hohe, zusätzlich durch versteckten Stacheldraht gesicherte Hecke nicht ohnehin tat.
Die ersten Übertragungswagen des Fernsehens waren bereits angerückt, die örtliche Presse drängte sich ungeduldig vor der Absperrung an der Dune Road. Vor wenigen Minuten war die Verstärkung aus Sag Harbor und East Hampton eingetroffen, und fast zeitgleich kamen die Männer von der Spurensicherung dazu und schleppten ihre Laborkoffer in Groves Haus.
Für einen Moment befiel den Sergeant so etwas wie nostalgische Wehmut. Es hatte einmal eine Zeit gegeben, da war auch er bei den Jungs von der Spurensicherung gewesen, ja, er hatte ihnen sogar gesagt, was sie tun sollten. Aber das war lange her.
Er verdrängte den Gedanken und rollte weiter sein Absperrband aus. Erst als er bei den Dünen angekommen war, warf er einen Blick zurück. Die Männer von der Spurensicherung krochen inzwischen auf Händen und Knien über den Rasen – eine Prozedur, die Lieutenant Braskie mit vorgetäuschtem Interesse verfolgte, obwohl er sich mit Sicherheit keinen Reim darauf machen konnte. Aber so waren die Rollen eben verteilt: Sein Chef trampelte mit gewichtiger Miene in den Spuren herum, und er musste aufdringliche Gaffer in Schach halten!
Zum Beispiel einen Fotografen, der mit einer Kamera mit riesigem Teleobjektiv Fotos von der Arbeit der Spurensucher schoss. Der Sergeant war mit zwei großen Schritten bei ihm und deckte mit der Hand das Objektiv ab.
»Nehmen Sie das Ding weg!«
»Seien Sie mal nicht so, Officer, bitte …«
»Sie wollen doch sicher nicht, dass ich den Film konfisziere, oder?«, fragte der Sergeant in freundlichem Ton. Er versuchte immer, Verständnis dafür aufzubringen, dass jeder seine Arbeit tun musste, auch die Presseleute.
Dann sah er sich suchend um, und als er zu dem Schluss gekommen war, dass es eigentlich nichts mehr für ihn zu tun gäbe, schulterte er die Rolle mit dem restlichen Absperrband und kehrte zu Groves Anwesen zurück. Dabei nahm er einen kleinen Umweg in Kauf, weil er den Kollegen – also gut, den ehemaligen Kollegen – nicht ins Gehege kommen wollte. Nachdem er sich durch ein paar Büsche gezwängt hatte, konnte er sich dem Haus von der Seite her annähern.
Er war nicht mehr weit von seinem Ziel entfernt, da sah er jemanden am Teich stehen und den Enten Brotbrocken zuwerfen. Ein komischer Kauz, lief im Oktober im knallbunten Hawaiihemd und weit geschnittenen Surfer-Shorts herum! Aber er schien harmlos zu sein.
»He, Sie da!«
Der Mann sah hoch.
»Was machen Sie da? Wissen Sie nicht, dass das ein polizeilicher Sperrbereich ist? Verschwinden Sie, sonst muss ich Ihnen Beine machen!«
»Ich gehe hier einer wichtigen Aufgabe nach, Sergeant, nämlich der, die Enten zu füttern. Die haben bestimmt Hunger. Vermutlich werden sie jeden Morgen gefüttert, aber heute … Sie wissen ja.« Er lächelte verhalten.
Der Sergeant konnte es nicht fassen. Da war jemand ermordet worden, und diesem Typen fiel nichts Besseres ein, als die Enten zu füttern!
»Zeigen Sie mir mal Ihren Ausweis.«
»Gern, Officer.« Der Mann fing an, in seinen Taschen zu wühlen, zuckte aber nach ein, zwei Minuten entschuldigend die Achseln und setzte ein einfältiges Lächeln auf. »Tut mir Leid, Officer. Wissen Sie, als sich die schreckliche Nachricht heute Morgen herumsprach, habe ich mir in aller Eile die Shorts angezogen und dabei ganz vergessen, meine Ausweispapiere und das Geld aus dem Anzug zu nehmen. Ich bin selbstverständlich gern bereit …«
Der Sergeant runzelte die Stirn. Der Bursche machte ihn kribbelig, allein durch seinen New Yorker Akzent! Normalerweise hätte er den Kerl kurzerhand vom Gelände gejagt, aber irgendwas war hier faul. Das Zeug, das er am Leib trug, sah so neu aus, dass es förmlich nach dem Edelholz einer teuren Sport-Boutique roch. Andererseits war die Zusammenstellung seiner Klamotten so bizarr, dass es sich eigentlich nur um eine Verkleidung handeln konnte. Wer weiß, ob der Typ wirklich so harmlos war, wie er tat.
»Wie gesagt, ich gehe gern los und …«
»Nein, Sie bleiben, wo Sie sind.« Der Sergeant zückte sein Notizbuch und leckte den Bleistift an. »Haben Sie einen festen Wohnsitz?«
»Ja und nein. Hier habe ich in Amangansett ein Haus gemietet, vorläufig für eine Woche.«
»Adresse?«
»Das Brickman House an der Windmill Lane.«
Aha, auch so ein reiches Arschloch! »Und wo haben Sie Ihren festen Wohnsitz?«
»Im Dakota, Central Park West.«
Der Sergeant stutzte. Wirklich ein seltsamer Zufall. »Ihr Name? Fangen wir mit dem Vornamen an.«
Der Mann seufzte. »Aloysius.«
»Buchstabieren Sie.«
Der Mann tat ihm den Gefallen.
»Nachname?«
»Pendergast.«
Der Bleistift kratzte übers Papier, aber nach den beiden ersten Silben hörte das Kratzen abrupt auf.
Der Sergeant hob langsam den Kopf. Pendergast? Er starrte verdattert auf das Gesicht, und da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen: Das ins Weißliche spielende blonde Haar, die fein gemeißelten Züge, der grau verschleierte Blick … »Sind Sie’s wirklich?«
»In Fleisch und Blut, mein lieber Vincent.« Der New Yorker Akzent war verschwunden, stattdessen schmeichelte nun der kultivierte Singsang der Südstaatler Vincent D’Agostas Ohren.
»Was hat Sie denn hierher verschlagen?«
»Dasselbe könnte ich Sie fragen.«
D’Agosta spürte, dass er rot wurde. Als er und Pendergast sich das letzte Mal begegnet waren, war er noch stolzer Lieutenant bei der New York City Police gewesen. Und nun rollte er in Shithampton gelbes Polizeiband aus.
»Ich war zufällig in Amagansett, als mir zu Ohren kam, Jeremy Grove habe unter ungewöhnlichen Umständen das Zeitliche gesegnet«, erzählte Pendergast. »Das hat natürlich meine Neugier geweckt. Bitte haben Sie Nachsicht mit meinem Outfit, ich konnte so schnell nichts Besseres auftreiben.«
»Haben Sie für das FBI die Ermittlungen übernommen?«
Pendergast lächelte. »Einen offiziellen Auftrag habe ich noch nicht. Streng genommen kann ich also nur Enten füttern. Aber bei meinem letzten Fall ist es mir ähnlich ergangen, da konnte ich auch nur ohne offiziellen Auftrag tätig werden. So etwas macht einige unserer höheren Chargen ziemlich nervös. Aber was soll’s, Vincent – Sie hier zu treffen ist eine willkommene Überraschung.«
D’Agosta lief wieder rot an. »Mir geht’s genauso. Tut mir sehr Leid, dass Sie mich unter … wie soll ich sagen … nun, unter etwas veränderten Umständen antreffen.«
Pendergast legte ihm die Hand auf die Schulter. »Wir werden noch viel Zeit haben, über alles zu reden.«
D’Agosta sah aus den Augenwinkeln, dass Braskie sich an sie herangeschlichen hatte. »Es tut mir in der Seele weh, Sie bei Ihrer Plauderei zu stören …«, Braskies Stimme triefte vor Sarkasmus, »… aber könnte es vielleicht sein, dass es sich bei Ihrem Gesprächspartner um ein Individuum handelt, das sich unerlaubt im polizeilichen Absperrbereich aufhält, Sergeant?«
»Nun, Lieutenant, streng genommen ist es so …«
Braskie winkte ab und musterte den Mann mit den Surfer-Shorts. »Oder lerne ich bei dieser Gelegenheit einen Ihrer Freunde kennen?«
»Der Sergeant hat mich gerade aufgefordert, den Sicherheitsbereich zu verlassen«, wollte Pendergast vermittelnd eingreifen.
»Tatsächlich, hat er das?«, fragte Braskie spöttisch. »Wären Sie, wenn es nicht zu viel Mühe macht, vielleicht bereit, mir zu erklären, weshalb Sie überhaupt in den Sicherheitsbereich eingedrungen sind, Sir?«
»Nun, ich wollte die Enten füttern.«
Lieutenant Braskies Gesicht nahm die Farbe einer überreifen Tomate an. D’Agosta wartete ungeduldig darauf, dass Pendergast endlich seine Dienstmarke zückte.
»Aha, Enten füttern?«, knurrte Braskie. »Dann zeigen Sie mir mal Ihren Ausweis, Sir.«
So, jetzt wirst du gleich große Augen machen!, dachte D’Agosta schadenfroh.
»Wie ich dem Officer bereits sagte, habe ich meine Brieftasche mit sämtlichen Ausweispapieren …«
»Sergeant«, fiel der Lieutenant dem Mann in den Surfer-Shorts ins Wort, »haben Sie seine Personalien aufgenommen?«
»Ja, habe ich.«
»Haben Sie ihn auch gefragt, wie er an den Absperrungen vorbeigekommen ist?«
»Ah – nein.«
»Sehen Sie ein, dass das Ihre Pflicht gewesen wäre?«
Pendergast wollte wieder hilfreich eingreifen. »Ich bin durch die Absperrung an der Little Dune Road …«
»Ausgeschlossen!«, schnarrte Braskie. »Da ist alles dicht, davon habe ich mich persönlich überzeugt!«
»Vermutlich war eine der Sperrketten defekt«, wandte Pendergast ein. »Als ich sie angetippt habe, ist sie wie von selbst heruntergefallen.«
Braskie drehte sich zu D’Agosta um. »Haben Sie das gehört, Sergeant? Da können Sie sich gleich mal nützlich machen. Und was Sie angeht, Sir …« Braskie grinste gehässig. »Sie werde ich persönlich aus dem Sicherheitsbereich eskortieren.«
Pendergast deutete eine elegante Verneigung an. »Überaus liebenswürdig von Ihnen, Lieutenant. Ich hoffe, dass ich mich irgendwann revanchieren kann.«
Braskies Blick pendelte zwischen den Männern hin und her. Komisch, irgendwie wurde er das Gefühl nicht los, dass die beiden irgendein Spielchen mit ihm trieben.
3
Lieutenant L. P. Braskie jr. vom Police Department Southampton stand unter dem von Weinreben berankten Zierbogen und verfolgte, wie die Männer von der Spurensicherung die weitläufige Rasenfläche Quadratzentimeter für Quadratzentimeter durchkämmten. Blanker Neid befiel ihn bei dem Gedanken an MacCready, seinen Chief, der sich zum Golfspielen in die schottischen Highlands abgesetzt hatte. MacCready war seit zwanzig Jahren Chief, kein Wunder, dass er sich inzwischen einbildete, er könne sich alles erlauben, weil sowieso niemand gegen ihn aufzumucken wagte.
Es wurde höchste Zeit, dass in Southampton endlich ein anderer Wind wehte, und das nicht nur wegen der Extratouren, die der amtierende Chief sich ständig herausnahm. Braskie war hier aufgewachsen, ihn kannten die Leute, und er hatte einige einflussreiche Freunde in der Stadtverwaltung. Er pflegte seine Beziehungen – ab und zu eine kleine Gefälligkeit, so etwas spricht sich herum und kann sich im entscheidenden Moment wundersam auswirken. Zugegeben, der Mord an Jeremy Grove wirbelte Staub auf, aber in ein, spätestens zwei Wochen hatten sie den Mörder überführt und eingebuchtet, und dann konnten die Wahlen im November kommen!
Natürlich, Braskie musste seinen Chief irgendwann über die aktuellen Ereignisse unterrichten. Mal sehen, vielleicht rief er MacCready morgen in St. Andrews an.
Oder sollte er lieber bis übermorgen warten? Ja, das war auch noch früh genug. Also wirklich, Chief, glauben Sie mir, ich störe Sie äußerst ungern während Ihres sauer verdienten Urlaubs …
Braskie wusste aus Erfahrung, dass bei einem Mordfall die ersten vierundzwanzig Stunden die entscheidenden sind. Wenn man dann noch keine Spur hatte, war das Spiel so gut wie verloren. Zuerst musste man herausfinden, wann wer Zutritt zum Tatort gehabt hatte, der Rest war ein Puzzlespiel: Spurenvergleiche, Mordwaffe, Zeugen, Motive. Irgendwann stieß man dann todsicher auf den Mörder.
Vorausgesetzt, man hatte jemanden, der einem die lästige Detailarbeit abnahm. Dafür wäre Sergeant Vincent D’Agosta zuständig gewesen – und genau dieser D’Agosta war die Schwachstelle. Er hielt sich einfach nicht an Braskies Anweisungen, und er wusste immer alles besser. Es gab Gerüchte, er sei selber Lieutenant gewesen, und zwar bei der Mordkommission der New Yorker Polizei. Hatte den Dienst quittiert und sich in Kanada niedergelassen, um Kriminalromane zu schreiben. Der erhoffte Erfolg war offenbar ausgeblieben, jedenfalls war er mit eingezogenem Schwanz reumütig zurückgekommen. Nur, in New York war keine Stelle frei, und so blieb ihm nichts anderes übrig, als sich in Southampton zu bewerben. Braskie hätte einen wie ihn nie und nimmer eingestellt. Der Bursche hatte zwar was auf dem Kasten, aber er war kein Typ für Teamarbeit.
Ah, wenn man vom Teufel spricht! D’Agosta kam mit seinem üblichen lässigen Gang auf den Zierbogen zu, ließ die Schultern hängen und trug das Haar so lang, dass es im Nacken auf seinen Hemdkragen fiel.
»Sir«, begrüßte er den Lieutenant. Aber es grenzte an Beleidigung, wie er die Silbe ausspuckte!
Braskie verfolgte weiter die Arbeit der Spurensucher. »Wir haben es hier mit einem wichtigen Fall zu tun, Sergeant.«
D’Agosta nickte.
»Wir dürfen uns nicht den Luxus leisten, die Sache zu vermasseln.«
»Nein, Sir.«
»Ich bin froh, dass Sie das auch so sehen. Um es mal ganz ehrlich auszusprechen: Seit Sie hierher gekommen sind, haben Sie mir deutlich den Eindruck vermittelt, dass Sie mit Southampton nicht viel am Hut haben.«
D’Agosta hüllte sich in Schweigen.
Braskie seufzte. »Sergeant D’Agosta, muss ich es Ihnen wirklich erst unter die Nase reiben? Sie sind jetzt nun mal hier. Und zwar als Sergeant beim Southampton Police Department. Finden Sie sich damit ab!«
»Ich verstehe nicht, was Sie damit sagen wollen, Sir.«
»D’Agosta, ich kann keine Rücksicht darauf nehmen, ob Sie sich hier wohl fühlen oder nicht. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie Ihren Pflichten nachkommen, ohne zu trödeln und ohne zu maulen! Nehmen wir nur mal die Sache heute Morgen. Geschlagene fünf Minuten haben Sie mit diesem Eindringling geredet, bis ich schließlich eingegriffen habe. Ich bin nicht darauf aus, Ihnen das Leben schwer zu machen. Aber Sie können nicht fünf Minuten damit verplempern, mit irgendeinem dahergelaufenen Kerl zu diskutieren, statt ihm einen klaren Befehl zu erteilen und ihn notfalls …«
Braskie brach mitten im Satz ab und starrte ungläubig nach rechts. Schon wieder dieser Typ in den weit geschnittenen Surfer-Shorts! Er atmete tief durch, bevor er sich in strengem Ton an D’Agosta wandte: »Nehmen Sie den Mann fest und lesen Sie ihm seine Rechte vor!«
»Lieutenant, meinen Sie nicht auch, dass wir nichts überstürzen sollten?«
Braskie starrte den Sergeant fassungslos an. Der Kerl wagte es tatsächlich, ihm in Gegenwart eines Delinquenten zu widersprechen. »Sergeant«, sagte er in gefährlich leisem Ton, »ich habe Ihnen soeben einen Befehl gegeben!« Und dann fuhr er den Komiker in den Surfer-Shorts an: »Ich hoffe, Sie haben diesmal Ihre Brieftasche dabei!«
»Aber natürlich«, versicherte der Mann, langte in die Hosentasche und ließ sein Ausweismäppchen aufklappen.
Obwohl der Inhalt des Mäppchens eindeutig silbern und goldfarben funkelte, hatte Braskie eher das Gefühl, dass ihm jeden Moment schwarz vor Augen würde. »Was zum Teufel …«, fing er zu stammeln an.
»Special Agent Pendergast, Federal Bureau of Investigation.«
Braskie lief blutrot an. Der Agent hatte ihn an der Nase herumgeführt. Wieso mischte sich das FBI in diesem frühen Stadium überhaupt in die Ermittlungen ein?
Das Mäppchen wurde ihm vor der Nase zugeklappt. Braskie hielt es für geboten, das Terrain sehr behutsam abzuklopfen. »Gibt es einen besonderen Grund für dieses frühzeitige Interesse seitens des FBI? Ich meine, wir sind bisher davon ausgegangen, dass es sich um einen ganz normalen Mord handelt.«
»Der oder die Mörder sind möglicherweise mit einem Boot gekommen, zum Beispiel aus Connecticut. Damit würde es sich um ein Staaten übergreifendes Verbrechen handeln.«
»Ist das nicht ein bisschen weit hergeholt?«
»Es könnte auf ein Motiv hindeuten.«
Ja, da hatte der Agent Recht. Wer weiß, Grove war womöglich in Drogenhandel und Geldwäsche verwickelt gewesen. Vielleicht sogar in terroristische Aktivitäten.
Wie auch immer, das ließ den Fall in einem ganz anderen Licht erscheinen. Braskie streckte dem Agent die Hand hin. »Willkommen in Southampton, Agent Pendergast. Falls es irgendetwas gibt, was ich oder meine Männer für Sie tun können, lassen Sie es mich bitte wissen. Ich vertrete zurzeit den Chief, Sie müssen also mit mir vorlieb nehmen.«
Braskie registrierte, dass der Handschlag des Agents kühl und trocken war. Wie der ganze Mann. Der Lieutenant war Feds vom selben Schrot und Korn schon bei früheren Gelegenheiten begegnet, nur dass dieser Pendergast oder wie er hieß blasser aussah als die, mit denen er bisher zu tun gehabt hatte. Egal wie, heute Abend würden sie sich bei ein paar Martinis schon näher kommen.
»Nachdem wir nun klare Verhältnisse geschaffen haben«, sagte der Agent in ausgemacht liebenswürdigem Ton, »wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mich zum Tatort führen würden.« Und mit einem Blick auf D’Agosta fragte er scheinbar beiläufig: »Begleiten Sie uns, Sergeant?«
»Ja, Sir«, antwortete D’Agosta, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken.
Braskie seufzte leise. Wenn das FBI auftauchte, ging’s einem wie bei einer schweren Erkältung. Man konnte nur geduldig abwarten, bis die Kopfschmerzen, die Magenverstimmung und das Fieber abgeklungen waren.
4
Vincent D’Agosta folgte Pendergast und Braskie auf die Terrasse, wo die Mordkommission ihr Quartier aufgeschlagen hatte. Eben befragte Chief Detective Tony Innocente die Haushaltshilfe. Sie hatte den Ermordeten gefunden. Genau das wollte Pendergast nicht verpassen, er legte ein Tempo vor, bei dem seine beiden Begleiter nur mit Mühe Schritt halten konnten.
Braskie machte den Chief Detective und den Mann vom FBI miteinander bekannt. Während sie sich noch die Hand gaben, schielte Pendergast neugierig zu der eher kleinen und etwas stämmigen Putzfrau hinüber.
Er deutete eine seiner unnachahmlich eleganten Verbeugungen an. »Agent Pendergast. Und Sie sind Mrs Agnes Torres, wenn ich den Namen richtig verstanden habe?«
»Miss«, korrigierte sie ihn.
»Entschuldigen Sie, Miss Torres. Sagen Sie mir bitte: Glauben Sie an Gott?«
Innocente und seine Detectives sahen sich verblüfft an. Atemlose Stille lag auf der Terrasse.
»Ja«, sagte Agnes Torres schließlich.
»Sind Sie gläubige Katholikin?«
»Ja, das bin ich.«
»Und glauben Sie auch an den Teufel?«
Wieder nahm sich Agnes Torres viel Zeit, bis sie antwortete.
»Ja, ich glaube daran, dass es ihn gibt.«
»Und darum haben Sie aus dem, was Sie oben im Dachboden gesehen haben, bestimmte Schlüsse gezogen, nicht wahr?«
»Oh ja, das habe ich«, sagte Miss Torres in so bestimmtem Ton, dass D’Agosta ein Schaudern überlief.
Braskie runzelte die Stirn. »Halten Sie die religiöse Überzeugung dieser Frau wirklich für relevant?«
Pendergast sah ihn aus kühlen, grau verschleierten Augen an. »Es hängt weitgehend von unserem Glauben ab, wie wir bestimmte Dinge wahrnehmen, Lieutenant.« Er nickte der Putzfrau zu. »Ich danke Ihnen, Miss Torres.«
Braskie führte Pendergast und D’Agosta durch den Dienstboteneingang ins Haus. »Wir versuchen weiter herauszufinden, wer das Haus wann betreten beziehungsweise verlassen hat«, sagte er, als sie im Foyer angekommen waren. »Das Tor war verschlossen und der Bereich rings ums Haus durch Alarmanlagen, Bewegungsmelder, Infrarotsensoren und vorprogrammierte Stromunterbrecher gesichert. Wenn jemand hineinwill, muss er bestimmte Codes kennen. Wir haben das System überprüft, es arbeitet einwandfrei.« Er deutete zum Wohnbereich hinüber. »Wie Sie sehen, besaß Mr Grove eine recht wertvolle Kunstsammlung, aus der aber nichts fehlt.«
Pendergast betrachtete bewundernd die Stiche, Ölgemälde und Zeichnungen – ein Enthusiasmus, den D’Agosta nicht nachempfinden konnte. Er starrte leicht irritiert auf etwas, das für ihn wie ein Kreuz, umgeben von einem Schwein, ein paar Würfeln und einer nackten Frau, aussah.
»Mr Grove hatte gestern Abend eine kleine Party, alles in allem fünf Personen«, fuhr Braskie fort. »D’Agosta, lassen Sie sich von Innocente die Namensliste geben.«
Pendergast hielt den Sergeant durch eine abwehrende Handbewegung auf. »Es wäre mir lieber, Sergeant D’Agosta könnte dies alles mit anhören. Ich hoffe, es macht nicht zu viel Mühe, einen anderen Ihrer Männer loszuschicken.«
Braskie bedachte D’Agosta mit einem zwischen Verblüffung und Ärger schwankenden Blick, dann gab er einem anderen Cop ein Zeichen und fuhr fort: »Nach allen uns vorliegenden Aussagen sind alle Gäste etwa zur selben Zeit aufgebrochen, gegen halb eins. Danach war Grove bis um halb acht heute Morgen allein.«
»Kennen Sie die genaue Todeszeit?«
»Noch nicht, der Gerichtsmediziner ist noch oben in der Dachkammer. Aber wir wissen, dass Grove um drei Uhr zehn noch gelebt hat. Da hat er nämlich versucht, einen gewissen Pater Cappi zu erreichen.«
»Grove wollte einen Priester?« Pendergast schien ehrlich überrascht.
»Grove und er waren wohl mal eng befreundet gewesen, aber das muss dreißig, vierzig Jahre her sein. Später haben sie sich wegen irgendeiner Sache zerstritten und aus den Augen verloren. Der Geistliche war übrigens nicht zu Hause, Grove konnte ihm nur eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.«
»Ich brauche eine Kopie des Bandes.«
»Selbstverständlich. Grove war in heller Aufregung, beinahe hysterisch. Er hat Pater Cappi gebeten, so bald wie möglich zu ihm zu kommen.«
Pendergast nickte. »Mit einer Bibel, einem Kreuz und Weihwasser eventuell?«
Braskie sah etwas enttäuscht aus. »Ach, Sie sind schon über den Anruf unterrichtet?«
»Nein, das war nur eine nahe liegende Vermutung.«
»Aha. Nun, Pater Cappi kam heute Morgen gegen acht hier an. Er hatte sich direkt auf den Weg gemacht, nachdem er die Nachricht vorgefunden hatte, aber da war es natürlich schon zu spät. Er konnte nur noch das Sakrament der letzten Ölung erteilen.«
»Wurden die Gäste schon vernommen?«
»Bisher wurden lediglich ihre Aussagen zu Protokoll genommen. Aber wir ermitteln noch. Theoretisch kann nämlich nicht ausgeschlossen werden, dass einer der Gäste doch länger geblieben ist, weil … nun ja, Mr Grove hatte perverse sexuelle Neigungen.«
Pendergast hob die Augenbrauen. »Inwiefern?«
»Er hatte eine Schwäche für Männer und Frauen.«
»Und was ist mit den perversen sexuellen Neigungen?«
»Wie ich schon sagte: Männer und Frauen.«
»Sie meinen also, er sei bisexuell veranlagt gewesen? Was angeblich auf dreißig Prozent aller Männer zutrifft.«
Braskie schüttelte energisch den Kopf. »Nicht in Southampton! Bei uns ist das nicht üblich!«
D’Agosta täuschte rasch einen Hustenanfall vor, um nicht laut loszulachen.
Pendergast hielt es für besser, das Thema zu wechseln. »Lieutenant, bisher wurde offensichtlich von allen Beteiligten ausgezeichnete Arbeit geleistet. Wollen wir jetzt den Tatort in Augenschein nehmen?«
Lieutenant Braskie nickte beflissen und führte sie durchs Haus. D’Agosta wäre jede Wette eingegangen, dass der seltsam scharfe Geruch, den er schon draußen bemerkt hatte, noch penetranter wurde. Nur, wonach roch es eigentlich? Nach Streichhölzern? Oder waren es Feuerwerkskörper? Oder abgefeuerte Mörserkartuschen? Das eindeutigste Signal, das seine Nase aufnahm, war der Geruch von versengtem Holz und gebratenem Wild. In British Columbia hatte ihm mal ein Freund ein Stück Bärenfleisch mitgebracht, und als er es im Ofen braten wollte, hatte seine Frau fluchtartig die Küche verlassen. Am Ende hatten sie sich Pizza bringen lassen.
Sie stiegen die steile Wendeltreppe zum Dachgeschoss hoch. Alle Türen, an denen sie vorbeikamen, waren verschlossen. Nur diejenige zu der Kammer am Ende des Flures, in der der Gerichtsmediziner seiner Arbeit nachging, stand offen. Und aus diesem Raum schien der üble, immer durchdringender werdende Geruch zu kommen.
Braskie ging voraus, Pendergast und D’Agosta folgten ihm. Die Kammer war mit einem Einzelbett ausgestattet, aus dem winzigen dreieckigen Fenster fiel der Blick auf die Dune Road. Jeremy Grove lag auf dem Bett, seine Kleidung war unversehrt bis auf einige Schnitte, die der Gerichtsmediziner bei seiner Untersuchung vorgenommen hatte. Im Moment stand er mit dem Rücken zu ihnen neben dem Bett und machte sich auf einem Klemmbrett Notizen.
D’Agosta, der an der Tür stehen geblieben war, hielt angewidert den Atem an. Der üble Gestank wurde immer rätselhafter. Es roch fast so, als habe jemand verdorbenes Fleisch zu braten versucht.
Pendergast war an das Bett getreten und versuchte den Leichnam aus möglichst vielen Blickwinkeln in Augenschein zu nehmen, ohne den mit seinen Notizen beschäftigten Gerichtsmediziner dabei zu stören.
Der Tote lag auf dem Bett, die Augen blutunterlaufen, die Hände zur Faust geballt. Seine Haut war auffallend blass und unnatürlich, als habe sie auf rätselhafte Weise ihre Konsistenz verloren. Aber es war der Gesichtsausdruck des Mannes, diese Maske des Grauens und des Schmerzes, der D’Agosta sich abwenden ließ. Während seiner langen Dienstjahre in New York hatte er sich gezwungenermaßen eine kleine Sammlung unerfreulicher Eindrücke zugelegt, die ihn zeit seines Lebens nicht mehr loslassen würden. Dieser hier war ein weiterer.
Der Gerichtsmediziner packte seine Siebensachen zusammen, zwei Assistenten kamen in die Dachkammer, um den Ermordeten in einem Leichensack zu verstauen und auf eine Bahre zu betten, ein Cop kniete auf dem Boden und schnitt ein Brandzeichen aus dem rohen Holzfußboden heraus.
»Entschuldigen Sie, Doktor, wenn ich Sie störe …«, ergriff Pendergast das Wort.
Erst als der Gerichtsmediziner sich umdrehte und das weiße Laborhäubchen abstreifte, bemerkte D’Agosta, dass sie es mit einer Frau zu tun hatten, und zwar einer ziemlich jungen, hübschen Blondine.
Pendergast klappte sein Mäppchen auf. »FBI. Darf ich Sie mit einigen Fragen behelligen, Frau Doktor?«
Die junge Frau nickte.
»Konnten Sie bereits die genaue Todeszeit feststellen?«
»Nein. Und das wird sicher schwierig werden.«
Pendergast hob die Augenbrauen. »Wieso das?«
»Schon als ich die ersten Tests machte, ahnte ich, dass es Probleme geben wird. Der Körper wurde von innen einer enormen Hitze ausgesetzt.«
»Von innen?«, wiederholte Pendergast ungläubig.
»Ja. Es ist, als sei der Körper … um es mal so zu formulieren: von innen gar gekocht worden.«
Pendergast sah sie verwundert an. »Gab es irgendwelche Brandstellen auf der Haut?«
»Nein. Bis auf ein sehr ungewöhnliches Brandmal auf der Brust ist die Haut vollkommen unversehrt.«
Pendergast dachte eine Weile nach. »Wie konnte das passieren? Durch einen starken Fieberschub?«
»Nein. Der Körper war bereits abgekühlt, aber die Körpertemperatur muss eine Zeit lang mehr als neunundvierzig Grad betragen haben – viel zu viel, als dass es biologischen Ursprungs sein könnte. Bei solchen Temperaturen zersetzt sich das Blut. Die Folge ist, dass man die üblichen Verfahren zur Bestimmung der Todeszeit nicht mehr anwenden kann, weil durch den Erhitzungsprozess die meisten Bakterien abgetötet und die Werte des Muskelproteins verfälscht wurden. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, als dass der Tod zwischen drei Uhr zehn, als der Verstorbene einen Anruf tätigte, und der Entdeckung des Leichnams um sieben Uhr dreißig eingetreten ist.«
Pendergast deutete auf ein blasses, wie ein Kreuz geformtes Brandmal auf der Brust des Toten. »Ist dies die Verletzung, die Sie vorhin erwähnten?«
Die Ärztin nickte. »Er muss wohl ein Kreuz getragen haben, offenbar ein sehr wertvolles. Aber als er aufgefunden wurde, war das Metall teilweise geschmolzen und das Holz vollständig verbrannt. In der Asche habe ich Diamanten und Rubine gefunden.«
Pendergast bedankte sich bei der Ärztin für ihre Erläuterungen, ging zu dem Cop, der das Brandzeichen auf dem Fußboden vorsichtig herauszustemmen versuchte, und winkte Sergeant D’Agosta zu sich. »Sehen Sie sich das mal an.«
Braskie – fest entschlossen, sich auf keinen Fall abschütteln zu lassen – zwängte sich so energisch neben sie, dass dem Cop nichts anderes übrig blieb, als seine Arbeit zu unterbrechen und Platz zu machen.
»Groves Mörder scheint einen etwas abartigen Humor zu haben«, murmelte D’Agosta.
»Mein lieber Vincent, glauben Sie wirklich, dass das eine Art Scherz sein sollte?«
»Sie etwa nicht?«
»Nein.«
Braskie machte lange Ohren. Die Anrede ›mein lieber Vincent‹ stieß ihm ausgesprochen sauer auf.
Pendergast kroch inzwischen auf Händen und Knien über den Boden und schnüffelte wie ein Hund beim Aufnehmen einer Fährte. Wie aus dem Nichts zauberte er aus den Surfer-Shorts ein Teströhrchen und eine Pinzette hervor, pickte einen bräunlichen Partikel auf, schnupperte daran und hielt ihn dem Lieutenant hin.
Braskie runzelte die Stirn. »Was ist das?«
»Ganz gewöhnlicher Schwefel«, antwortete Pendergast. »Derselbe Schwefel, der bereits im Alten Testament erwähnt wird, Lieutenant.«
5
Das Chaunticleer war ein winziges Restaurant mit sechs Tischen in einer Seitenstraße von Amagansett, zwischen der Bluff Road und der Hauptstraße gelegen. D’Agosta musste sich auf dem unbequemen Holzstuhl den Hals verrenken, als er sich unauffällig umsehen wollte. Gelb schien die Lieblingsfarbe der Besitzer zu sein: gelbe Narzissen als Tischschmuck, gelbe Raffgardinen vor den gelb gestrichenen Fenstern, gelbes Tischleinen – für einen Moment musste D’Agosta die Augen schließen. Nach dem muffigen Dunkel von Jeremy Groves Dachboden sah hier irgendwie alles unerträglich fröhlich aus.
Die Besitzerin, ein kleines, rotbackiges Persönchen mittleren Alters, kam lächelnd angehuscht. »Ah, Monsieur Pendergast – comment ça va? Sie nehmen sicher das Übliche?«
Als Pendergast nickte, wandte sie sich an D’Agosta: »Und Sie, Officer?«
D’Agosta schielte auf die mit Kreide auf eine Schultafel geschriebene Speisekarte. Die Hälfte der Gerichte waren böhmische Dörfer für ihn, und den Fleischgerichten vermochte er nach den Erläuterungen der Gerichtsmedizinerin nichts mehr abzugewinnen. »Für mich nichts, danke.«
»Vielleicht etwas zu trinken?«
»Ja, ein Budweiser. Eiskalt, bitte.«
»Ich bin untröstlich, Monsieur, aber wir haben keine Lizenz zum Ausschank von Alkoholika.«
D’Agosta fuhr sich mit der Zunge über die ausgedörrten Lippen. »Dann einen Eistee, bitte.«
Als sie allein waren, musterte D’Agosta verstohlen sein Gegenüber. Pendergast trug nun seinen üblichen schwarzen Anzug und schien seit ihrer letzten Begegnung kein Jahr älter geworden zu sein. Was man, wie D’Agosta sich eingestand, von ihm leider nicht sagen konnte. Er fühlte sich fünf Jahre älter und zehn Jahre schwerer, ganz davon abgesehen, dass er auf seinen Schulterklappen zwei Streifen weniger trug.
»Wie haben Sie dieses Lokal entdeckt?«
»Durch reinen Zufall, es liegt nur fünf Blocks von meinem angemieteten Haus entfernt. Das Essen ist ausgezeichnet. Sind Sie ganz sicher, dass Sie nicht doch einen Happen zu sich nehmen wollen?«
D’Agosta schüttelte entschieden den Kopf. »Sie haben mir übrigens noch nicht erzählt, warum Sie hier sind.«
»Ich will die Gegend ein wenig auskundschaften.«
»Auskundschaften? Was kann man da auskundschaften?«
»Ein Freund von mir braucht … sagen wir: Tapetenwechsel. Sie werden ihn zu gegebener Zeit kennen lernen. Aber nun zu Ihnen: Wie ist es Ihnen ergangen? Zuletzt hörte ich, sie steckten in British Columbia und schrieben Romane. Ich muss sagen, Engel der Hölle fand ich durchaus lesbar.«
»Lesbar?«
Pendergast machte eine hilflose Geste. »Legen Sie mein Wort nicht auf die Goldwaage, ich verstehe nicht viel von Thrillern und Krimis.«
D’Agosta zuckte die Achseln. So genannte literarische Gespräche hatte er in den letzten Jahren Gott weiß wie oft geführt, sein Bedarf war für alle Zeiten gedeckt.
Die Getränke kamen, er nahm einen tüchtigen Schluck, fand, dass sein Eistee nach nichts schmeckte, und gab ein paar Würfel Zucker dazu. »Meine Geschichte ist schnell erzählt, Pendergast. Vom Schreiben konnte ich nicht leben, also bin ich nach New York zurückgekehrt. Aber im Police Department war keine Stelle frei, der neue Bürgermeister hatte drastische Sparmaßnahmen angeordnet. Dazu kam, dass ich mir während der Arbeit in der Mordkommission nicht nur Freunde gemacht hatte. Ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte, und da habe ich mich in meiner Verzweiflung für eine freie Stelle in Southampton beworben.«
»Vermutlich gibt es Orte, an denen es sich schlechter arbeiten lässt.«
»Dachte ich auch. Aber wenn man einen Sommer lang hauptsächlich damit beschäftigt war, Jagd auf Hundebesitzer zu machen, deren Köter ein dampfendes Häufchen auf dem Strand abgeladen haben, sieht man die Dinge anders.«
Pendergast nahm einen Schluck Tee. »Und wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Lieutenant Braskie?«
»Er ist ein Arschloch. Peinlich darauf bedacht, nirgendwo anzuecken. Weil er sich Hoffnungen macht, Chief zu werden.«
»Kompetent genug erscheint er mir.«
»Na gut, dann ist er eben ein kompetentes Arschloch.«
Pendergasts tiefer, grau verschleierter Blick machte ihn unruhig. Er hatte ganz vergessen, wie nervös einen diese Augen machen können.
»Ich glaube, Sie haben in Ihrem Bericht etwas ausgelassen. Als wir uns das letzte Mal begegnet sind, hatten Sie eine Frau und einen Sohn. Vincent jr., nicht wahr?«
D’Agosta nickte. »Den Sohn habe ich immer noch, er lebt bei seiner Mutter in Kanada. Und nach dem Gesetz sind wir noch verheiratet.« Er zögerte, nahm innerlich Anlauf und fügte hinzu: »Lydia und ich, wir hatten uns nicht mehr viel zu sagen. Sie wissen, wie das bei Cops ist: Lange Nachtarbeit, es gibt kaum noch Gemeinsamkeiten, man lebt sich auseinander. Sie wollte nicht nach Kanada ziehen, schon gar nicht in einen abgelegenen Flecken wie Invermere. Ich habe mich den ganzen Tag im Haus verkrochen und versucht zu schreiben. Wir sind uns, um es gelinde zu formulieren, gegenseitig auf die Nerven gegangen. Das Komische war, dass sie irgendwann anfing, sich dort wohl zu fühlen. Da wurde mir klar: Wenn wir unsere Ehe retten wollten, mussten wir nach New York zurück.«
Das Essen wurde gebracht. D’Agosta nutzte die Gelegenheit, rasch das Thema zu wechseln. »Und wie ist es Ihnen ergangen? Hat New York Sie die ganze Zeit über in Atem gehalten?«
»Durchaus nicht, ich hatte bis vor kurzem im Mittleren Westen zu tun, genauer gesagt in Kansas. Ich habe dort an einem Fall gearbeitet. Kein Kapitalverbrechen, aber die Sache hat einen speziellen Reiz auf mich ausgeübt.«
»Und wie sieht es mit dem Fall Grove aus?«
»Sie wissen ja, Vincent, ich habe ein ausgeprägtes, manche würden vielleicht sagen: ein abartiges Interesse an ungewöhnlichen Mordfällen. Für solche Fälle nehme ich selbst weite Reisen in Kauf.«
»Sie sind also in offizieller Mission hier?«
»Die Tage, an denen ich auf eigene Faust gehandelt habe, sind vorbei. Das FBI mag das mitunter anders sehen, aber Sie haben Recht, ich bin offiziell hier.«
»Und woraus leitet das FBI im Fall Grove seine Zuständigkeit ab? Ich meine, weil Sie vorhin Braskie gegenüber von Drogenhandel und Terrorismus gesprochen haben.«
»Nun, die Begründung, die ich Braskie genannt habe, mag sich als nicht stichhaltig erweisen, aber ich kann mich fürs Erste darauf stützen.« Pendergast beugte sich vor und fuhr mit gesenkter Stimme fort: »Und dabei brauche ich Ihre Unterstützung, Vincent.«
D’Agosta sah Pendergast an, als habe er einen schlechten Witz gemacht. Doch dann spürte er wieder diesen verdammten Blick auf sich ruhen, aus dem er nicht schlau wurde, und hörte Pendergast sagen: »Wir waren mal ein gutes Team.«
»Aber ich …« D’Agosta setzte eine ärgerliche Miene auf. »Sie brauchen meine Hilfe doch gar nicht.«
»Vielleicht brauchen Sie meine?«
»Wie meinen Sie das? Ich brauche von niemandem Hilfe. Ich komme ganz gut zurecht.«
»Nehmen Sie es mir nicht übel, Vincent, aber Sie kommen keineswegs gut zurecht. Sie tun lauter Dinge, bei denen Sie Ihre Fähigkeiten nicht entfalten können. Lieutenant Braskie mag im Grunde ein anständiger Kerl sein, und ich will ihm auch eine gewisse Intelligenz nicht absprechen, aber Sie sind nicht aus dem Holz geschnitzt, nach seiner Pfeife zu tanzen. Sollte er tatsächlich Chief werden, wird es Ihnen noch schwerer fallen, sich ihm unterzuordnen.«
»Sie halten ihn für intelligent und anständig? Arbeiten Sie mal einen Tag lang für ihn, dann werden Sie die Dinge mit anderen Augen sehen!«
»Sie sind es, der die Dinge mit anderen Augen sehen sollte, Vincent. Wir haben schon schlimmere Dünnbrettbohrer als Lieutenant Braskie erlebt und trotzdem mit ihnen zusammengearbeitet.«
»Sie wollen mich also vor mir selbst retten? Ist es das, was Sie vorhaben?«
»Nein, Vincent. Der Fall Grove wird Sie retten.«
D’Agosta stand abrupt auf. »Ich werde mir diesen Quatsch nicht länger anhören, nicht mal von Ihnen!« Er zog einen verkrumpelten Fünfer aus der Tasche, warf ihn auf den Tisch und stakste steifbeinig aus dem Lokal.
Als er nach zehn Minuten zurückkam, saß Pendergast immer noch am selben Tisch, sein verkrumpelter Fünfer lag da, wo er ihn wütend hingeworfen hatte. Er setzte sich mit rotem Kopf an seinen alten Platz und bestellte noch einen Eistee.
Pendergast aß in aller Ruhe seinen Teller leer. Dann zog er ein Blatt Papier aus dem Jackett und schob es D’Agosta hin. »Dies sind die Namen der vier Personen, die bei Jeremy Groves letzter Party anwesend waren, und der Name und die Telefonnummer des Geistlichen, den Grove in der Mordnacht anrufen wollte. Es sind ein paar interessante Leute darunter.«
D’Agosta überflog die Liste. Das alte, lang vermisste Jagdfieber erwachte in ihm. Der Fall Grove schien für einige Überraschungen gut zu sein.
»Ich werde mit Braskie vereinbaren, dass Sie als Verbindungsmann für das FBI abgestellt werden.«
»Darauf wird er sich bestimmt nicht einlassen.«
»Im Gegenteil, er wird froh sein, Sie loszuwerden. Im Übrigen werde ich das nicht wie eine Bitte aussehen lassen. Wie Sie schon sagten: Er achtet peinlich darauf, nirgendwo anzuecken. Also wird er sich nicht krumm legen.«
D’Agosta grinste zustimmend.
Pendergast warf einen Blick auf die Uhr. »Kommen Sie, Vincent, wir haben eine lange Rückfahrt vor uns. Wenn wir uns beeilen, erwischen wir Pater Cappi vielleicht noch, bevor er sein Mittagsschläfchen hält.«
6
D’Agosta hatte das Gefühl, tief in den weichen Ledersitzen des 59er Rolls-Royce Silver Wraith zu versinken. Die Nobelkarosse wurde von einem Chauffeur gelenkt, was D’Agosta umso bemerkenswerter fand, als er sich noch gut an die Zeit erinnerte, als Pendergast und er in New York an den Museumsmorden gearbeitet hatten und der Agent mit einem uralten Buick aus dem Fahrzeugpool des FBI vorlieb nehmen und sich persönlich hinters Steuer klemmen musste.
Der Wagen glitt auf der Schnellstraße 9 lautlos und geschmeidig durch die reizvolle Landschaft des mittleren Hudson-Tals. Für D’Agosta waren das satte Grün und das Auf und Ab der Hügel nach so vielen Monaten, in denen er nur Sand und die von angeschwemmtem Seetang verschmutzten Dünen gesehen hatte, eine wahre Augenweide. Hin und wieder tauchten abseits der Straße, halb hinter dichtem Baumbestand verborgen, Herrenhäuser auf, von denen der Blick vermutlich weit über den Fluss reichte.
Nach einer Weile verlangsamte der Chauffeur das Tempo und bog in eine kopfsteingepflasterte ehemalige Kutschenauffahrt ein. Vor ihnen lag ein weitläufiges, im flämischen Stil erbautes Gebäude mit gepflegten, zum Hudson abfallenden Rasenflächen und einem schmalbrüstigen Glockenturm. Ein in die Fassade geschraubtes Kupferschild belehrte Besucher darüber, dass der Gebäudekomplex 1874 errichtet und in das Nationalregister historischer Bauwerke aufgenommen worden sei.
Pendergast klopfte an der Pforte. Die schwere Eichentür wurde fast augenblicklich geöffnet, und vor ihnen stand ein Mönch im braunen Ordensgewand mit einem um den Bauch geschlungenen seidenen Zingulum. Er verbeugte sich stumm und ließ sie in einen eleganten Innenraum treten, der nach Zeitlosigkeit und Bohnerwachs roch. Sie wurden offenbar erwartet, denn als Pendergast dem Mönch seine Karte gegeben hatte, führte er sie durch ein Labyrinth verwinkelter Flure in einen spartanisch wirkenden Raum, dessen einziger Wandschmuck ein Kruzifix war. Der Bruder Pförtner verbeugte sich abermals und zog sich zurück, ohne auch nur ein einziges Wort gesprochen zu haben.
Kurz darauf betrat ein anderer Mönch das Zimmer, ein Ordensmann mit dem Gardemaß von gut einem Meter neunzig und lebhaft funkelnden Augen. »Ich bin Pater Bernard Cappi«, stellte er sich vor, »willkommen in unserem Kloster. Wie Sie vermutlich wissen, haben wir Kartäuser das Schweigegelübde abgelegt, aber einmal in der Woche treffen wir uns in diesem Raum, den wir das Disputationszimmer nennen, weil wir dann miteinander reden dürfen. Nach einer Woche striktem Schweigen läuft das gewöhnlich darauf hinaus, dass jeder seinem aufgestauten Frust und Ärger Luft macht.«
Pendergast stellte dem Pater Sergeant D’Agosta vor, sie gaben sich die Hand, tauschten ein paar Höflichkeiten aus, und dann konnte Pendergast endlich sein Anliegen vorbringen. »Um Ihre Zeit nicht über Gebühr in Anspruch zu nehmen, wäre es vielleicht gut, gleich über den Telefonanruf zu sprechen, Pater Cappi.«
Der Pater nickte. »Wie ich der Polizei schon gesagt habe, kam der Anruf am frühen Morgen hier an, nach der Aufzeichnung des Anrufbeantworters um drei Uhr zehn. Er hat mich aber nicht erreicht, weil ich mich, wie jedes Jahr, zwei Wochen zu Exerzitien zurückgezogen hatte. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, alle Anrufe sofort nach meiner Rückkehr abzuhören. Das ist nach den Ordensregeln streng genommen nicht erlaubt, aber meine Mutter ist schon sehr betagt, und so beruhige ich mein schlechtes Gewissen mit dem Argument, dass die Ordensregeln noch nichts von Anrufbeantwortern wussten. Ich bin, nachdem ich das Band abgehört hatte, sofort nach Long Island gefahren, aber es war natürlich schon zu spät.«
»Warum hat Mr Grove Sie angerufen?«
»Das lässt sich nicht mit wenigen Worten beantworten. Jeremy Grove und ich kennen uns schon seit unserem Studium an der Columbia. Nach dem Examen haben sich unsere Wege getrennt, ich fühlte mich zum Priestertum berufen, und er ist nach Florenz gegangen, um dort Kunstgeschichte zu studieren. Wir waren damals beide sehr religiös – das heißt, ich sollte vielleicht richtiger sagen: Wir waren auf die Erörterung religiöser Themen versessen. Während meines Theologiestudiums am Mount St. Mary haben wir unsere Freundschaft weiter gepflegt, und einige Jahre später habe ich für Grove und seine Braut die Hochzeitsmesse gelesen. Ich habe beide wiederholt in Florenz besucht, sie wohnten in einer prächtigen, in den Hügeln über der Stadt gelegenen Villa.«
»Woher hatte Grove das nötige Geld, um auf so großem Fuß zu leben?«, platzte D’Agosta heraus.
»Tja, das ist eine interessante Geschichte, Sergeant. Er hatte bei Sotheby’s ein Gemälde ersteigert, das für die Arbeit eines späten Raffael-Schülers gehalten wurde. Aber Grove konnte nachweisen, dass es von Raffael selbst stammte, und so hat er das Gemälde für dreißig Millionen Dollar an das Getty Museum verkauft.«
D’Agosta schluckte. »Ein hübsches Sümmchen.«
»In der Tat. Aber worauf ich eigentlich hinauswollte: Er ist während seiner Zeit in Florenz zu einem frommen Mann geworden. Auf intellektuelle Weise, gewissermaßen. Er war ständig darauf bedacht, mich in Diskussionen zu verwickeln. Ja, das gibt es, Mr Pendergast: intellektuelle Katholiken, und Grove war einer davon.«
Pendergast nickte bestätigend.
»Er war sehr glücklich verheiratet«, nahm Cappi den Faden wieder auf, »er vergötterte seine Frau. Und dann, ganz plötzlich, verließ sie ihn und lief mit einem anderen davon. Er war, wie man so sagt, am Boden zerstört, seine ganze Welt brach zusammen, und so richtete sich seine ohnmächtige Wut gegen Gott. Er fühlte sich von ihm betrogen. Er wurde nicht Atheist oder Agnostiker, nein, er warf Gott den Fehdehandschuh hin.«
Cappi saß ein paar Sekunden stumm da, als wolle er seinen eigenen Worten nachlauschen, um sicher zu sein, dass er Jeremy Grove nicht unrecht tat.
»Aus Trotz führte er ein sündhaftes Leben«, fuhr er schließlich fort, »durch das er Gott zu bestrafen glaubte, obwohl er im Grunde sich selbst bestrafte. Er wurde Kunstkritiker – ein Beruf, bei dem die Regeln zivilisierten Benehmens von vornherein außer Kraft gesetzt sind. Kein halbwegs besonnener Mensch würde lauthals herausposaunen, dass dieser oder jener Maler nur jämmerlichen Schund produziere, aber von Kunstkritikern erwartet man das geradezu. Es gibt keinen schändlicheren Berufsstand als den des Kritikers – außer vielleicht den des Arztes, der einer Hinrichtung vorsitzt.«
»Sehr richtig«, stimmte D’Agosta ihm zu. »Je weniger Ahnung die Leute haben, desto lieber erteilen sie Belehrungen. Und wenn ihnen keine Belehrungen einfallen, beschränken sie sich aufs Meckern und Kritisieren.«
»Sergeant D’Agosta schreibt Kriminalromane«, erläuterte Pendergast dem Pater.
»Meine Lieblingslektüre!«, rief Cappi begeistert aus. »Verraten Sie mir einen Ihrer Titel?«
»Der letzte hieß Engel der Hölle«, nuschelte D’Agosta ein wenig verlegen, weil er fürchtete, der Pater könne herausfinden, dass er als Autor gescheitert war.
»Den werde ich mir sofort besorgen«, versprach Cappi, bevor er weitererzählte: »Wie zu erwarten, waren Groves Kritiken meisterhaft formuliert. Sie erschienen in der New York Review of Books und fanden bei einer breiten Leserschaft große Beachtung. All das entsprach seiner schon immer latenten Neigung zur Maßlosigkeit, ob es nun um die Auswahl seiner Freunde, um Alkoholexzesse oder um seine Dinnerpartys ging, bei denen er sich wie ein römischer Kaiser gebärdete.«
»Und was wurde aus Ihrer Freundschaft?«, erkundigte sich Pendergast.
»Die ist schlicht verkümmert. Ich glaube, er hat es mir persönlich übel genommen, dass ich Priester war. Seine Frau ist ihm 1974 davongelaufen, und kurz danach ist er auf Distanz zu mir gegangen. Ich habe seither nichts mehr von ihm gehört. Das heißt, bis auf heute Morgen.«
»Als er Sie anrufen wollte?«
Der Pater nickte und kramte einen Mikrokassettenrekorder aus der Soutane. »Ich habe mir erlaubt, eine Kopie zu ziehen, bevor ich das Original der Polizei übergab.« Dann drückte er die Wiedergabetaste. Nach einem Piepston war Groves Stimme zu hören.
»Bernard? Bernard, ich bin’s, Jeremy. Du musst sofort kommen! Bist du da? Ich flehe dich an, nimm den Hörer ab! Bei allem, was dir heilig ist, nimm ab!«
Die Stimme klang schrill, gehetzt und seltsam belegt.
»Hör zu, Bernard, ich brauche dich dringend! Southampton, Dune Road 3001. Komm sofort! Bitte, es ist – es ist schrecklich! Und bring ein Kreuz, die Bibel und Weihwasser mit, hörst du? Ich muss die Beichte ablegen! Ich brauche Vergebung … die Absolution, verstehst du? Um Gottes willen, nimm endlich ab, Bernard!«
Die Stimme verstummte, die vorprogrammierte Zeit des Anrufbeantworters war abgelaufen. Einen Augenblick lang herrschte betretenes Schweigen, dann wandte sich Pendergast an Cappi: »Ich würde gern erfahren, was Sie davon halten, Pater.«
Cappis Gesicht verdüsterte sich. »Ich glaube, er hatte Angst vor der ewigen Verdammnis.«
»Vor der Verdammnis oder vor dem Teufel?«
Cappi rutschte nervös auf seinem Stuhl herum. »Nun, Jeremy litt zweifellos unter Todesangst. Warum auch immer, er ahnte wohl, dass er sehr bald sterben würde. Und er wollte zuvor unbedingt die Vergebung seiner Sünden. Immerhin war ihm das offensichtlich wichtiger, als die Polizei anzurufen. Woraus ich schließe, dass er nie aufgehört hat, an Gott zu glauben.«
»Ist Ihnen das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung bekannt? Sind Sie über den eingebrannten Hufabdruck, die Spuren von Sulfid und Schwefel und das Phänomen einer ungewöhnlichen Erhitzung des Körpers unterrichtet?«
»Ja, das hat man mir erzählt.«
»Und wie erklären Sie sich das alles?«
»Hinter all dem steckt mit Sicherheit ein Mensch aus Fleisch und Blut. Jemand, der demonstrieren wollte, was für ein Mensch Grove seiner Meinung nach war. Deshalb der Hufabdruck und der Schwefel und das alles …« Pater Cappi ließ den Rekorder wieder in seiner Soutane verschwinden. »Das Böse ist nicht so geheimnisumwittert, wie wir uns mitunter einreden, Mr Pendergast. Es ist immer und überall ganz in unserer Nähe, ich begegne ihm jeden Tag. Darum erscheint es mir sehr zweifelhaft, dass der Teufel, welche Gestalt er auch annehmen mag, sonderlich daran interessiert ist, sich bei seinen Geschäften in die Karten blicken zu lassen.«
7
Der Mann, den alle nur unter dem Namen Wren kannten, eilte in der einsetzenden Dunkelheit den oberen Riverside Drive hinunter. Zur Linken konnte er den Park erahnen, der sich bis zum Ufer des Hudson erstreckte, zu seiner Rechten lagen die einst prächtigen Herrenhäuser, die nun leer standen, allmählich verfielen und die Wohngegend zu einem Eldorado für finsteres Gesindel machten. Wren glaubte nicht, dass er das Opfer eines Überfalls werden könnte. Er vertraute auf seinen stämmigen Körperbau und den jugendlich beschwingten Schritt, vielleicht hoffte er aber auch, sein wildes, für einen Mann seines Alters viel zu üppiges weißes Haar werde potenzielle Angreifer so verunsichern, dass sie sich ein anderes, leichter einzuschätzendes Opfer suchten.
Vor einer Jugendstilvilla zwischen 127th und 128th Street blieb er stehen. Das viergeschossige Haus war von einem mannshohen Zaun mit abschreckenden Eisenspitzen umgeben, an dem der Rost fraß. Das Gebäude selbst wirkte baufällig. Die Fenster waren mit Zinnplatten gesichert, das schiefergedeckte Dach splitterte stellenweise ab, und dem Geländer vor den raumtiefen Fenstern der oberen Stockwerke fehlte die Hälfte der Pfosten.
Das eiserne Gartentor stand offen, und Wren schlüpfte durch den Spalt. Er bahnte sich einen Weg durch wucherndes Unkraut, angewehte Abfälle und tief hängende, ausladende Büsche, die schon seit Jahren keine Gärtnerschere mehr gesehen hatten. Schließlich war er an der mit Graffiti beschmierten Eichentür angekommen und klopfte. Es dauerte eine Weile, bis er den Schlüssel im Schloss rumoren hörte und die Tür sich knarrend öffnete. Im gelben Lichtschimmer, der aus dem Haus fiel, stand Pendergast vor ihm, winkte ihn herein und führte ihn durch die Diele und einen lang gestreckten, mit Edelholz verkleideten Flur.
Wren hatte das Haus das letzte Mal im Sommer gesehen, als er die umfangreiche Sammlung in den Kellergewölben katalogisiert hatte, während Pendergast in Kansas Urlaub gemacht hatte. Er erinnerte sich noch, dass das Innere des Hauses damals einer Bauruine mit aufgerissenen Fußböden und nackten Wänden geglichen hatte – nicht zu vergleichen mit dem gepflegten Eindruck, den es jetzt vermittelte! Mit Raritäten bestückte Vitrinen aus schön gemasertem Kastanienholz standen in den Ecken, die Wände waren mit kostbaren, der viktorianischen Zeit nachempfundenen Tapeten und Vorhängen geschmückt.
»Gefällt mir, was du aus dem Haus gemacht hast«, sagte er anerkennend. »Und das in so kurzer Zeit!«
»Nachkommen der Cajun, die unserer Familie schon vor vielen Jahren durch ihr handwerkliches Können gute Dienste geleistet haben. Sie waren auch jetzt wieder wahre Zauberkünstler. Ich hatte allerdings den Eindruck, dass ihnen die Umgebung nicht ganz geheuer war.«
Wren schmunzelte. »Das kann ich ihnen nachfühlen. Dass sich jemand, der ein so gepflegtes Zuhause unten im Dakota hat, ausgerechnet hier niederlässt …« Er brach mitten im Satz ab und sah Pendergast mit großen Augen an. »Es sei denn …«
Der Agent nickte. »Ja, Wren, das ist der Grund. Oder sagen wir: einer der Gründe.«
Sie durchschritten eine große Empfangshalle, und Wren fasste Pendergast am Ärmel: »Wie geht es ihr?«