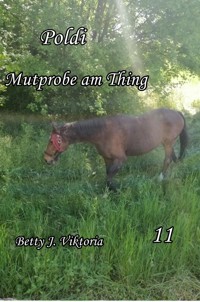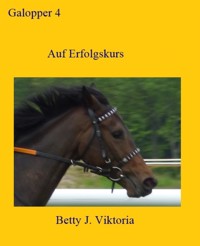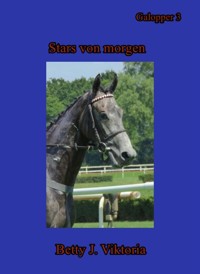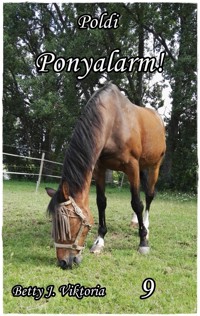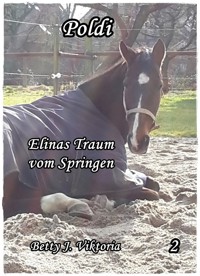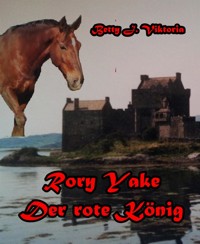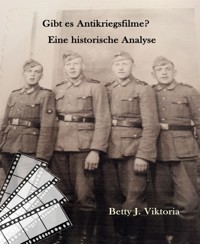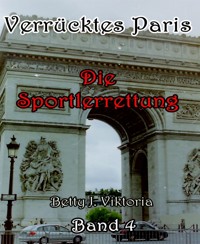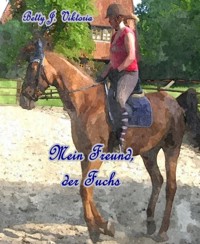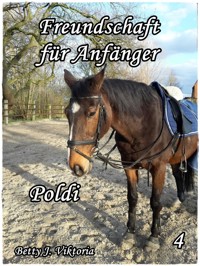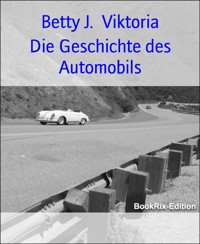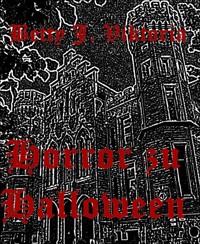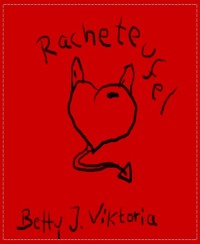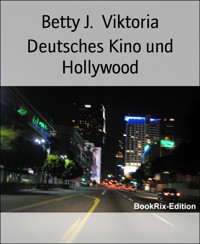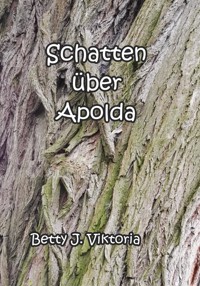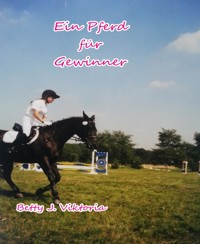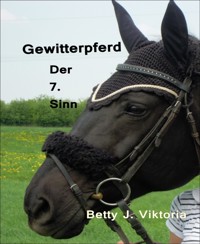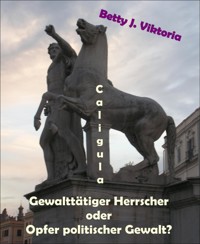
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Caligula wurde als Gaius Caesar Germanicus am 31. August des Jahres 12 nach Christus vermutlich in Antium geboren und wurde am 24. Januar des Jahres 41 nach Christus als Kaiser in Rom ermordet. Seinen Namen Caligula erhielt er schon in früher Kindheit, die er mit seiner Familie im Soldatenlager in Germanien verbrachte. Dort steckte seine Mutter ihn in ein kleines Soldatenkostüm, so dass er den Spitznamen „Caligula“ bekam, was so viel wie „Kleine Stiefel“ oder „Soldatenstiefelchen“ bedeutet. Mit 24 Jahren war Caligula schließlich der jüngste Kaiser, den Rom je hatte. Dabei war er zunächst gar nicht als möglicher Thronfolger angedacht worden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Caligula
Gewalttätiger Herrscher oder Opfer politischer Gewalt?
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenEinleitung
Caligula wurde als Gaius Caesar Germanicus am 31. August des Jahres 12 nach Christus vermutlich in Antium geboren und wurde am 24. Januar des Jahres 41 nach Christus als Kaiser in Rom ermordet. Seinen Namen Caligula erhielt er schon in früher Kindheit, die er mit seiner Familie im Soldatenlager in Germanien verbrachte. Dort steckte seine Mutter ihn in ein kleines Soldatenkostüm, so dass er den Spitznamen „Caligula“ bekam, was so viel wie „Kleine Stiefel“ oder „Soldatenstiefelchen“ bedeutet. Mit 24 Jahren war Caligula schließlich der jüngste Kaiser, den Rom je hatte. Dabei war er zunächst gar nicht als möglicher Thronfolger angedacht worden. Ich möchte in dieser Hausarbeit die Frage behandeln, inwieweit Caligula selbst ein gewaltausübender Herrscher war und inwiefern er das Opfer von (politischer) Gewalt war. Dabei werde ich auf die große Verschwörung eingehen, die es gegen den jungen Kaiser gegeben hat, aber auch auf den Vorwurf, er sei wahnsinnig gewesen. Des Weiteren möchte ich die besondere Art der Kommunikation zwischen dem Senat und Caligula betrachten, ebenso die Art, wie der junge Kaiser diese Kommunikation durchschaut hat. Im letzten Teil werde ich noch den gewaltsamen Tod Caligulas sowie die Motive der Täter behandeln.
Caligula, der Wahnsinnige?
Einige Beinamen hatte sich der junge Kaiser selbst geben lassen. So zum Beispiel „Sohn des Lagers“ oder auch „Vater der Armee“ , welche seine Verbundenheit zum Militär seit seiner Kindheit betonen sollten. Außerdem ließ Caligula sich gern „der Fromme“ und der „beste und größte Caesar“ nennen. Damit ließ er seine Größe und Machtposition ausdrücken. Einen weit weniger rühmlichen Beinamen bekam er jedoch von seinen Biographen und anderen antiken Schreibern, sowie später teilweise auch von der modernen Forschung. Man nannte ihn „Caligula der Wahnsinnige“. So schreibt ihm Seneca als Zeitgenosse „Irrsinn“ zu. Philo von Alexandrien, ebenfalls ein Zeitgenosse, spricht im Zusammenhang mit Caligula von einem „verwirrten Geist“. Des Weiteren berichten Plinius und Flavius einige Jahrzehnte nach Caligulas Tod von dessen angeblichen Wahn. Außerdem spricht Tacitus von einem „verwirrten Geist“ des jungen Kaisers und Cassio Dio berichtet schließlich, Caligula habe „den Verstand verloren“. Cligulas Biograph Sueton wirft ihm vor, geisteskrank zu sein. Er beschreibt den Zustand des jungen Kaisers als „körperlich und seelisch gesundheitlich nicht stabil“ und führt neben der Geisteskrankheit andere seelische Leiden des Caligula auf, wie zum Beispiel Epilepsie und Schlafstörungen. Außerdem erklärt er mithilfe seiner Theorie der Geisteskrankheit einige gegensätzliche charakterliche Schwächen Caligulas. Zunächst folgte auch die moderne Forschung diesen Quellen und bezeichnete Caligula als einen Wahnsinnigen. Die Erklärung lautete weitgehend „Cäsarenwahnsinn“. Damit ist nach Ludwig Quidde ein „Größenwahn, gesteigert bis zur Selbstvergötterung“ gemeint. Der Begriff bezeichnet jedoch weniger ein Krankheitsbild sonder eher eine Reihe von Merkmalen, die ein Kaiser aufwies. Neben dem bereits genannten Größenwahn und dem Glauben an die eigene Göttlichkeit können das außerdem ziel- und sinnlose brutale Grausamkeit, Missachtung gesetzlicher Schranken und Rechte, Verschwendungssucht, Gier nach militärischen Triumphen und Verfolgungswahn sein. Diese treffen auf Caligula in gewissem Maße zu. Jedoch kann man bei ihm kaum von militärischen Erfolgen sprechen und sein Verfolgungswahn- soweit vorhanden- lässt sich leicht auf die verschiedenen Verschwörungen zurückführen, die schließlich tatsächliche Bedrohungen für sein Leben darstellten. Heute geht man in der modernen Forschung nicht mehr generell davon aus, dass Caligula tatsächlich wahnsinnig gewesen ist. Durch quellenkritische Vergleiche zeitlich paralleler und früherer mit späteren Überlieferungen gelange es bereits, Falschinformationen aufzudecken, die zum Beispiel auf die Intentionen der antiken Autoren zurückzuführen sind.
Politische Gewalt gegen die Familie des Germanicus
Bereits in jungen Jahren bekam Caligula das politische Machtstreben, die Konkurrenz und die daraus entstehende Gewalt zu spüren. Als sein Vater Germanicus auf einer Reise, begleitet von seiner Frau und seinem Sohn Caligula, erkrankte und im Alter von 33 Jahren starb, beschuldigte dieser den Statthalter von Syrien, ihn vergiftet zu haben. Daraus entstand wiederum das Gerücht, dass der Mord durch Gift von Kaiser Tiberius selbst angeordnet worden war. Der Grund dafür soll gewesen sein, dass Germanicus durch seine große Beliebtheit bei Volk und Soldaten zum Rivalen des Kaisers geworden war. Wenn man davon ausgeht, dass Germanicus´ Anschuldigungen wahr sind, dann war dies vermutlich die erste Begegnung mit politisch motivierter Gewalt für Caligula. Doch schon bald wurden weitere Familienmitglieder durch Kaiser Tiberius ausgeschaltet, weil sie ins Zentrum der Nachfolgefrage rückten. Nachdem Drusus II, der Sohn des Tiberius, ermordet worden war, kamen die Brüder des Caligula als Thronfolger in Frage. Caligula selbst war zu diesem Zeitpunkt noch zu jung. Obwohl Tiberius zunächst selbst darauf hingewiesen hatte, dass Nero und Drusus III für die Nachfolge geeignet wären, war er schon bald sehr aufgebracht darüber, wie viel Aufmerksamkeit und Ehre den Beiden zukam. Auch sein Verhältnis zu Caligulas Mutter verschlechterte sich. Daher wurde Drusus III in den Kerker geworfen, wo er den Hungertod starb. Caligulas Mutter und ihr Sohn Nero wurden verbannt und starben vermutlich ebenfalls durch Nahrungsentzug. So kam Caligula zunächst für zwei Jahre zu seiner Urgroßmutter Livia, die Witwe des Augustus, und nach deren Tod für weitere zwei Jahre zu seiner Großmutter Antonia Minor. Mit 18 Jahren kam Caligula schließlich zu Kaiser Tiberius auf die Insel Capri. Dass er vom Kaiser dorthin beordert wurde, sollte jedoch nicht bedeuten, dass er als Nachfolger angedacht wurde, sondern er hatte eher die Rolle einer Geisel. Denn bei der Bevölkerung war er als Sohn des beliebten Germanicus noch immer sehr angesehen, so dass er dem Kaiser zur Sicherheit dienen konnte.
Verschwörungen gegen den Kaiser Caligula
Die konsularische Verschwörung
Caligulas Biograph Sueton berichtet von verschiedenen Verschwörungen gegen den jungen Kaiser, ordnet allerdings nur die letzte- und erfolgreiche- zeitlich ein. Seneca und Philo zeigen an Verschwörungen keinerlei Interesse, denn diese könnten möglicherweise das spätere Handeln Caligulas erklären, was nicht im Sinne der beiden Autoren läge. Somit sind eigentlich nur die große Verschwörung aus dem Jahre 39 nach Christus und die Verschwörung, die zu Caligulas Tod führte, überliefert. Mit einer entscheidenden Verschwörung wurde der junge Kaiser im Jahre 39 nach Christus konfrontiert. Dabei können die genauen Ereignisse nur anhand von Indizien rekonstruiert werden, denn genaue Berichte gibt es nicht. Caligula legte sein zweites Konsulat nach nur 30 Tagen nieder. Antike Autoren berichten, dass nach der Amtsniederlegung „viele führende Männer den Tod fanden“ (Cassius Dio). Der Hinweis, dass einige der Verurteilten und Getöteten bereits unter Tiberius wegen Verschwörungsvorwürfen verfolgt worden waren, deutet auf eine Verschwörung gegen Caligula hin. Dass jedoch tatsächlich eine Verschwörung stattgefunden hat, wird nicht erwähnt. Doch die Hinweise, die man den antiken Schriften entnehmen kann, lassen wie gesagt darauf schließen, dass am Tage der Konsulatsniederlegung des Caligula eine Verschwörung gegen ihn aufgedeckt wurde. Die Verschwörer waren keine alten Feinde der Germanicus Familie, die eine offene Rechnung begleichen wollten, sondern Personen, denen gegenüber der Kaiser bisher eher loyal gewesen war. Diese Personen waren die führenden Köpfe der Senatsaristokratie, sogar Konsulare. Sie waren ehemalige Anhänger des Gemellus, des Sohnes des Tiberius, den Caligula nach seiner Krankheit zum Selbstmord hatte zwingen lassen. Denn in den antiken Quellen wird berichtet, dass die verurteilten Männer bereits unter Tiberius wegen ähnlichen Vergehen verurteilt worden waren. Also zu einer Zeit, in der sie sich Vorteile als Feind des Germanicus und als Anhänger des Gemellus verschaffen konnten. Wie schon erwähnt war die Verschwörung nicht erfolgreich. Die große Verschwörung