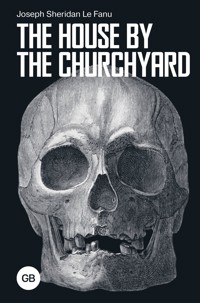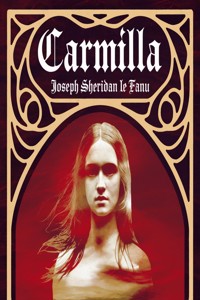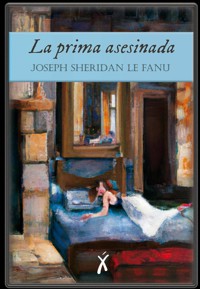Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
"Carmilla" gilt als einer der ersten und besten Vampir-Romane überhaupt. Bram Stoker – Autor des berühmten "Dracula"-Werks – fand in diesem Buch des irischen Schriftstellers Joseph Sheridan Le Fanu entscheidende Anregungen. Joseph Sheridan Le Fanu (1814–1873) zählt zu den bekanntesten Autoren klassischer Gruselgeschichten. Auch in seinem Werk "Carmilla" über die gleichnamige und lesbische Vampirin zeigt sich Le Fanu in Bestform: Der Roman von 1872 ist hochspannend, düster und erotisch – kurzum: "Carmilla" hat alles, was ein guter Vampir-Roman braucht. "Carmilla" wurde mehrfach verfilmt (unter anderem "Draculas Tochter" von 1936, "Gruft der Vampire" von 1970, "Lesbian Vampire Killers" von 2009), doch wie so oft ist das Original unübertroffen. Das vorliegende Buch wurde sorgfältig editiert und enthält Le Fanus Roman im Original-Wortlaut der Erstveröffentlichung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carmilla | Ein Vampir-Roman
JOSEPH SHERIDAN LE FANUJOSEPH SHERIDAN LE FANU
CARMILLA
Ein Vampir-Roman
Vorwort
„Carmilla“ gilt als einer der ersten und besten Vampir-Romane überhaupt. Bram Stoker – Autor des berühmten „Dracula“-Werks – fand in diesem Buch des irischen Schriftstellers Joseph Sheridan Le Fanu entscheidende Anregungen.
Joseph Sheridan Le Fanu (1814–1873) zählt zu den bekanntesten Autoren klassischer Gruselgeschichten. Auch in seinem Werk „Carmilla“ über die gleichnamige und lesbische Vampirin zeigt sich Le Fanu in Bestform: Der Roman von 1872 ist hochspannend, düster und erotisch – kurzum: „Carmilla“ hat alles, was ein guter Vampir-Roman braucht. „Carmilla“ wurde mehrfach verfilmt (unter anderem „Draculas Tochter“ von 1936, „Gruft der Vampire“ von 1970, „Lesbian Vampire Killers“ von 2009), doch wie so oft ist das Original unübertroffen.
Das vorliegende Buch wurde sorgfältig editiert und enthält Le Fanus Roman im Original-Wortlaut der Erstveröffentlichung.
Viel Spaß beim Lesen!
Prolog
Auf ein Blatt Papier, welches dem folgenden Bericht beigegeben war, hat Dr. Hesselius eine ziemlich ausführliche Anmerkung geschrieben und ihr einen Hinweis auf seine Abhandlung über das merkwürdige Problem, das im Manuskript beleuchtet wird, hinzugefügt.
In der erwähnten Schrift behandelt er jenes geheimnisvolle Thema mit der ihm eigenen Gelehrsamkeit und Geistesschärfe, und zudem bemerkenswert unumwunden und präzis. Die Abhandlung wird übrigens nur einen Band der gesammelten Werke dieses außergewöhnlichen Mannes ausmachen.
Wenn ich, allein um das Interesse der "Laien" zu wecken, den betreffenden Fall hier veröffentliche, so will ich der klugen Berichterstatterin in nichts vorgreifen. Aus dem gleichen Grunde habe ich mich nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, von einer Zusammenfassung der Argumente des gelehrten Doktors abzusehen und auch keinen Auszug aus seiner Stellungnahme zu einem Thema beizufügen, das, wie er schreibt, "auf nicht unwahrscheinliche Weise an einige der tiefsten Geheimnisse der beiden Bereiche unserer Existenz und der dazwischenliegenden Stufen rührt".
Als ich die folgenden Aufzeichnungen entdeckte, war ich begierig, den Briefwechsel fortzusetzen, den Dr. Hesselius vor vielen Jahren mit einer so gescheiten und umsichtigen Person, wie seine Informantin es gewesen sein muß, begonnen hatte. Aber zu meinem großen Bedauern erfuhr ich, daß sie inzwischen verstorben ist.
Wahrscheinlich hätte aber auch sie dem Bericht wenig hinzufügen können, den sie - soweit ich beurteilen kann, mit größter Gewissenhaftigkeit - auf den folgenden Seiten erstattet hat.
Kapitel 1
Frühes Entsetzen
Obwohl wir keineswegs hohe Herrschaften sind, bewohnen wir ein Schloß in der Steiermark. In diesem Teil der Welt reicht ein bescheidenes Einkommen weit. Acht- oder neunhundert Pfund jährlich wirken hier Wunder. Zu Hause hätte man uns wohl kaum zu den Begüterten gezählt. (Mein Vater ist Engländer, und ich trage einen englischen Namen, obgleich ich England nie gesehen habe.) Hier jedoch, in dieser einsamen, primitiven Gegend, könnte man selbst mit unbegrenzten finanziellen Mitteln nicht bequemer, ja luxuriöser leben als wir es tun.
Mein Vater war in österreichischen Diensten. Nach seiner Pensionierung griff er auf sein väterliches Erbteil zurück und erwarb diesen Adelssitz samt dem dazugehörigen kleinen Landgut zu einem äußerst günstigen Preis.
Nichts kann malerischer und einsamer sein als unser Schloß. Es steht mitten im Wald auf einer leichten Anhöhe. Der schmale, ausgetretene Weg führt an der Zugbrücke vorbei, die, so lange ich hier gelebt habe, niemals hochgezogen worden ist, und verläuft entlang dem Burggraben, in dem Karpfen gezüchtet werden und auf dessen Wasserspiegel viele Schwäne zwischen den weißen Flottillen der Wasserlilien ihre Bahn ziehen.
Darüber erhebt sich das Schloß mit seinen vielen Fenstern, seinen Türmen und seiner gotischen Kapelle.
Vom Portal aus blickt man auf eine sehr idyllische Waldlichtung. Rechter Hand spannt sich eine steile, gotische Brücke über einen Fluß, der sich in tiefem Schatten durch den Forst windet. Ich habe diesen Ort sehr einsam genannt. Beurteilen Sie selbst, ob ich recht habe. Vom Eingang der Halle aus gesehen, erstreckt sich der Wald, in dem unser Schloß steht, fünfzehn Meilen nach rechts und zwölf nach links. Das nächste bewohnte Dorf liegt ungefähr sieben englische Meilen gen Osten, das nächste bewohnte Schloß von historischem Interesse ist das des alten Generals Spielsdorf, das in entgegengesetzter Richtung fast zwanzig Meilen entfernt liegt.
Ich habe absichtlich vom nächsten bewohnten Dorf gesprochen, denn nur drei Meilen westlich, also in derselben Richtung wie General Spielsdorf Schloß, steht ein verfallenes Dorf mit einer kleinen altertümlichen Kirche, die kein Dach mehr hat und in deren Seitenschiff die Gräber der stolzen Karnsteins zerbröckeln, einer ausgestorbenen Familie, einst Eigentümer des heute ebenfalls verödeten Schlosses, das, von dichtem Wald umgeben, die stummen Ruinen des Dorfes überragt.
Eine Erklärung dafür, warum dieser eindrucksvolle, melancholisch stimmende Ort von seinen Bewohnern verlassen wurde, findet sich in einer alten Geschichte, die ich Ihnen später erzählen werde.
Jetzt muß ich Sie mit dem sehr kleinen Kreis von Menschen bekanntmachen, der in unserem Schloß lebt. Ich nehme die Dienerschaft und die in den anliegenden Gebäuden wohnenden Angestellten aus. Hören und staunen Sie! Da ist mein Vater, der gütigste Mensch auf der Welt, aber ein alternder Mann, und da bin ich. Zu der Zeit, von der ich berichten will, war ich erst neunzehn. Seitdem sind acht Jahre vergangen. Wir beide waren die einzigen Familienmitglieder. Meine Mutter, eine Steiermärkerin, starb, als ich noch ganz klein war, doch ich hatte eine gutmütige Gouvernante, die mich seit meiner frühen Kindheit betreute. Ihr dickliches, wohlwollendes Gesicht war mir von jeher vertraut: Madame Perrodon, aus Bern gebürtig, ersetzte mir mit ihrer Fürsorglichkeit und ihrem guten Herzen wenigstens zum Teil die Liebe meiner Mutter, die ich zu früh verloren hatte, um mich ihrer erinnern zu können. Madame also war die Dritte in unserer kleinen Tischrunde. Und die Vierte war Mademoiselle De Lafontaine, die sie vermutlich als Hauslehrerin bezeichnen würden. Sie sprach Französisch und Deutsch, Madame Perrodon Französisch und gebrochen Englisch, während mein Vater und ich, teils um das Englische nicht ganz und gar zu vergessen, teils aber auch aus patriotischen Gründen, uns täglich in dieser Sprache unterhielten. Die Folge war eine babylonische Sprachverwirrung, über die fremde Besucher sich amüsierten und die ich in diesem Bericht nicht wiedergeben will. Hier und da waren zwei oder drei uns befreundete junge Damen, etwa in meinem Alter, bei uns zu Gast, und gelegentlich erwiderte ich ihren Besuch.
Das also war mein täglicher Umgang. Aber natürlich sprachen bisweilen auch Nachbarn bei uns vor, die fünfzehn bis zwanzig Meilen entfernt wohnten. Trotzdem, das können Sie mir glauben, war mein Leben recht einsam.
Meine Gouvernanten hatten mich nur so weit in der Hand, wie es eben möglich ist, wenn ehrwürdige Damen es mit einem ziemlich verzogenen jungen Mädchen zu tun haben, dessen Vater ihm fast immer seinen Willen läßt.
Das erste Ereignis meines Lebens, das mir einen furchtbaren Schrecken einjagte und mir nie mehr aus dem Gedächtnis geschwunden ist, zählt zu den frühesten Vorfällen, deren ich mich überhaupt entsinnen kann. Manch einem mag es zu unbedeutend erscheinen, um in diesen Bericht aufgenommen zu werden; doch Sie werden allmählich verstehen, warum ich es erwähne. Das Kinderzimmer, das so genannt wurde, obwohl ich es allein bewohnte, war ein großer Raum im oberen Stockwerk des Schlosses, unmittelbar unter dem steilen eichenen Dachgebälk. Ich war kaum älter als sechs Jahre, als ich eines Nachts aufwachte, mich vom Bett aus im Zimmer umsah, weder die Kinderfrau noch das ihr zugeteilte Hausmädchen entdeckte und glaubte, ich sei allein. Ich fürchtete mich nicht, denn ich war eines jener glücklichen Kinder, denen man absichtlich keine Geistergeschichten, Märchen oder Sagen erzählt, und die daher den Kopf nicht unter die Bettdecke stecken, wenn plötzlich die Tür knarrt oder im Flackern einer niedergebrannten Kerze der Schatten des Bettpfostens an der Wand tanzt; ganz nahe am Kopfkissen. Aber ich war ärgerlich und beleidigt, denn ich fühlte mich vernachlässigt; ich begann zu wimmern und war nahe daran, in heftiges Geschrei auszubrechen. Da erblickte ich zu meiner Überraschung ein ernstes, aber sehr liebreizendes Gesicht, das mich vom Rand des Bettes her ansah. Es war das Gesicht einer jungen Dame, die neben mir kniete und die Hände unter die Bettdecke geschoben hatte. Ich betrachtete sie mit fast freudigem Staunen und hörte auf zu schluchzen. Sie streichelte mich zärtlich, legte sich neben mich aufs Bett und zog mich lächelnd an sich. Sofort fühlte ich mich wunderbar beruhigt und schlief wieder ein. Doch plötzlich schreckte ich hoch: mir war, als seien zwei Nadeln tief in meine Brust gedrungen. Ich stieß einen lauten Schrei aus. Die Dame richtete sich rasch auf, starrte mich an, ließ sich zu Boden gleiten und schlüpfte, wie mir schien, unters Bett.
Jetzt erst packte mich die Angst, und ich schrie so laut ich konnte. Kinderfrau, Mädchen, Haushälterin - alle stürzten ins Zimmer, hörten sich meine Geschichte an, versuchten, sie mir auszureden und mich zu beruhigen. Aber ich bemerkte, wenngleich ich noch ein Kind war, daß ihre Gesichter blaß wurden und einen seltsam ängstlichen Ausdruck annahmen, und ich sah, wie sie unters Bett schauten, sich im Zimmer umblickten, unter die Tische lugten und die Schränke öffneten. Ich hörte, wie die Haushälterin der Kinderfrau zuflüsterte: "Spüren Sie diese Vertiefung im Bett? Hier hat jemand gelegen, so wahr mir Gott helfe! Die Stelle ist noch warm." Ich weiß noch, wie das Hausmädchen mich streichelte, wie alle drei meinen Oberkörper besahen, dort, wo ich die Stiche gespürt hatte, und dann erklärten, es sei nicht das Geringste zu entdecken.
Die Haushälterin und die beiden fürs Kinderzimmer verantwortlichen Mädchen wachten bis zum Morgen bei mir. Und von jenem Tag bis zu meinem vierzehnten Lebensjahr verbrachte stets eine Bedienstete die Nacht in meinem Zimmer.
Nach diesem Vorfall war ich lange Zeit sehr nervös. Man holte einen Arzt, einen blassen ältlichen Mann. Wie gut ich mich an sein langes, melancholisches, leicht pockennarbiges Gesicht erinnern kann! Eine Zeitlang erschien er jeden zweiten Tag und gab mir eine Medizin ein, die ich natürlich verabscheute.
Am Morgen nach der nächtlichen Erscheinung hatte mich das Entsetzen so gepackt, daß ich es nicht ertrug, auch nur einen Augenblick alleingelassen zu werden - obwohl doch heller Tag war. Ich entsinne mich, daß mein Vater heraufkam, munter plaudernd an meinem Bett stand, ein paar Fragen an die Kinderfrau richtete, über eine ihrer Antworten herzlich lachte, meine Schulter tätschelte, mich küßte und mir zuredete, keine Angst zu haben - es sei alles nur ein Traum gewesen, der mir nichts anhaben könne.
Ich aber empfand keinen Trost, denn ich wußte, daß der Besuch der fremden Dame kein Traum gewesen war. Ich hatte furchtbare Angst.
Es half auch nicht viel, daß das Hausmädchen mir versicherte, es habe in der Nacht nach mir gesehen und sich zu mir aufs Bett gelegt. Offenbar hätte ich im Halbschlaf ihr Gesicht nicht erkannt. Obwohl die Kinderfrau das alles bestätigte, gab ich mich mit dieser Erklärung nicht zufrieden.
Ich weiß noch, daß am selben Tag ein ehrwürdiger alter Mann in schwarzer Soutane von der Kinderfrau und dem Mädchen ins Zimmer geführt wurde, sich kurz mit beiden unterhielt und sich dann freundlich an mich wandte. Er hatte ein mildes, gütiges Gesicht. Er sagte, er wolle jetzt mit uns beten, ergriff meine Hände, legte sie zusammen und bat mich, leise vor mich hin zu sagen: "O Herr, erhöre alle, die für uns bitten, um Jesu willen." Ich glaube, das waren genau die Worte, denn ich habe sie in Gedanken oft wiederholt, und meine Kinderfrau achtete jahrelang darauf, daß ich sie meinen Gebeten zufügte.
Ich kann mich lebhaft an das nachdenkliche, milde Gesicht jenes weißhaarigen alten Mannes erinnern, der in seiner schwarzen Soutane in dem strengen, hohen, braunen Raum mit dem schwerfälligen Mobiliar im Stil der Zeit vor dreihundert Jahren stand, einem Raum, dessen Düsterkeit nur spärlich von dem durch das kleine vergitterte Fenster dringenden Licht erhellt wurde. Er und die drei Frauen lagen auf den Knien, und er betete - sehr lange, wie mir schien - mit ernster, bebender Stimme. Alles, was ich vor diesem Tag erlebt hatte, habe ich vergessen, und auch, was in der darauffolgenden Zeit geschah, ist versunken. Die Szenen aber, die ich gerade geschildert habe, sehe ich klar und deutlich vor mir, wie die unzusammenhängenden Bilder einer aus dem Dunkel aufsteigenden Phantasmagorie.
Kapitel 2
Ein Gast
Was ich Ihnen jetzt berichten werde, ist so seltsam, daß Sie es nur glauben werden, wenn Sie meiner Wahrhaftigkeit voll vertrauen. Meine Geschichte ist wahr, mehr noch, ich habe sie selbst erlebt.
Es war ein milder Sommerabend, und mein Vater forderte mich wieder einmal zu einem Spaziergang in der herrlichen Waldlichtung auf, die, wie ich bereits erwähnt habe, direkt vor dem Schloßtor beginnt.
"General Spielsdorf kann nun doch nicht so bald zu uns kommen, wie ich gehofft hatte", sagte mein Vater, während wir dahinschritten.
Der General hatte geplant, uns für einige Wochen zu besuchen, und wir hatten ihn bereits am folgenden Tag erwartet. Er wollte eine junge Dame mitbringen, Fräulein Rheinfeldt, seine Nichte und zugleich sein Mündel. Ich kannte sie nicht, hatte aber gehört, sie sei ein reizendes Mädchen, und hatte mich auf viele schöne Tage in ihrer Gesellschaft gefreut. Ich war tiefer enttäuscht, als eine in der Stadt oder in einer belebten ländlichen Gegend wohnende junge Dame sich vorstellen kann. Seit vielen Wochen hatte ich mir diesen Besuch und die neue Bekanntschaft in meinen Tagträumen ausgemalt.
"Wann wird er denn kommen?" fragte ich.
"Nicht vor dem Herbst. In zwei Monaten wahrscheinlich", erwiderte mein Vater. "Und ich bin jetzt sehr froh, daß du Fräulein Rheinfeldt nie kennengelernt hast."
"Warum?" fragte ich betroffen und neugierig zugleich.
"Weil die arme junge Dame tot ist. Ich vergaß beinahe, daß ich es dir noch nicht erzählt habe, aber du warst nicht im Zimmer, als ich heute abend den Brief des Generals erhielt."
Ich war entsetzt. General Spielsdorf hatte in seinem ersten Brief, vor sechs oder sieben Wochen, zwar erwähnt, daß sie sich nicht wohlfühle, aber nichts hatte auf die geringste Gefahr gedeutet.
"Hier ist der Brief des Generals", sagte mein Vater und gab mir das Schreiben. "Ich fürchte, er ist völlig verstört. Er muß den Brief in großer Verwirrung geschrieben haben."
Wir ließen uns unter herrlichen Linden auf einer klobigen Bank nieder. Am bewaldeten Horizont sahen wir die Sonne in melancholischer Pracht sinken, und im Fluß, der am Schloß vorbeifließt, von der bereits erwähnten alten, steilen Brücke überspannt wird und sich dann, fast zu unseren Füßen, zwischen zahlreichen prächtigen Baumgruppen hindurchschlängelt, spiegelte sich der verblassende Purpur des Abendhimmels. General Spielsdorfs Brief war so außergewöhnlich, so heftig und stellenweise so widerspruchsvoll, daß ich ihn zweimal las - das zweite Mal laut -, ihn aber auch dann noch unerklärlich fand, es sei denn, man unterstellte, daß der Kummer den Geist des Generals verwirrt hatte.