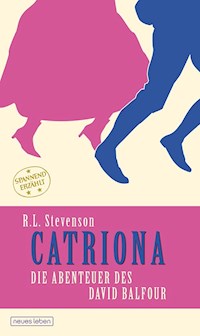
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neues Leben
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Spannend erzählt
- Sprache: Deutsch
David Belfour, ein junger schottischer Adliger, ist Zeuge des Mordes an einem Landvogt des englischen Königs. Doch auf seine Zeugenaussage legen die Beamten seiner Majestät keinen Wert, er wird sogar der Mittäterschaft bezichtigt. David kämpft um Gerechtigkeit und verliebt sich in Catriona Drummond, die Tochter eines Clanhäuptlings. In den beiden Balfour-Romanen - "Entführt" und "Catriona" - erzählt Stevenson eine spannende Geschichte aus dem Schottland des 18. Jahrhunderts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
ISBN eBook 978-3-355-50007-4
ISBN Print 978-3-355-01719-0
Titel der englischen Originalausgabe: Catriona
Ins Deutsche übertragen von Ruth Gerull-Kardas
© 2006 Neues Leben Verlags GmbH & Co. KG
Neue Grünstr. 18, 10179 Berlin
Umschlagentwurf: Verlag
Die Bücher des Verlags Neues Leben
erscheinen in der Eulenspiegel Verlagsgruppe.
www.eulenspiegel-verlagsgruppe.de
Robert Louis Stevenson
Catriona
Die Abenteuer des David Balfour
Erster Teil
Der Lord-Staatsanwalt
I. Der Bettler hoch zu Roß
Am 25. August des Jahres 1751 – es mochte gegen zwei Uhr nachmittags sein – verließ ich, David Balfour, die Britische Leinen-Kompagnie in Edinburgh, gefolgt von einem Bankboten, der mir einen Beutel voll Gold nachtrug. Einige leitende Angestellte der Firma begleiteten mich katzbuckelnd zum Ausgang.
Noch vor kurzem, genauer: Am Morgen des gestrigen Tages – hatte ich dem Bettler am Straßenrand geglichen, die Kleider zerlumpt und nicht einmal mehr einen ganzen Shilling in der Tasche. Mein Begleiter war ein überführter und verurteilter Landesverräter gewesen, wenn er auch seine schottische Heimat und ihre Freiheit über alles geliebt hatte und für sie zum Rebellen geworden war. Auf meinen Kopf war ein Preis ausgesetzt worden für ein Verbrechen, das ich nicht begangen und an dem ich mich nicht beteiligt hatte, von dem aber im ganzen Lande getuschelt wurde. Ich spreche von dem Mord an dem Verweser des britischen Königs, Colin Campbell of Glenure. Zufällig war ich Zeuge geworden, als ich auf der Suche nach meinem Freund Alan Breck Schottland durchwandert hatte. Gleich darauf war ich mit ihm zusammengetroffen; auch ihn hatte ein unseliger Zufall in demselben Augenblick an den Schauplatz des Verbrechens, den Wald von Lettermore, geführt, in dem der tödliche Schuß gefallen war. Alan, der sein Angelgerät bei sich getragen, war unbewaffnet gewesen, und da ich beobachtet hatte, wie der mir unbekannte Mörder entflohen war, glaubte ich fest an Alans Unschuld.
Wir hatten fliehen müssen, Alan und ich, denn wir waren als Mittäter bezichtigt worden; unsere Flucht war gelungen, und nun, glücklich in Edinburgh angekommen und in Sicherheit, war ich endlich in den Besitz meines Vermögens gelangt, um das mein Oheim Ebenezer mich mit allen Mitteln zu betrügen versucht hatte – er hatte mich ermorden wollen; und als dieser Anschlag mißglückt war, hatte er meine gewaltsame Entführung auf der Brigg »Covenant of Dysart« verschuldet – es war ein Komplott zwischen ihm und Kapitän Hoseason gewesen. Dem zufälligen Auftauchen des schiffbrüchigen Alan Breck, seinem Eintreten für mich, seiner Freundschaft und nicht zuletzt aber dem Untergang der »Covenant« vor der Insel Mull hatte ich meine Rettung zu verdanken.
Heute nun erwies man mir die meinem Stande gebührenden Ehren – ich verfügte über Geld und Grundbesitz, war ein Laird, ein großer Herr. In meiner Tasche steckte ein Empfehlungsschreiben meines Advokaten, Mr. Rankeillors. Und damit stand mir die Welt offen.
Zwei Umstände aber hemmten dieses rasche Dahinschießen mit geschwellten Segeln. Da war erst einmal das schwierige, ja geradezu tödliche Unterfangen, das mir bevorstand – ich mußte Alan, der sich verborgen hielt, retten, und zudem hielt ich mich ausgerechnet in Edinburgh auf, dem Ort, an dem meine Gegner saßen und die Macht hatten.
Diese große düstere Stadt mit dem unablässig flutenden Menschenstrom und ihrem Lärm war mir überdies ungewohnt und neu. Nach der erhabenen Stille der Heide- und Moorlandschaft, wo ich so lange Zuflucht vor meinen Verfolgern gefunden hatte, nach dem Frieden auf der weiten Sandfläche des öden, verlassenen Meeresstrandes war ich hier verstört und fühlte mich unfrei. Besonders das Gedränge der vielen hastenden Menschen bedrückte mich. Dazu kam noch etwas anderes: Rankeillors Sohn, dessen Kleider ich trug, mußte klein und schmächtig von Gestalt sein, denn sein Rock wollte mir ganz und gar nicht passen. Es ging also nicht an, daß ich in diesem Aufzug wie ein vornehmer Herr einherstolzierte, und wenn ich es doch tat, würden die Leute wohl über mich lachen, oder – was in meinem Fall weit schlimmer gewesen wäre – sie hätten auf den Einfall kommen können, peinliche Fragen zu stellen. Ich mußte mir daher zuallererst eigene, gut sitzende Kleider beschaffen und, bis es soweit war, schön brav neben dem Bankboten hergehen und ihn freundschaftlich beim Arm nehmen.
Bei einem Kleiderhändler in der Luckenbooth-Straße staffierte ich mich aus – nicht zu elegant, denn ich wollte nicht auftreten wie der Bettler hoch zu Roß. Aber mein Anzug sollte adrett und gediegen aussehen, damit die Dienerschaft in den Häusern, die ich aufsuchen mußte, Respekt vor mir haben konnte. Vom Kleiderhändler ging’s zum Waffenschmied, bei dem ich einen meinem Stande entsprechenden schlichten Degen erstand. Der Besitz dieser Waffe hob mein Selbstbewußtsein, doch für jemand, der sich, wie ich, schlecht damit verteidigen konnte, bedeutet er auch eine gewisse Gefahr. Der Bankbote, der einige Erfahrung in solchen Dingen hatte, fand meine Ausrüstung durchaus angemessen.
»Eure Kleidung ist einfach und anständig«, sagte er, »und wirkt keineswegs auffallend. Der Degen, nun ja, der gehört nun einmal zum Edelmann. Ich an Eurer Stelle hätte allerdings mein Geld besser anzulegen gewußt.«
Dann schlug er mir vor, ich sollte bei einer Frau in einem Hinterhaus in Cowgate – seiner Base, sagte er – warmes Unterzeug kaufen, da sie gute und ungewöhnlich haltbare Ware feilböte.
Doch ich hatte anderes und Dringlicheres im Kopfe.
Die engen Straßen der alten Stadt erschienen mir wie das undurchdringliche Labyrinth in einem Kaninchenbau, nicht nur, weil sie von geschäftigen Leuten wimmelten, sondern mehr noch wegen der ineinandergeschachtelten, unübersichtlichen Gassen, Durchgänge, Schlupfwinkel und Höfe. Es mochte wahrhaftig nicht ganz leicht sein, hier als Fremder einen Freund aufzuspüren, geschweige denn einen mir Unbekannten wie Mr. Charles Stuart. Selbst wenn es mir zufällig gelänge, das richtige Gebäude zu finden, so hockten die Menschen in diesen hohen Häusern so dicht beieinander, daß ich wohl einen ganzen Tag suchen müßte, ehe ich vor der richtigen Tür stände. Es war daher allgemein üblich, sich einen jungen Burschen, Caddie genannt, zu dingen, der als Kundschafter oder Lotse seinen Auftraggeber an den gewünschten Ort zu führen und ihn dann wieder in sein Quartier zurückzugeleiten hatte, sobald dessen Geschäft beendet war. Aber diese Caddies, die immer ähnliche Aufträge ausführen mußten, kannten natürlich alle Häuser und ihre Bewohner genau und waren mit den Verhältnissen in der Stadt so gut vertraut, daß sie zu einer Art Bruderschaft von Spitzeln geworden waren. Aus Mr. Campbells Schilderungen wußte ich, daß sie ständig miteinander in Verbindung standen und voll brennender Neugier ihre Nasen in die Angelegenheiten ihrer Auftraggeber steckten – sie waren sozusagen Auge und Ohr der heiligen Hermandad1 und konnten der Polizei wertvolle Fingerzeige geben. In meiner mißlichen Lage wäre es höchst unklug gewesen, mir ein solches Frettchen an die Fersen zu heften.
Ich hatte drei wichtige Besuche zu machen, und keiner ließ sich aufschieben. Mein Verwandter, Mr. Balfour of Pilrig, mußte aufgesucht werden, dann der Advokat Mr. Charles Stuart, und schließlich mußte ich mich zu dem britischen Lord-Staatsanwalt für Schottland, William Grant, Herrn auf Prestongrange, begeben. Der Besuch bei Mr. Balfour war mühelos und einfach zu bewerkstelligen, denn die Herrschaft Pilrig lag außerhalb der Stadt, und ich würde den Weg dorthin mit Hilfe meiner flinken Beine und meiner gewandten schottischen Zunge leicht selber finden. Mit den beiden anderen Besuchen war die Sache schon schwieriger. In Anbetracht der Gerüchte über den Appin-Mord war es nicht ganz ungefährlich, den Bevollmächtigten dieses Clans aufzusuchen, und außerdem ließ sich das mit meiner Absicht, zu Prestongrange zu gehen, keineswegs in Einklang bringen. Selbst im günstigsten Falle würde ich bei dem Lord-Staatsanwalt einen schweren Stand haben, aber stehenden Fußes vom Appin-Bevollmächtigten zu ihm zu eilen hätte bedeutet, meiner Sache Schaden zuzufügen und Alan erst recht ins Unglück zu stürzen. Die ganze Angelegenheit konnte mir überdies so ausgelegt werden, als liefe ich einerseits mit dem Hasen davon und schlösse mich andererseits der verfolgenden Meute an, was aber durchaus nicht nach meinem Geschmack war. Ich mußte daher zuerst zu Mr. Stuart gehen und gleich den ganzen jakobitischen Teil meines Vorhabens hinter mich bringen. Bei der Ausführung dieses Planes sollte mir der Bankbote behilflich sein.
Als ich ihm die Adresse genannt hatte, begann es zu regnen, zwar nicht sehr heftig, aber in Anbetracht meiner neuen Kleider suchten wir Schutz unter dem Dach über dem Durchgang zu einem geschlossenen Hof.
Da ich so etwas nicht kannte, trat ich neugierig etwas tiefer in den Hof hinein; die gepflasterte Straße fiel steil ab, und zu beiden Seiten ragten sehr hohe Häuser empor. Durch die vorspringenden Stockwerke verengte sich der Durchgang nach oben so sehr, daß nur ein schmaler Himmelsstreifen zu sehen war. Soweit sich durch die Fenster und an den heraus- und hereinströmenden Bewohnern erkennen ließ, mußten es Angehörige vornehmer Stände sein, die hier ihren Wohnsitz hatten. Für mich war das alles fremdartig und seltsam.
Ich spähte noch wißbegierig umher, als hinter mir Marschtritte und Waffengeklirr laut wurden, und als ich mich hastig umsah, entdeckte ich einen Trupp rotberockter Soldaten, die einen hochgewachsenen Mann in einem weiten Mantel in ihrer Mitte führten. Seine leicht vorgeneigte Haltung hatte etwas Unterwürfiges. Er gehörte zweifellos den besseren Ständen an und winkte den Passanten beim Gehen herablassend zu. Obwohl er gut aussah, machte er einen verschlagenen Eindruck. Es schien mir, als habe er mich angesehen, sei aber meinem Blick scheu ausgewichen.
Der Trupp marschierte an uns vorbei und machte vor einer Haustür halt, die von einem Lakaien in prächtiger Livree geöffnet wurde. Zwei der Wachsoldaten führten den Gefangenen in das Haus hinein, die anderen lungerten, ihre Musketen im Arm, vor dem Gebäude herum.
Was immer in einer Stadt vorgehen mag, sogleich finden sich schaulustige Müßiggänger und Kinder ein. Das geschah auch jetzt. Doch die meisten, die herbeigeströmt waren, verzogen sich rasch wieder, und nur vier Personen blieben zurück, darunter ein Mädchen, das wie eine adlige Dame gekleidet war und deren Kopfputz die Familienfarben der Drummonds zeigte. Ihre Begleiter oder, besser, die hinterdreinschlurfenden Gefolgsleute waren zerlumpte Knechte, wie ich sie auf meinen Wanderungen durch das Hochland zu Dutzenden gesehen hatte. Sie unterhielten sich eifrig in gälischer Mundart; Alans wegen waren mir diese Laute lieb und vertraut.
Obwohl der Regen jetzt nachließ und mein Bankbote mich am Ärmel zupfte und zum Weitergehen ermunterte, pirschte ich mich näher an die Gruppe heran, um zu lauschen, was gesprochen wurde. Die junge Dame schalt die Knechte, die sich dienstbeflissen zu entschuldigen suchten, streng und ärgerlich aus. Das bestärkte mich in meiner Vermutung, das Mädchen müsse vornehmen Standes sein. Alle drei Knechte kramten, während sie redeten und gestikulierten, in ihren Taschen; offenbar suchten sie nach Geldstücken, konnten aber, soweit sich feststellen ließ, nicht mehr als einen halben Farthing zusammenkratzen. Ich mußte ein wenig lächeln, weil sie, wie so viele Hochländer, mit leeren Taschen die feinen Herren spielen wollten.
Als sich die junge Dame überraschend umwandte, bekam ich zum erstenmal ihr Gesicht zu sehen. Gleicht es nicht dem größten Wunder, wenn ein junger Mann, dem das Aussehen eines Mädchens gefällt, es sich einprägt und doch nicht sagen kann, weshalb das so ist? Er weiß nur, daß er immer auf diesen Augenblick gewartet hat.
Das Mädchen hatte wunderschöne hellgraue Augen, die wie Sterne glänzten, und sicher waren diese Augen schuld daran, daß ich immerzu hinstarren mußte. Ich kann mich auch noch gut entsinnen, daß ihre Lippen, als sie mir das Gesicht zukehrte, halb geöffnet waren. Aber was auch immer der Grund für meine Verwirrung gewesen sein mochte, ich stand da wie ein Narr und verschlang sie mit den Blicken. Sie mußte wohl nicht gemerkt haben, daß jemand so dicht hinter ihr stand, denn sie sah mich in ihrer Überraschung länger und genauer an, als gemeinhin schicklich gewesen wäre.
In meinem einfältigen Sinn – schließlich war ich ja auf dem Lande groß geworden – bildete ich mir ein, sie bewundere meine neuen Kleider. Dieser Gedanke ließ mich bis in die Haarwurzeln erröten, was wiederum sie falsch auszulegen schien, denn sie trat zur Seite und winkte den Knechten, ihr zu folgen. Nun konnte ich nicht mehr hören, was gesprochen wurde.
Gewiß, sie war nicht das erste Mädchen, das mir gefiel, aber noch nie hatte mich bisher die heftige Bewunderung für eine Frau so plötzlich erfaßt. Im allgemeinen war ich eher zurückhaltend, alles andere als ein Draufgänger. Ja, ich fürchtete ständig, von den Frauenzimmern ausgelacht zu werden.
Der Leser wird meinen, ich hätte in diesem Fall allen Grund gehabt, mich recht unauffällig zu benehmen, da ich der jungen Dame auf der Straße begegnet war, zudem in Begleitung dreier zerlumpter und recht verdächtig aussehender Hochländer, alle zusammen offensichtlich einem Gefangenen folgend. Und noch etwas kam hinzu: Das Mädchen hatte zweifellos annehmen müssen, ich wolle meine Nase in seine Geheimnisse stecken. Und dieser Gedanke war mir hier, in meinen neuen Kleidern, den Degen an der Seite, auf dem Gipfel meines Glückes angelangt, ganz unerträglich. Der Bettler hoch zu Roß konnte die Vorstellung, ausgerechnet von diesem Mädchen mißachtet zu werden, nicht ertragen.
So folgte ich ihr, zog den Hut und redete sie höflich an. »Madam«, stammelte ich, »es ist nur recht und billig, wenn ich Euch sage, daß ich Gälisch nicht verstehe. Gewiß, ich habe Euch zugehört, aber laßt Euch erklären: Jenseits der Hochlandgrenze leben Freunde von mir, daher ist mir der Klang dieser Mundart lieb und vertraut. Was aber Eure persönlichen Angelegenheiten betrifft, so hättet Ihr ebensogut chinesisch oder griechisch sprechen können, wobei ich das letztere schon eher verstanden hätte.«
Sie hatte sich diese lange Rede ruhig angehört und bedankte sich mit einer knappen Neigung ihres hübschen Kopfes.
»Es ist ja nicht weiter schlimm«, rief sie auf englisch und fügte schalkhaft hinzu: »Sieht doch die Katz’ den Kaiser an!«
»Ich wollte Euch gewiß nicht kränken«, erwiderte ich. »Feine städtische Manieren sind mir fremd. Heute habe ich zum erstenmal den Fuß auf Edinburghs Pflaster gesetzt. Nehmt mich gütigerweise für das, was ich bin: einen ungehobelten Burschen vom Lande. Ich sage es Euch lieber gleich, damit Ihr es nicht zu meinem Schaden später selbst herausfindet.«
»Ist es nicht recht ungewöhnlich, daß wir als Fremde auf der Straße miteinander reden? Aber wenn Ihr vom Lande seid und Euch in den städtischen Sitten nicht auskennt, ist das ein ander Ding. Ich bin übrigens auch ein Landkind, stamme aus dem Hochland, und meine Heimat ist weit von hier.«
»Erst vor einer Woche bin ich über die Grenze gekommen. Noch vor wenigen Tagen habe ich das Bergland von Balquidder durchwandert.«
»Balquidder?« fragte sie. »Ihr kommt von Balquidder? Schon wenn ich diesen Namen höre, könnte ich laut aufjubeln. Wart Ihr lange dort? Seid Ihr wohl jemandem von meinen Freunden begegnet? Von meiner Familie?«
»Ich bin bei einem ehrlichen Mann untergekommen, bei Duncan Maclean.«
»Oh, ich kenne Duncan, er ist eine ehrliche Haut, es gibt keinen besseren auf der Welt, und seine Frau ist eine gute Seele.«
»Ja«, sagte ich, »es sind brave Leute, und es lebt sich gut bei ihnen. Das Land ist herrlich.«
»Auf der ganzen Welt gibt es kein schöneres! Ich bin glücklich, wenn ich nur an den Geruch der Erde und der Pflanzen denke.«
Ihr lebhaftes, offenesWesen entzückte mich.
»Ich wünschte, ich hätte Euch ein wenig Heidekraut von Balquidder mitgebracht«, entgegnete ich ihr, »und wenn es auch nicht ganz schicklich gewesen sein mag, daß ich Euch vorhin ansprach, so hat sich dabei doch herausgestellt, daß wir gemeinsame Freunde haben. Ihr dürft mich aber nicht gleich wieder vergessen. Ich heiße David Balfour, und heute ist ein Glückstag für mich. Nach tödlichen Gefahren hat man mir meine Güter und mein Vermögen zurückgegeben. Um Balquidders und Duncans willen wünschte ich, Ihr merktet Euch meinen Namen. Den Euren würde ich bestimmt nicht vergessen, wenn Ihr ihn mir sagen wolltet.«
»Mein Name darf nicht laut genannt werden«, erwiderte das Mädchen etwas hochmütig. »Seit mehr als hundert Jahren haben die Menschen ihn kaum je über die Lippen gebracht, höchstens manchmal und aus Versehen. Es geht mir wie den Feen und Zauberwesen, ich habe keinen richtigen Namen. Aber Ihr dürft mich Catriona Drummond nennen.«
Jetzt wußte ich genau, wer sie war und was es mit ihr und ihrer Familie auf sich hatte. Im ganzen großen Schottland gab es einen Namen, der nie genannt werden durfte, und das war der Name Macgregor. Statt aber dieser unerwünschten Bekanntschaft aus dem Wege zu gehen, geriet ich immer stärker in den Bann des schönen Mädchens.
»Ich habe einen Mann kennengelernt«, sagte ich, »der in der gleichen Lage war wie Ihr. Er wurde Robin Oig genannt.«
»Ist das möglich?« wandte sie sogleich ein. »Ihr seid Vetter Robin begegnet?«
»Wir sind eine ganze Nacht zusammen gewesen.«
»Ja, er ist ein Nachtvogel«, meinte sie lachend.
»Es war ein Dudelsack im Hause. Ihr könnt Euch denken, wie rasch uns die Zeit verflogen ist.«
»Dann seid Ihr auch kein Feind unserer Sippe«, stellte Catriona fest. »Der Mann, der eben hier von Rotröcken umgeben entlangging, ist sein Bruder – mein Vater.«
»Ist das wahr?« rief ich. »Ihr seid die Tochter von James More?«
»Seine einzige Tochter, die Tochter eines Gefangenen. Ach, daß ich es in einem Gespräch mit einem Fremden auch nur für kurze Zeit vergessen konnte.«
In diesem Augenblick richtete einer der Knechte in gebrochenem Englisch das Wort an sie; er wollte wissen, was »sie« – damit meinte er sich selber – wohl des Schnupftabaks wegen unternehmen sollten.
Ich sah mir den Mann etwas genauer an; er war untersetzt, krummbeinig, rothaarig und hatte einen breiten Schädel. Diesen Mann sollte ich später, sehr zu meinem Schaden, näher kennenlernen.
»Daraus wird heute nichts, Neil«, erwiderte Catriona. »Wie willst du Schnupftabak kaufen, wenn du kein Geld hast? Hoffentlich gibst du ein andermal besser acht. James More wird mit Neil of the Tom nicht sonderlich zufrieden sein.«
Da sie englisch miteinander gesprochen hatten, war mir der Sinn ihrer Worte klargeworden. Nun unterbrach ich Miss Drummond und wiederholte: »Ich sagte Euch doch, heute ist ein Glückstag für mich, dieser Mann« – ich wies auf meinen Begleiter – »ist ein Bankbote, der mein Geld trägt, und in Eurer Heimat in Balquidder hat man uns gastlich aufgenommen.«
»Der Euch aufgenommen hat, war keiner von meinen Freunden«, wandte sie ein.
»Schon recht, aber Eurem Robin Oig schulde ich Dank für Tänze, die er uns auf dem Dudelsack vorgespielt hat. Außerdem habe ich Euch vorhin schon meine Dienste angeboten, und Ihr habt sie nicht rechtzeitig abgelehnt.«
»Wenn es sich um eine größere Summe handelte, wäre Euer Anerbieten wohl ruhmvoller, aber laßt Euch sagen, worum es geht. James More liegt gefesselt im Kerker, wird aber seit einiger Zeit jeden Tag zum Lord-Staatsanwalt geführt ...«
»Zum Lord-Staatsanwalt?« rief ich. »Dann wohnt dort ...«
»... der Lord-Staatsanwalt Grant of Prestongrange«, vollendete das Mädchen. »Mein Vater wird zu den verschiedensten Zeiten hingebracht, bald zu dieser, bald zu jener Stunde. Ich ahne nicht, zu welchem Zweck. Es scheint aber, daß diese Besuche einen Hoffnungsschimmer für ihn bedeuten. Dennoch läßt Prestongrange es nicht zu, daß ich mit meinem Vater spreche oder an ihn schreibe. So lauern wir ihm hier auf der Straße auf, und wenn er vorüberkommt, stecken wir ihm Schnupftabak und sonst allerlei zu. Aber dieser Unglücksmensch Neil of the Tom, meines Vaters Diener, hat die vier Penny, mit denen er den Schnupftabak kaufen sollte, verloren, und James More muß heute leer ausgehen. Er wird denken, seine Tochter habe ihn vergessen.«
Ich zog eine Sechs-Penny-Münze aus der Tasche und reichte sie Neil, damit er den Auftrag seiner jungen Herrin ausführen könne. Zu Catriona sagte ich: »Dieses Geldstück stammt noch aus Balquidder; es hat mich bis hierher begleitet.«
»Ach«, rief sie, »ich sehe, Ihr seid ein Freund der Macgregors.«
»Ich möchte Euch nicht täuschen, Miss Drummond. Von Eurer Familie weiß ich nicht allzuviel und noch weniger von James More und seinen Angelegenheiten. Da ich aber, seit wir hier auf der Gasse miteinander bekannt sind, mehr über Euch selbst erfahren habe, dürfte es richtiger sein, wenn Ihr sagtet, ich wäre Catrionas Freund.«
»Das eine schließt doch das andere nicht aus«, meinte sie.
»Nun, das muß man abwarten, Miss Drummond«, erwiderte ich.
»Was müßt Ihr nur von mir denken, daß ich einem Fremden so mir nichts, dir nichts die Hand gereicht habe?«
»Ich denke mir, daß Ihr eine gute Tochter seid«, antwortete ich darauf schnell.
»Das Geld muß ich Euch aber zurückgeben«, versetzte sie. »Wo seid Ihr abgestiegen?«
»Ehrlich gesagt, ich habe bis jetzt in dieser Nacht noch keine Wohnung, doch wenn Ihr mir angeben wolltet, wo ich Euch finden kann, werde ich mir erlauben, meine Münze bei Euch abzuholen.«
»Wollt Ihr das auch wirklich tun?«
»Darauf könnt Ihr Euch verlassen.«
»James More würde es sonst als eine Kränkung empfinden, und ich könnte Eure Hilfe gar nicht annehmen«, sagte sie. »Ich wohne bei Mistress Ogilvy of Allardyce, meiner Tante und guten Freundin, nahe der Ortschaft, die an der Nordseite des Wassers liegt; sie wird Euch Dank wissen, daß Ihr mir geholfen habt.«
»Sobald es meine Angelegenheiten gestatten, werde ich mich einfinden, Miss Drummond.«
Ich hatte keine Ruhe mehr. Der Gedanke an Alan lag mir schwer auf der Seele, daher verabschiedete ich mich hastig von Catriona.
Verwundert dachte ich im Fortgehen daran, wie überraschend schnell wir doch miteinander bekannt geworden waren. Ein wirklich gesittetes Mädchen, überlegte ich, hätte sich gewiß zurückhaltender benommen. Der Bankbote riß mich aus diesen Gedanken.
»Ich hätte Euch für verständiger gehalten, Sir«, meinte er und schnitt dabei eine Grimasse. »Auf diesem Wege werdet Ihr es nicht weit bringen. Ein Narr wird sein Geld rasch los, und mir scheint, Ihr seid noch ein rechter Grünschnabel und reichlich leichtfertig, Euch mit solch einem Frauenzimmer einzulassen!«
»Wie könnt Ihr es wagen, so von der jungen Dame zu sprechen«, rief ich zornig, »und wenn Ihr ...«
Er ließ mich nicht ausreden.
»Junge Dame!« spottete er. »Gott bewahre uns, das und eine Dame! Laßt Euch gesagt sein, die Stadt wimmelt von solchen Frauenzimmern. Man merkt Euch an, daß Ihr in Edinburgh nicht Bescheid wißt.«
Ich wurde immer zorniger.
»Hört mal«, wies ich ihn zurecht, »haltet Euren losen Mund. Führt mich zu der angegebenen Adresse, und dann trollt Euch.«
Mein Führer verstummte zwar, gehorchte mir aber nur widerwillig. Er pfiff ein Liedchen vor sich hin, das etwa so ging:
»Mally kommt den Weg daher,
ihr Kleidchen fliegt im Wind.
Sie schaut zurück, sie schaut umher,
wer folgt dem schönen Kind?
Wir gehen nach Ost, wir gehn nach West,
und immer sehn wir sie.
Wir gehen nach Ost, wir gehn nach West,
wo bleibt Mally Lee?
1 im 13. Jahrhundert Bündnis spanischer Städte gegen die Übergriffe des Adels; seit 1476 politisch-militärische Organisation, später abfällige Bezeichnung für Polizei überhaupt
II. Der Hochlandadvokat
Der Advokat Charles Stuart wohnte im obersten Stockwerk eines Hauses mit der längsten Treppe, die je ein Maurer gebaut hat; es ging ungezählte Stufen hinauf, und ich war ganz außer Atem, als ich endlich vor seiner Tür stand. Ein Schreiber öffnete und erwiderte auf meine Frage, sein Herr sei anwesend. Ich entlohnte meinen Begleiter und wünschte ihn zum Teufel. Laut aber sagte ich zu ihm: »Packt Euch nach Ost oder nach West!«
Dann nahm ich ihm den Geldbeutel ab und folgte dem Schreiber, der im ersten Raum vor einem mit Gerichtsakten hochbeladenen Schreibtisch seinen Platz hatte. An die Kanzlei schloß sich ein zweites Zimmer an, in dem ein kleiner, lebhaft wirkender Herr saß, der offenbar in ein Aktenstück vertieft war. Bei meinem Eintritt blickte er kaum auf, ja, er ließ sogar den Finger an der Stelle ruhen, die er gerade gelesen hatte, wohl in der Absicht, den lästigen Besucher rasch abzufertigen und dann sogleich zu seiner begonnenen Lektüre zurückzukehren. Ein solches Betragen wollte mir nicht gefallen, noch weniger aber die Tatsache, daß der Schreiber von seinem Platz aus jedes Wort hören konnte, das hier drinnen gesprochen wurde.
Ich fragte den kleinen Herrn, ob er Mr. Charles Stuart sei.
»Der bin ich«, erwiderte er, »und wenn die Gegenfrage erlaubt ist, wer seid Ihr selber?«
»Ihr kennt vermutlich weder meinen Namen, noch habt Ihr je etwas von mir gehört«, versicherte ich, »doch ich werde Euch das Andenken eines Freundes zeigen, eines Mannes, den auch Ihr gut kennen dürftet.« Mit gedämpfter Stimme fuhr ich fort: »Es wird Euch vermutlich gar nicht besonders angenehm sein, etwas von ihm zu hören, und das Geschäft, das ich mit Euch zu bereden hätte, ist übrigens streng vertraulich. Kurz gesagt, es wäre mir lieber, wenn ich Euch unter vier Augen sprechen könnte.«
Er stand wortlos auf, schloß, wie mir schien, ein wenig ärgerlich, die Akte, die er noch immer in der Hand hielt, ging in den Nebenraum, und ich hörte, wie er seinen Schreiber mit irgendeinem Auftrag fortschickte. Sobald sich die Wohnungstür hinter dem Manne geschlossen hatte, kam Charles Stuart zu mir zurück. Etwas freundlicher sagte er: »So, Sir, jetzt sind wir ungestört, nun redet frisch von der Leber weg. Doch ehe Ihr zu sprechen beginnt, laßt Euch sagen, falls meine Ahnung mich nicht trügt, seid Ihr entweder ein Stuart, oder ein Stuart hat Euch zu mir geschickt. Versteht mich recht, es ist ein Name von gutem Klang, aber meines Vaters Sohn hütet sich wohl, ihn ohne Not auszusprechen. Ich gestehe Euch offen, jedesmal, wenn ich ihn höre, erfaßt mich leises Grauen.«
»Dazu liegt jetzt wohl kein Grund vor«, erwiderte ich, David Balfour, David Balfour of Shaws. Was aber den Mann anbelangt, der mich zu Euch geschickt hat, nun, für ihn mag dieses Geschenk sprechen.«
Mit diesen Worten zog ich Alans silbernen Mantelknopf hervor und zeigte ihn dem Advokaten.
»Steckt das Ding schnell wieder in die Tasche, Sir«, rief Charles Stuart. »Ihr braucht keinen Namen zu nennen. Der Knopf gehört einem Teufelskerl. Mich wundert nur, daß ihn der Satan nicht längst geholt hat«, fuhr Charles Stuart mit grimmigem Humor fort.
Der Wahrheit entsprechend sagte ich dem Advokaten, daß mir Alans gegenwärtiger Aufenthalt nicht genau bekannt sei. Er befinde sich in einem, wie er selbst glaube, sicheren Versteck, irgendwo außerhalb der Stadt, und zwar in nördlicher Richtung. Dort wolle er warten, bis sich ein Schiff gefunden habe, ihn nach Frankreich zu bringen. Dann berichtete ich noch, wann und wo Alan zu sprechen sei.
»Ich habe mir schon immer gedacht«, rief Mr. Stuart, »daß ich wegen meiner Familie noch eines Tages an den Galgen kommen werde, und mir will scheinen, der Tag ist nicht mehr fern. Ein Schiff, das ihn nach Frankreich bringen soll ... Das ist leicht gesagt, Sir. Und wer wird für die Kosten aufkommen? Der Mann muß übergeschnappt sein.«
»Für die Bezahlung laßt mich sorgen, Mr. Stuart. Hier in diesem Beutel ist Geld genug«, erwiderte ich, »und wenn mehr gebraucht wird, wendet Euch an die gleiche Quelle.«
»Nun, nach dieser Erklärung muß ich Euch wohl nicht nach Eurer politischen Meinung fragen«, sagte Mr. Stuart.
Ich lächelte.
»Nein, das braucht Ihr nicht«, erwiderte ich, »denn ich bin ein überzeugter Whig-Anhänger.«
»Halt, halt« rief der Advokat, »was soll das heißen? Ein Whig-Anhänger? Wenn es so ist, was wollt Ihr dann hier mit Alans Knopf? Mit was für einer finsteren Sache befaßt Ihr Euch da, Mr. Whig? Hier geht es um einen vogelfreien Rebellen, um einen Mann, der des Mordes verdächtig ist, der steckbrieflich verfolgt wird und auf dessen Kopf eine Belohnung von zweihundert Pfund ausgesetzt wurde. Ihr aber kommt zu mir, bittet mich um meinen Beistand und erzählt mir gleichzeitig, Ihr hieltet es mit der Whigpartei. So ein Whig ist mir bis heute noch nicht vorgekommen, und ich kenne nicht wenige von der Farbe.«
»Gewiß, er ist vogelfrei, er ist ein Rebell, schlimm genug. Das alles gebe ich zu, aber außerdem ist er mein Freund. Ich wünschte freilich, er wäre besser beraten gewesen. Auch wird er zu seinem Unglück des Mordes verdächtigt, aber diese Anschuldigung ist falsch.«
»Das sagt Ihr mir!«
»Andere werden von mir bald das gleiche zu hören bekommen. Alan Breck ist unschuldig. James Stuart ebenfalls.«
»Oh«, sagte der Advokat, »das eine läßt sich von dem anderen nicht trennen; wenn Alan nichts mit dem Mord zu tun hat, gilt das unbedingt auch für James.«
Da der Advokat mich fragend anblickte, erzählte ich ihm so kurz wie möglich von meiner Bekanntschaft mit Alan, von der zufälligen Begegnung im Walde von Lettermore, die mich mit dem Appin-Mord in Verbindung gebracht hatte, und dann von den verschiedenen Etappen unserer Flucht durch Heide und Moor. Zum Schluß berichtete ich, wie es mir glücklich gelungen war, mich in den Besitz der mir widerrechtlich vorenthaltenen Güter sowie meines Vermögens zu setzen. »Und damit, Sir«, schloß ich, »wißt Ihr, wie alles gekommen ist, und könnt Euch nun selber ein Bild machen, wieso ich in die Angelegenheiten Eurer Familie und Eurer Freunde so tief verstrickt wurde. Es wäre besser für uns alle, wenn diese Verbindung weniger umständlich und mit weniger Blutvergießen zustande gekommen wäre. Jetzt werdet Ihr auch begreifen, daß bestimmte Einzelheiten in dieser Sache nicht irgendeinem Advokaten anvertraut werden durften. Und nun bleibt mir nur noch die Frage, ob Ihr bereit wäret, mir behilflich zu sein. Das erste und wichtigste: Alan muß aus dem Lande geschmuggelt und in Sicherheit gebracht werden! Doch das brauche ich wohl nicht eigens zu betonen!«
»Dieser Punkt wird sich schwerlich umgehen lassen«, sagte der Advokat zustimmend.
»Als zweites bitte ich Euch, eine kleine Summe, die ich Cluny Macpherson schulde, an ihn zurückzuzahlen«, fuhr ich fort. »Mir dürfte es schwerfallen, einen Boten dafür aufzutreiben, aber Euch macht so etwas wohl keine Mühe. Ich schulde Cluny zwei Pfund, fünf Schilling, drei halbe Penny und einen Farthing.«
Der Advokat schrieb sich die Summe auf.
»Ach«, rief ich, »und dann ist da noch ein Mr. Henderland, ein wandernder Prediger und Missionar in Argdour. Dem würde ich gern ein wenig Schnupftabak zukommen lassen. Sicherlich steht Ihr mir Euren Freunden im Appin-Gebiet in ständiger Fühlung, und von da bis Argdour ist es ja nicht weit. Vielleicht läßt es sich mit etwas anderem verbinden.«
»Wieviel Schnupftabak soll er bekommen?« fragte der Advokat.
»Nun, ich denke, etwa zwei Pfund«, erwiderte ich.
»Zwei Pfund?« fragte er erstaunt.
Ich lächelte und nickte.
»Dann ist da noch ein junges Mädchen, Alison Hastie« fuhr ich fort, »das mir und Alan einen großen Dienst erwiesen hat. Ohne ihre Hilfe wären wir nicht über den Forth gekommen. Ich habe mir gedacht, man könnte Alison ein hübsches Sonntagskleid besorgen – eines, das ihrem Stand angemessen ist. Diese Sache belastet mein Gewissen, denn – genaugenommen – hat sie uns das Leben gerettet.«
»Ich freue mich, daß Ihr ein dankbares Gemüt habt und ein vernünftiger Rechner seid, Mr. Balfour.« Während der Advokat das sagte, machte er sich wieder eine Notiz.
»Wenn es schon an meinem ersten Glückstag anders wäre, müßte ich mich schämen« erwiderte ich. »Wollt Ihr die Güte haben, diese Auslagen sowie Eure eigenen Gebühren zu berechnen. Ich wüßte gern, ob noch etwas von dem Geld übrigbleibt. Gewiß, ich wäre bereit, für Alans Sicherheit die ganze Summe und noch mehr hinzugeben, auch kann ich jederzeit weitere Beträge abheben, aber nachdem ich heute schon soviel entnommen habe, könnte es auffallen, wenn ich nach so kurzer Zeit bereits mehr verlangte. Und ich muß vorsichtig sein. Stellt Eure Rechnung aber bitte so auf, daß Ihr mit dem Geld auskommt, denn ich möchte es möglichst vermeiden, Euch ein zweites Mal aufzusuchen.«
»Nun, ich freue mich, daß Ihr alles so wohl bedenkt, Mr. Balfour«, sagte der Advokat, »aber haltet Ihr es nicht für unvorsichtig, mir eine so große Summe anzuvertrauen?«
Mr. Stuart hatte das mit unverhohlenem Spott gesagt.
»Dieses Risiko muß ich wohl auf mich nehmen«, erwiderte ich im gleichen Ton.
Es entstand eine Pause, in der Mr. Stuart das Geld verschloß.
»Ihr dürft ganz unbesorgt sein, Mr. Balfour«, versetzte der Advokat. »Ich werde Euren Namen keiner Menschenseele nennen, und so viel scheint sicher, bisher ahnt der Lord-Staatsanwalt noch gar nichts von Eurer Existenz.«
Ich merkte, daß ich mit Mr. Stuart ganz offen reden mußte.
»Dann kann sich der Lord-Staatsanwalt auf allerlei gefaßt machen; spätestens morgen werden ihm die Augen aufgehen. Ich habe vor, ihn aufzusuchen.«
»Ihr wollt ihn aufsuchen?« rief Mr. Stuart entsetzt. »Bin ich wahnsinnig oder seid Ihr es? Was wollt Ihr von ihm?«
»Ich will mich ihm stellen.«
»Mr. Balfour«, schrie der Advokat, »wollt Ihr Euern Scherz mit mir treiben?«
»Nein, Sir«, erwiderte ich, »obwohl mir scheint, daß Ihr mich eben nicht ganz ernst genommen habt. Seid Euch ein für allemal klar darüber, daß mir in dieser Sache nicht nach Scherzen zumute ist.«
»Mir auch nicht«, entgegnete Stuart. »Seid Ihr Euch denn gewiß, daß mir Euer Verhalten immer weniger gefallen will? Ihr kommt hier hereinspaziert und macht mir allerlei Vorschläge, die mich zu sehr unerwünschten Handlungen veranlassen und die mich künftig notwendigerweise mit Personen in Berührung bringen werden, die ich mir weit lieber vom Leibe halten würde. Und nach alledem sagt Ihr mir rundheraus, daß Ihr von hier stehenden Fußes zum Lord-Staatsanwalt Prestongrange gehen wollt, um Euch mit ihm zu verständigen. Gut und schön, Ihr habt Euch bei mir durch Alans Knopf ausgewiesen, aber Alan in eigener Person könnte mich nicht dazu bringen, mich noch tiefer in die Sache einzulassen.«
»Versucht es weniger leidenschaftlich zu sehen, Sir. Vielleicht wird sich das, woran Ihr Anstoß nehmt, vermeiden lassen. Ich sehe zwar keine andere Möglichkeit , als mich dem Lord-Staatsanwalt zu stellen, aber es könnte ja sein, daß Ihr etwas Besseres wißt. Wenn es so wäre, dann leugne ich nicht, daß mir eine schwere Last von den Schultern genommen würde. Auch ich fürchte, mein Zusammentreffen mit dem Lord-Staatsanwalt könnte böse Folgen für mich haben. Aber eines bleibt unerschütterlich bestehen: Ich muß meine Zeugenaussage anbringen, denn damit hoffe ich, Alans Ruf, soweit das noch möglich ist, zu retten und, was wichtiger ist, James Stuart vor dem Galgen zu bewahren.«
Nachdem ich geendet hatte, schwieg der Advokat lange Zeit, dann sagte er: »Guter Freund, Ihr werdet diese Zeugenaussage nie im Leben machen dürfen.«
»Das bleibt abzuwarten«, entgegnete ich. »Wenn ich etwas will, kann ich sehr hartnäckig sein.«
»Ein Esel seid Ihr, ein ganz großer Esel!« schrie Mr. Stuart. »Diese Leute wollen doch James’ Kopf haben! James muß baumeln und Alan, wenn sie ihn kriegen können, auch, aber James auf jeden Fall. Geht nur ruhig mit solchen Absichten zu Prestongrange, und Ihr werdet erleben, daß er Mittel und Wege finden wird, um Euch das Maul zu stopfen.«
»Ich denke besser von dem Lord-Staatsanwalt«, erwiderte ich.
»Ach, zum Teufel mit dem Lord-Staatsanwalt, hier geht gar nicht um ihn, sondern um den Willen der Campbells, guter Freund. Ihr werdet bald das ganze Gesindel auf dem Halse haben, und Prestongrange wird es genauso ergehen, dem armen Kerl. Es ist erstaunlich, daß Ihr nicht einsehen könnt, worum es sich hier tatsächlich handelt! Wenn es kein anständiges und rechtliches Mittel gibt, Euch zum Schweigen zu bringen, nun, dann wird man verwerfliche Methoden anwenden. Wißt Ihr, daß sie Euch auf die Anklagebank bringen können? Begreift Ihr das nicht?«
Er hatte es förmlich herausgeschrien und gab mir dabei einen Rippenstoß.
»Freilich begreife ich das«, erwiderte ich, »genau das gleiche hat mir heute morgen schon ein anderer gesagt.«
»Und wer war das, wenn ich fragen darf? Es muß ein vernünftiger Mann gewesen sein.«
»Seinen Namen möchte ich lieber nicht nennen«, sagte ich. »Er ist ein aufrechter Anhänger der Whigpartei, und ich will nicht, daß er in diese Sache hineingezogen wird.«
»Mir will scheinen, alle Welt befaßt sich schon damit. Und was habt Ihr ihm geantwortet?«
Nun erzählte ich, was sich an diesem Morgen vor dem Hause der Shaws zwischen Mr. Rankeillor und mir zugetragen und was wir besprochen hatten.
Mr. Stuart schwieg eine Weile, dann sagte er: »Soll ich den Propheten spielen und Euch sagen, was Euch blüht, wenn Ihr nur auf Eurem närrischen Eigensinn beharrt? Ihr werdet neben James Stuart am Galgen baumeln.«
»Das wollen wir nicht hoffen, Sir. Aber daß die Sache gefährlich ist, will ich nicht bestreiten.«
»Gefährlich ...«, wiederholte er und verstummte wieder; dann begann er von neuem: »Ich müßte Euch dankbar sein, daß Ihr so treulich zu meinen Freunden steht. Wenn Ihr nur genug Mut und Kraft aufbringt standzuhalten. Ich warne Euch allen Ernstes, junger Freund, Ihr spielt ein gewagtes Spiel. Obwohl ich ein Stuart bin – so möchte ich doch nicht an Eurer Stelle sein, auch wenn es gälte, alle Stuarts zu retten, die es je gegeben hat. Nun, gefährlich ist auch alles, was ich tue – mehr als gefährlich. Aber sich vorzustellen, daß Ihr es kalten Blutes darauf anlegt, vor ein Gericht gebracht zu werden, dessen Geschworene samt und sonders Campbells sind, von einem Richter verurteilt zu werden, der Campbell heißt, und das in einem Lande, in dem die Campbells herrschen – denkt von mir, was Ihr wollt, Mr. Balfour, aber das geht über meinen Verstand.«
»Unsere Anschauungsweise ist eben verschieden, Sir«, entgegnete ich. »Mein Vater hat mich in dieser Denkart erzogen, und er handelte ebenso.«
»Ehre seinem Andenken. Er hat einen Sohn hinterlassen, der dem Namen Balfour keine Schande macht. Dennoch dürft Ihr mich nicht allzu hart verurteilen. Ich bin in einer besonders schwierigen Lage. Seht, Mr. Balfour, Ihr nennt Euch einen Whig-Anhänger. Nun, ich möchte wahrhaftig wissen, zu welcher Partei ich gehöre. Ein Whig bin ich bestimmt nicht, aber laßt es Euch ganz heimlich zuflüstern, von der anderen Seite, von den Tories, halte ich auch nicht viel.«
»Ist das tatsächlich so?« rief ich. »Von einem klugen Manne, wie Ihr es seid, habe ich eigentlich auch nichts anderes erwartet.«
»Pscht, keine Schmeicheleien«, unterbrach mich Mr. Stuart. »Wenn vom Klugsein die Rede ist, möchte ich Euch nicht ausnehmen. Ich habe übrigens gar nicht die Absicht, König Georg etwas zuleide zu tun – und was König Jakob, den Kronprätendenten, anbelangt, so möge Gott ihn segnen. Doch er soll meinethalben lieber jenseits des Kanals bleiben. Ich bin Advokat, junger Freund, ich liebe meinen Beruf, ich liebe aber auch meine Bücher und gelegentlich eine gute Flasche Wein, eine gelungene Verteidigung, einen schwierigen Schriftsatz, ein Streitgespräch mit Kollegen von der Jurisprudenz und vielleicht am Samstagabend eine Partie Golf zur Entspannung. Für den Kilt der Hochländer und für ihre breiten Schwerter habe ich allerdings nicht allzu viel übrig; sie passen nicht so ganz zu meiner Lebensweise.«
»Da habt Ihr recht«, meinte ich, »vom wilden Hochländer ist Euch wirklich nicht viel anzumerken.«
»Nicht viel? Nicht das geringste, guter Freund. Und doch bin ich ein gebürtiger Hochländer; sobald ich den Dudelsack höre, fangen meine Füße von selber zu tanzen an. Der Clan und der Name geben den Ausschlag. Auch für mich trifft das zu, was Ihr vorhin gesagt habt, Euer Vater hat Euch so erzogen. Helfe sich, wer kann! Ich sitze nun einmal in der Patsche. Überall Verrat. Überall Verräter. Sie müssen aus dem Lande hinausgeschmuggelt werden. Und dann die Rekruten für Frankreich – eine leidige Sache; die müssen auch hinausgebracht werden. Prozesse und Scherereien gibt es deswegen in einem fort. Für den jungen Ardshiel mußte ich jüngst einen solchen Prozeß führen; er klagte auf Rückgabe seines beschlagnahmten Grundbesitzes – ein Heiratskontrakt lag vor. Sosehr ich den Ardshiels auch zugeredet habe, den sinnlosen Rechtshandel aufzugeben, sie wollten nicht auf mich hören. Nun kämpfe ich mit dem Gegenadvokaten, der die ganze Affäre ebenso verabscheut wie ich, denn sie schadet unserem Ruf. Sie scheren sich nicht darum. Was soll ich machen? Ich bin ein Stuart und muß meinen Clan, meine Sippe verteidigen. Gestern erst ist wieder ein Stuart ins Burgverlies gekommen. Weswegen? Oh, ich weiß schon, Vergehen gegen das Gesetz von 1736, Rekrutierung für König Ludwig von Frankreich! Natürlich wird er mich als Verteidiger haben wollen. Er pfeift, und ich muß springen, und schon wieder habe ich einen Fleck auf meiner Weste. Ich sage Euch ehrlich, Mr. Balfour, wenn ich auch nur ein Wort Hebräisch könnte, heute noch schmisse ich die ganze Juristerei hin, sattelte um und würde Geistlicher.«
»Ihr seid wirklich in einer bedrängten Lage«, sagte ich.
»Verdammt bedrängt ist sie«, rief er, »und deswegen macht Euer mutiges Vorgehen auch solchen Eindruck auf mich. Ihr, der Ihr kein Stuart seid, steckt Eure Nase so tief in die Angelegenheiten der Stuarts; das verdient meine Achtung. Weshalb Ihr das tut, ist mir rätselhaft. Aus Pflichtgefühl?«
»Ich hoffe, daß es das ist«, sagte ich.
»Schön, ein prächtiger Zug. Aber seht, da kommt mein Schreiber zurück. Jetzt wollen wir alle drei erst einmal gehen und einen Happen essen. Sobald wir unseren Hunger gestillt haben, will ich Euch die Adresse eines rechtschaffenen Mannes geben, bei dem Ihr wohnen könnt. Aber erst laßt Euch die Taschen füllen – aus Eurem eigenen Geldbeutel notabene. Unsere Angelegenheit wird längst nicht so kostspielig werden, wie Ihr vielleicht angenommen habt, auch Alans Überfahrt nicht.«
Ich gab ihm durch ein Zeichen zu verstehen, daß der Schreiber uns hören könne. Er lachte.
»Pah, wegen Robbie macht Euch keine Sorgen«, rief er, »der ist auch ein Stuart und hat mehr Rekruten für Frankreich aus dem Lande geschmuggelt und mehr Papisten in Sicherheit gebracht, als er Haare auf dem Kopfe hat. Robbie besorgt diesen Teil meiner Aufträge ganz allein. – Wer kommt für eine Überfahrt in Frage, Robbie?« rief er dem Schreiber zu.
»Vielleicht Andie Scougal mit dem Segler ›Thistle‹«, erwiderte der Gefragte. »Kürzlich habe ich mit Hoseason gesprochen, aber der hat, wie es scheint, noch kein neues Schiff, und dann wäre da noch Tam Stabo – doch dem traue ich nicht so recht. Ich habe ihn neulich in anrüchiger Gesellschaft getroffen. Falls es sich bei dieser Überfahrt um einen wichtigen Mann handelt, kommt Tam keinesfalls in Frage.«
»Der Mann ist seine tausend Pfund wert, Robbie«, rief der Advokat.
»Doch nicht etwa Alan Breck?« fragte der Schreiber.
»Genau der«, sagte Mr. Stuart.
»Den Teufel auch, das ist ernst. Dann versuchen wir’s am besten mit Andie; er wird der Richtige sein.«
»Die Sache scheint doch etwas schwierig«, meinte ich.
»Ach, Mr. Balfour«, klagte der Advokat, »so ergeht es uns dauernd.«
»Euer Schreiber hat da vorhin einen Namen genannt, den Namen Hoseason. Ich kenne den Kapitän von der Brigg ›Covenant‹ her. Schenkt Ihr diesem Mann Euer Vertrauen?«
»Ich weiß, er hat sich Euch und Alan gegenüber nicht schön benommen«, erwiderte der Advokat, »doch wir kennen ihn von einer anderen Seite. Hätte Alan damals an Bord sogleich eine feste Abmachung mit ihm getroffen, Hoseason wäre bestimmt bei der Stange geblieben. Ich hege kein Mißtrauen gegen ihn, ja, ich würde ihm sogar Ardshiel in Person bedenkenlos anvertrauen.«
III. Der Weg nach Pilrig
Kaum war ich am nächsten Morgen in meiner neuen Wohnung erwacht, da sprang ich auch schon aus dem Bett, schlüpfte in meine gestern erstandenen Kleider und brach, sobald ich das Frühstück verzehrt hatte, zu weiteren Abenteuern auf. Für Alan war, wie ich zuversichtlich hoffte, vorgesorgt. Mit James mochte sich die Sache schon schwieriger gestalten, und ich wurde den Gedanken, wie gefährlich diese Angelegenheit für mich enden konnte, nicht los. Übrigens dachten alle die genauso, denen ich mich anvertraut hatte.
Anscheinend war ich nur auf dem Gipfel meines Glücks angelangt, um in einen Abgrund zu stürzen. Mühsam hatte ich einen steilen Berg erklommen, hatte zahllose schwere Prüfungen glücklich bestanden, hatte Reichtum und Ansehen erworben, hatte mir feine städtische Kleider zugelegt und einen Degen umgeschnallt, und nun, nachdem ich das alles erreicht hatte, war ich im Begriff, ganz einfach Selbstmord zu begehen, und hatte mir dazu die schlimmste Todesart ausgesucht, denn ich legte es ja darauf an, auf Kosten der britischen Krone an den Galgen zu kommen.
Während ich in nördlicher Richtung die Hohe Straße entlang an Lyth-Wind vorüberwanderte, fragte ich mich immer wieder, was mich eigentlich veranlaßte, ein solches Wagnis einzugehen. Nun ja, ich wollte James Stuart retten. Gewiß spielte dabei die Erinnerung an die Verzweiflung des Hochländers und an die Tränen seiner unglücklichen Frau eine wesentliche Rolle, nicht weniger aber das Bewußtsein, ihnen damals ein Versprechen gegeben zu haben. Das alles beeinflußte meinen Entschluß. Zwar sagte ich mir immer wieder, daß es mir doch ganz gleichgültig sein könnte oder sein sollte, ob James Stuart in seinem Bett eines natürlichen Todes starb oder eines gewaltsamen am Galgen. Zugegeben, er war Alans Verwandter, aber gerade was Alan anbelangte, wäre es das beste gewesen, mich ruhig zu verhalten und keineswegs aufzufallen und es Seiner Britischen Majestät dem König, Seiner Hoheit dem Herzog von Argyle und nicht zuletzt den Aasgeiern dieses Clans zu überlassen, das Fleisch vom Gerippe des unseligen Hochländers zu picken, wann und wie es der erlauchten Gesellschaft beliebte. Auch konnte ich nicht ganz vergessen, daß James damals; als wir alle noch im gleichen Boot saßen, weder mit Alan noch mit mir besonderes Mitleid gehabt hatte. War er es nicht gewesen, der eilfertig einen Steckbrief gegen uns erlassen hatte, um die Aufmerksamkeit der britischen Verwaltung auf uns und von sich abzulenken?
Dann aber redete ich mir ein, es sei mir ja nur um Recht und Gesetz zu tun. Dieser Gedanke gefiel mir, und ich verweilte dabei, denn da wir in politisches Fahrwasser geraten waren – keiner der Beteiligten fühlte sich recht wohl dabei –, war es doch das wichtigste, daß es bei dieser Sache gerecht zuging, und der Tod eines unschuldigen Menschen würde der Gesellschaft eine schwärende Wunde beibringen. Schließlich aber warnte mich mein christliches Gewissen. Wie kam ich eigentlich dazu, mich in so hochpolitische Angelegenheiten zu mischen? Glich ich nicht einem verächtlichen Narren, der, weil er Rankeillor und James Stuart gegenüber geprahlt hatte, jetzt glaubte zu seinem Wort stehen zu müssen? War ich nicht im Begriff, feige und schlau zugleich, ein geringfügiges Wagnis auf mich zu nehmen, um mir dadurch größere Sicherheit zu erkaufen? Ja, zweifellos war es so; denn konnte ich nicht jederzeit Mungo Campbell oder jenem Gerichtsbeamten begegnen, die bei Colin Roys Tod im Walde von Lettermore Zeugen gewesen waren? Konnten sie mich nicht leicht wiedererkennen und mich mit dem Appin-Mord in Verbindung bringen? War es da nicht klüger, wenn ich mich freiwillig stellte und meine Unschuld bewies? Wenn es mir gelänge, meine Widersacher von der Wahrheit zu überzeugen und meine Aussage erfolgreich anzubringen, würde ich dann nicht erleichtert aufatmen können? Diese Überlegungen hatten gewiß nichts Beschämendes. Im übrigen standen mir zwei Wege offen, die beide zu dem gleichen Ziel führten. Es wäre Unrecht gewesen, zu gestatten, daß James an den Galgen käme, wenn ich ihn retten konnte. Da ich den Mund so voll genommen hatte, würde ich mich, wenn ich jetzt schwiege, nur lächerlich machen. Für James of the Glens war es also nur günstig, daß ich so geprahlt hatte, und für mich war es das beste, mich zu stellen. Es blieb mir gar nichts anderes übrig; als so zu handeln. Ich führte jetzt den Titel eines Standesherrn und verfügte über das entsprechende Vermögen; wie armselig wäre es, wenn ich nun im wesentlichen versagen wollte.
Ich hatte also, wie es mir schien, ganz unchristliche Gedanken gehabt und sprach insgeheim reuevoll ein kurzes Gebet; ich bat um den Mut und die Kraft, meine Pflicht so treu und brav erfüllen zu können wie ein Soldat auf dem Schlachtfeld, hoffte aber im stillen, ebenso wie mancher Soldat; daß nicht jede Kugel treffen und ich unbeschadet aus diesem Kampf hervorgehen würde.
Während ich mir das alles überlegte, kam ich zu einer ruhigeren Auffassung; aber mein Entschluß festigte sich. Ich verhehlte mir jedoch keineswegs, wie böse die Sache für mich ausgehen, ja, wie leicht ich dennoch die Stufen zum Galgen hinaufstolpern konnte.
Obwohl der Wind aus Osten kam und mich vor Kälte erschauern ließ, war es ein schöner Tag. Die Blätter gilbten bereits, und unwillkürlich gedachte ich der Toten in ihren Gräbern. Es müßte doch mit dem Teufel zugehen, wenn ich, eben auf dem Gipfel meines Glückes angelangt, so frühzeitig den Tod finden sollte, noch dazu wegen der Schuld eines anderen.
Als ich den Kamm des Calton-Hügels erreicht hatte, erblickte ich ein paar Kinder, die lachend und jubelnd ihre Papierdrachen fliegen ließen – eigentlich war es noch nicht die rechte Jahreszeit für dieses Spiel. Deutlich hoben sich die bunten Drachen vom hellen Himmel ab, und ich beobachtete, wie der größte und schönste emporgetragen wurde, weit, weit hinauf, und dann in der Tiefe in das Gestrüpp hineinstürzte. Es kam mir vor wie ein Gleichnis. Davie, dachte ich, Davie, mein Junge, der Papierdrachen da oben, das bist du!
Der Weg nach Pilrig führte über den Mouters-Hügel, durch einen Weiler und an einem Berghang entlang, durch Felder und Wiesen. In den ärmlichen Katen knarrten Webstühle, in den Gärten summten Bienen. Die Leute, die auf ihren Türschwellen standen, plauderten in einer mir unverständlichen fremden Mundart miteinander. Später habe ich erfahren, daß dieser Flecken »Picardy« heißt und daß sich französische Weber, die für die Britische Leinen-Kompagnie werkten, dort angesiedelt hatten.
Ich fragte einen der Männer, wie ich wohl von hier nach Pilrig käme. Er gab mir freundlich Bescheid. Kurze Zeit darauf gelangte ich zu einem Galgen, an dem die Leiche zweier Männer in Ketten schaukelten. Man hatte sie, wie es Brauch war, in Teer getaucht. Nun wurden sie vom Wind gespenstisch hin und her gewiegt, und ihre Ketten klirrten. Vögel umschwärmten kreischend die unheimlichen Hampelmänner.
Der Schrecken fuhr mir in die Glieder. War es nicht wie ein böses Vorzeichen, als sollten meine schlimmsten Angstträume Wirklichkeit werden? Von Grauen geschüttelt und wie gebannt starrte ich auf die Toten. Ein um das andere Mal schlich ich um den Galgen herum, und dabei stieß ich auf ein häßliches altes Weib, das, an einen der Balken gelehnt, dem Kopf wackelte und wirres Zeug vor sich hin brabbelte. »Wer sind diese Toten, Mütterchen?« fragte ich.
»Dein hübsches Lärvchen sei gepriesen«, schrie die Alte mit schriller Stimme und im breitesten Schottisch, »die beiden waren meine Liebsten, du Goldjunge.«
»Und weshalb sind sie an den Galgen gekommen?« fragte ich.
»Für nichts und wieder nichts, Söhnchen«, rief das alte Weib. »Ich hab’s ihnen vorhergesagt, wie’s enden würde. Um zwei schottische Shillinge ging’s; einem Kind aus Broughton hatten sie das Geld gestohlen. Dafür wurden sie aufgeknüpft.«
»Ach«, sagte ich mehr zu mir selbst als zu der verrückten alten Hexe, »wegen so einer Kleinigkeit müssen sie baumeln! Sie haben ihre Unredlichkeit wahrlich schwer gebüßt.«
Die Alte war indessen dichter an mich herangekrochen. »Zeig deine Hand her, Goldjunge«, schmeichelte sie, »laß dir von mir sagen, was die Zukunft bringt.«
»So neugierig bin ich nicht, Mütterchen«, erwiderte ich. »Es ist gar schlecht, allzuviel von der Zukunft zu wissen.«
Aber das alte Weib ließ nicht locker.
»Ich les es Euch von der Stirn ab«, brabbelte sie, »ein hübsches Mädchen mit hellen Augen wartet auf Euch ... da ist noch ein kleiner Mann ... er trägt einen weiten Mantel ... und dann seh ich noch einen langen Kerl, in weiß-bepuderter Perücke ... ach, und weit hinten ... einen Galgen ... Sein Schatten fällt quer über Euren Weg. Gebt mir Eure Hand, Söhnchen, Mutter Merren wird Euch nur Gutes weissagen ...«
Ich stutzte. War das ein Zufall? Konnte sie mit ihrem wirren Geschwätz Alan und die Tochter von James More gemeint haben? Ich war so betroffen, daß ich nur den einen Gedanken hatte zu fliehen, dieser unheimlichen Vettel zu entrinnen. Hastig warf ich ihr eine Münze in den Schoß und lief wie von Furien gehetzt davon. Als ich mich nach längerer Zeit verstohlen umsah, hockte die Alte noch immer unter dem Galgen. Ich sah, wie sie im schwankenden Schatten der beiden Gehenkten mit der Silbermünze spielte.
Ohne diese schauerliche Begegnung hätte ich sicher mehr Freude an meinem Spaziergang gehabt. Zwischen Feldern, die sauber und mit großem Fleiß bestellt waren, zog sich eine alte, halbverfallene Burgmauer hin. Es war angenehm, durch die freie Natur zu wandern, nur wollte mir das Klirren der Ketten nicht aus dem Sinn und dazu das verworrene Geschwätz der Alten. Meine Gedanken kehrten wider Willen zu den beiden armen Teufeln zurück, die, vielleicht von arger Not getrieben, gestohlen hatten und dafür jetzt baumeln mußten.
Wegen zweier armseliger Shillinge an den Galgen zu kommen, erschien mir schlimm genug. Aber war es etwa besser, wenn, wie Mr. Stuart sich ausgedrückt hatte, »das Pflichtgefühl eines Narren« dazu führen konnte? War so ein armer Kerl erst geteert und hing in seinen Ketten, dann mochte es ihm wohl gleichgültig sein, wieso es dazu gekommen war.
Konnte es nicht auch geschehen, daß ich, David Balfour, am Galgen hinge und junge Burschen vorbeikämen und flüchtig hinschauten, daß alte Weiber am Fuße des Galgens hockten und den Burschen weissagen wollten und hübsche Dirnen sich angewidert die Nasen zuhielten? Ich konnte sie mir gut vorstellen, die schmucken jungen Dinger – sie hatten helle graue Augen, und ihr Kopfputz leuchtete in den Familienfarben der Drummonds.
Ich war sehr niedergeschlagen, blieb aber unbeirrt bei meinem Entschluß, mich der Obrigkeit zu stellen. Erleichtert war ich erst, als ich bald darauf das Herrenhaus von Pilrig erblickte, ein freundliches Gebäude,
das mit seinem hellen Putz und den vielen Giebeln und Erkern unweit der Landstraße zwischen jungen aufstrebenden Baumgruppen hervorleuchtete.
Vor der Haustür stand ein gesatteltes Reitpferd, doch der Hausherr war noch in seinem Arbeitszimmer, in dem er mich, umgeben von gelehrten Büchern und allerlei Musikinstrumenten, freundlich empfing; der Laird von Pilrig war nicht nur ein feingebildeter Philosoph, sondern auch ein guter Musiker.
Er begrüßte mich sehr zuvorkommend, und nachdem er Mr. Rankeillors Empfehlungsschreiben gelesen hatte, Schien er gern bereit, mir weiterzuhelfen.
»Was ist Euer Begehr, Vetter David?« fragte er, »denn es scheint ja, daß wir zur gleichen Sippe gehören. Was kann ich für Euch tun? Ihr braucht ein paar einführende Zeilen an Prestongrange! Nichts leichter als das. Was soll ich ihm schreiben?«
»Ich könnte Euch meine ganze Geschichte sehr ausführlich erzählen, Mr. Balfour, aber Mr. Rankeillor meinte, Ihr würdet wenig Gefallen daran finden.«
»Es tut mir leid, so etwas von Euch zu hören«, sagte der Laird betroffen.
»So arg ist es nun wieder nicht«, wandte ich ein. »Ich habe nichts getan, dessen ich mich zu schämen brauchte oder wofür Ihr mich tadeln müßtet. Schlimmstenfalls handelt es sich um die übliche menschliche Schwäche, die Folge von Adams Sündenfall, wenn Ihr wollt – und um einen Mangel an Rechtlichkeit und die Verderbtheit der Natur. Das alles will ich zugeben. Man hat mich frühzeitig gelehrt, dort um Beistand zu bitten, wo er gewiß zu finden ist.«
Ich sagte das, nachdem ich mir Mr. Balfour of Pilrig sehr genau angesehen hatte. Gewiß war es richtig, wenn er gleich merkte, daß ich meinen Katechismus auswendig wußte. Dann fuhr ich fort: »Etwas Ehrenrühriges habe ich mir nicht vorzuwerfen, Sir. Ich bin eigentlich gegen meinen Willen und ohne mein Zutun in Schwierigkeiten geraten, und es ist mein Pech, daß ich damit in eine politische Angelegenheit verwickelt wurde. Mr. Rankeillor meinte, ich sollte Euch nicht damit beschweren.«
»Genug davon, Vetter David. Wie ich zu meiner Freude sehe und wie Mr. Rankeillor in seinem Schreiben bestätigt, verdient Ihr meine Hilfe. Was Ihr da von politischen Verwicklungen erzählt, so hat Euch Mr. Rankeillor gut beraten. Ich möchte lieber nicht allzuviel davon hören, denn ich bin bemüht, mir solche Dinge fernzuhalten und selbst den Verdacht einer politischen Betätigung zu vermeiden. Die Frage ist nur, wie soll ich Euch beistehen, wenn ich von diesen Dingen nichts weiß.«
»Nun Sir, ich möchte vorschlagen, Ihr schreibt an Seine Lordschaft, ich sei ein junger Mann aus guter Familie und nicht ohne Vermögen, was beides stimmen dürfte.«
»Dafür bürgen mir Mr. Rankeillors Zeilen«, versetzte der Laird, »und mir genügt diese Bürgschaft.«
»Hinzufügen könntet Ihr noch«, fuhr ich fort, »daß ich kirchlich gesinnt und ein treuer Untertan König Georgs bin, falls Euch meine eigene Zusicherung ausreicht. Ich wurde in diesem Geist erzogen.«
»Was Eurer Sache keineswegs schaden dürfte«, warf Mr. Balfour ein.
»Ferner könntet Ihr Seiner Lordschaft mitteilen, daß ich ihn in einer sehr dringlichen Angelegenheit sprechen möchte – in einer Sache, die Seiner Majestät dem König nützlich sein und der gerechten Verwaltung dieses Landes zugute kommen könnte.«
»Da ich von dieser Sache nichts wissen darf«, wandte Mr. Balfour ein, »kann ich mir nicht erlauben, ein Urteil über ihren Zweck und Nutzen abzugeben, und kann sie also auch nicht als sehr dringlich bezeichnen. Im übrigen kann ich in Euerem Sinn an Prestongrange schreiben.«
»Noch eines, Sir«, sagte ich und griff mir dabei unwillkürlich an den Hals, »es wäre gut, wenn Ihr ein Wort einflechten könntet, das meine Sicherheit verbürgt.«
»Sicherheit!« wiederholte er. »Eure Sicherheit? Das ist ein Ausdruck, der mir nicht gefallen will. Wieso ist Eure Sicherheit bedroht? Wenn die Sache so gefährlich ist, möchte ich lieber nichts damit zu tun haben – vor allem nicht blindlings hineintappen.«
»Ich glaube, ich könnte Euch mit zwei Worten auf die richtige Spur bringen«, sagte ich.
»Das wäre wohl das beste«, meinte er.
»Es geht bei dieser Sache um den Appin-Mord.«
Mr. Balfour hob abwehrend beide Hände. »Gütiger Himmel!« rief er und sah erschrocken aus; seine Stimme klang so ablehnend, daß ich fürchtete, seinen Beistand verloren zu haben.
»Laßt Euch erklären ...«, bat ich.
»Danke bestens, ich will nichts mehr davon wissen«, wehrte er ab. »Ich weigere mich entschieden, auch nur ein weiteres Wort anzuhören. Aber da Ihr den Namen Balfour tragt und Mr. Rankeillor Euch mir so warm empfohlen hat, will ich dennoch sehen, was ich tun kann, um Euch behilflich zu sein. Doch ich halte es für meine vornehmste Pflicht, Euch zu warnen. Ihr treibt ein gewagtes Spiel, Mr. David, und Ihr seid noch sehr jung. Überlegt Euch zweimal, was Ihr da tun wollt, und seid vorsichtig.«
»Ihr dürft getrost annehmen, Sir, daß ich mir diese Sache mehr als zweimal überlegt habe«, erwiderte ich. »Laßt Eure Aufmerksamkeit nochmals auf Mr. Rankeillors Empfehlungsbrief lenken. Gewiß hat er Euch geschrieben, daß er meinen Entschluß billigt.«
»Gut, gut«, sagte Mr. Balfour, und dann nochmals: »Gut, gut! Ich will für Euch tun, was ich kann.«
Nachdem er das gesagt hatte, nahm er Papier und Feder zur Hand, überlegte eine ganze Weile und begann dann zu schreiben, wobei er immer wieder innehielt und nachsann. Einmal blickte er auf und fragte: »Mr. Rankeillor billigt also, Was Ihr vorhabt?«
»Ja, nach anfänglichem Zögern und nachdem wir uns ausgesprochen haben, hat er mir gesagt, ich solle in Gottes Namen an diese Sache herangehen.«
»Das ist wohl auch der rechte Geist, um so etwas zu unternehmen«, sagte mein Verwandter und begann wieder zu schreiben. Er unterzeichnete den Brief und las ihn dann noch einmal sorgfältig durch. Von neuem wandte er sich mir zu.
»Hier habt Ihr Euer Empfehlungsschreiben, Mr. David. Ich werde mein Siegel daruntersetzen und es Euch, wie es sich gebührt, unverschlossen übergeben. Da ich in dieser Sache nicht klar sehe, möchte ich Euch aber vorlesen, was ich geschrieben habe; dann mögt Ihr sehen, ob es geeignet ist, Euch weiterzuhelfen.«
Und er las:
Pilrig, am 26. August 1751
Mylord,
diesen Zeilen möchte ich Euch meinen Vetter, Mr. Balfour, Herrn auf Shaw, vorstellen, einen jungen Mann von bester Herkunft und bedeutendem Vermögen. Überdies hat er den wichtigen Vorzug, eine gottesfürchtige Erziehung genossen zu haben, und seine politische Meinung entspricht durchaus dem, was Eure Lordschaft wünschen und begrüßen werden. Die Angelegenheit, in der Mr. Balfour Eure Lordschaft sprechen möchte, ist mir nicht bekannt, doch nach seinen eigenen Worten will er damit der Sache des Königs und einer gerechten Verwaltung dieses Landes dienen – eine Aufgabe also, der Eure Lordschaft, wie man allgemein weiß, Zeit und Kraft widmet. Darf ich noch hinzufügen, daß der Schritt des jungen Mannes seinen Freunden, achtbaren Männern in diesem Lande, bekannt ist und von ihnen gebilligt wird und daß sie Erfolg oder Mißerfolg seines Unternehmens mit Zuversicht, aber nicht ohne Sorge verfolgen.
Der Laird ließ das Schreiben sinken und fuhr nach einer Pause fort: »Es folgen nun noch die üblichen höflichen Schlußworte, und es dürfte Euch aufgefallen sein, daß ich ›seine Freunde‹ erwähnte – also mehrere ... Ich hoffe, daß die Mehrzahl gerechtfertigt ist.«
»Völlig, Sir«, erwiderte ich. »Tatsächlich habe ich meinen Plan mehr als einer Person anvertraut, und Euer Schreiben, für das ich Euch von Herzen dankbar bin, übertrifft bei weitem das, was ich zu hoffen wagte.«
»Mehr konnte ich auch wirklich nicht für Euch tun, junger Freund«, bemerkte der Laird, »und nach dem wenigen, was ich von der Angelegenheit weiß, in die Ihr Euch da einmischen wollt, kann ich nur wünschen und hoffen, daß meine Empfehlung Euch weiterhelfen wird.«
IV. Der Lord-Staatsanwalt





























