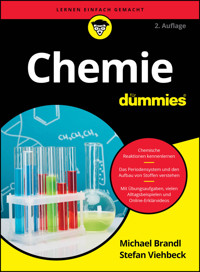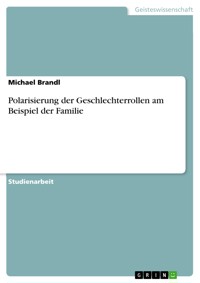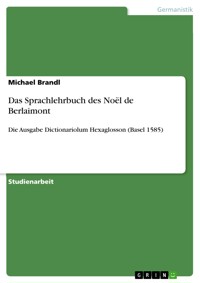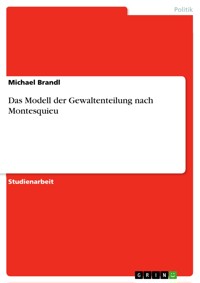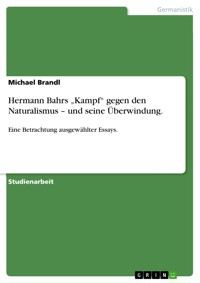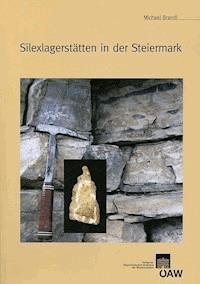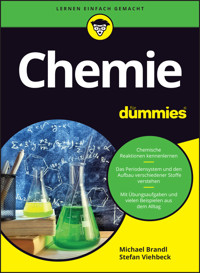
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH GmbH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: ...für Dummies
- Sprache: Deutsch
Die Grundlagen der Chemie einfach erklärt
In diesem Buch finden Sie alles, was Sie benötigen, um Chemie von Grund auf zu verstehen. Michael Brandl und Stefan Viehbeck erklären Ihnen leicht verständlich und mit vielen Beispielen aus dem Alltag die Grundlagen der Chemie: angefangen bei Aggregatzuständen und Atomen über Bindungen und chemische Reaktionen bis hin zu komplexeren Themen wie der organischen Chemie. Abbildungen und Formeln in Farbe erleichtern Ihnen das einfache Nachvollziehen von chemischen Vorgängen. Mithilfe von Versuchen und Aufgabenstellungen können Sie das Gelernte auch praktisch üben.
Sie erfahren
- Wie das Periodensystem der Elemente aufgebaut ist
- Welche chemischen Bindungen es zwischen Atomen gibt
- Was es mit Wechselwirkungen und Redoxreaktionen auf sich hat
- Warum sich in der organischen Chemie alles um ein Element dreht
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Chemie für Dummies
Schummelseite
PERIODENSYSTEM DER ELEMENTE
REAKTIONSGLEICHUNGEN AUFSTELLEN
Die Indizes dürfen beim Ausgleichen der Reaktionsgleichung nicht verändert werden, da man ansonsten die Moleküle verändert. Mit dem Koeffizienten wird ausschließlich die Anzahl der Teilchen verändert:
C4H10O + 6 O2 → 5 H2O + 4 CO2
BINDUNGSARTEN UND WECHSELWIRKUNGEN
Bindung
Metallbindung
Ionenbindung
Atombindung
Beteiligte Atome
Metallatome
Metall-Kationen und Nichtmetall-Anionen
Nichtmetall-Atome
Wechselwirkung
Dipol-Dipol-WW
H-Brücken
London-Dispersions-WW
Voraussetzungen
Polare oder unsymmetrische Moleküle
Durch Bindung mit N-, O- oder F-Atom stark polarisiertes H-Atom und mindestens ein freies Elektronenpaar an einem N-, O- oder F-Atom
Unpolare, symmetrische Moleküle
Quantitative Chemie
Die wichtigsten Formeln zur Berechnung der Stoffmenge:
Konstanten der Stöchiometrie:
Erweiterung um die Stoffmengenkonzentration:
BENENNUNG ORGANISCHER VERBINDUNGEN
(Falls eindeutig, können Ziffern ignoriert werden)
Priorität:
Carbonsäure > Aldehyd > Keton > Alkohol > Alken > Alkin > Alkan
Reihenfolge im Namen:
-en, -in, -ol, -on, -al, -säure
-ol, -on, -al, -säure nicht gemeinsam, als Substituent behandeln:
-ol als Hydroxy-; -on als Oxo-; -al als Formyl-
Alkane -an:
Längste C-Kette ist die Hauptkette.Alkyl-Seitenketten mit Endung -yl benennen.Seitenketten alphabetisch ordnen und bei mehreren gleichen Seitenketten Vorsilben (di, tri, tetra, …) verwenden.Verknüpfungsstellen zwischen Hauptkette und Seitenketten mit den zusammengenommen kleinstmöglichen Ziffern nummerieren. Dies gibt die Orientierung der Hauptkette vor.Hauptkette so wählen, dass möglichst keine verzweigten Seitenketten auftreten.Alkene -en und
Alkine -in:
Endung des Alkans -an entfällt und wird durch die Endung des Alkens -en oder Alkins -in ersetzt. Dabei muss davor die Positionsnummer der Mehrfachbindung angegeben werden.Orientierung der Hauptkette abhängig von möglichst kleinen Ziffern für die Mehrfachbindungen. Nur bei Gleichstand werden die Seitenketten dafür herangezogen.Mehrere identische Mehrfachbindungen müssen mit Vorsilben, wie die Seitenketten, benannt werden.Wenn mehr als eine Mehrfachbindung im Molekül vorkommt, wird das -a der Endung des Alkans nicht weggelassen. Beispiel: Hexa-2,4-dien.Die Hauptkette muss so gewählt werden, dass möglichst viele Mehrfachbindungen in ihr enthalten sind.Alkohol -ol:
Vollständiger Name der Hauptkette mit davorstehenden Seitenketten mit Endung -ol. Die Position der Hydroxy-Gruppe wird vor der Endung -ol angegeben.Die Ziffern der Hydroxy-Gruppen müssen möglichst klein sein.Mehrere Hydroxy-Gruppen müssen mit den Vorsilben, wie die Seitenketten, benannt werden.Aldehyde -al und Ketone -on und Carbonsäuren- säure:
Seitenketten + Alkan + Positionsziffer + EndungZiffern möglichst gering halten.Mehrere gleiche funktionelle Gruppen mit Vorsilben, wie Seitenketten, kennzeichnen. Aldehyde und Säuren maximal »di«.
Chemie für Dummies
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage 2024
© 2024 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße 12, 69469 Weinheim, Germany
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This translation published by arrangement with John Wiley and Sons, Inc.
Alle Rechte vorbehalten inklusive des Rechtes auf Reproduktion im Ganzen oder in Teilen und in jeglicher Form. Diese Übersetzung wird mit Genehmigung von John Wiley and Sons, Inc. publiziert.
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Coverfoto: © Davizro Photography — stock.adobe.comKorrektur: Petra Heubach-Erdmann
Print ISBN: 978-3-527-72054-5ePub ISBN: 978-3-527-84177-6
Über die Autoren
Gemeinsame Zeit der Autoren
Stefan Viehbeck und Michael Brandl trennte eine Jahrgangsstufe am Gymnasium Dingolfing, was sie jedoch nicht davon abhielt, eine enge Freundschaft aufzubauen, die sich während der gemeinsamen Studienzeit in Regensburg vertiefte. Durch den geringfügigen Altersunterschied besuchten die Freunde zwar keine gemeinsame Vorlesung, jedoch gab es viele Berührungspunkte, unter anderem durch das beiderseits gewählte Studienfach Chemie sowie durch die zahlreichen Treffen und dem Austausch in Mensen, Bibliotheken und an gemeinsamen Abenden. Einen nicht unerheblichen Anteil an Kontaktmöglichkeit bot ein gemeinsamer Freundeskreis und die daraus resultierenden diversen Feierlichkeiten, von denen die ein oder andere fröhliche Anekdote bei Treffen erinnert. Die Freundschaft der Autoren beruht zudem besonders auf sich ähnlich entwickelten Interessen, wie dem Lesen von Büchern aus diversen Genres, dem Ansehen bestimmter Serien und Filme, die Begeisterung für Technik oder auch das Basteln von Faschingskostümen im Superheldenstil. Das über eine so lange Zeitspanne gegenseitig aufgebaute tiefe Vertrauen prägt bis heute die Freundschaft nachhaltig. So entstand auch während der Corona-Zeit die Idee, neben ihren eigentlichen Berufen noch etwas Weiteres zu »erschaffen«. Letztlich haben sie sich dabei auf ein Gebiet spezialisiert, in dem sie sich bereits etwas besser auskannten, nämlich der Chemie. Daraus ist das Erstellen von Lern- und Lehrvideos und die Gestaltung einer dazugehörigen Website www.chemistryathome.de geworden. Diese Zusammenarbeit hat schließlich dazu geführt, dieses Buch zu schreiben.
Danksagung Stefan Viehbeck
Im Trubel des Alltags fällt es leicht, das Umfeld als gegeben zu nehmen, das nächste Ziel im Auge zu haben und nach vorne zu blicken. Dabei werden die wichtigen Dinge im Leben nicht wertgeschätzt und man vergisst einfach, einmal Danke zu sagen.
An dieser Stelle möchte ich den besonderen Menschen in meinem Leben meinen Dank aussprechen.
Beginnen werde ich bei meinen Eltern, Anna und Robert. Danke, dass ihr immer für mich da seid und in jeder Situation zu mir steht! Ich verdanke euch so viel und verpasse es viel zu oft, euch das zu sagen. Ihr seid wunderbare Eltern und ich hoffe, ich kann meinen Kindern dieselbe Führsorge, dieselbe Liebe und den gleichen Beistand bieten, wie ihr es bei mir getan habt. Vielen Dank dafür.
Der nächste Dank gilt meiner Frau Daniela. Vielen Dank, dass du mit deiner Gutmütigkeit, deiner Geduld und deinem Vertrauen in mich immer an meiner Seite bist und mir den Rücken freihältst. Du bist nicht nur eine großartige Ehefrau, sondern auch eine wunderbare Mutter. Danke, dass du in meinem Lebenbist.
Lieber Noah, lieber Finn, es fällt mir schwer, in Worte zu fassen, was ich für euch empfinde. Mein Herz geht auf, wenn ich an euch denke. Ich hätte mir nicht erträumen können, zwei so wunderbare und einzigartige Kinder zu haben wie euch. Jeder Tag mit euch ist ein Geschenk. Folgt eurem Instinkt, lebt euren Traum, macht, was ihr liebt, seid einfühlsam, seid respektvoll und vor allem seid einzigartig, es ist euer Leben. Danke, dass es euch gibt und ihr mein Leben bereichert.
Des Weiteren bin ich Neffe von zwei tollen Onkeln, Harald und Hans-Peter, und Enkel von liebevollen Großeltern Anna und Johann. Danke, dass ihr immer ein offenes Ohr für mich habt und stets zur Stelle seid, wenn ich Hilfe benötige.
Euch allen möchte ich meinen Dank aussprechen. Ihr seid meine Familie und die Menschen in meinem Leben, die ich von ganzem Herzen liebe!
Zu meinem beruflichen Werdegang.
Kleine Dinge können das Leben maßgeblich beeinflussen. So war es der Chemie-Unterricht bei Frau Karl in der Kollegstufe, der mein Interesse für die Chemie geweckt hat. Dabei möchte ich Ihnen, Frau Karl, meinen Dank aussprechen, da Sie eine großartige didaktische Art haben, komplexe Themen einfach zu erklären, anschauliche Beispiele zu geben und durch Exkursionen das Interesse an der Chemie zu vertiefen.
Einen weiteren maßgeblichen Einfluss hatte mein Doktorvater, Herr Prof. Matysik. Besten Dank für Ihren Einfluss während des Studiums und während meiner Doktorandenzeit. Sie haben mein Verständnis für die analytische Chemie geprägt und mich bestens auf meinen beruflichen Alltag vorbereitet.
Ebenfalls möchte ich mich bei meinen Kollegen und Kolleginnen an meinen bisherigen drei beruflichen Stationen bedanken. Ich durfte stetig mein Wissen erweitern, von euch lernen und konnte mich immer auf eure Unterstützung verlassen. VielenDank.
Danksagung Michael Brandl
Ich bin seit 2015 Lehrer für Biologie und Chemie an einem bayerischen Gymnasium.
Den Weg bis dahin haben mir vor allem meine Eltern, Gaby und Oskar, ermöglicht, die mich zu jeder Zeit in meinem Werdegang unterstützt haben und mir auch heute noch in allen möglichen Situationen und Fragen mit Rat und Hilfe zur Seite stehen. Ohne euch wäre ich nicht zu der Person herangewachsen, die ich heute bin, und hätte dann wahrscheinlich auch niemals dieses Buch mitgeschrieben. Worte können meine aufrichtige Dankbarkeit nicht in vollem Umfang zum Ausdruck bringen, dennoch vielen Dank dafür, dass ihr jederzeit für mich daseid.
Während der Arbeit am Buch hat mich vor allem meine Frau, Stefanie, unterstützt. So war sie zum Beispiel die erste Person, die überhaupt ein Kapitel von mir zu Gesicht bekommen hat. Ihr ehrliches Feedback dazu hat mich zwar manches Mal kalt erwischt, mich jedoch in meiner Arbeit bestärkt und ihr die Chemie etwas nähergebracht. Vielen Dank dafür, dass du immer für mich da bist, mir den Rücken während des Schreibens freigehalten hast und mir in jeder Lebenslage beistehst.
Die abschließenden familiären Danksagungen gehen an meine Schwester Alexandra, ihren Mann Christian und meine Nichte Emma, die sich immer Zeit für mich nehmen, wenn ich wieder einmal zu Hause vorbeischaue. Ich hoffe, dass vor allem dir, Emma, das Buch in naher Zukunft weiterhelfenkann.
Nun komme ich zu fachlichen Vorbildern, die mich vor allem im Hinblick auf die Entwicklung meiner Lehrerpersönlichkeit in meiner Anfangszeit begleiteten. Diese durfte ich am Ernst-Mach-Gymnasium Haar, östlich von München, ableisten.
Es war eine prägende Zeit, auf die ich gerne zurückblicke. Zum einen möchte ich mich hiermit bei allen meinen ehemaligen KollegInnen bedanken, zum anderen ist mir wichtig, hier auch einigen davon meinen besonderen Dank auszusprechen.
Eine besondere Rolle haben dabei die Mitglieder meiner Fachschaften Biologie und Chemie gespielt. Dies liegt vor allem an drei hervorragenden Biologie- und Chemielehrern und -lehrerinnen.
Da wäre zum einen Susanne zu nennen, meine ehemalige Fachschaftsleiterin für das Fach Biologie. Deiner Unterstützung und Hilfe konnte ich mir in jeder Situation gewiss sein. Danke, dass du für mich ein Vorbild in konstruktiver Zusammenarbeit warst.
Die zweite Fachschaftsleiterrolle wurde von Stefan in Chemie ausgefüllt. Ein begeisterter Experimentator, der schon den einen oder anderen Schüler mit einer plötzlichen Explosion oder einem Feuerlöscher-Einsatz wachgerüttelt hat. Danke, dass man sich bei fachlichen Fragen jederzeit an dich wenden konnte.
Beide haben sich gemeinsam für die Fächer Biologie und Chemie starkgemacht. Eine besonders positive Eigenschaft, der ich gerne nacheifere. Macht weiterso.
Der Dritte im Bunde, Ludwig, ehemaliger olympischer Fackelträger und so etwas wie ein Vorbildlehrer aus einer anderen Generation, ist ein Kollege, an dem ich mich sehr gerne orientiere. Viele deiner kleinen Weisheiten ermöglichen es mir, heutzutage meinen Unterricht zu halten und nicht alles allzu ernst zu nehmen, danke dafür und genieße deinen Ruhestand in vollen Zügen.
Neben den direkten Fachkollegen spielt auch die Schulleitung für die Entwicklung der Lehrkräfte eine wichtige Rolle. Diese wichtige Aufgabe hat in meiner Zeit in Haar Frau Gabriele Langner übernommen. Die Zusammenarbeit war zu jeder Zeit von gegenseitigem Vertrauen und höchster Professionalität geprägt. Meine Tätigkeit in Haar wird mir, vor allem auch aufgrund Ihrer Art und Weise, eine Schule zu leiten, immer sehr positiv in Erinnerung bleiben. Vielen Dank für Ihr Geschick der Schulorganisation.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Über die Autoren
Gemeinsame Zeit der Autoren
Danksagung Stefan Viehbeck
Danksagung Michael Brandl
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Über dieses Buch
Wie man dieses Buch benutzt
Voraussetzungen
Wie ist dieses Buch aufgebaut?
Icons, die in diesem Buch verwendet werden
Wie geht es von hier aus weiter?
Teil I: Grundlagen der Chemie
Kapitel 1: Wieso brauchen Sie Chemie?
Was ist Chemie?
Grenzen zu anderen Naturwissenschaften
Die vielen Gesichter der Chemie
Arbeiten mit Chemie
Kapitel 2: Die Welt der Teilchen
Klein, kleiner, am kleinsten – Zeig mir deine Teilchen!
Drei Aggregatzustände, um die Chemie zu verstehen
Aggregatzustandsänderung
Kein Stoff gleicht dem anderen – Reinstoffe
Es mische sich, was sich mischen lässt – unterschiedliche Stoffgemische im Teilchenmodell
Wo ist eigentlich die Chemie? – Physikalischer oder chemischer Vorgang
Sie atmen Chemie! – Bestandteile der Luft
Übungen
Kapitel 3: Der Grundbaustein – Das Atom
Aufbau eines Atoms
Die Symbolschreibweise
Besondere Atomarten
Übungen
Kapitel 4: Periodensystem der Elemente (PSE)
Das gekürzte Periodensystem oder die acht Hauptgruppen
Die Ionisierungsenergie (E
I
)
Tendenzen im PSE
Übersicht wichtiger Tendenzen im PSE
Übungen
Kapitel 5: Chemische Reaktionen
Sie sind kein Zauberer – Massenerhaltung
Das Kochrezept der Chemiker – Die chemische Reaktion
Schon wieder Aggregatzustände
Verschwunden – in wässriger Lösung
»Was bist du denn?« – Abgrenzung unterschiedlicher Stoffklassen
Abkürzungen machen das Leben einfacher – Die Formelschreibweise in der Reaktionsgleichung
Die Formelschreibweise bei Verbindungen aus unterschiedlichen Elementen – Die Summenformel
»Bauklotzchemie« – Reaktionsgleichungen aufstellen
»Die Meisterleistungen der Bauklotzchemie« – Komplexere Reaktionsgleichungen
»Ich habe einen Namen!« – Einfache binäre Verbindungen und deren Benennung
Unlimited Power – Das Konzept der Energie
»Manchmal braucht es eine Starthilfe« – Die Katalyse
Übungen
Teil II: Drei Arten, alle zu binden, und die Wechselwirkungen
Kapitel 6: Die Ionenbindung der Salze
Damit kochen wir also! – Die Ionenbindung
Salzbildung
Die Namen der Salze
Die Energie der Salzbildung
Die Eigenschaften der Salze
Übungen
Kapitel 7: Die Metallbindung – Ritterrüstungen und ihre Chemie
Wie sich Metalle binden
Eigenschaften der Metalle
Wichtige Legierungen
Übungen
Kapitel 8: Die Atombindung
Das Orbitalmodell
Die Valenzstrichformeln der Moleküle meistern
Ausgewählte Valenzstrichformeln aufstellen
Räumliche Anordnung der Moleküle: Das EPA-Modell
Die drei wichtigen Geometrien
Die Keilstrichformel
Die Mesomerie – exakter als Valenzstrichformeln
Regeln zum Aufstellen von mesomeren Grenzstrukturformeln
Eigenschaften von Molekülen
Übungen
Kapitel 9: Die Wechselwirkungen
Polarität der Bindungen
Was ist ein Dipol?
Die Wechselwirkungen
Ion-Dipol-Wechselwirkungen
Übungen
Teil III: Die großen Drei der allgemeinen Chemie
Kapitel 10: Quantitative Chemie
Die atomare Masseneinheit m
a
im PSE
Atommassen
Molekül- und Formelmassen
Die Avogadro-Konstante und die Stoffmenge
Der Zusammenhang der stöchiometrischen Formeln
Rechenbeispiel Kohlenstoffdioxid-Ausstoße
Die Macht des Stoffmengenverhältnisses
Allgemeines Vorgehen bei Rechnungen
Die Übersicht der Rechengrößen
Übungen
Kapitel 11: Säure-Base-Reaktionen
Was sind Säuren?
Achtung sauer – Die sauren Lösungen
Kennen Sie Basen?
Vorsicht Lauge – Die basischen Lösungen
Wichtige Konzepte aus der Säure-Base-Chemie
Gleichgewicht und Reversibilität bei Protonenübergängen
Die Verdünnungsreihe
Neutralisationsreaktion
Titration
Übungen
Kapitel 12: Redoxreaktionen
Salzbildung als einfachste Form der Redoxreaktion
Weitere Redoxreaktionen in Form von Salzbildungen
Und welche Oxidationszahl hast du?
Redoxreaktionen überall
Reduktion und Oxidation
Sicheres Aufstellen von Redoxreaktionen – die glorreichen Sieben
Übungen zu den Redoxreaktionen
Praktische Redoxreaktion?
Die etwas anderen Redoxreaktionen: Komproportionierung und Disproportionierung
Auch Metalle können edel sein: Die Oxidationsreihe der Metalle
Eine Reihe voller Redoxpaare
Jetzt baut sich Spannung auf! Die elektrochemische Zelle
Übungen
Teil IV: Die Welt der Kohlenstoffchemie
Kapitel 13: Die einfache organische Chemie
Das Grundgerüst – Die Alkane
Benennung der verzweigten Alkane
Die Alkene und Alkine
Übungen
Kapitel 14: Die funktionellen Gruppen der organischen Chemie
Stoff- und funktionelle Gruppen
Alkohole
Aldehyde, Ketone und Carbonsäuren
Mehrere funktionelle Gruppen im Molekül
Übungen
Kapitel 15: Die wichtigsten Vertreter der organischen Chemie
Zucker
Fette
Proteine
Wohin man sieht: Plastik
Übungen
Teil V: Der Top-Ten-Teil
Kapitel 16: Zehn Reaktionen, die Sie kennen sollten
Die Zellatmung
Die Photosynthese
Das Haber-Bosch-Verfahren
Die Verbrennung an sich
Die Reaktion für die Zukunft?
In der Küche: Der aufgehende Teig
Die Milchsäuregärung
Die Knallgas-Probe
Ozonbildung
Synthetische Acetylsalicylsäure (Aspirin)
Kapitel 17: Zehn wissenschaftliche »Fun Facts«
Sternenstaub und Gold
Anomalie des Wassers
Kältemischung
Warum ist der Himmel blau?
Power to Gas
Kernfusion
Supraleiter und die Suche nach der Raumtemperatur
Der Lotus-Effekt
Die Orgel und die Zinnpest
Helium und die »Mäusestimme«
Kapitel 18: Zehn nützliche Websites mit Chemieinhalten
Chemistryathome
Der Online-Klassiker
Spektrum der Wissenschaft
Reaktionsgleichungen ausgleichen
Stoffdatenbank mit Gefährdungseinstufung
Allgemeine Datenbank
Die Gesellschaft deutscher Chemiker
Wer ist dieser IUPAC?
Künstliche Intelligenz als Hilfe
Auf der Suche nach wissenschaftlichen Papern?
Lösungen zu den Übungsaufgaben
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Tabellenverzeichnis
Kapitel 2
Tabelle 2.1: Vergleich fest, flüssig, gasförmig im Teilchenmodell
Kapitel 3
Tabelle 3.1: Die drei Elementarteilchen und ihre Eigenschaften
Kapitel 4
Tabelle 4.1: Bezeichnung Hauptgruppen
Kapitel 5
Tabelle 5.1: Elementname und Formelschreibweise
Tabelle 5.2: Benennung von CO
2
Tabelle 5.3: Benennung von N
2
O
5
Tabelle 5.4: Übersicht griechische Zahlwörter bis 10
Tabelle 5.5: Lateinische Namen für das zweite Element in binären Verbindungen
Kapitel 6
Tabelle 6.1: Wichtige Namen der Molekül-Ionen und Fallen
Tabelle 6.2: Das Vorgehen zur Benennung von Na
2
O
Tabelle 6.3: Das Vorgehen zur Benennung von Fe
2
S
3
Tabelle 6.4: Die Wertigkeit von Eisen in Fe
2
S
3
bestimmen
Tabelle 6.5: Die Wertigkeit von Eisen in FeS bestimmen
Tabelle 6.6: Beteiligte Energien im Born-Haber-Kreisprozess für Natriumchlorid
Tabelle 6.7: Gitterenergien verschiedener Salze
Tabelle 6.8: Schmelz- und Siedetemperaturen verschiedener Salze
Kapitel 8
Tabelle 8.1: Molekül-Geometrien und Strukturbezeichnungen
Kapitel 11
Tabelle 11.1: Wichtige Säuren und Säurereste
Tabelle 11.2: Wichtige Basen und die basischen Lösungen
Tabelle 11.3: Übersicht gängiger Indikatoren
Tabelle 11.4: pH- und pOH-Werte im Vergleich
Kapitel 12
Tabelle 12.1: Elektrochemische Spannungsreihe unter Standardbedingungen (
nach V
...
Kapitel 13
Tabelle 13.1: Die homologe Reihe der Alkane
Tabelle 13.2: Vergleich von Valenzstrichformeln und Halbstrukturformeln
Tabelle 13.3: Vergleich von Halbstrukturformel und Skelettformel
Tabelle 13.4: Mehrfachbindungen in der Skelettformel
Tabelle 13.5: Verzweigte Alkane erster Schritt
Tabelle 13.6: Verzweigte Alkane zweiter Schritt
Tabelle 13.7: Verzweigte Alkane dritter Schritt
Tabelle 13.8: Verzweigte Alkane vierter Schritt
Kapitel 14
Tabelle 14.1: Übersicht Stoffgruppen und funktionelle Gruppen
Tabelle 14.2: Benennung funktioneller Gruppen bei höherwertiger funktioneller G...
Illustrationsverzeichnis
Kapitel 2
Abbildung 2.1: Wachsblöcke im Teilchenmodell, unter Verwendung vo...
Abbildung 2.2: Die drei Aggregatszustände © LuckySoul ...
Abbildung 2.3: Die brennende Kerze im Teilchenmodell, unter Verwe...
Abbildung 2.4: Überblick Aggregatzustandsänderungen, unter Verwen...
Abbildung 2.5: Die »Magie« der Kerze, unter Verwendung von Motive...
Abbildung 2.6: Teilchenmodell destilliertes Wasser
Abbildung 2.7: Teilchenmodell Leitungswasser
Abbildung 2.8: Attribute bei einem Videospiel, © PikePicture ...
Abbildung 2.9: Teilchenvorstellung in Lösung gehen
Abbildung 2.10: Teilchenvorstellung teilweise in Lösung gehen
Abbildung 2.11: Teilchenvorstellung gesättigte Lösung
Abbildung 2.12: Teilchenvorstellung Einfluss Luftdruck auf Siede...
Abbildung 2.13: Die »Herzchen-Formel«
Abbildung 2.14: Überblick homogene Stoffe
Abbildung 2.15: Überblick heterogene Stoffe
Abbildung 2.16: Zusammensetzung der Luft
Kapitel 3
Abbildung 3.1: Rutherford'scher Streuversuch, © ChemistryGod...
Abbildung 3.2: Erklärung der Beobachtung des Rutherford'schen Ver...
Abbildung 3.3: Das Elementsymbol von Kohlenstoff
Kapitel 4
Abbildung 4.1: Das Periodensystem der Elemente
Abbildung 4.2: Gekürztes PSE
Abbildung 4.3: PSE mit Markierung der Metalle, Halbmetalle und Ni...
Abbildung 4.4: Erklärung steigende Ionisierungsenergie
Abbildung 4.5: Ionisierungsenergien von Natrium
Abbildung 4.6: Energiestufenmodell von Natrium
Abbildung 4.7: Erste Ionisierungsenergie der Hauptgruppen-Elemente...
Abbildung 4.8: Tendenzen im PSE
Kapitel 5
Abbildung 5.1: Reaktionsgleichung, Schema
Abbildung 5.2: Übersicht Stoffe
Abbildung 5.3: Die Formelschreibweise
Abbildung 5.4: Die Summenformel von Wasser
Abbildung 5.5: Die Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff zu Was...
Abbildung 5.6: Die Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff zu Was...
Abbildung 5.7: Die Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff zu Was...
Abbildung 5.8: Nichtmetalle im PSE
Abbildung 5.9: Exothermes Energiediagramm
Abbildung 5.10: Endothermes Energiediagramm
Abbildung 5.11: Energiediagramm Katalysator
Abbildung 5.12: Katalyse: endotherme Reaktion mit Katalysator
Kapitel 6
Abbildung 6.1: Ionengitter von Natriumchlorid © designua
Abbildung 6.2: PSE als Spielbrett
Abbildung 6.3: Kreuzregel Calciumnitrid
Abbildung 6.4: Besonderheiten bei der Kreuzregel
Abbildung 6.5: Wertigkeit bestimmen
Abbildung 6.6: Bestimmen der Wertigkeiten
Abbildung 6.7: Born-Haber-Kreisprozess
Abbildung 6.8: Erklärung der Salz-Sprödigkeit auf Teilchenebene
Abbildung 6.9: Leitfähigkeit der Salze auf Teilchenebene
Kapitel 7
Abbildung 7.1: Das Metallgitter
Abbildung 7.2: Teilchenvorstellung der Druckeinwirkung auf Metall
Abbildung 7.3: Teilchenvorstellung Leitfähigkeit bei Metallen
Abbildung 7.4: Teilchenmodell der hexagonal dichtesten und kubisch dichtesten...
Abbildung 7.5: Erklärung des metallischen Glanzes
Kapitel 8
Abbildung 8.1: Punktelle Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektr...
Abbildung 8.2: Die Elektronenwolke des Wasserstoff-Atoms
Abbildung 8.3: Die Bildung eines Molekülorbitals
Abbildung 8.4: Ausbildung eines bindenden Elektronenpaars
Abbildung 8.5: Ausbildung eines antibindenden Molekülorbitals
Abbildung 8.6: Molekülorbital-Schema von Wasserstoff
Abbildung 8.7: Molekülorbital-Schema von Helium
Abbildung 8.8: Kugel-Stab-Modell von CO
2
mit einem Bindungswinkel...
Abbildung 8.9: H
2
CO im Kugel-Stab-Modell mit einem Bindungswinkel...
Abbildung 8.10: Kugel-Stab-Modell von SO
2
mit nicht-bindendem El...
Abbildung 8.11: Tetraeder
Abbildung 8.12: Kugel-Stab-Modell von Methan mit einem Bindungsw...
Abbildung 8.13: Kugel-Stab-Modell von Ammoniak
Abbildung 8.14: Kugel-Stab-Modell von Wasser
Abbildung 8.15: Elektronendichteverteilung von H
2
CO
Abbildung 8.16: Elektronendichte-Verteilung von CO
3
2-
Kapitel 9
Abbildung 9.1: Elektronendichteverteilung von HCl
Abbildung 9.2: Elektronendichteverteilung von H
2
Abbildung 9.3: Elektronegativitätswerte der Hauptgruppen-Elemente
Abbildung 9.4: Modell Dipol-Dipol-Wechselwirkung
Abbildung 9.5: Entstehung eines spontanen Dipols
Abbildung 9.6: Spontaner Dipol trifft auf benachbarte Moleküle
Abbildung 9.7: Spontaner Dipol bildet einen induzierten Dipol
Abbildung 9.8: Vergleich Siedetemperaturen
Abbildung 9.9: Teilchenebene – Salzkristall in Wasser
Kapitel 10
Abbildung 10.1: Übersicht über alle Rechengrößen
Kapitel 11
Abbildung 11.1: Vergleich verdünnte und konzentrierte Lösung
Abbildung 11.2: Die Verdünnungsreihe
Abbildung 11.3: Aufbau und Ablauf einer Titration @ Nandalal
Kapitel 12
Abbildung 12.1: Regeln zur Bestimmung der Oxidationszahlen
Abbildung 12.2: Bestimmung Oxidationszahl anhand Valenzstrichfor...
Abbildung 12.3: Reaktion von verschiedenen Metallpulvern in der ...
Abbildung 12.4: Oxidationsreihe der Metalle
Abbildung 12.5: Schema einer Normalwasserstoff-Elektrode
Abbildung 12.6: Vereinfachte Darstellung eines Daniell-Elements
Abbildung 12.7: Experimentalversuch Nachbau einer Volta'schen S...
Abbildung 12.8: Funktionsschema einer Elektrolyseanlage © natros
Abbildung 12.9: Funktionsweise eines Blei-Akkumulators
Abbildung 12.10: Schema einer Brennstoffzelle
Abbildung 12.11: Ladevorgang einer Lithium-Ionen-Batterie
Kapitel 15
Abbildung 15.1: Bild- und Spiegelbild eines Elefanten in der Natur
Kapitel 17
Abbildung 17.1: Farbe des Himmels – Rayleigh-Streuung
Abbildung 17.2: Konzept von Power to Gas für die Hausversorgung
Lösungen zu den Übungsaufgaben
Abbildung A.1: Energiestufenmodell Calcium
Orientierungspunkte
Cover
Titelblatt
Impressum
Über die Autoren
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Fangen Sie an zu lesen
Lösungen zu den Übungsaufgaben
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
1
2
3
4
7
8
9
10
11
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
125
126
127
128
129
130
131
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
355
356
357
358
359
360
361
Einführung
Was haben Ihr Frühstück, die Luft, die Sie atmen, die Weltmeere, ein Raketenstart, andere Planeten, unsere Sonne, das Buch beziehungsweise Tablet, auf dem Sie lesen, und sogar Sie selbst gemeinsam?
Die Chemie!
Alles besteht aus winzig kleinen Teilchen. Mit winzigen Teilchen und vor allem deren Umordnung in chemischen Reaktionen beschäftigt sich die Chemie. Menschen und Wissenschaftler versuchen mithilfe von Modellen, Vorgänge so genau wie möglich zu beschreiben und letztlich zum Beispiel im chemischen Kontext vorherzusagen, welche chemischen Reaktionen eintreten können. Das heißt, man möchte voraussagen können, was mit zwei Stoffen passiert, wenn man sie zusammengibt oder auch anzündet.
So handelt es sich bereits beim Anzünden einer Kerze um eine chemische Reaktion. Sie wissen, dass sich die Kerze nicht spontan von selbst entzündet, jedoch mit den richtigen Reaktionsbedingungen, hier einer Flamme, lässt sich die Verbrennung in Gang setzen. Nach dem Ingangsetzen brennt die Kerze ohne Ihr Zutun weiter, bis es keinen Brennstoff, also Wachs, mehr gibt.
Bei Verbrennungen handelt es sich allgemein um nichts anderes als chemische Reaktionen. Damit kommen wir zu einem scheinbar ganz anderen Thema: Raketenstarts. Auch beim Raketenstart spielt die Chemie eine wichtige Rolle, da der Treibstoff einer Rakete eine andere Form des Brennstoffs Wachs der Kerze ist. Prinzipiell laufen also beim Anzünden einer Kerze und beim Ins-All-Schießen einer Rakete ähnliche chemische Reaktionen ab. Es gibt natürlich ein paar kleine Unterschiede, da mit der Verbrennung von Kerzenwachs keine Tonnen von Material in den Weltraum geschossen werden können.
Da die Chemie des Raketenstarts anfangs noch etwas kompliziert ist, werden zunächst einfachere chemische Vorgänge an Beispielen wie eben der gerade genannten brennenden Kerze behandelt, um danach die gelernten Prinzipien auf komplexere chemische Reaktionen und Phänomene übertragen zu können.
Bevor Sie anfangen, sei noch an eines erinnert: Wenn Sie genau genug hinsehen, finden Sie wirklich überall Chemie – wir helfen Ihnen, die Chemie in allem zu entdecken.
Über dieses Buch
Sie wollen sich ein Grundlagenwissen in der Naturwissenschaft Chemie aneignen? Dann ist dieses Buch genau das richtige für Sie. Wir zeigen Ihnen auf eine einfache und verständliche Art und Weise, dass die Chemie keine unverständliche Wissenschaft ist, sondern auf einer überschaubaren Anzahl von Konzepten aufgebaut ist.
Unserer Meinung nach sind viele »schwierige« Chemieinhalte nur auf mangelndes Allgemeinwissen in der Chemie zurückzuführen beziehungsweise es ist nicht bekannt, wie man vorgehen muss, wenn man die Aufgabe lösen will. Sowohl allgemeine Informationen als auch Vorgehensweisen, um Probleme in der Chemie zu lösen, zeigen wir Ihnen in diesem Buch.
Deswegen eignet sich das Buch auch für Sie, wenn Sie sich auf eine Prüfung vorbereiten wollen, solange es sich um das Niveau der Sekundarstufe I handelt. Dies bedeutet in Deutschland alle Inhalte bis einschließlich der zehnten Klasse, unabhängig von der Schulart.
Wie man dieses Buch benutzt
Wenn Sie bei null anfangen, dann arbeiten Sie das Buch einfach von Teil I bis Teil V in der nummerierten Reihenfolge beginnend mit Kapitel 1 durch.
Wenn neue Formeln eingeführt werden, dann sind die Einheiten in eckigen Klammern hinter den jeweiligen Variablen angegeben. Dies soll eine bessere Übersichtlichkeit gewährleisten. Bei den Rechenaufgaben an sich werden die Einheiten nicht in eckigen Klammern angegeben.
Am Ende der jeweiligen Kapitel finden Sie Übungsaufgaben zu der Thematik aus dem gerade bearbeiteten Kapitel. Die detaillierten Lösungen zu den Aufgaben finden Sie im Anhang des Buches.
Sie können uns in einem Punkt vertrauen: Wenn Sie glauben, so etwas wie das Aufstellen von Reaktionsgleichungen oder das Lösen von Redoxreaktionen gemeistert zu haben, indem Sie das Buch gelesen haben, dann wird das in einer Prüfungssituation in der Regel nicht ausreichen. Woran liegt das? Weil Sie in der Chemie Aufgaben, Reaktionsgleichungen und Formeln, um eine kleine Auswahl zu nennen, per Hand gelöst haben müssen. Es ist ein nicht zu unterschätzender Unterschied, ob Sie eine Aufgabe im Geiste lösen oder die Lösung tatsächlich auf einem Blatt Papier notieren. Wir ermutigen Sie hiermit, alle Aufgaben und auch Vorgehensweisen separat auf einem Notizzettel oder Ihrem Tablet zu lösen beziehungsweise auszuprobieren. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie sich mithilfe des Buches auf eine Prüfung vorbereiten.
Voraussetzungen
Was nicht im Buch enthalten ist, was Sie aber benötigen, wenn Sie alles im Buch durcharbeiten wollen, ist ein Taschenrechner, ein Stift und mehrere Blatt Papier oder als Alternative ein Tablet.
Wenn Sie sich gezielt für einen bestimmten Inhalt vorbereiten wollen, dann springen Sie einfach direkt zu diesem Abschnitt. Sollten dort weitere Informationen benötigt werden, ist dies mit Verweis auf die entsprechenden Kapitel vermerkt.
Sollten Sie das Buch einfach aus Interesse gekauft haben, dann bringen Sie alle Voraussetzungen, die Sie nur irgendwie benötigen können, bereits mit. Viel Erfolg beim Lesen und Lösen der Aufgaben.
Wie ist dieses Buch aufgebaut?
Das Buch gliedert sich in fünf große Teile. Die ersten vier Teile behandeln dabei die Grundlagen der allgemeinen Chemie und sind so aufgebaut, dass die Inhalte mit den leichtestmöglichen beginnen und kontinuierlich immer komplexer werden. So werden relativ spät die viel gefürchteten Redoxreaktionen behandelt, wenngleich sie in Wirklichkeit gar nicht so schwer sind. Wenn Sie nach diesen vier Teilen immer noch nicht genug von der Chemie haben, dann empfehlen wir Ihnen weiterführende oder vertiefende Inhalte beziehungsweise interessante Fakten aus der Chemie im letzten Teil des Buches.
Es folgt ein kurzer Überblick über die einzelnen Teile im Buch.
Teil I: Grundlagen der Chemie
Die Überschrift sagt es eigentlich schon, es geht um die vielen Gesichter und die fundamentalsten Grundlagen der Chemie und warum es sich überhaupt lohnt, sich mit Chemie zu beschäftigen.
Zunächst wird hier das Konzept der Teilchenebene eingeführt, das Sie benötigen, um die am Ende des Teils behandelten Reaktionsgleichungen sinnvoll bearbeiten zu können. Auf dem Weg zu den Reaktionsgleichungen rauschen Sie noch an dem Konzept des Atoms vorbei und lernen, wie man mit dem Periodensystem der Elemente arbeitet.
Teil II: Drei Arten, alle zu binden, und die Wechselwirkungen
An sich gibt es sechs Begriffe, denen Sie in diesem Teil begegnen werden und Sie werden vor allem lernen, diese voneinander abzugrenzen:
Ionenbindung
Metallbindung
Atombindung
Dipol-Dipol-Wechselwirkungen
Wasserstoff-Brücken
London-Dispersion-Wechselwirkungen
Dieser Abschnitt im Buch behandelt, warum Stoffe oder Teilchen überhaupt zusammenhalten und welche Kräfte dabei eine Rolle spielen.
Teil III: Die großen Drei der allgemeinen Chemie
Dieser Teil beschäftigt sich mit drei Inhalten, die in der Regel sehr schöne Prüfungsaufgaben ausspucken und auch in der Praxis ihren Nutzen haben. Darüber hinaus erklären sie auch noch, wieso manche Reaktionen überhaupt stattfinden.
Zunächst wird dabei die quantitative Chemie behandelt, also die Möglichkeit, Berechnungen zu chemischen Reaktionen, die im Labor Anwendung finden können, durchzuführen. Dabei beginnen Sie mit der Masse der Atome und arbeiten sich über die Avogadro-Konstante, die molare Masse und das molare Volumen vor zu einem Zusammenhang, der über die Stoffmenge besteht.
Als Zweites kommt die Säure-Base-Chemie, ein mit vielen »Vokabeln« gespickter Abschnitt, der schwierigere Reaktionsgleichungen und Variationen davon, die Ionengleichungen, umfasst. Der Säure-Base-Abschnitt gipfelt in einer Erweiterung der Inhalte aus der quantitativen Chemie und dem dazugehörigen Verfahren, der Titration.
Der letzte der großen Drei sind die Redoxreaktionen. Diese werden in Oxidations- und Reduktionsgleichung unterteilt und treten bei einfachen Reaktionen wie der Salzbildung, aber auch bei Verbrennungen und der Elektrochemie auf. Die Letzteren erfordern, dass Redoxgleichungen nach einem vorgegebenen Schema aus mehreren Teilen gelöst werden müssen.
Teil IV: Die Welt der Kohlenstoffchemie
Auch Sie sind Teil der Kohlenstoffchemie, da die Moleküle, die Sie als Lebewesen auszeichnen, organischer Natur sind. Worum es sich bei der organischen Chemie handelt und welche Rolle dabei funktionelle Gruppen spielen, wird in diesem Teil behandelt.
Ein großer Anteil des Kohlenstoff-Teils wird sich mit der richtigen Benennung der vielen unterschiedlichen organischen Verbindungen beschäftigen. Angefangen mit einfachen, um ein Kohlenstoff-Atom länger werdenden Kohlenstoff-Wasserstoff-Verbindungen bis hin zu komplexen funktionellen Gruppen und deren Kombination.
Der letzte Abschnitt bietet einen Einblick in die Zucker, Fette, Proteine und Plastik. Richtig gelesen, Plastik gehört in den gleichen Abschnitt wie die drei Nährstoffgruppen.
Teil V: Der Top-Ten-Teil
Der Top-Ten-Teil ist in drei weitere Bereiche unterteilt. So wird zunächst auf wichtige Reaktionen eingegangen, die man als Chemiker kennen sollte. Die Fun-Facts behandeln bemerkenswerte Erkenntnisse aus der Chemie, interessantes Trivialwissen für Ihren nächsten Grillabend oder einfach nur lustige Fakten.
Zum Abschluss bieten wir Ihnen mit einer Auswahl aus zehn Websites die Möglichkeit, Ihr Wissen in der Chemie gezielt weiter zu vertiefen.
Icons, die in diesem Buch verwendet werden
Alle … für Dummies-Bücher haben gemeinsam, dass sie eine gewisse Anzahl an gleichen, jedoch für einzelne Bücher unterschiedlich definierten Icons verwenden. Die in diesem Buch verwendeten Icons und ihre von den Autoren festgelegte Bedeutung wird hier erklärt:
Das Merke-Icon umfasst Definitionen und Inhalte der Anfangschemie, die Sie klassischerweise auswendig parat haben sollten. Diese Inhalte bilden in der Regel die Grundlage für ein tiefer gehendes Verständnis oder die Voraussetzung, um Aufgaben in der Chemie lösen zu können. Dieses Icon werden Sie am häufigsten im Buch finden, da Sie immer einen Grundstock an Wissen benötigen, um komplexe Aufgaben in der Chemie lösen zu können.
Bei den Tipps handelt es sich um Informationen über Sachverhalte, die unserer Erfahrung nach gerne falsch gemacht werden und damit besondere Aufmerksamkeit verdienen. Darüber hinaus können es auch klassische Merkhilfen oder Vorgehensweisen sein, um Aufgaben einfacher zu lösen.
Dieses Icon sehen Sie, wenn wir Ihnen Zusatzinformationen in bestimmten Bereichen präsentieren, die für die Inhalte im Buch nicht zwingend erforderlich, unserer Meinung nach aber doch so interessant sind, dass wir Ihnen damit die Möglichkeit geben, etwas über den Tellerrand hinauszublicken.
Hierbei gehen wir mit Ihnen eine Beispielaufgabe aus dem aktuellen Themenbereich nach dem Prinzip »learning by doing« durch. Jede Aufgabe wird so detailliert wie möglich im Buch beschrieben, damit sie auch bei vollkommener Ahnungslosigkeit nachvollzogen werden kann. Einige dieser Aufgaben finden Sie aufgrund ihrer Größe mit keinem Icon versehen, dafür haben diese eine eigene Überschrift.
Es wird gefährlich, wenn Sie das Vorsicht-Icon im Buch sehen. Keine Angst, wenn Sie das Buch lesen, kann Ihnen nichts passieren, außer dass Sie müde werden, einschlafen und Ihnen Ihr Buch aus den Händen fällt. Das Icon zeigt, wo man im chemischen Kontext oder auch einfach zu Hause Fehler machen kann, die zu erheblichen Risiken führen. Die Informationen sind definitiv nicht dafür gedacht, es selbst auszuprobieren, da Sie sich damit ernsthaften Schaden zuziehen können.
Der Glaskolben zeigt Ihnen, dass es sich um ein Experiment handelt, das Sie gerne mit einfachen Mitteln nachmachen können. Dazu wird Ihnen zunächst das benötigte Material aufgezählt und dann die Versuchsdurchführung beschrieben. Wenn Sie die Experimente selbst ausprobieren wollen, dann sollten Sie bei den Glaskolben-Icons erst bis zum Ende der Versuchsdurchführung lesen und dann den Versuch, wie beschrieben, selbst ausprobieren, Ihre eigene Beobachtung notieren und versuchen, ein Ergebnis, das die Beobachtung erklärt, zu formulieren. Damit können Sie aktiv die Arbeitsweise in der Naturwissenschaft Chemie anwenden. Ihre Beobachtungen und Ergebnisse können Sie dann mit unseren Angaben vergleichen. Sollten Sie keine Möglichkeit haben, die Versuche selbst durchzuführen, dann sind zu jedem Versuch auch die Versuchsbeobachtung und die Versuchsergebnisse im Text zu finden. Es ist also kein Muss, die Versuche durchzuführen, jedoch lohnt es sich unserer Meinung nach, beim Lesen des Buches auch ein paar Mal anderweitig aktiv zu werden.
Wie geht es von hier aus weiter?
Fangen Sie mit dem ersten Kapitel an oder auch nicht. Letztlich können Sie in manche Kapitel komplett ohne Vorkenntnisse einsteigen, wohingegen dies bei anderen Kapiteln etwas schwieriger sein wird. Wenn Sie bisher noch keine Erfahrungen mit Chemie gemacht haben, empfehlen wir Ihnen, die Reihenfolge des Buches einzuhalten und mit dem ersten Kapitel zu starten. Sollten Sie ausschließlich am Verständnis der größeren Zusammenhänge interessiert sein, können Sie alles, was mit Rechnungen, wie die Berechnung der Dichte oder der Stoffmenge, zu tun hat, weglassen. Die restlichen Inhalte lassen sich zu einem wissenschaftlichen Gesamtbild der Chemie zusammenfügen, weswegen jeder Teil auch eine wichtige Rolle einnimmt. Wenn Sie bereits Erfahrungen mit Chemie gemacht haben, dann springen Sie einfach zu dem Kapitel, aus dem Sie etwas Neues erfahren oder nachschlagen wollen.
Letztlich liegt die Entscheidung, wie Sie mit dem Buch arbeiten, voll und ganz bei Ihnen. Wir wünschen Ihnen lediglich viel Erfolg auf Ihrem Weg.
Teil I
Grundlagen der Chemie
IN DIESEM TEIL …
Chemie, eine Naturwissenschaft von vielenKleine Teilchen und ihre Rolle in der ChemieDie Einfachheit und gleichzeitig die Vielfalt der Chemie in Ihrem Leben und AlltagAtome sind überall und dennoch zum Großteil nichtsLernen Sie das Periodensystem der Elemente kennenReaktionsgleichungen aufstellen und verstehenKapitel 1
Wieso brauchen Sie Chemie?
IN DIESEM KAPITEL
Was ist ChemieDer Unterschied zu anderen NaturwissenschaftenDie unterschiedlichen Zweige der ChemieWieso mit Chemie beschäftigenExplosionen, giftige Gase, Umweltschäden und chemische Zusatzstoffe: nur einige Punkte, die Sie vielleicht mit Chemie in Verbindung bringen. Der Chemie haftet immer noch ein relativ schlechtes Image an, zum Beispiel wegen diverser Unfälle mit massenhaftem Fischsterben und dem negativ behafteten Einsatz von »chemisch« hergestellten Stoffen. In der allgemeinen Masse verspürt man schon fast so etwas wie Angst vor der Chemie. Angst resultiert leider häufig aus Unwissenheit.
Das Buch gibt Ihnen die nötigen Grundlagen an die Hand, um chemische Vorgänge, die überall um Sie herum ablaufen, verstehen und nachvollziehen zu können. Dabei gibt es viele Bereiche der Chemie, die mit einfachen Experimenten aus dem Alltag zum Mitmachen einladen und Ihnen die Wissenschaft auch so näherbringt, wie es sein sollte: mit Experimentieren, Beobachten und Auswerten. Das Besondere dabei ist, dass man aus Experimenten mit erfolgreichen Auswertungen Rückschlüsse auf andere Vorgänge ziehen kann. So können Sie sich selbst eine Meinung über die Sachverhalte mit chemischem Kontext bilden.
Darüber hinaus besteht die Chemie aus einem großen theoretischen Anteil, der Ihnen hilft, die Beobachtungen auch verstehen zu können. Wir laden Sie ein, dieses Kapitel als Vorspeise zu betrachten, die Ihnen Geschmack auf das, was in den kommenden Abschnitten folgt, machen soll.
Dabei werden Sie in den Kapiteln von Teil I die Einfachheit und gleichzeitig die Vielfalt der Chemie in Ihrem Leben und Alltag kennenlernen. Neben der greifbaren Chemie dürfen dabei die berüchtigten Reaktionsgleichungen und das Periodensystem der Elemente nicht fehlen. Beides sind wichtige Werkzeuge in der Chemie und helfen dabei, komplexere Zusammenhänge schnell begreifen zu können. Mit etwas Übung und den richtigen Tipps schaffen Sie es, diese Werkzeuge sicher zu verwenden.
Beim zweiten Teil geht es darum, vorhersagen zu können, wie zwei Stoffe miteinander reagieren. Diese müssen Sie dafür nicht zwangsweise mithilfe eines Experiments zur Reaktion bringen. Sobald Sie wissen, welche Arten von Bindungen in Ihren betrachteten Stoffen vorliegen, lassen sich bereits einige relevante Aussagen treffen. Bringen Sie zum Beispiel ein Metall und ein Nichtmetall zur Reaktion, so werden Sie ein Salz als Produkt erhalten. Tauschen Sie nun entweder das Metall oder Nichtmetall aus, können Sie bei der Reaktion niemals ein Salz erhalten.
Stellen Sie sich vor, Sie wollen einen Kaffee kochen. Wenn Sie anstelle der Bohnen oder des Kaffeepulvers eine Portion Nudeln verwenden, dürfen Sie sich nicht wundern, wenn am Ende kein Kaffee herauskommt. Bei der Chemie handelt es sich um eine große Küche, die sich jedoch mit sehr kleinen Teilchen beschäftigt. Wenn Sie die falschen Zutaten auswählen, dann kann es nicht zum gewünschten Ergebnis kommen. Darüber hinaus werden Sie die Kaffeemaschine nur zum Kaffeekochen verwenden und nicht, um damit eine Pizza zuzubereiten. So gibt es für die drei Bindungsarten, die Ionen-, Metall- beziehungsweise Atombindung auch Modelle und Vorgehensweisen, die nur auf eine der Bindungsarten anwendbar sind. Sie können zum Beispiel die Benennung der Salze nur bei Ionenbindungen durchführen und das Aufstellen der Valenzstrichformeln nur bei Atombindungen.
Die Art der Bindung bezieht sich darauf, wie ein einzelnes Teilchen beziehungsweise eine Kristallstruktur zusammenhält, und beeinflusst die Eigenschaften der betrachteten Stoffe und ihre Fähigkeit zu Reaktionen. Darüber hinaus ist wichtig, dass Sie eine klare Abgrenzung von den angesprochenen Bindungen zu Wechselwirkungen zwischen den Teilchen treffen können.
Damit Sie sicher in der Küche der Chemie mit Stoffen hantieren können, werden in diesem Teil ausführlich die unterschiedlichen Bindungstypen sowie die möglichen Wechselwirkungen behandelt.
Der dritte Teil behandelt etwas komplexere Inhalte. Wenn Sie sich mit Chemie beschäftigen, dann können Sie andere Naturwissenschaften nicht außer Acht lassen. Eine der wichtigsten weiteren Naturwissenschaften für die Chemie ist die Mathematik. Wenn Sie an das Aufstellen und Ausgleichen von Reaktionsgleichungen denken, werden Sie dort bereits mithilfe von Mathematik die Ihnen gestellten Probleme lösen.
Mithilfe von einigen Variablen und Tricks können Sie die beiden Naturwissenschaften nutzen, um zum Beispiel zu berechnen, wie viel Masse an Ausgangsstoffen Sie benötigen, um ein bestimmtes Volumen eines entstehenden Gases bei der Produktseite zu erhalten. Dies ist zum Beispiel für Ihren Airbag im Auto so relevant, dass es über Leben oder Tod entscheidet.
Die Mathematik gipfelt in den Berechnungen zu Titrationen, die wiederum Teil der großen Säure-Base-Chemie sind. Säuren und Basen kennen Sie aus dem Alltag, wenngleich es Ihnen nicht immer bewusst ist. Sobald Sie etwas »Saures« essen, beruht dies darauf, dass hier irgendwo eine Säure mit im Spiel ist. Basen hingegen finden Sie eher seltener in Ihrem Alltag. Vielleicht verwenden Sie ja noch Kern- oder Schmierseifen, Vertreter aus dem Bereich der Basen, zu gewissen Anlässen. Grundsätzlich verbindet man mit dieser Thematik das Verätzen und damit »Auflösen« von Stoffen.
Zu guter Letzt wird in diesem Teil die Königsklasse der Anfangs-Chemie, die Redoxreaktionen behandelt. Vermeintlich komplizierte Gleichungen erklären Ihnen, wieso manche Reaktionen überhaupt ablaufen oder wo der Zusammenhang zwischen dem Rosten Ihres Autos und der »Opferanoden« eines Kreuzfahrtschiffs zu finden ist.
Im vierten Teil wird es organisch. Wenn Sie sich mit der Kohlenstoffchemie beschäftigen, kommen Sie an dem Begriff organische Chemie nicht vorbei. So werden Sie zum Beispiel auf den folgenden Seiten lernen, die organische Chemie von der anorganischen Chemie abzugrenzen. Darüber hinaus spielt das Benennen der organischen Verbindungen eine zentrale Rolle. Dafür gibt es ein eigenes Regelwerk, das dem Lernen einer Sprache bereits etwas mehr ähnelt als die Benennung von einfachen binären Verbindungen. Dies ist notwendig, weil es eine ungeheure Vielfalt an organischen Verbindungen zu entdecken gibt.
Letztlich sind auch die Reaktionen von organischen Verbindungen von besonderem Interesse, da komplexere Moleküle im Bereich des lebenden Organismus oft eine zentrale Rolle bei Stoffwechselvorgängen spielen. Um die Verbindung zum Lebenden nicht zu stark aufblühen zu lassen, sei erwähnt, dass auch die extrem praktischen, aber auch für uns bedenklichen Kunststoffe und damit das Rohöl Teil der Kohlenstoffchemie sind.
Wie Sie sehen, gibt es in Ihrem Leben ständig Überschneidungspunkte mit der Chemie, die offensichtlich, aber manchmal auch etwas versteckter sein können. Chemie kann Sie, wie so ziemlich jede Naturwissenschaft, am Leben erhalten oder schneller aus dem Leben scheiden lassen. Aus diesem Grund brauchen Sie unserer Meinung nach definitiv die Chemie. Selbst wenn Sie eine andere Meinung dazu haben, die Chemie wird Sie früher oder später einholen.
Was ist Chemie?
Der Aufbau und die Eigenschaften von Stoffen legt die Grundlage, um die Umwandlung von Stoffen erklären zu können. Genauere Informationen dazu finden Sie in Kapitel 2. Bei der Umwandlung von Stoffen handelt es sich wiederum um Prozesse, bei denen Teilchen unter Energiebeteiligung neu angeordnet werden. Diese Umwandlung der Stoffe beschreibt der Chemiker in einer chemischen Reaktion, die in Kapitel 5 ausführlich behandelt wird. Chemische Reaktionen und die Informationen, die man aus diesen herauslesen kann, sind das tägliche Brot für jeden Chemiker.
Grenzen zu anderen Naturwissenschaften
Der Stein der Weisen galt als Hilfsmittel für Alchemisten (altertümliche Chemiker), um aus unedlen Metallen edle Metalle wie Gold herstellen zu können. Ein Traum, der lange von vielen Gelehrten und Schwindlern verfolgt worden ist.
Abgrenzung zur Physik
Damit sind Sie an einer Grenze, die es in der Chemie gibt, angelangt. Eine Umwandlung von Elementen wie Eisen in ein anderes Element wie Gold kann man in der Chemie nicht erreichen. Dies liegt daran, dass der Stoff Eisen nur aus Eisen-Atomen besteht. Diese Eisen-Atome können Sie in der Chemie nicht zu anderen Atomen wie denen des Goldes umwandeln.
Der Stein der Weisen wird für immer ein unerreichbarer Traum in der Chemie sein, wird aber zum Teil in der Physik mithilfe der Kernspaltung imitiert. Zwar wird auch dort kein Gold aus anderen Elementen hergestellt, jedoch können die Atome von Elementen wie Uran in die Atome des Elements Krypton und Barium gespalten werden. Darüber hinaus wird auch die Fusion in der Physik betrieben, wobei zum Beispiel Deuterium- und Tritium-Atome zu einem Helium-Atom verschmolzen werden können.