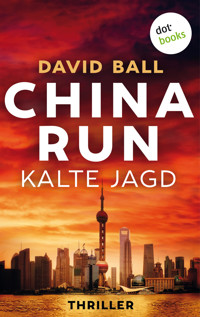
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn der größte Traum zum Albtraum wird – und eine erbitterte Jagd beginnt: Der fesselnde Thriller »China Run« von David Ball als eBook bei dotbooks. Wie weit darf man gehen, um das Leben eines Kindes zu schützen? Voller Zuversicht reist die amerikanische Anwältin Allison Turk gemeinsam mit anderen hoffnungsfrohen Eltern nach China: Sie haben die Erlaubnis erhalten, hier Kinder zu adoptieren, um ihnen eine bessere Zukunft bieten zu können. Vom ersten Moment an fühlt Allison eine tiefe Verbundenheit zur kleinen Wen Li – umso härter trifft sie der Schock, als die Gruppe kurz vor der Abreise von korrupten Beamten der Entführung bezichtigt wird … und die Kinder zurücklassen soll! Im letzten Moment kann Allison den Vollstreckern der chinesischen Polizei mit Wen Li entkommen. Doch nun befindet sie sich auf der Flucht durch ein fremdes Land, in dem sie niemanden kennt und keine Freunde hat – mit einem kleinen Mädchen in ihren Armen, das sich schutzsuchend an sie klammert … Zu den Männern, die nach der verschwundenen Amerikanerin suchen, gehört auch der Polizist Ma Lin. Je länger die unbarmherzige Jagd dauert, umso größer werden seine Zweifel, ob er wirklich auf der richtigen Seite steht. Aber kann er wirklich in Frage stellen, woran er sein Leben lang geglaubt hat? Temporeich, vielschichtig, fesselnd: Ein Thriller, der unter die Haut geht! Jetzt als eBook kaufen und genießen: »China Run« von David Ball. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 795
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wie weit darf man gehen, um das Leben eines Kindes zu schützen? Voller Zuversicht reist die amerikanische Anwältin Allison Turk gemeinsam mit anderen hoffnungsfrohen Eltern nach China: Sie haben die Erlaubnis erhalten, hier Kinder zu adoptieren, um ihnen eine bessere Zukunft bieten zu können. Vom ersten Moment an fühlt Allison eine tiefe Verbundenheit zur kleinen Wen Li – umso härter trifft sie der Schock, als die Gruppe kurz vor der Abreise von korrupten Beamten der Entführung bezichtigt wird … und die Kinder zurücklassen soll! Im letzten Moment kann Allison den Vollstreckern der chinesischen Polizei mit Wen Li entkommen. Doch nun befindet sie sich auf der Flucht durch ein fremdes Land, in dem sie niemanden kennt und keine Freunde hat – mit einem kleinen Mädchen in ihren Armen, das sich schutzsuchend an sie klammert … Zu den Männern, die nach der verschwundenen Amerikanerin suchen, gehört auch der Polizist Ma Lin. Je länger die unbarmherzige Jagd dauert, umso größer werden seine Zweifel, ob er wirklich auf der richtigen Seite steht. Aber kann er wirklich in Frage stellen, woran er sein Leben lang geglaubt hat?
Über den Autor:
David Ball wurde 1949 in Denver, Colorado geboren und ist ausgebildeter Journalist. Statt einer Tätigkeit als Reporter nachzugehen beschloss David Ball die Welt zu bereisen – bisher hat David Ball 65 Länder besucht und die Sahra viermal durchquert. Seine Romane sind in 11 Sprachen weltweit übersetzt worden.
Von David Ball erscheinen bei dotbooks auch seine historischen Romane »Asha, Sohn von Malta« und »Ikufar, Sohn der Wüste«.
***
Aktualisierte eBook-Neuausgabe April 2021
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2002 unter dem Originaltitel »China Run« bei Simon & Schuster, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2005 unter dem Titel »Nacht über dem Yangtse« bei Droemer
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2002 David Ball
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2005 Droemer
Copyright © der aktualisierten Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Plus ONE, ESOlex
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-96655-382-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »China Run« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
David Ball
China Run – Kalte Jagd
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Rainer Schmidt
dotbooks.
Prolog
Shao lin plagte die Erinnerung an jenen bitterkalten Winter, in dem sie ein flaches Grab für ihr Baby gegraben hatte. Eine Kaltfront, wie es sie selten gab, war aus der Mongolei heruntergekommen und hatte dafür gesorgt, dass der Himmel an diesem Tag so kalt und bleiern war wie ihre Seele. Sie hatte den Schnee weggescharrt und die gefrorene Erde aufgekratzt, bis ihre Finger blutig waren. Heiße Tränen mischten sich mit dem Blut. Das Loch war bald groß genug für das kleine Bündel.
Ein Mädchen war es. Xiao Xi. Ein kleines Glück.
Aber von Glück war nicht die Rede. Wenn man die Genehmigung für nur ein Kind hatte, dann durfte dieses Kind kein Mädchen sein. Eine Frau kam auf die Welt, um Söhne zu gebären, nicht Töchter. Söhne, die den Familiennamen weitertrugen. Söhne, die den Besitz der Familie erbten. Söhne, die ihre Eltern im Alter unterstützten und später ihre Gräber pflegten. Töchter wurden verheiratet und waren wertlos. Das war seit hundert Generationen so.
»Du bist also doch die Tochter deiner Mutter«, schimpfte ihr Mann, als sie ihm zurief, dass sein Erstgeborenes ein Mädchen war. »Ihr seid verflucht!« Es stimmte. Ihre Mutter hatte vier Mädchen geboren und keinen Jungen. Die Mutter ihrer Mutter hatte sechs Kinder bekommen – lauter Mädchen. Er hatte schon befürchtet, dass dieses Gebrechen in der Familie lag.
Mit düsterer Miene nahm ihre Schwiegermutter das Baby. »Ich werde es tun«, sagte sie zu Shao Lin. Aber sie brauchte gar nichts zu tun. Das Baby machte es ihr leicht. Es hatte etwas in der Kehle, etwas, das im Weg war – Schleim vielleicht –, und es atmete nicht richtig. Es würgte und brauchte einen Klaps. DieSchwiegermutter legte es einfach hin und wandte sich ab. Das Baby wurde blau und hörte auf zu zappeln.
Später stapfte Shao Lin über die gefrorenen Felder zu der Anhöhe, wo der Urgroßvater ihres Mannes unter einem Geröllhaufen begraben war. Es war nicht mehr erlaubt, die Toten in der Erde zu bestatten. Land war zu wertvoll. Sie hätte den Leichnam in den Yangtse legen sollen, wo er ins Meer getrieben wäre. Aber das kümmerte sie nicht. Sie hatte an diesem Tag genug für ihre Familie getan. Sie hatte an diesem Tag genug für China getan. Sie hatte an diesem Tag genug für ein ganzes Leben getan.
Da war noch eine Erinnerung. Eine Genehmigung von der Regierung, lang erwartet, als sie für eine Weile aufhörten, den Termin ihrer Monatsblutung auf der Tafel im Dorf zu notieren. Für den Distrikt war noch ein Baby genehmigt worden.
Ihr Baby.
Diesmal wollte ihr Mann es vorher wissen. Sie nahmen Ersparnisse aus dem Kasten unter dem Bett. Hinten auf einem Karren unternahmen sie die weite Reise nach Jiangyin zum Arzt. Er hatte ein Ultraschallgerät. Das benutzt jetzt jeder, sagten die alten Frauen im Dorf. Der Ultraschall konnte ein Mädchen entdecken, bevor es geboren wurde, und dann war die Sache einfach. Sie ließen sie Wasser trinken, bis sie zu platzen drohte, und dann halfen sie ihr auf einen kalten Stahltisch. Der Arzt rieb ihren Bauch mit einem kalten Gelee ein und drückte eine Art Stempel auf ihre Haut. Sie reckte den Hals, um die graue Masse zu sehen, die sich auf dem kleinen Schwarzweißmonitor bewegte. Nach einer Weile nickte der Arzt und deutete auf etwas. Shao Lin sah nur einen unscharfen Fleck. Der Arzt sagte, der Fleck sei ein Mädchen.
Die Abtreibung wurde vorgenommen, während ihr Mann draußen im Flur wartete. Sie schloss die Augen vor dem kalten Stahl und den rauen Händen des Arztes und sagte sich, es sei am besten so.
Aber der Ultraschall hatte den Arzt getäuscht. Das tote Kind war ein Junge.
Ihr Mann wurde verrückt vor Schmerz und Zorn. Er ging ohne sie, ließ sie allein auf dem Tisch. Eine ganze Woche lang ließ ihre Schwiegermutter sie nicht ins Haus, und so schlief sie im Stroh draußen vor den sonnenwarmen Mauern, bei den Ziegen und Schafen.
Beim nächsten Mal verließ sie das Haus, um das Baby allein zur Welt zu bringen. Das Kind wurde in einem Orangenhain bei strahlendem Sonnenschein geboren, und es schrie laut mit kräftiger Lunge. Als Shao Lin sah, dass es wieder ein Mädchen war, erwog sie, sich mit dem Messer, mit dem sie die Nabelschnur durchtrennt hatte, das Leben zu nehmen. Es schien keinen anderen Ausweg zu geben. Sie konnte nicht zulassen, dass das Kind ihre Familie, ihr Leben zerstörte. Sie konnte es nicht behalten, und sie konnte es nicht umbringen. Und wenn sie es aussetzte, würde sie vielleicht jahrelang im Gefängnis sitzen.
Shao Lin dachte an ihre Cousine in Suzhou. Die Familie mied sie; es hieß, sie sei eine Frau, die sich in den nächtlichen Straßen auskannte. Shao Lin kümmerte das nicht; sie brauchte Hilfe, und es gab sonst niemanden, an den sie sich hätte wenden können.
Sie wickelte das Kind in eine warme Decke und ging den Pfad hinunter zur großen Straße, wo ein Bauer sie auf seinem Karren mitfahren ließ. Er lächelte breit, als er das Kind sah. »Ein Segen«, sagte er. Während sie über die holprigen Landstraßen fuhren, trank das Kind an ihrer Brust und schlief dann. Shao Lin sah, dass es ein schönes Mädchen war, aber sie vermied es, ihr ins Gesicht zu blicken, weil es ihr zu schwer fiel, dann wieder wegzusehen. Sie deckte das Kind zu und starrte dumpf auf die vorüberziehenden Kohlfelder. Die Nacht verbrachte sie in Shengang, und am nächsten Morgen nahm sie den Bus.
In Suzhou herrschte großes Gedränge, und alles war schnell und beängstigend. Sie hatte eine Adresse. Vornübergebeugtwanderte sie durch die Straßen und bemühte sich, ihr Baby – ihr Verbrechen – vor den Blicken der Öffentlichkeit zu verbergen. Wenn sie einen Polizisten sah, wandte sie sich ab, denn sie hatte schreckliche Angst, er könne irgendwie in ihr Herz blicken und ihre Absichten erkennen. Aber niemand hielt sie auf. Niemand sprach sie an. Schließlich zeigte ihr ein Ladenbesitzer den Weg.
Ihre Cousine war eine erschöpfte, freundliche Frau, die überrascht und erfreut war, sie zu sehen. Wenn sie eine Hure war, konnte Shao Lin es ihr nicht ansehen. Die Frau hörte mitfühlend zu, als Shao Lin ihr Herz erleichterte. »Ich kenne da einen Mann«, sagte sie.
Er kam am Nachmittag. Sein Gesicht war fleischig und pockennarbig. Er trug einen ausgebeulten westlichen Anzug und roch nach Fisch. Shao Lin empfand instinktiv Abneigung gegen ihn. Als er das Kind nackt auszog, um es zu untersuchen, geriet ihre Entschlossenheit ins Wanken. Sie streckte die Hände nach dem Kind aus, aber ihre Cousine hielt sie zurück. »Es gibt keine bessere Möglichkeit«, flüsterte sie.
Der Mann hob den Kopf. »Ich gehe, wenn du willst«, sagte er. »Aber wenn du sie auf die Krankenhaustreppe legst, kriegen wir sie auch. Auf diese Weise springt für dich noch etwas dabei heraus.«
»Was wird mit ihr geschehen?«
»Sie wird leben«, sagte er nur.
Der Mann war zufrieden mit dem Kind und wickelte es wieder in die Decke. Er tat es schnell und ohne Zärtlichkeit. Er zog ein Bündel Geldscheine aus der Tasche, blätterte ein paar davon ab und hielt sie Shao Lin entgegen. Ohne nachzudenken wollte sie danach greifen, aber dann stockte sie entsetzt und beschämt. Er warf ihr das Geld vor die Füße und verabschiedete sich grunzend von Shao Lins Cousine. Als er die Tür öffnete, drang ein kraftvoller Schrei aus dem Bündel. Er kümmerte sich nicht darum. Die Tür schloss sich hinter ihm. Shao Lin sank hemmungslosschluchzend zu Boden. Ihre Cousine sammelte die Geldscheine auf und legte sie in eine Schublade.
Shao Lin blieb auf dem Boden sitzen, bis es dunkel wurde. Ein paarmal würgte sie, als müsse sie sich übergeben, aber es kam nichts. Sie lehnte ab, als ihre Cousine ihr etwas zu essen und ein Bett für die Nacht anbot.
Und als sie sich kräftig genug fühlte, stand sie auf. Sie flüchtete aus dem Haus und in die Nacht hinaus.
An diesem Abend klingelte in einem ummauerten Anwesen außerhalb von Suzhou ein Telefon.
»Wei?«
»Ich habe noch eine«, sagte der Mann mit dem pockennarbigen Gesicht. »Nicht registriert.«
»Ja?«
»Sie ist tadellos. Nur zwei Tage alt. Gesund und gut ausgebildet. Ihre Mutter war vorzüglich.«
»Sehr gut.«
»Ich ... ich will mehr für sie.«
Es blieb lange still in der Leitung. »Wir werden sehen. Bring sie zu mir.«
Shao Lin belog ihren Mann und die Geburtenkontrollbeamtin und erklärte, das Kind sei bei der Geburt gestorben. Ihr Mann ging auf seine Felder zurück, und die Beamtin stellte keine Fragen, weil die Antworten sie nicht interessierten.
Kein Baby bedeutete, dass die Quote nicht in Gefahr war.
Eins
Suzhou
Provinz Jiangsu
Volksrepublik China, Mai 1996
Es fing an wie immer in ihrem Albtraum, genauso wie es schon einmal angefangen hatte. Es klopfte an der Tür.
Allison Turk rührte sich kaum in ihrem Bett. Noch fünf Tage nach der Ankunft in China litt sie unter dem Jetlag. Ihr Körper war völlig durcheinander, und jetzt war sie in den Tiefschlaf der Erschöpfung gefallen. Dann fing das Baby leise an zu schreien, und Allison schrak auf der Stelle hoch. Blinzelnd versuchte sie, einen klaren Kopf zu bekommen. Hatte sie etwas gehört, bevor Wen Li geschrien hatte? Es war dunkel im Zimmer, die Vorhänge waren zugezogen.
Es war eine schwere Nacht gewesen. Sie hatte versucht, dem Baby die Fingernägel zu schneiden, und dabei ein Stückchen Haut vom Finger abgeschnitten. Wen Li blutete, aber es war Allison, die weinte; sie kam sich dumm und ungeschickt vor und konnte sich nicht vorstellen, dass sie je eine gute Mutter sein würde. Und als sie dann im Badezimmer auf dem Boden gesessen und sich bemüht hatte, die Wunde zu verbinden – die nicht besonders schlimm war, aber für ihre furchtsamen Augen schrecklich aussah –, war Wen Li ihr vom Schoß gefallen und hatte sich den Kopf an der Badewanne gestoßen, und sie hatten beide vor Schmerzen geweint. Zu allem Überfluss hatte Wen Li Fieber und Ausschlag bekommen und deshalb ein paar unruhige Stunden verbracht. Das Fieber war rasch wieder vergangen, aber trotzdem war Allison alle zwanzig Minuten aufgestanden, um zu sehen, ob alles in Ordnung war und das Kind noch atmete. Erst um drei war sie in einen unruhigen Schlaf versunken.
Es klopfte noch einmal. Schneller. Beharrlich.
Allison warf die Bettdecke zurück und richtete sich auf. Die Wolldecke im Kinderbettchen war zusammengeknüllt, und sie sah nur ein Büschel dunkles Haar und einen winzigen nackten Arm, der um Pu geschlungen war. Wen Li hatte den Bären nicht losgelassen, seit sie einander kannten. Allison sah hin, bis die Decke sich beinahe unmerklich bewegte. In der anderen Hälfte des Doppelbetts lag Tyler und schlief so regungslos, wie es nur Neunjährige können. Es würde eher ein Erdbeben als ein Klopfen an der Tür erfordern, um ihn vor zehn Uhr zu wecken.
Sie zog ihren Bademantel an, ging durch das Zimmer und griff nach dem Türknopf, als es erneut klopfte. Sie öffnete die Tür und zog sich den Bademantel fester um die Schultern. Draußen stand Nash Cameron, einer der Väter aus ihrer Gruppe, die hergekommen war, um Kinder zu adoptieren. Er war schroff und aggressiv. Seiner Frau Claire gegenüber benahm er sich kalt, und selbst die neue Tochter, Katie, behandelte er scheinbar gleichgültig. Er begrüßte sie nicht und wartete auch nicht, bis sie etwas sagte.
»Es gibt ein Problem. Könnte schlimm sein. Wir treffen uns in meinem Zimmer.«
Allison blinzelte und bemühte sich, wach zu werden. »Was? Was heißt das? Treffen? Wieso treffen ...«
Aber er ließ sie nicht ausreden, sondern wandte sich abrupt ab und lief eilig den halbdunklen Korridor hinunter. »Beeilen Sie sich!«, drängte er sie. Vor Ruth Pollards Zimmer blieb er stehen und klopfte wieder. Ruth gehörte auch zu den frisch gebackenen Adoptiveltern. Ihr Baby war wunderschön, winzig und zerbrechlich. Sie hieß Tai. Ruth nannte sie nur »Küken«.
Allison schloss die Tür. Sie bekam Angst. Von Anfang an hatte sie befürchtet, dass etwas schief gehen würde. So viel konnte passieren, genau wie schon einmal ... Gewaltsam verdrängte sie den Gedanken. Hastig zog sie ihren Jogginganzug über und fragte sich, ob sie Tyler und Wen Li wecken und mitnehmen sollte. Sie hatte sie noch nie allein gelassen. Sie warf einen Blick auf die Uhr: kurz nach sieben. Das Zimmer der Camerons war nebenan. Sie beschloss, die Kinder schlafen zu lassen. Rasch schrieb sie einen Zettel für Tyler, damit er wusste, wo sie war, und stellte ihn aufrecht auf den kleinen Schreibtisch.
Am Waschbecken wusch sie sich den Schlaf aus den Augen und bürstete sich das Haar. Dabei betrachtete sie sich im Spiegel. Die dunklen Ringe unter den Augen ließen die Strapazen der Reise erkennen. Ihr Gesicht war verquollen. Sie sah furchtbar aus. Zu viele Flugzeuge, zu viele Busfahrten, zu viel Stress. Sie zuckte mit den Schultern. Nichts zu machen. Sie konnte wieder zu sich kommen, wenn sie in Denver wäre, und wenn Marshall da wäre, um ihr zu helfen.
Sie schloss die Tür leise hinter sich und steckte die kleine Plastikkarte ein, die als elektronischer Schlüssel diente. Die Chinesen hatten sie mit ihren modernen Hotels überrascht. Sie hatte hier eher so etwas wie Dietriche erwartet. Aber vieles an China war überraschend gewesen.
Die Tür zum Zimmer der Camerons stand offen. Allison klopfte leise und trat ein. Das kleine Zimmer war überfüllt; die fünf anderen amerikanischen Familien, die hergekommen waren, um chinesische Kinder zu adoptieren, waren schon da. Den größten Teil der Reise von den Vereinigten Staaten hierher hatten sie zusammen unternommen, und sie hatten ihre Babys alle im selben Waisenhaus abgeholt. In einem betäubenden Nebel aus endlosen Tagen hatten sie Flugzeuge und enge Busse miteinander geteilt, Windeln und Geschichten von ersten Zähnen und Tipps über chinesische Mikroben. Die meisten waren keine Freunde, sondern unfreiwillige Reisegefährten, die aus ihrer Gesellschaft das Beste machten und jetzt nur noch die Tage zählten, bis sie in die Vereinigten Staaten zurückkehren und ihr eigenes, privates Leben mit ihren Babys beginnen könnten.
Claire Cameron saß auf einem Stuhl neben dem Kinderbett, in dem ihre neue Tochter Katie schlief. Sie war eine stille Frau, die ganz und gar unter der Fuchtel ihres Mannes stand. Wenn sie sprach, dann nur, um sich über das Hotel, die Straßen und die Märkte zu beklagen – und über die Tatsache, dass so wenige Chinesen genügend gute Manieren hatten, um Englisch zu sprechen. Sie hatte geweint. Ruth Pollard saß auf dem Bett und hielt ihre Tochter Tai im Arm, die noch schlief. Ruth hatte keinen Partner; sie war allein nach China gereist und hatte auch die Absicht, Tai allein großzuziehen. Dazu brauchte man Mumm, Energie und ein gewisses Maß an Wahnsinn. Allison mochte sie gern. Neben Ruth saßen Wally und Ruthann Jackson. Allison kannte sie als bibelfromme Christen aus Montana, harmlos genug, aber auch lästig mit ihren ständigen Predigten, vor allem, wenn sie sich damit an die Chinesen wandten, die darauf mit angestrengter Höflichkeit reagierten. Barry und Ceil Levin vertrieben Reinigungs- und Körperpflegeprodukte; sie waren aus Minnesota, sprachen wenig und blieben meist für sich. Roger und Cindy Lawton waren Rancher aus East Texas. Er war ein bigotter Langweiler voller Gehässigkeit.
Die Anspannung im Zimmer war mit Händen zu greifen; die Leute waren müde und besorgt wegen dieser plötzlichen Zusammenkunft. Nash schloss die Tür hinter Allison und wandte sich dann der Gruppe zu.
»Yi Ling hat mich vor zwanzig Minuten angerufen und darum gebeten, dass wir uns alle hier versammeln«, sagte er. Yi Ling war ihre chinesische Dolmetscherin und Reisebegleiterin. Sie hatte jeden ihrer Schritte begleitet, hatte sie am Flughafen abgeholt und dann für sie übersetzt und verhandelt und ihnen in einem Land geholfen, in dem sie ohne Hilfe nicht einmal das Badezimmer finden konnten. Sie war wunderbar gewesen. »Der Direktor des Waisenhauses hat sie gestern am späten Abend angerufen. Er hatte eine Unterredung mit einem Provinzbeamten. Ich habe nicht genau verstanden, was das für ein Beamter war. Jemand vom Ministerium für Verwaltungsangelegenheiten, glaube ich.
Jedenfalls teilte er ihr mit, dass ihnen bei unseren Babys ein Irrtum unterlaufen sei.«
Getöse brach aus, und alle redeten durcheinander. »Was heißt das, ein Irrtum? Noch so eine gottverdammte Panne? Was ist es denn diesmal für ein Irrtum?«, fragte Roger Lawton. Nash winkte ungeduldig ab und wies Fragen zurück, auf die er keine Antworten wusste.
»Ich bin nicht sicher. Es hatte wohl etwas damit zu tun, dass Familien der Kategorie Für besondere Bedürfnisse gesunde Babys bekommen hätten.«
Allison hielt den Atem an. Es stimmte, es gab entsprechende Vorschriften der chinesischen Behörden. Sie hatte ein Kind mit irgendeinem Handicap erwartet – ein Kind mit einem Herzgeräusch, einem Bruch, oder einfach ein größeres Kind, das schon laufen konnte, aber nicht einen kerngesunden Säugling. Nach chinesischem Recht mussten Adoptiveltern mindestens fünfunddreißig Jahre alt sein und durften keine anderen Kinder haben, wenn sie für ein gesundes Baby in Frage kommen wollten. Alle anderen konnten nur Kinder mit besonderen Bedürfnissen bekommen. Aber diese Vorschriften wurden locker gehandhabt, und es gab so viele Babys, die Adoptiveltern brauchten, dass aus irgendeinem Grund alle in der Gruppe ein gesundes Kind bekommen hatten. Selbstverständlich hatte keiner von ihnen Fragen gestellt, und auf der Reise war das Thema nicht zur Sprache gekommen.
Die Chinesen hatten Wen Lis Untersuchungsbericht sechs Wochen zuvor an Allison und Marshall geschickt und ein kleines Foto von einem verwirrt aussehenden Winzling dazugelegt. Das war alles, was Allison in der Hand gehabt hatte, alles, was sie über ihr neues Baby wusste. Sie und Marshall hatten die Entscheidung zur Adoption auf der Grundlage eines Fotos und eines dreißig Zeilen langen Untersuchungsbefundes treffen müssen. Allison hatte Dutzende von Vergrößerungen des Fotos anfertigen lassen und sie aufgeregt an jeden geschickt, den sie kannte. Und sie hatte den Befund hundertmal gelesen. Größe: 60 cm. Gewicht: 5,9 kg. Augen, Ohren, Hals: unauffällig. Zähne: keine. Lippen und Gaumen: unauffällig. Herz, Lunge, Nieren, Milz ...
In diesem trockenen Stil ging es weiter, eine Aufzählung der einzelnen Merkmale eines zwölf Pfund schweren chinesischen Geheimnisses. Der Bericht war fünf Monate alt, aber sie las ihn abends im Bett mit Marshall und versuchte, den leidenschaftslosen Worten mit dem Pinsel ihrer Vorstellungskraft Fleisch und Blut und Charakter zu verleihen. Sie zeigte ihn ihrem Kinderarzt, der feststellte, »oberflächlich gesehen« sei alles in Ordnung. Dann fragte sie sich besorgt, was der chinesische Arzt wohl übersehen haben mochte. Sie hatte gehört, dass die Untersuchungen sehr flüchtig vorgenommen wurden; das Baby könnte geistig behindert oder taub sein, und niemand würde es bemerken.
Es war ein Vabanquespiel, ein Baby mit fremden Genen zu adoptieren, und sie war krank vor Sorge. »Es ist ein Vabanquespiel, ein Baby mit deinen eigenen Genen in die Welt zu setzen«, gab Marshall zu bedenken. Und sie ging auf und ab, erfüllt von Sorgen, Träumen, Hoffnungen.
Stundenlang sah sie sich das Foto an. Sie sprach mit ihm und vertraute ihm Familiengeheimnisse an. Sie starrte es abends an, auf ihrem Nachttisch, an den Wecker gelehnt. Sie lächelte ihm morgens zu, dem Baby, das von seiner hohen Warte unter dem Kühlschrankmagneten hervorlugte. Sie summte ihm von der Dusche her ein Lied zu, wenn das Kind vom Badezimmerspiegel in seiner Nische unschuldig zu ihr herübersah. Und aus jedem Blickwinkel entdeckte Allison etwas Neues in den Gesichtszügen. Abends sah das Kind versonnen aus, und morgens ängstlich. Das Gesicht besaß Charme und Persönlichkeit, und die Augen verrieten einen wachen Verstand. Sie stellte sich die Vergangenheit des Babys in hundert verschiedenen Variationen vor. War es geliebt oder misshandelt worden? In einem Waisenhaus oder bei einer Pflegefamilie? Stammte es von einem Bauernhof oder aus der Großstadt? Wie war die Mutter? Hatte sie ihm die Knöchel auf irgendeine Weise gebrandmarkt, damit sie es eines Tages wieder erkennen könnte, wie es angeblich so häufig geschah?
Tausend Fragen schwirrten ihr durch den Kopf, Fragen, auf die es niemals Antwort geben würde. Und tausend Zweifel bedrängten sie. Sie befürchtete, dass sie das Baby oder das Baby sie nicht lieben würde. Sie befürchtete, dass sie keine gute Mutter sein würde, dass das Baby etwas brauchen und dass sie es nicht merken würde. Dass das Kind seine Bedürfnisse immer weiter in sich tragen würde, unerfüllt, gekettet an eine Mutter, die die Zeichen seiner Not nicht erkennen konnte, weil es nicht ihr eigen Fleisch und Blut war. Verrückte Befürchtungen, irrationale Befürchtungen, hartnäckige Befürchtungen, die einfach nicht vergehen wollten. Auch Tylers wegen machte sie sich Sorgen, sie fragte sich, wie ein Neunjähriger darauf reagieren würde, dass er nicht mehr im Mittelpunkt stand – und sie sorgte sich wegen Marshall. War es ihr Traum mehr als seiner? War diese Adoption ihr Bedürfnis mehr als seines? War es selbstsüchtig von ihr, ein Kind haben zu wollen? Und eine wunderbare Familie aus dem Gleichgewicht zu bringen, um es zu bekommen?
Im Laufe der Wochen verliebte sie sich in das Kind auf dem Foto, aber sie rahmte es nie ein, denn ein Rahmen wäre irgendwie etwas Dauerhaftes, und sie wusste, dass nichts von Dauer sein konnte, solange nicht alles geregelt war. Diesen Fehler hatte sie schon einmal begangen; sie hatte ein Kinderzimmer für ein Baby eingerichtet und dann unter dem leeren Zimmer gelitten, als das Baby gestorben war. Den gleichen Fehler hatte sie ein zweites Mal begangen und geglaubt, ein Baby gehöre ihr, bevor es ihr wirklich gehört hatte, und dann hatte sie auch dieses Baby verloren. Ein Bilderrahmen war das Gleiche.
Dann war die weite Reise nach China gekommen, die bange Fahrt zum Waisenhaus, der elektrisierende Augenblick, als die Pflegerin das kleine Bündel hochgehalten hatte. Mit zitternden Fingern hatte Allison die Wolldecke zurückgezogen. Wen Li hatte dunkles Haar, dicht und wild, als wäre es in einer bizarren, stachligen Nadelkissenfrisur gefriergetrocknet worden. Kämmen half da nicht; die Haare waren kurz und schnellten gleich wieder hoch wie Stahlfedern. Sie hatte große, dunkle, ovale Augen, so sanft und samten, dass Allison das Gefühl hatte, sie könnte darin versinken, Augen, die lebhaft und neugierig blickten und all die Intelligenz und Lebensfreude enthielten, um die sie gebetet hatte.
Dann kam das sorgfältige Fingerzählen, und bei der ersten Gelegenheit hatte Allison sie im Hotelzimmer mit Tylers Hilfe ausgezogen, um sie zu baden. Sie hatte gezittert vor Aufregung, nervös und voller Staunen und Hoffnung und Furcht angesichts des zappelnden Kindes. Alles war normal und rosig und vorhanden, wie sie es so verzweifelt erhofft hatte. Knie und Ellenbogen funktionierten, und als Wen Li gepiekst und gedrückt wurde, pinkelte sie Allison nass und ließ dabei ein boshaftes Grinsen aufstrahlen. Tyler musste lachen, und Allisons Herz schmolz auf der Stelle: Sie hatte ein gesundes, neun Monate altes Mädchen mit Humor, das nicht einmal eine Erkältung hatte. Sie dankte ihrem Glück und hielt ihr Kind im Arm und kam sich töricht vor, weil sie sich so viele Sorgen gemacht hatte.
Während sie auf die Papiere gewartet hatte, hatten sie vier wunderbare Tage zusammen im Hotel verbracht. Allison lernte in diesen Augen zu lesen, in denen ein Wunsch aufleuchtete oder ein Bedürfnis sich zeigte, Augen, die zornig oder zufrieden in die Welt blicken konnten, gekränkt oder nur schläfrig. Ab und zu präsentierte Wen Li ihren Hurenblick, einen langsamen Augenaufschlag, sexy und lasziv, als hätte sie ihn in einem hochklassigen Bordell gelernt und als wäre es das Natürlichste auf der Welt, und dann musste Allison laut lachen.
Am dritten Tag setzte Tyler sie zwischen die Kissen und verkündete, er werde ihr jetzt das aufrechte Sitzen beibringen. Er gab ihr ausführliche Anweisungen auf Englisch und ließ dann los. Einen Augenblick lang behielt Wen Li ihre Position tapfer bei und sackte dann zusammen wie ein Strumpf. Nach einigen Versuchen geriet sie zu nah an die Bettkante und purzelte herunter. Allison fing sie gerade noch rechtzeitig auf und schwenkte sie durch die Luft. Wen Li krähte in wildem Entzücken durch ihre fünfeinhalb Zähne. Ihre Blicke trafen sich, und irgendwo berührten ihre Seelen einander, und in diesem Moment wussten sie, dass es perfekt war.
Marshall war Angler, und meistens warf er die Fische, die er fing, ins Wasser zurück. Aber manchmal hatte er einen am Haken, den er nicht wieder hergeben konnte, einen Fisch, den er einfach nach Hause bringen musste. »Behaltefisch« nannte er so einen. Allison wusste, dass sie jetzt auch einen hatte: einen unterentwickelten, zerzausten, nicht sitzen könnenden Behaltefisch.
Das Waisenhaus hatte sie Wen Li getauft. Allison und Marshall gefiel der Name, und sie fügten Maria hinzu. Wen Li Maria Turk. Ehemals Waisenkind in China, in Zukunft amerikanische Staatsbürgerin.
Ja, perfekt.
Nur, dass diese Perfektion jetzt ein Problem war.
Nash blickte zum fünften Mal binnen weniger als zwei Minuten auf die Uhr. »Ms. Yi wollte inzwischen hier sein.«
Ceil Levin stand auf. »Ich mache Kaffee«, sagte sie.
Sie beschäftigte sich mit der Thermoskanne mit heißem Wasser, den Gläsern und den Beuteln mit bitterem Nescafé, der das Einzige war, was sie bekommen konnten. Als sie die Gläser verteilte, erschien Ms. Yi. Sie war eine kleine Frau, selbst nach chinesischen Maßstäben, Mitte dreißig, mit rabenschwarzem Haar und einer so makellosen Haut, dass sie zu leuchten schien. Sie war vernarrt in die Babys und verbrachte jeden freien Augenblick mit den Familien, um ihnen dabei zu helfen, sich zurechtzufinden – als wäre sie die Mutter für ein Dutzend Kinder, wo sie doch kinderlos war. Sie war eine Zauberin, die mitten in der Nacht Medizin oder spezielle Babynahrung auftreiben oder eine spontane Besichtigung der hübschen Gärten und Kanäle von Suzhou organisieren konnte. Sie war eine unermüdliche Begleiterin und begegnete den Mühen von Gruppenreisen und Verwaltungsbürokratie mit Anmut und Gelassenheit.
Das war die Yi Ling, die sie kannten, aber jetzt sahen alle, dass etwas sie aus der Fassung gebracht hatte. Sie wirkte hager und bekümmert. Allison vermutete, dass sie geweint hatte. Mit einer höflichen kleinen Verneigung sah sie sich im Zimmer um und lächelte jeden Einzelnen an.
»Es tut mir sehr Leid, dass ich Sie so früh stören muss«, begann sie. Ihr Englisch war stockend, aber klar und deutlich. »Die Angelegenheit ist leider äußerst betrüblich.« Offensichtlich tat sie sich schwer. Es war nicht höflich, unverblümt zu sprechen und ohne Umschweife zur Sache zu kommen, aber Yi Ling hatte keine Wahl; es war keine Zeit für Formalitäten. »Es gibt irgendeine – eine Kontroverse bei der Regierung, glaube ich. Zwischen dem Ministerium für Verwaltungsangelegenheiten und dem Justizministerium.« Die beiden Ressorts konkurrierten um den Einfluss auf das Verfahren der Adoption chinesischer Kinder durch Ausländer. Ihre Streitereien hatten zu Verzögerungen und widersprüchlichen Regelungen geführt. In den vergangenen Monaten war den ausländischen Adoptivfamilien dieses Gezänk schmerzlich vertraut geworden. »Ein Beamter des Verwaltungsministeriums hat jede Akte in der Provinz überprüft. Dann hat er Direktor Lin vom Waisenhaus Suzhou mitgeteilt, dass diese Gruppe ...« Sie suchte nach dem richtigen Ausdruck, »... nicht die korrekten Babys bekommen hat.«
»Was zum Teufel soll das ...«, begann Roger Lawton, aber Nash schnitt ihm das Wort ab.
»Lassen Sie sie ausreden.«
Yi Ling nickte. »Er sagt, nur Babys mit Problemen oder ältere Kinder sollten mit dieser Gruppe gehen. Keine gesunden Babys. Er sagt, Sie müssen Babys zurückgeben. Er sagt ...« Sie wartete, bis das erschrockene Stimmengewirr verebbt war. »Er sagt, Sie bekommen andere Babys. Montagmorgen. Gute Babys. Er verspricht.«
Allison spürte, wie ihr das Blut in den Kopf stieg. Einen Moment lang glaubte sie, sie habe sich verhört. Dann gaben ihre Knie nach, und halb setzte sie sich, halb fiel sie auf das Bett.
Oh, lieber Gott, nicht noch einmal. Bitte nicht noch einmal.
Ruth Pollard hielt Tai plötzlich viel fester im Arm. Das Baby regte sich und begann leise zu weinen. Ruthann Jackson murmelte ein Gebet. Und dann breitete sich der Schrecken über diese Eröffnung im Zimmer aus, und es wurde ganz still.
»Herr im Himmel«, flüsterte Roger Lawton schließlich. »Ich wusste, dass es noch irgendwie schief gehen würde.«
Yi Ling senkte den Blick auf den Teppich und schwieg.
»Ich will kein anderes Baby«, sagte Claire Cameron klagend in die Runde. Sie streckte ihren Arm über das Gitter des Kinderbetts und legte Katie die Hand aufs Haar. »Das können sie nicht machen. Oder?«
»Das ist ein verdammter Witz.« Barry Levin war rot im Gesicht, und seine Hände zitterten sichtlich. Seine Frau Ceil ließ ihr Kaffeeglas fallen. Es rollte über den Teppich, und sie fing an zu weinen.
Yi Ling war zu Tode beschämt, aber sie raffte sich auf und tat ihre Pflicht. »Selbstverständlich würde ich in einer solchen Angelegenheit niemals Witze machen«, sagte sie ernsthaft. »Es tut mir sehr Leid. Direktor Lin kommt mit einem Bus, der die Babys abholt. Um acht Uhr. Bis dahin müssen wir in der Lobby bereit sein.«
Plötzlich redeten alle durcheinander. Um acht Uhr! Das war weniger als eine Stunde. Eine Uhrzeit ließ plötzlich alles sehr real erscheinen.
»Was können wir tun?«
»Nichts, glaube ich, bis Montag. Dann können wir vielleicht mit dem Ministerium sprechen und alles in Ordnung bringen. Wir werden natürlich in Beijing anrufen.« Yi Ling bemühte sich, ihre Mutlosigkeit zu verbergen und hoffnungsvoll zu klingen. Aber sie war fast die ganze Nacht auf den Beinen gewesen, um das Unheil abzuwenden, und sie hatte resigniert.
»Ist das legal? Können die das tun, Nash?«, fragte Claire Cameron.
»Wer weiß? Ich nehme an, die können tun, was sie wollen, und es dann hinterher für legal erklären.« Er starrte aus dem Fenster. »Es sind ihre Gesetze, es ist ihr Land. Und wir haben noch keine Papiere, mit denen die Adoptionen vollzogen wären.« Sie hatten darauf gewartet, dass die chinesischen Notare die Verzichts- und Adoptionsurkunden fertig stellten, die Papiere, mit denen sie chinesische Pässe und dann amerikanische Visa für die Kinder beantragen könnten. Diese Unterlagen hätten schon seit zwei Tagen da sein müssen. Niemand wusste, warum es zu der Verzögerung gekommen war, aber niemand war deshalb sonderlich beunruhigt gewesen. Ihre Reisepläne berücksichtigten unvorhergesehene Verzögerungen. »Erwarten Sie das Unerwartete«, hatte die Adoptionsagentur ihnen immer wieder geraten.
Nash ging rastlos auf und ab und dachte nach. »Bis die Notare fertig sind, ist nichts amtlich. Nach keinem Gesetz, ob chinesisch oder amerikanisch.«
»Aber sie haben uns doch gesagt, welche Babys wir bekommen! Sie haben uns Bilder und medizinische Untersuchungsberichte geschickt! Sie haben gesagt, alles ist bereit!« Das war Cindy Lawton. Wie alle anderen hatte sie sechs Wochen lang auf das Bild und den Bericht gestarrt, die sie über das Aussehen und die Gesundheit ihres Babys informiert hatten.
»Na ja, und jetzt haben sie Mist gemacht«, knurrte Roger Lawton. »Oder gelogen.« Er funkelte seine Frau an und senkte seine Stimme ein wenig, aber die andern verstanden doch, was er sagte. »Ich habe dir gesagt, wir sollten nach Russland gehen. Da hätten wir auch ein weißes Baby bekommen. Du hättest auf mich hören sollen.« Seine Frau wurde rot. Sie wollte etwas erwidern, aber dann schloss sie die Augen und wiegte sich vor und zurück.
»Seien Sie still, Roger«, sagte Allison erbost.
Barry Levin schüttelte den Kopf. »Wie ist einer wie Sie eigentlich je am Sozialarbeiter vorbeigekommen?«
»Sozialarbeiter sind genauso dämlich wie ...«, fing Lawton an.
»Ruhe!«, fuhr Nash dazwischen. »Denken Sie nach! Was tun wir jetzt?«
»Was können wir tun?«, fragte Levin. »Sollen wir den chinesischen Behörden die Tür versperren? Wir haben hier keine Rechte. Wir sind auf ihre Einladung in diesem Land. Sie haben selbst gesagt, dass wir keine Papiere haben. Noch ist nichts legalisiert. Die Kinder gehören uns nicht. Wir haben nichts zu entscheiden. Wir müssen sie zurückgeben, wie man es verlangt.« Er ging auf und ab und überlegte. »Hören Sie, ich kenne Jack Fentress in der Konsularabteilung der Botschaft in Beijing. Wir waren Zimmergenossen auf dem College. Ich habe ihn seit ein paar Jahren nicht mehr gesprochen, aber ich bin sicher, dass er noch dort ist. Ich rufe ihn am Montag an. Er wird uns helfen, diesen Schlamassel in Ordnung zu bringen.«
»Und wenn nicht?«, fragte Nash.
»Er wird es tun. Das Ganze ist doch nur ein kolossaler bürokratischer Patzer. Selbst eine Dritte-Welt-Regierung kann so verrückt nicht sein.«
»Sie haben gesagt, sie geben uns andere Kinder, ja?« Levi sah Ms. Yi an und klammerte sich an das einzig Hoffnungsvolle in dem, was sie gesagt hatte.
Yi Ling nickte. »Es gibt viele Kinder. Gute Kinder.«
»Na, dann ist es doch nicht das Ende der Welt, oder?« Levin bemühte sich, seiner Frau Mut zu machen. »Es sind wundervolle Babys, die wir hier haben. Wir haben sie alle ins Herz geschlossen, aber sie gehören nicht uns, und es gibt andere, die uns auch brauchen und die es nicht weniger verdienen. Wir werden sie genauso ins Herz schließen und lieben können.«
»Warum können wir diese Kinder nicht bis Montag behalten, bis feststeht, dass es so sein muss?«, fragte Ceil. »Dann können wir immer noch sehen.«
»Das habe ich schon versucht«, sagte Yi Ling. »Darum bin ich so spät gekommen. Ich habe die Behörden um Aufschub gebeten. Niemand wollte auf mich hören. Nicht einmal Direktor Lin. In solchen Angelegenheiten hat er keine Wahl. Er muss die Anweisungen des Ministeriums befolgen. Er sagt, je länger wir warten, desto schwieriger wird alles. Er sagt, wir müssen es so machen.«
»Schwierig!« Claire Cameron lachte verbittert. »Wie können sie so grausam sein? Gott, ich hasse dieses Land.«
»Das sind nicht dieselben Leute«, sagte Yi Ling, aber sie wusste, dass ihre Worte bedeutungslos waren und dass es auf diese Feinheit nicht ankam. »Direktor Lin hat fast die ganze Nacht mit dem Ministerium diskutiert. Er ist über diese Direktive ebenso bestürzt wie Sie.« In Wahrheit hatte sie gefunden, dass Direktor Lin ihr die unerwartete Verfügung ziemlich kalt und ungerührt übermittelt hatte, aber sie war zu höflich, um dergleichen auszusprechen.
»Bestürzt?«, wiederholte Ceil Levin höhnisch. »Er ist bestürzt? Es sind doch nicht seine Kinder.«
»Es sind auch nicht unsere.« In Barry Levins Stimme lag der sanfte Tadel der Realität. Er hatte sich mit dem unergründlichen Beschluss bereits abgefunden und ergriff die Hand seiner Frau. »Wir haben keine Wahl, Ceil. Wir müssen sie zurückgeben. Wir werden versuchen, die Sache am Montag zu klären. Und wenn wir es nicht können, bekommen wir doch wenigstens ein anderes Baby. Es wird alles gut werden, du wirst schon sehen.« Ceil nickte und wischte sich die Tränen aus den Augen. Natürlich, es blieb ihnen nichts anderes übrig. Sie drückte seine Hand.
Eine Zeit lang sagte niemand etwas. In der Stille wachte Tai auf und fing an zu weinen. Sie hustete rau, und Ruth drehte sie um und klopfte ihr auf den Rücken, um die rasselnden Atemwege freizumachen. Ruth war Ende vierzig, klein und ein wenig untersetzt; ihr dichtes Haar sah aus wie graue Stahlwolle. Alle mochten sie; sie war die Robusteste von allen – jedermanns Lieblingstante. Nächtelang hatte sie bei ihrem Baby gesessen und der Kleinen die Medizin eingeflößt, die der Arzt gegen die Infektion der oberen Atemwege verschrieben hatte, und gleichzeitig hatte sie sich bemüht, ihr über einen Anfall von Hitzebläschen, einen ziemlich wunden Po und eine Ohrenentzündung hinwegzuhelfen. Ruth besaß die Tatkraft einer Mutter, die halb so alt war wie sie, und sie ließ nichts von der Anspannung erkennen, die sie empfinden musste. Sie war einfach entschlossen, Tai durchzubringen, und für Erschöpfung war jetzt keine Zeit. Alle hatten ihr abwechselnd geholfen; sogar Yi Ling hatte eine Nacht bei Tai gewacht, hatte Babynahrung mit Medizin gemischt und lindernde Bäder mit Hafergrütze gegen den Ausschlag zubereitet. Tai war eine Kämpfernatur, aber sie war schmächtig. Wenn ein Problem unter Kontrolle zu sein schien, trat gleich ein anderes auf. Ruth hatte die Tage gezählt, bis sie die Kleine endlich in die Vereinigten Staaten bringen könnte.
»Mich können sie doch sicher nicht meinen«, sagte sie jetzt.
»Nicht Tai, meine ich – sie ist doch krank, wissen Sie? Sie ist kein ...«
»Es tut mir Leid«, sagte Yi Ling. »Auch danach habe ich gefragt. Sie sagen, Tai gilt als gesund. Ihre Probleme nur vorübergehend.«
Ruths Blick umwölkte sich, und sie flüsterte so leise, dass nur Allison es hören konnte: »Ich kann sie nicht zurückgeben. Sie wird sterben, wenn ich sie zurückgebe. Das weiß ich.« Tai hörte auf zu husten, und Ruth drehte sie wieder um und nahm sie auf den Schoß. Tai hob lächelnd die kleine Hand und versuchte wild fuchtelnd, Ruth die Brille von der Nase zu ziehen. Ruth wühlte eine Saftflasche aus ihrer Tasche, und Tai gab sich damit zufrieden.
»Ich kann es einfach nicht tun«, wiederholte Ruth, diesmal so laut, dass die andern es hörten. Allison sah, dass ihre Hände zitterten.
»Na, ich kann’s«, sagte Roger Lawton. Er nahm eines der kleinen Airlinefläschchen Scotch vom Glasregal über dem Kühlschrank und drehte den Deckel ab. Er stürzte den Whisky schnell herunter und griff nach der nächsten Flasche. »Wir warten nicht auf ein neues Baby. Wir geben sie zurück, und dann reisen wir ab«, teilte er seiner Frau mit. »Scheiß auf die Schweine. Scheiß auf sie alle.«
»Sie hat einen Namen, Roger«, sagte seine Frau resigniert. »Sie heißt Annie. Nenne sie auch so, ja?«
»Am besten, du vergisst diesen Namen wieder, bevor du dich noch mehr an sie bindest. Annie ist ein amerikanischer Name. Sie ist keine Amerikanerin, und sie wird nie eine werden. Sie geht in einer halben Stunde zurück, und dann kann sie verdammt noch mal ihren alten Namen wiederhaben, wie immer der lauten mag.«
»Es ist Gottes Wille«, sagte Wally Jackson tröstend zu seiner Frau, die immer noch betete und das Baby im Arm hielt. »Er hat einen Plan für uns.«
»Das weiß ich«, sagte sie schniefend. »Sein Wille geschehe ...«
Allison hielt es nicht mehr aus. Ihre Schläfen pochten. Das alles führte doch zu nichts. Sie musste zurück in ihr Zimmer, zu Wen Li, zu Tyler, um nachzudenken und zu telefonieren. Sie zwang sich zum Aufstehen und ging mit weichen Knien zur Tür; dabei musste sie über Beine steigen und um Stühle herumgehen. »Sie können sie nicht wegnehmen«, murmelte sie kopfschüttelnd. »Sie können es einfach nicht.« Nash Cameron beobachtete sie aufmerksam. Sie schloss die Tür laut hinter sich, lief den Korridor hinunter und fummelte die Plastikkarte ins Türschloss. Endlich blinkte ein grünes Lämpchen auf, das Schloss klickte, und sie trat ins Zimmer. Die Kinder schliefen noch. Sie schloss die Augen und lehnte sich mit dem Rücken an die Tür. Ihr Herz raste. Ihr war übel vor Angst.
Oh, lieber Gott, nicht noch einmal. Bitte nicht noch einmal, nicht dreimal. Ich sterbe, wenn es ein drittes Mal passiert.
Sie musste etwas tun. Und zwar schleunigst.
Du hast keine Zeit.
Ruf Marshall an.
Sie stürzte zum Schreibtisch, riss ihre Tasche auf und blätterte in den Plastikhüllen nach ihrer Kreditkarte. Verdammt! Warum war das Ding nie zu finden? Aber da war sie. Allison griff zum Telefon und tippte die endlose Ziffernkette für ein internationales Ferngespräch ein. Dabei zitterte ihre Hand, und sie wusste, dass sie dabei war, den Kampf gegen die aufsteigende Panik zu verlieren. Sie atmete flach, und ihr Inneres war in Aufruhr. Zu allem Überfluss wachte Wen Li jetzt langsam auf.
Die sirupzähe Singsangansage dauerte zermürbend lange. »Herzlich willkommen bei AT&T«, sagte die Stimme. »Bitte wählen Sie die gewünschte Vorwahl und Teilnehmernummer und dann Ihre zehnstellige Zugangsnummer und Ihre Geheimzahl ...« Bla bla bla. Hastig begann sie zu wählen und musste dann noch einmal von vorn anfangen, weil sie sich vertippt hatte.
»Verdammt!«, murmelte sie, und als sie von neuem wählte, begann Wen Li zu weinen. Allison schloss die Augen, legte den Hörer auf die Gabel und ging zum Bettchen. Wen Li sah sie und lächelte. Ein überwältigendes Gefühl von Zärtlichkeit stieg ihn ihr auf, wie jedes Mal, wenn sie das Kind sah. Sanft hob sie die Kleine auf und drückte sie an sich. »Wen Li«, flüsterte sie und schloss die Augen. »Mama ist hier. Es ist alles in Ordnung.« Aber es war nicht in Ordnung. Nichts war in Ordnung, überhaupt nichts.
Sie hatte nicht einmal ein Fläschchen bereit. Sie hatte keine Zeit gehabt, eins zu machen. Mit Wen Li auf dem Arm ging sie zum Schreibtisch zurück, klemmte sich den Telefonhörer zwischen Kinn und Schulter und wählte noch einmal. Zwischendurch schloss sie die Augen und versuchte ihr Herz mit der Kraft ihres Willens dazu zu bringen, langsamer zu schlagen. Langsamer. Langsamer. Sie wählte weiter und betete, dass sie jetzt auf die richtigen Tasten drückte.
Nach einer kurzen Pause kam ein hohles Rauschen durch die Leitung, und sie wusste, dass sie es jetzt richtig gemacht hatte. Nach weiteren langen Sekunden vernahm sie das Freizeichen.
Wen Li begann zu zappeln. Sie hatte Hunger. »Ja, ja ...« Sie ließ die Kleine auf ihr Knie gleiten, hielt sie dort aufrecht und wippte sacht mit ihr auf und ab, um sie zu unterhalten.
Niemand meldete sich. Komm schon, Marshall, geh ans Telefon. Wen Li griff nach der Telefonschnur und hätte Allison fast den Hörer aus der Hand gerissen. Sie konnte so kräftig sein, obwohl sie noch so klein war. Allison erhob sich mühsam, setzte sich Wen Li auf die Hüfte und entzog ihr behutsam die Telefonschnur.
Sie hörte, wie am anderen Ende abgenommen wurde. »Marshall?«, sprudelte sie hervor, ehe sie erkannte, dass es der Anrufbeantworter war.
»Sie haben die Nummer der Turks gewählt«, sagte ihre eigene Stimme aus siebentausend Meilen Entfernung. »Wir können gerade nicht selbst ans Telefon kommen. Wenn Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer hinterlassen ...«
Verzweifelt wartete sie auf das Ende der Ansage. Sie hatte nicht gewusst, dass Maschinen so lange brauchen konnten. Marshall, bitte sei da. Bitte. Nach dem Signalton fing sie an zu reden. »Marshall, bist du zu Hause? ... Marshall, nimm ab! Bitte! ... Marshall, melde dich!« Aber sie wusste, dass es vergeblich war. Marshall war nicht da. Er war nicht bei ihr, und er war auch nicht da. Er würde den Hörer nicht abnehmen. Ihre Gedanken überschlugen sich. »Marshall, ich brauche dich. Es gibt Schwierigkeiten. Wenn du diese Nachricht in der nächsten halben Stunde hörst« – sie sah auf die Uhr und rechnete die Zeitverschiebung aus: fünfzehn Stunden minus – »wenn du das hier bis fünf Uhr deiner Zeit hörst, ruf mich im Hotel an. Wir sind noch in Suzhou. Marshall, bitte, schnell!«
Sie überlegte, ob sie ihm sagen sollte, was passiert war; vielleicht käme ihm eine Idee, wenn er einen Vorsprung hätte. Marshall war Rechtsanwalt und Krisen gewohnt, er war es gewohnt, schnell zu denken und schnell zu handeln. Er wäre auch jetzt bei ihr gewesen und hätte die Sache in die Hand genommen, aber eine fieberhafte Ohrenentzündung hatte ihn im letzten Moment an der Reise gehindert. Sie kam zu dem Schluss, dass es ihr nichts einbringen würde. Im selben Augenblick löste ihr Schweigen am anderen Ende das automatische Abschalten des Anrufbeantworters aus. Der Apparat unterbrach die Verbindung. Sie hätte ihm wenigstens sagen müssen, dass Tyler wohlauf war, erkannte sie plötzlich. Gott, wahrscheinlich würde er einen Herzinfarkt bekommen, wenn er ihre Stimme hörte, voller Panik, und ohne dass sie auf Einzelheiten einging. Sie wollte noch einmal anrufen, aber da fiel ihr Blick auf den Wecker am Bett.
Sieben Uhr vierzig. Noch zwanzig Minuten.
Marshall würde warten müssen.
Mit Wen Li auf dem Arm lief sie zu ihrem großen Koffer, der auf der Ablage neben dem Schreibtisch stand. Sie warf Kleidungsstücke beiseite und suchte das Kuvert mit den Adoptionspapieren. Als sie es gefunden hatte, öffnete sie es mühsam mit einer Hand. Wen Li wurde lauter und ungeduldiger. Allison brauchte Hilfe. Sie wandte sich dem anderen Bett zu. »Tyler! Tyler, wach auf!«, rief sie verzweifelt und rüttelte ihn an der Schulter. »Tyler, du musst mir Wen Li einen Augenblick abnehmen. Kannst du ihr ein Fläschchen machen? ... Tyler, aufwachen!« Tyler drehte sich um, aber das war alles.
Sie ließ Wen Li noch ein bisschen wippen, um sie zu beruhigen. Gleichzeitig schüttete sie die Papiere auf den Tisch und schob sie hin und her, bis sie fand, was sie suchte. Unten auf dem Blatt stand die Nummer des amerikanischen Konsulats in Guangzhou. Sie setzte sich ans Telefon, und dann dämmerte ihr, dass sie keine Ahnung hatte, wie man innerhalb Chinas telefonierte. Sie zog die Schreibtischschublade auf, nahm die Hotelbroschüre heraus und blätterte darin, bis sie die richtige Seite gefunden hatte. Ortsgespräche vom Zimmer aus ... Inlandsferngespräche vom Zimmer aus: Bitte wählen Sie 8 ...
Wieder drückte sie auf die Nummerntasten und zwang sich, langsam vorzugehen, damit sie keinen Fehler machte.
Im Hörer war es einen Augenblick lang still, und dann piepte es schnell hintereinander. Die Leitungen waren besetzt. Frustriert warf sie den Hörer auf die Gabel. Sie überlegte kurz, nahm dann wieder ab und wählte die Null. Es klingelte dreimal, und dann meldete sich die Rezeption.
»Ni hao«, sagte eine freundliche Stimme. »Hallo.«
»Ja«, sagte Allison, »ich brauche eine Telefonnummer, bitte. Die amerikanische Botschaft in Beijing. Können Sie mir die heraussuchen?«
»Ni hao«, wiederholte die Telefonistin hilfsbereit und fügte eine Reihe von chinesischen Wörtern hinzu.
»Verstehen Sie mich? Ich brauche eine Nummer.«
»Nummer?«, fragte die Stimme zögernd. »Room Service?«
»Eine Telefonnummer«, sagte Allison langsam. Sie holte tief Luft und zwang sich, geduldig zu bleiben. Manche Telefonistinnen sprachen ausgezeichnet englisch, und manche ... nun ja, manche sprachen eben ausgezeichnet chinesisch. »Sie müssen eine Telefonnummer für mich suchen.« Sie sprach so deutlich, wie sie konnte.
»Gut, bitte«, antwortete die Telefonistin. »Moment.« Allison wartete; sie nahm an, dass die Telefonistin ihre Vorgesetzte zu Hilfe holte. Einige Augenblicke vergingen, ohne dass etwas geschah. Ihre Unruhe nahm zu, und plötzlich hörte sie einen Wählton. Die Frau hatte aufgelegt.
Wütend warf sie den Hörer auf die Gabel. Wen Li zappelte und klagte. Allison hätte am liebsten alles abgeschaltet, sich die Decke über den Kopf gezogen und den Tag noch einmal von vorn begonnen. Sie konnte nicht glauben, was hier geschah.
»Tyler! Aufwachen!«
Wieder nahm sie den Hörer ab und wählte noch einmal die Nummer des Konsulats in Guangzhou. Wieder war es erst still, aber dann endlich läutete es. Im selben Augenblick klopfte jemand an die Zimmertür.
»Tyler! Kannst du die Tür aufmachen?« Sie beugte sich hinüber, dass die Telefonschnur sich dehnte, und stieß den Jungen mit dem Fuß an.
»Hnn?« Tyler drehte sich wieder um.
»Du sollst die Tür aufmachen, bitte!« Tyler setzte sich auf und rieb sich die Augen. Er sah verwirrt und mürrisch aus. »Mach die Tür auf!«
Der Anruf wurde angenommen. »Vielen Dank, dass Sie das Konsulat der Vereinigten Staaten von Amerika anrufen«, sagte eine Tonbandstimme. »Unsere Büros sind montags bis freitags von acht bis siebzehn Uhr besetzt. Wenn Sie die Nummer des Nebenanschlusses kennen, den Sie anrufen möchten, und ein Tonwahltelefon benutzen, können Sie diese Nummer jetzt wählen. Wenn Sie chinesischer Staatsbürger sind und Informationen zu Visaangelegenheiten benötigen, wählen Sie bitte 225. Wenn Sie amerikanischer Geschäftsmann sind und konsularische Unterstützung benötigen, wählen Sie bitte 221. Wenn Sie amerikanischer Staatsbürger sind und es sich um einen Notfall handelt, wählen Sie bitte ...« Allison griff nach einem Stift und kritzelte mutlos die Nummer hin. Die Zeit wurde knapp.
Zur Hölle mit all den Apparaten, dachte sie.
Tyler öffnete jetzt endlich die Tür, und Nash Cameron kam herein. Sein Blick forderte sie auf, das Telefongespräch zu beenden. Als sie die Nummer notiert hatte, legte sie auf.
»Sie werden in fünfzehn Minuten hier sein«, sagte er. »Die andern treffen sich unten. Kommen Sie, oder was?«
Sie wäre am liebsten in Panik verfallen oder in Tränen ausgebrochen. Stattdessen sah sie Tyler an. »Tyler, mach deiner Schwester das Fläschchen.«
»Sie ist nicht meine Schwester«, sagte Tyler. Seit das Thema in Denver zur Sprache gekommen war, hatte er keine kleine Schwester haben wollen, und Wen Lis Anwesenheit hatte ihn nicht erweichen können. Jeder Tag war eine neue Herausforderung für Allison; sie bemühte sich, ihn dazu zu bringen, dass er Wen Li akzeptierte, ja, ihn dazu zu bringen, dass er sie selbst akzeptierte. Sie war nur seine Stiefmutter. Er war Marshalls Sohn aus erster Ehe, und Tyler fühlte sich keineswegs wohl mit ihr. »Du hast gesagt, ich brauche nichts für sie zu tun«, erinnerte er sie, und ein bitterer Vorwurf lag in seinem Ton.
»Das weiß ich, Tyler. Aber bitte. Ich brauche deine Hilfe. Ich muss jetzt mit Mr. Cameron sprechen.«
»Bei Dad würde ich es nicht müssen.«
»Nun, aber er ist jetzt nicht hier. Bitte.«
Tyler brummte missmutig etwas vor sich hin, aber er nahm die Thermosflasche mit heißem Wasser, die das Hotel stets ersetzte, und ging ins Bad, wo Babynahrung und Fläschchen standen. Sie hörte, wie er damit hantierte.
»Was haben Sie vor?«, fragte Nash. »Wir haben nicht viel Zeit.« Wen Li zappelte an ihrer Schulter, und in diesem Augenblick übermannte sie die schreckliche Realität dessen, was hier im Gange war. Sie wollen sie wegnehmen. In einen Bus packen, ins Waisenhaus zurückbringen, sie gegen ein anderes Kind eintauschen. Das alles war zu schrecklich, zu plötzlich, zu schnell.
»Ich weiß es nicht«, sagte sie wahrheitsgemäß, und sie wusste, wie lahm das klingen musste. Sie strich sich das Haar aus den Augen und schüttelte den Kopf. »Ich weiß es einfach nicht.« Noch nie hatte sie sich so hilflos gefühlt, so verwirrt und so unsicher. Sie brauchte Zeit – Zeit zum Nachdenken, Zeit, sich zu überlegen, was sie tun sollte. Wieder sah sie auf die Uhr.
Fünfzehn Minuten.
Sie hörte, wie im Badezimmer etwas zu Boden fiel und verspritzte. »Verflixt!«, schimpfte Tyler. Er hatte die Flasche fallen lassen, und jetzt war es Wen Lis Schuld. »Ich hasse sie!« Allison versuchte, nicht hinzuhören.
»Ich werde es nicht tun«, sagte Nash.
»Wie meinen Sie das?«
»Wie ich es sage. Ich gebe nicht so leicht nach. Wir müssen hier verschwinden. Wir können nach Shanghai. Da gibt es ein Konsulat. Das wird am Montag geöffnet sein. Dort werden sie uns helfen.«
»Ich habe eben versucht, das Konsulat in Guangzhou anzurufen. Es ist geschlossen, aber ich habe die Nummer des Diensthabenden Beamten.«
Nash grunzte. »Zeitverschwendung. Am Wochenende kriegen Sie bestenfalls eine untere Charge. Selbst wenn Sie ihn erreichen können, wird er Ihnen nicht helfen. Er wird ein Formular ausfüllen und versprechen, einen Vorgesetzten zu informieren. Und der wird Ihnen raten, das zu tun, was die Behörden sagen. Was soll er auch sonst machen? Er wird Sie bestimmt nicht ermuntern, den Chinesen den Finger zu zeigen. Außerdem – bevor Sie die Situation zur Hälfte erklärt haben, werden die Leute vom Waisenhaus hier vor der Tür stehen.« Nash klopfte mit dem Finger auf seine Armbanduhr. »Allison. Wir haben Samstagmorgen. Dreizehn Minuten vor acht. Sie haben uns nicht genug Zeit gelassen, um irgendetwas anderes zu tun als das, was sie wollen. Glauben Sie nicht auch, das genau dass ihre Absicht war? Sie schubsen uns herum, wie sie es mit jedem tun. Aber wir müssen es uns nicht gefallen lassen, Allison.«
Sie kämpfte die Panik nieder. Alles erschien hoffnungslos. Nash schwieg kurz und sah Wen Li an. »Wenn Sie sie jetzt aufgeben, werden Sie sie nie wieder sehen. Wir müssen die Kinder nehmen, Allison, und mit ihnen verschwinden.«
Bei diesem Gedanken war Allison wie vom Donner gerührt. Das war zu viel, zu schnell. »Mein Gott, Nash«, flüsterte sie. »Wir sind in China.«
Er zuckte mit den Schultern, als sei das ohne Belang. »Wir fahren nur nach Shanghai. Das sind achtzig Meilen. Wie schwierig kann das sein? Was können sie uns schon anhaben, wenn wir uns an unsere eigene Regierung wenden? Und außerdem: Lassen sie uns eine andere Wahl?«
Allison fühlte sich zwischen Ungläubigkeit und Hoffnung qualvoll hin- und hergerissen. Irgendetwas in ihr weigerte sich zu akzeptieren, was Nash da sagte. Es musste eine andere Möglichkeit geben, einen alternativen Plan. Aber je länger sie darüber nachdachte, desto mehr hoffte sie, dass er vielleicht Recht hatte. »Claire ist einverstanden?«
»Claire tut, was ich sage. Sie packt schon. Hören Sie, ich werde jetzt nicht betteln oder diskutieren. Sie können mitkommen, oder Sie können mit den anderen nach unten gehen. Mir ist das im Grunde egal. Ich nehme an, wir werden in Shanghai eine stärkere Position haben, wenn wir mehr sind, aber die andern sind bereits eingeknickt. Gott und die weiße Rasse und das Gesetz und all das Zeug«, sagte er voller Sarkasmus und meinte damit die Jacksons und die Lawtons und die Levins. »Wie auch immer – ich werde in fünf Minuten an der Treppe sein. Ich dachte nur, ich sage Ihnen Bescheid. Jetzt liegt’s an Ihnen.« Er wandte sich ab, ging hinaus und zog die Tür hinter sich zu.
»Ich mache diese Sauerei nicht weg«, verkündete Tyler aus dem Badezimmer und kam einen Augenblick später mit Wen Lis Fläschchen heraus. Milchpulver bedeckte seine Arme und seine Wangen.
»Das ist schon in Ordnung.« Allison nahm ihm die Flasche ab. »Danke.« Wen Li machte es sich auf ihrem Schoß bequem und begann eifrig zu trinken. Zum ersten Mal seit dem rauen Aufwachen am Morgen klammerte Allison sich an einen friedlichen Augenblick. Sie strich sich das Haar aus dem Gesicht und betrachtete lächelnd das winzige Geschöpf auf ihrem Schoß. Ein Strahlen erblühte in dem kleinen Gesicht, als die dunklen Mandelaugen sie anblickten. Allison spürte die Wärme ihres Körpers und roch ihren Babygeruch, und wieder überwältigte es sie, als Wen Li zu ihr aufblickte. Es war ein körperliches Gefühl, stark und prächtig, voller Wunder und Schönheit und außerordentlichem Glück. So hart hatte sie dafür gearbeitet, so lange gewartet. Sie dachte über das nach, was Nash gesagt hatte. Seine Idee war so außergewöhnlich wie alles, was an diesem Morgen geschehen war. Die Vorstellung, sich den Behörden der Volksrepublik China zu widersetzen, erschütterte sie bis ins Mark. Das war undenkbar. Absurd. Vielleicht gefährlich. Nein, jetzt übertrieb sie. Wahrscheinlich hatte er Recht – wie viel Ärger konnten sie bekommen, nur weil sie nach Shanghai fuhren? Das war nicht so weit. Und was würden sie einem amerikanischen Bürger schon antun? Einer Frau noch dazu, die um ein Kind kämpfte, das man ihr versprochen hatte? Konnte ihr etwas Schlimmeres passieren, als Wen Li zu verlieren? Im Augenblick konnte sie sich nichts Schlimmeres vorstellen.
Sie wusste, dass sie wahrscheinlich gegen irgendein Gesetz verstoßen würde. Sie musste an Tyler denken, und auch an Marshall, der nicht einmal wusste, was hier vor sich ging. Sie hatte niemanden, der ihr raten, niemanden, mit dem sie reden konnte. Sie war Ingenieurin, und ihre Welt bestand aus geraden Linien und sauberen Berechnungen und der geordneten Präzision der Physik. Sie war es gewohnt, Probleme sorgfältig zu analysieren, sie hin und her zu wenden, bis sie sich der Logik fügten. Aber hier gab es keine Ordnung, und wenn ein Gesetz in ihr wirksam war, dann war es ein Gesetz der Natur, nicht eins der Physik oder der Mathematik.
Ein chinesischer Blitz hatte eingeschlagen und ihre Welt in Brand gesetzt. Sie musste eine Entscheidung treffen, sie musste sie sofort treffen, und sie konnte sich dabei nur von ihrem Instinkt leiten lassen. Wen Li saugte hungrig an ihrer Flasche, und Allison strich ihr übers Haar. Sie war nicht mehr das brieftaschengroße, zweidimensionale Waisenkind auf dem Foto oder ein klinisches Subjekt, dessen kurzes Leben in einem dreißig Zeilen langen Untersuchungsbefund zusammengefasst war. Allison hielt sie in ihren Armen und spürte ihre Wärme und ihre Bedürfnisse. Sie dachte an die chinesische Laune, die sie zusammengeführt hatte, und an die chinesische Laune, die sie jetzt wieder auseinander zu reißen drohte. Zorn flammte auf, Trotz – und dies war ein Augenblick, der ihr Leben für alle Zeit verändern sollte. Dieses Kind war nicht irgendeine Ware, die man gegen eine andere austauschen konnte, nur weil es einem gesichtslosen Beamten gerade so gefiel.
Wen Lis Bild gehörte in einen Rahmen. In ihren Rahmen.
Und Allison Turk wusste plötzlich mit unumstößlicher Sicherheit, dass sie nicht zum Wagen des Waisenhauses kommen würde.
»Tyler, wir müssen packen.«
Zwei
Um fünf Minuten vor acht bogen zwei identische schwarze Liberation-Kleinbusse von der Shiquan Jie Road in die lange Hotelzufahrt ein. Der Wachtposten vor dem Hotel, der die Straßenhändler von den Hotelgästen fern halten sollte, winkte sie durch, und sie schlängelten sich durch den makellos gepflegten Park bis zum Hoteleingang. Noch ehe die Motoren verstummt waren, stieg Direktor Lin vom Kinderwohlfahrtsinstitut Nummer drei mit finster entschlossener Miene aus dem vorderen Fahrzeug. Drei Helferinnen aus dem Waisenhaus warteten im zweiten Wagen, bis der Fahrer ihnen von außen die Tür öffnete. Sie plapperten nervös miteinander und spähten durch die getönten Scheiben hinaus.
Direktor Lin, ein strenger Bürokrat, der bedingungslose Autorität ausstrahlte, winkte den Fahrern und Erzieherinnen ungeduldig, sich zu beeilen. Dann ging er ihnen voraus ins Hotel. Neben einem Block von Aufzügen in der Mitte der Lobby befand sich ein Loungebereich mit Sesseln und Couchtischen. Er sah drei der Ausländerfamilien, die dort mit den Kindern auf ihn warteten. Es enttäuschte ihn, dass er Yi Ling nicht entdecken konnte, die diese delikate Angelegenheit eigentlich mit den lao wai über die Bühne bringen sollte. Macht nichts, dachte er. Sein Englisch war passabel. Er würde es auch allein schaffen.
Er verbeugte sich leicht, als er bei der Gruppe angekommen war. Ein freundliches Lächeln war auf seinem Gesicht erschienen, eine hastige Ergänzung, die besagen sollte, dass alles in schönster Ordnung sei. »Ni hao«, sagte er mit gezwungener Fröhlichkeit. »Guten Morgen.« Barry Levin nickte, aber alle andern bewahrten eisiges Schweigen. Roger Lawton saß brütend allein auf einer Couch. Seine Frau weinte leise, während Annie hungrig an einer Flasche saugte. Ceil Levin stand stumpf da und wartete ab. Die Jacksons hatten betend die Hände über ihrem Baby gefaltet.
»Ich bedauere die Unannehmlichkeiten«, sagte Direktor Lin.
»Bringen wir’s einfach hinter uns, ja?«, sagte Roger Lawton.





























