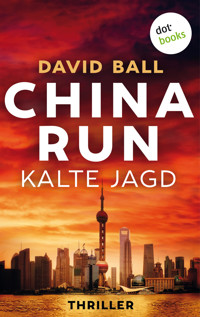Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Roman voller Exotik, atemberaubender Spannung – und über das Versprechen bedingungsloser Liebe: »Ikufar« von David Ball als eBook bei dotbooks. Paris, 1870: Ikufar de Vries ist der Sohn eines französischen Adligen und einer stolzen Tuaregprinzessin. Gemeinsam mit seinem Cousin und Herzensverwandten Paul verlebt er eine unbeschwerte Jugend in der prachtvollen Hauptstadt. Doch als Ikufars Familie vor politischen Unruhen flieht und Paris für immer verlässt, verlieren sich die beiden besten Freunde aus den Augen. Erst viele Jahre später treffen sie in der Sahara wieder aufeinander … als scheinbare Todfeinde: Ikufar, der in der Wüste bei den Tuareg seine wahre Heimat und die Liebe seines Lebens gefunden hat – und Paul, mittlerweile Offizier der französischen Armee, der den Auftrag hat, das stolze Wüstenvolk zu unterwerfen … »Ein fantastischer Abenteuerroman.« Welt am Sonntag Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der fesselnde Roman »Ikufar« von David Ball. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1504
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Paris, 1870: Ikufar de Vries ist der Sohn eines französischen Adligen und einer stolzen Tuaregprinzessin. Gemeinsam mit seinem Cousin und Herzensverwandten Paul verlebt er eine unbeschwerte Jugend in der prachtvollen Hauptstadt. Doch als Ikufars Familie vor politischen Unruhen flieht und Paris für immer verlässt, verlieren sich die beiden besten Freunde aus den Augen. Erst viele Jahre später treffen sie in der Sahara wieder aufeinander … als scheinbare Todfeinde: Ikufar, der in der Wüste bei den Tuareg seine wahre Heimat und die Liebe seines Lebens gefunden hat – und Paul, mittlerweile Offizier der französischen Armee, der den Auftrag hat, das stolze Wüstenvolk zu unterwerfen …
Über den Autor:
David Ball wurde 1949 in Denver, Colorado geboren und ist ausgebildeter Journalist. Statt einer Tätigkeit als Reporter nachzugehen beschloss David Ball die Welt zu bereisen – bisher hat David Ball 65 Länder besucht und die Sahra viermal durchquert. Seine Romane sind in 11 Sprachen weltweit übersetzt worden.
Von David Ball erscheint bei dotbooks der historische Roman »Asha, Sohn von Malta« sowie sein Thriller »China Run«.
***
eBook-Neuausgabe April 2021
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1999 unter dem Originaltitel »Empires of Sand« bei Bantam Books, New York.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1999 by David Ball
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1999 Schneekluth Verlag GmbH, München
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/LucVi, PIGAMA, faberfoto-it, Marzolino
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-96655-400-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Ikufar« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
David Ball
Ikufar – Sohn der Wüste
Roman
Aus dem Amerikanischen von Rainer Schmidt
dotbooks.
Kapitel 1
Frankreich, 1866
»Die Kinder! Nicht schießen!«
Es war zu spät. Das Gewehr brüllte auf und schlug gegen die Schulter des Jägers. Es war ein weiter Schuß, hundertfünfzig Meter oder mehr. Beinahe hätte er den Keiler nicht gesehen; durch den Wald war er kaum zu erkennen, denn Schatten und Sonnenlicht tanzten auf dem Laub des fernen Dickichts und verschluckten ihn fast. Alle andern hatten den Blick zum Himmel gerichtet, auf den Falken des Grafen, aber der Jäger hatte eine Bewegung gesehen, und da war er und wühlte nach Bucheckern: ein mächtiger Keiler, ein königlicher Keiler, ein bösartiger Teufel von einem Keiler. Selten in diesem Wald. Er beschloß sofort, ihn zur Strecke zu bringen.
Ein anderer wäre weiter vorgerückt, um einen besseren Schuß anbringen zu können und das Tier nicht zu verfehlen oder, schlimmer noch, nur zu verwunden. Auf der extremen Entfernung beruhte der Unterschied zwischen einem guten Schuß und einem spektakulären Schuß, einem Schuß, der wegen seiner Ungewißheit desto erregender war, einem Schuß, an dem sich seine Waffe erwies und sein Talent und der ihm das Prahlrecht in der Schenke auf Monate hinaus sicherte. Er wußte, daß er es konnte, denn er kannte seine Waffe. Es war ein neues Repetiergewehr, wie es beim Militär in Gebrauch war. Der lange Lauf verlieh ihm eine bis dahin ungeahnte Treffgenauigkeit. Er hatte die Visiereinrichtung mit tausend Übungsschüssen perfekt justiert.
Er hob die Waffe und nahm sein Ziel aufs Korn. Der Warnruf des Grafen ließ ihn zusammenfahren, aber nur für einen Augenblick. Dann zielte er mit ruhiger Hand und drückte ab. Und schon da, schon bevor die Kugel den Lauf verlassen hatte, wußte er, daß er es geschafft hatte. Er brauchte es nicht zu sehen, um es zu wissen, brauchte den Aufschlag der Kugel nicht zu hören. Er wußte es einfach. Und eine Sekunde später war seine Gewißheit bestätigt: Er hörte ein klatschendes Geräusch und ein wütendes Schmerzquieken. Man sah raschelnde Bewegung, und das Tier verschwand im Unterholz.
Der Jäger jauchzte aufgeregt. Zum Teufel mit dem Grafen! Bei Gott, er hatte getroffen! Einen Keiler! Ein ganz unerwarteter Bonus, sehr viel besser als die vergleichsweise langweilige Jagd mit dem Falken. Er würde seine Trophäe bekommen, und es würde kein mickriger Vogel sein. Ohne sich nach den anderen umzusehen – vor allem den Grafen wollte er jetzt nicht anschauen –, lief er über die Lichtung.
Graf Henri de Vries war Gastgeber einer Gruppe von Mitgliedern der Société Géographique, die hier die uralte Kunst der Falkenjagd miterleben wollten. Die Familie des Grafen hielt seit Generationen Falken, und sie jagten jetzt in einem Revier, das an sein Anwesen grenzte.
Henri hatte den Keiler schon vor dem Jäger gesichtet, und ungläubig hatte er gesehen, wie der Mann sein Gewehr in Anschlag brachte, denn in der Nähe spielten die Kinder. Als er das Schwein quieken hörte und die jähe Bewegung sah, waren seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt.
Denn jetzt galoppierte der Tod durch den Wald.
Ohne ein Wort zu verlieren, ließ er seine Jagdgesellschaft stehen und lief zu seinem Pferd. Ein wilder Keiler war immer gefährlich, aber ein angeschossener war unberechenbar, ja mörderisch. Niemand war vor ihm sicher, nicht einmal ein bewaffneter Mann zu Pferde. Nicht solange der angeschossene Keiler noch lebte.
Der Graf schwang sich auf sein Pferd. Das Tier kannte seinen Reiter – es spürte die Gefahr und galoppierte los, noch ehe er richtig im Sattel saß. Sie jagten geradewegs auf die Stelle zu, wo der Keiler verschwunden war und einer fernen Lichtung entgegenflüchtete. Pferd und Reiter donnerten durch den Wald, unter den goldenen Eichen und Ulmen des großen Bois de Boulogne hindurch, der einst das Jagdrevier der Valois-Könige gewesen war.
Henris Frau Serena saß im Schatten eines großen Baumes. Sie hatte nicht auf ihre Umgebung geachtet, überhaupt nicht. Normalerweise wäre sie mit Henri auf der Jagd gewesen. Aber sie war eine Tuareg, eine Frau der Wüste, und insgeheim lernte sie seit einer Weile Französisch zu lesen, die Muttersprache ihres Mannes. Sie hatte es ihm noch nicht erzählt. Auf eigene Faust hatte sie einen Tutor gefunden, einen Lehrer am Lycée in Paris, mit dem sie verstohlen lange Stunden verbrachte, auf die weitere Stunden einsamen Übens folgten. Nach und nach war eine neugefundene Liebe in ihr erwacht. Jede neue Geschichte hatte den Zauber verstärkt. Auf die Themen kam es gar nicht an. Henris Bibliothek war reich an wissenschaftlichen Zeitschriften. Bei den meisten konnte sie die Worte und ihre Bedeutungen nicht erfassen, aber es gab auch Romane und Artikel und Essays. Deren Worte waren wie Musik und brachten ihr fast mystische Freuden, weil sie ihr neue Welten eröffneten.
Sie hatte eine Inspiration. Bald hatte Henri Geburtstag. Dann würden sie Moussa zu Hause lassen und zusammen in den Wald reiten, zu einem abgelegenen Wasserfall am Rande des Anwesens. Sie würde ein Picknick mitnehmen, ein weiches, sonniges Fleckchen aussuchen und eine Decke auf dem Boden ausbreiten – nein, viele Decken, falls es kühl wäre, und dann würde sie ihm ein Glas Wein einschenken. Er würde den Kopf in ihren Schoß legen, und dann würde sie ihm vorlesen, und sie würde das überraschte Entzücken genießen, das sie in seinen Augen finden würde. Später würden sie dann miteinander schlafen. Es machte ihr großen Spaß, sich diesen Tag bis in die winzigsten Details auszumalen, und sie hatte ihre Bemühungen verdoppelt, um bereit zu sein. So war sie heute von der Lektüre ihres Victor Hugo gefesselt.
Der Graf kam unerwartet heran und riß sie aus ihren Tagträumen.
»Die Jungen!« rief er, als er näher kam. »Wo sind die Jungen?«
Sie hatte keine Ahnung, was geschehen war, aber die Dringlichkeit in seiner Stimme war nicht zu überhören. Verzweifelt sah sie sich um. Als sie die Kinder zuletzt wahrgenommen hatte, hatten sie in der Nähe gespielt ... aber wann? Vor einer Viertelstunde? Oder war es länger her? Sie war nicht sicher. Es war ein ruhiger Herbsttag. Sie waren einfach da gewesen, bei dem umgestürzten Baumstamm, und sie hatte keinen Grund gehabt, sich besondere Sorgen zu machen; sie spielten immer im Wald. Aber in einem schrecklichen Augenblick voll panischem Schuldbewußtsein wurde ihr klar, daß sie keine Ahnung hatte, wann sie sie zuletzt gesehen hatte oder wohin sie gelaufen sein konnten.
Das große Wildschwein stürmte krachend durch ein Dickicht von Krüppeleichen. Die Kugel hatte ihm eine Rippe gebrochen und einen Lungenflügel durchbohrt. Lebenswichtige Arterien hatte sie verfehlt, aber die Lunge füllte sich allmählich mit Blut. Der Atem des Tieres ging hitzig und mühsam, und die Anstrengung der Flucht würde das Ende um so früher eintreten lassen. Aber noch kam das Ende nicht – noch eine ganze Weile nicht. Der Keiler sammelte sich und trabte in einem wahnsinnigen Zickzacklauf voran, weg von seinem Verfolger.
Nach einigen Augenblicken blieb er stehen, mit wogender Brust und rasendem Herzschlag. Er war ein massiges, scheußliches Tier. Noch im Todeskampf waren seine Sinne hellwach, er lauschte, schnupperte, sicherte. Seine Haltung war eine einzige Drohung. Die Ohren lagen flach am Kopf, und die Schnauze war dicht über den Boden gesenkt. Altgewohnte Reflexe ließen ihn die oberen und unteren Hauer zusammenschlagen, um sie zu schärfen. Niemand konnte vorhersehen, was ein Keiler unter diesen Umständen tun würde. Er hatte keine Furcht, sondern erwog die Alternativen und suchte die beste Möglichkeit, am Leben zu bleiben. Er könnte sich auf die Lauer legen und ein Duell auf Leben und Tod mit seinem Verfolger erzwingen. Wenn keine Hunde und Pferde im Spiel wären, könnte er fliehen. Schwer verwundet und von Sinnen vor Schmerzen, könnte er sich als vollends unberechenbar erweisen – sich gegen einen anderen Keiler oder sonst etwas auf seinem Weg wenden.
Der Gejagte lauschte und hörte den Jäger. Der Mann stürmte Hals über Kopf durch den Wald, und seine Schritte stampften schwer auf dem Laubpolster, das den herbstlichen Waldboden bedeckte. Er hatte die blutige Spur aufgenommen, voller Erregung, das Gewehr schußbereit. Ungestüm brach er durch eine niedrige Hecke; sein Fuß verhakte sich im Gestrüpp, und er stolperte. Mit großer Mühe hielt er sich auf den Beinen, aber am kritischen Punkt zwischen Laufen und Fallen sah er den Keiler. Er hatte gewußt, daß er nah an ihn herangekommen war, sehr nah. Und in diesem Augenblick wußte er, daß er verloren hatte, denn sein Gewehr war nach unten gerichtet und vom Körper weggestreckt in dem Bestreben, das Gleichgewicht wiederzufinden.
Der Keiler stürmte ihm entgegen. Der Jäger riß das Gewehr hoch und feuerte, ohne zu zielen, aber er tat es um einen Lidschlag zu früh. Die Kugel traf den Keiler in die Schulter, aber das rasende Tier war nicht mehr aufzuhalten. Mit einem einzigen mächtigen Hieb riß es dem Jäger den Leib vom Nabel bis zum Hals auf. Der Mann war tot, bevor er zu Boden fiel.
Atemlos blieb der Keiler stehen, um sich zu erholen. Die neue Wunde pochte und blutete. Er keuchte, und er bewegte den Kopf auf und ab, wie um das Feuer in seinem Leib zu löschen. Nach einigen Augenblicken setzte er sich in Bewegung und rannte weiter, nur fort, irgendwohin. Er trat auf den stählernen Gewehrlauf und verbog ihn. Gehemmt durch seine Wunden, rannte er stockend, aber immer noch kraftvoll.
Auf einer Lichtung hielt er wiederum inne. Er hatte etwas Neues gehört, etwas Beunruhigendes. Mit wütenden roten Augen funkelte er in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war. Sein Blick war weniger scharf als sein Gehör und sein Geruchssinn, aber durch Dunst und Schmerz und Todespein erkannte der Keiler dennoch die zwei kleinen Jungen, die am Fuße eines Baumes spielten. Er senkte den Kopf und griff an.
Zur ungeheuren Erheiterung seines Cousins Paul pinkelte Moussa soeben auf einen Ameisenhaufen. In hellen Scharen krabbelten schwarze Ameisen herum, um dem Strom zu entgehen; sie verschwanden in Löchern oder unter Blättern oder rannten davon, so schnell sie konnten. Rasch trat Paul neben ihn, und gemeinsam ließen sie eine ganze Armee auseinanderstieben und schauten entzückt zu, wie Ordnung und Zielstrebigkeit sich in ein schlammiges Chaos verwandelten. Einige, stellte Paul voller Schadenfreude fest, waren nicht annähernd schnell genug.
»Die Laus!« krähte er und tat sein Bestes, eines der kleinen Tiere zu ertränken. »Sollte mal schwimmen lernen!«
»Oder sich einen Schirm besorgen!« Moussa lachte.
»Oder ein Boot!« Sie kicherten und zielten und pinkelten, bis sie versiegten.
Die Jungen waren beide sechs Jahre alt. Sie hatten sich von Moussas Mutter fortgeschlichen; sie kannten diesen Wald gut und waren hier in ihrem eigenen Königreich, das kein Erwachsener kannte, keiner außer Gascon, ein Bedienter des Grafen. Eine wuchtige Eiche barg ihr geheimes Baumhaus. Tatsächlich war es gar kein Baumhaus, sondern ein prächtiges Schloß mit Aussichtstürmen und Fenstern und Brüstungen, und von dort aus konnten sie die Kutschen beobachten, die auf der Straße jenseits des Sees vorüberfuhren. Manchmal war der Kaiser selbst zu sehen, der mächtige Napoleon III., und er kam so dicht heran, daß sie die fein gezwirbelten Spitzen seines Schnurrbarts erkennen konnten. Dann war er umgeben von einer prächtigen Eskorte der Cent Gardes in ihren blauen Waffenröcken mit federgeschmückten Helmen und blitzenden Reiterstiefeln, und alle saßen in prunkvollen Kutschen oder auf herrlichen Pferden. Oder sie sahen womöglich die Kaiserin Eugénie mit ihren Stallmeistern und Herren und Damen des Hofes, eine elegante Prozession von Troddeln und Federn und Samt und Spitze.
Es war eine durchaus erhabene Warte. Hier, in ihrem eigenen Reich, schauten die Jungen auf den Kaiser hinunter und regierten die ganze bekannte Welt.
Gascon hatte ihnen das Ganze gebaut, aus Brettern und Planken, die er auf dem Anwesen zusammengetragen hatte. Die Jungen hatten das Innere mit samtenen Draperien ausgestattet, die sie im Schlafzimmer von Pauls Mutter Elisabeth gefunden hatten. Sie ahnte nicht, was aus ihnen geworden war, und Gascon verriet es nicht, und das war gut so, denn was die Jungen und die Eichhörnchen von den Draperien übrigließen, hätte man im Hause nicht mehr gebrauchen können. Die Jungen verbesserten die Einrichtung mit einem Stuhl, dann mit zwei Stühlen und dann mit einem Beistelltisch und einer Messinglampe aus der Bibliothek des Grafen, die sie aber nicht anzünden durften, Gascon hatte es ihnen verboten. Sie waren dabei, den Baum mit einer Kiste voller Bücher aus der Bibliothek des Grafen zu erklettern, als Gascon dem Unternehmen einen Riegel vorschob. Er wußte, wo der Graf die Grenzen zog.
Eine Leiter zu diesem Schloß gab es nicht, nur verborgene Handgriffe und Trittstellen, die man einfach kennen mußte. Moussa und Paul kannten sie natürlich, und Gascon auch, und zusammen bildeten sie die gesamte Mitgliederschaft des Club de la Grande Armée. Sie hatten heimliche Sitzungen und geheime Losungswörter, und ihre Festung war gut bewaffnet. Gascon hatte fünfzehn Jahre mit dem Ersten Lanzenreiter-Regiment in Algerien gekämpft. Er kannte alle Waffen und wußte, wie man sie benutzte, und er hatte für die Bestückung des Arsenals in der Burg gesorgt, einer prächtigen Sammlung von Holzschwertern, Rindenschilden und Dolchen aus Eiche. Er zeigte ihnen, wie man die Schwertgriffe mit Schnur umwickelte, damit sie gut in der Hand lagen, und wie man die Rinde auf dem Schild so schichtete, daß auch die Hiebe des mächtigsten Schwertes harmlos davon abglitten. Sie hatten Scheiden für die Dolche und Helme aus Milchkannen.
Er erzählte ihnen Geschichten, während sie an der Burg arbeiteten, Geschichten aus alten Zeiten, von Rittern und Drachen, von fernen Orten und großen Schlachten zwischen Königen und Päpsten und Kaisern. Stumm und mit großen Augen saßen sie da, wenn er ihnen von der Sahara erzählte, von Derwischen, Teufeln und Dschinns. Sie lachten über seine Zauberkunststücke. Er konnte blanke Münzen hinter ihren Ohren erscheinen lassen und Grashüpfer aus ihrem Bauchnabel holen.
Gascon lehrte sie klettern und schwimmen. Stundenlang hob er mit ihnen einen Graben für ihr Schloß aus. Die Jungen halfen mit, und im Laufe des Sommers wurde dieser Graben immer weiter vervollkommnet; er wand sich in einem großartigen Ring um den Baum, und an Brücken aus Ästen wurde die Parole verlangt. Und auf dem Grund des Grabens fanden sich sorgsam arrangierte Steinansammlungen, die sich – wenn man nur richtig hinschaute – in Krokodile verwandelten, die Unbefugte, Steuereinnehmer und Ritter aus dem Reich des Bösen fraßen. Manchmal bedeckten sie den Graben mit Ästen, Blättern und Erde und verwandelten ihn so in das Schloßlabyrinth, ein Gewirr von Gängen mit geheimen Fluchtluken und Gängen, die hierhin und dorthin führten. An der Oberfläche war dann fast nichts zu sehen. Und noch in der vergangenen Woche hatte Gascon ihnen eine neue Kostbarkeit geschenkt: Ein Seil hing jetzt von einem Ast des Baumes. Es war mit einem Steigbügel verknotet, und sie konnten damit über den See hinausschwingen und nach Piraten Ausschau halten. Gascon sagte, eines Tages würden sie lernen, hinauszuschwingen und loszulassen, und dann würden sie bis zum Wasser fliegen können.
Das alles war nicht so oberflächlich, wie es den Anschein haben konnte. Die Spiele und Phantastereien hatten Methode, und es stand ein Plan hinter den Geschichten von Verliesen und Schurken. Der Graf hatte Gascon seine Ziele für diese Phase in der Erziehung der Jungen sorgfältig auseinandergelegt, und dieser kam seinem Herrn nur zu gern entgegen, denn er liebte die Jungen, und ihr Spiel machte ihm großen Spaß. Geschickt verwob er das Wissen um den Wald mit allerlei Zauberei, und auf hundert gefährlichen Missionen, bei denen sie Ungeheuern und Dieben nachstöberten, arbeitete er daran, die Gewandtheit der Jungen und ihr Verantwortungsgefühl zu entwickeln. Vielleicht war Gascon derjenige, dem es am meisten Spaß machte, denn es weckte Erinnerungen an seine eigene Kindheit im Südwesten Frankreichs, wo er nicht das Glück gehabt hatte, einen Vater wie den Grafen zu haben oder auf einem Anwesen wie diesem zu wohnen.
Alles in allem, darin waren sich die Mitglieder des Club de la Grande Armée einig, war die Welt vollkommen und ihr Königreich noch besser.
Moussa und Paul wandten sich von den vernichteten Ameisen ab, um den Graben zu überqueren und in ihre Burg zu klettern.
Paul hörte es zuerst, ein dunkles, fernes Grollen wie Donner. Er drehte sich um und sah es: Haare und Hufe und Hauer, die sich ihnen grunzend und raschelnd durchs Laub näherten. Es stürmte geradewegs auf Moussa zu. Paul hielt es für einen Drachen. In seiner Phantasie sah er es fliegen; er sah das Feuer in seinen Augen und die Mordlust in seinem Herzen. Er schrie. Es war ein Drache.
Moussa befand sich zwischen Paul und dem Keiler. Er sah Pauls ausgestreckten Zeigefinger und das Entsetzen in seinem Blick. Und dann sah auch Moussa den Keiler und erstarrte.
Erwachsene Männer konnten jahrelang lernen, wie man Wildschweine jagte, und die nötigen Lektionen erforderten einen schrecklichen Preis, der in Blut und Mühen zu entrichten war. Sie konnten die nötigen Waffen bereithalten und sich mit Kameraden und Pferden und all dem Schutz umgeben, den der Mensch gegen die Bestie aufbringen konnte. Und schließlich, wenn der Augenblick käme, wenn alle Vorbereitungen und alles Lernen endlich auf die Probe gestellt werden sollten, konnte auch dem besten Mann das Herz in die Hose fallen, wenn der Keiler herankam, um die Rechnung zu begleichen. Mehr als einer war schon gestorben in diesem Augenblick, da Angst und Übung zusammenprallten und die Fähigkeit zum entschlossenen Handeln auf die Probe stellten.
Von zwei Jungen konnte man nicht erwarten, daß sie etwas anderes taten, als stehenzubleiben und entsetzt dem Tier entgegenzustarren, das da auf sie zugestürmt kam, und abzuwarten, was immer jetzt kommen mochte. Nur in Gascons wildesten Geschichten hatten sie je von einer solchen Kreatur gehört, und nicht einmal er hatte ihnen etwas so Grausiges geschildert.
Und so zeigte Paul eine erstaunliche Geistesgegenwart, als er jetzt tat, was er tat.
»Lauf weg!« schrie er.
Moussa blieb wie gelähmt stehen.
»Lauf weg!« schrie Paul noch einmal, aber es half nichts. Und kurz bevor der Keiler seinen Cousin erreicht hatte, sprang Paul vor und stieß Moussa, so fest er konnte, auf ihren Graben zu, ehe er selbst hineinsprang.
Der Stoß rettete Moussa das Leben, denn sonst wäre der Keiler mit gesenktem Kopf gegen ihn gerannt und hätte ihm den Bauch aufgerissen. So aber streifte das Untier ihn nur an der Seite – immer noch wuchtig genug, um Moussa in die Luft zu schleudern, so daß er glatt über den Graben flog. Der Junge landete drüben und sackte gleich zusammen, bewußtlos und blutend.
Der Keiler hielt jäh in seiner Attacke inne. Er stand am Rande des Grabens, und unten lag Paul. Der Junge starrte hinauf und sah den furchtbaren Kopf mit Zähnen und Hauern. Der Mut hatte ihn verlassen, und er konnte sich nur noch wimmernd zusammenkrümmen.
Die Verwundungen des Keilers wurden immer schlimmer, aber ein furchterregendes Tier blieb er dennoch; das Adrenalin erweckte tief verborgene Kraftreserven. Sterben würde er nicht – noch nicht. Der Graben vereitelte seinen Angriff; wie rasend lief der Keiler hin und her und suchte nach einem Weg hinunter zu Paul oder hinüber zu Moussa.
Auf der anderen Seite des Baumes sah der Keiler festen Boden.
Dort führte ein Pfad zum Ziel seiner Wut.
Er senkte den Kopf und begann zu laufen.
Zur selben Zeit kehrte Monseigneur Murat, der Bischof von Boulogne-Billancourt, auf der anderen Seite des Sees nach einer Audienz bei Kaiserin Eugénie zu seinem Schloß zurück. Er war sehr zufrieden. Die Audienz war vorzüglich verlaufen. Unter all den sorgenvollen Seelen in den Tuilerien war ihre die fügsamste, katholisch und gottesfürchtig wie keine, und keine war seinen Überredungskünsten so zugänglich wie sie. Und jetzt hatte sein Einfluß auf sie ein neues und ganz erhabenes Ausmaß erreicht. Sie hatte ihm einen internationalen Fonds anvertraut, der für den Wiederaufbau der Kirche vom Heiligen Grab eingerichtet wurde. Er konnte sein Vergnügen kaum bezähmen. Sie hatte es vor zahllosen Zeugen getan, und deren Erzählungen würden sein Ansehen in sämtlichen Salons von Paris befördern. Ihr Vertrauen in ihn würde es ihm, einem Mann, der ohnedies ein Meister in diesen Dingen war, noch weiter erleichtern, seinen Einfluß zu verkaufen und Gefälligkeiten zu erweisen. Er hatte das Tuilerien-Schloß größer verlassen, als er ihn betreten hatte.
Es war ein schöner Tag, sonnig, frisch und mit herbstlichen Farben gesegnet. Zur Feier des Erfolgs wies er seinen Kutscher an, die neue Straße durch den Bois de Boulogne zu nehmen. Der Kaiser schätzte diesen Waldpark ja sehr; lange hatte er sich mit dessen Planung beschäftigt und sich bei der Ausführung noch um die winzigsten Details gekümmert. Es würde noch ein paar Jahre dauern, bis der Park vollendet wäre, aber schon liebte ihn ganz Paris, und niemand mehr als der Bischof, an dessen Diözese er grenzte.
Seine Kutsche war prachtvoll. In ganz Frankreich gab es nur wenige, die ihr gleichkamen, und dabei war dies nur sein Schönwettergefährt. Für unfreundliche Witterung hatte er die gleiche noch einmal mit Dach, und in seiner Remise standen noch sechs weitere. Die Kutsche rollte auf vergoldeten Rädern, deren Speichen geformt waren wie Engelsflügel. Sie war mit vier Pferden bespannt; Straußenfedern wippten auf ihren Geschirren, und sie trugen seidene Polster auf dem Rücken. Die Karosse selbst war aus Messing und Rosenholz, verziert mit Intarsien aus Perlmutt. An der Rückseite befand sich eine goldene Abbildung des bischöflichen Wappens, und an den Seiten, über den Rädern, gut geschützt unter einer achtfachen Schicht von glänzendem Lack, prangten ölgemalte Miniaturen, die verschiedene Szenen darstellten: das letzte Abendmahl, die Bergpredigt, der hl. Antonius, wie er von den Dämonen gepeinigt wird, und der hl. Petrus, wie er den Schlüssel zum himmlischen Königreich in Empfang nimmt. Vierzehn der besten Maler und Handwerker der Gegend hatten mehr als ein Jahr gebraucht, um diese Kutsche zu bauen, und die Diözese hatte hunderttausend Francs dafür bezahlen müssen. Es kam selten vor, daß man für den Bischof von Boulogne-Billancourt irgendwelche Kosten scheute, ob es um Kutschen, Gewänder und seine Privatresidenz oder um die Vergnügungen ging, mit denen er sich selbst und diejenigen seiner Gäste überhäufte, die es verdient hatten.
Die Kutsche war nur ein kleiner Widerschein seines Prälatenappetits, der so gewaltig war wie der Mann selbst. Er war von ungeheurer Gestalt, und seine violetten Gewänder taten wenig, seine Ausmaße zu verhüllen. Um den Hals trug er ein goldenes Bischofskreuz, und fabelhafte Ringe schmückten seine fetten Finger: Opale, Diamanten und Rubine.
An diesem Tag saß der Bischof allein auf dem Rücksitz, tief versunken in den üppigen dunkelroten Samtpolstern, die speziell für seine Körpermassen angefertigt worden waren. Er verspeiste ein gebratenes Huhn aus einem Weidenkorb und schenkte sich Wein aus einer Flasche ein, die in einem eigens konstruierten Reisebehälter stand. Geräuschvoll leckte er sich die Finger, ohne auf die Leute am Wege zu achten, die seinen Blick oder eine kleine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken versuchten, während er vorüberfuhr.
Jäh hielt der Kutscher den Wagen an. Er hatte den Keiler und dann auch die Jungen gesehen, und auch die schreckliche Szene, die sich jenseits des Gewässers abspielte. Erst traute er seinen Augen nicht und glaubte, er habe eine Fata Morgana gesehen. Aber da war es.
»Was ist los?« Der Bischof war verärgert. Er hatte sich Wein auf den Mantel gespritzt.
»Da ist ... es ist ein Wildschwein, Euer Gnaden, ein wilder Eber!« In höchster Erregung streckte der Kutscher den Finger aus. Gleichgültig hob der Bischof den Kopf und sah das Tier; es war keine fünfzig Meter weit entfernt.
»Ja, ja«, sagte er. »Ein Wildschwein, in der Tat. Jetzt fahr schon weiter.«
Der Kutscher riß eine Büchse aus ihrer Halterung an den Bodenbrettern der Kutsche. Er war stets bewaffnet, denn man konnte nie wissen, ob dem Bischof keine Gefahr drohte. Die Diözese umfaßte zweiundvierzig Pfarrgemeinden und siebenundfünfzig Unterpfarreien in einem wilden Hügelland, wo die Diebe keinerlei Respekt vor hohen Ämtern und mächtigen Personen zeigten.
»Was machst du denn da?« fragte der Bischof, als er sah, daß der Mann zur Waffe gegriffen hatte. »Ich habe gesagt, du sollst weiterfahren.«
»Aber Euer Gnaden! Die Kinder!« Der Kutscher ließ die Zügel fahren und handelte rasch. Er hätte gerade genug Zeit, um einen Schuß abzufeuern, vielleicht zwei. Er mußte es versuchen.
Der Bischof schaute über den See und sah Paul und Moussa. Er erkannte sie sofort, denn Moussas Kleidung war anders als die Kleidung anderer Kinder. Alles an Moussa war anders als bei anderen Kindern. Alles an dieser Familie war anders als bei anderen Familien. Alles an de Vries ärgerte den Bischof. Vor allem die Mutter, dieses gottlose Weib, das sein Blut zum Kochen brachte: die Teufelin, die zu falschen Göttern betete und sich nicht bekehren lassen wollte und deren Ehe nicht gesegnet werden konnte, solange sie an ihren heidnischen Gebräuchen festhielt. Ein Luder war sie, ein Luder, das sich über ihn lustig machte, jawohl, sich in seiner eigenen Diözese über ihn lustig machte, vor den Priestern und den Curés, sogar vor den Sous-curés, sich über ihn lustig machte vor Gott mit ihren fremdländischen Augen und diesem gezierten, spöttisch verzogenen Mund, sich über ihn lustig machte mit ihrer Weigerung, nachzugeben, zu bereuen, ihr sündhaftes Leben aufzugeben und den Herrn Jesus Christus anzunehmen. Gleichgültig und zugleich genüßlich machte sie sich über ihn lustig. Seine Hände zitterten, und sein Gesicht rötete sich jedesmal, wenn er sie sah, ja, wenn er überhaupt einen von ihnen sah.
Ja, dachte der Bischof, diesen Jungen kenne ich gut.
Der Kutscher legte an und zielte.
»Leg das Gewehr weg.«
»Euer Gnaden?« Er war nicht sicher, ob er richtig gehört hatte. Er richtete sich auf seinem Bock auf und spähte über Kimme und Korn, um den Keiler zu erfassen. Der Schuß war schwierig, aber nicht unmöglich.
»Du sollst das Gewehr weglegen, habe ich gesagt. Nicht schießen. Du erschreckst die Pferde.«
Der Kutscher geriet zusehends in Panik. Träumte er denn? Der Keiler würde die Kinder im nächsten Augenblick erreicht haben!
»Die Pferde?« fragte er verdattert. »Euer Gnaden, die Kinder werden sterben! Wir haben keine Zeit mehr!«
»Gottes Wille geschehe«, sagte der Bischof.
»Aber es sind Kinder!« flehte der Kutscher. Er hatte das Gewehr noch an der Schulter und hätte immer noch schießen können, aber sein Finger lockerte sich, denn er kannte den Tonfall des Bischofs. Die Debatte war beendet.
»Ja, es sind Kinder. Auf Seine Kinder muß der Herr besonders achtgeben.« Der Bischof verfolgte ungerührt die Szene, die sich jenseits des Sees abspielte. »Doch wohlgemerkt: Du siehst dort nur ein Gotteskind vor dir. Nur eines. Gott wird es erretten. Das andere ist ein Bastard, ein halbblütiges Kind der Sünde. Und jetzt wird es der Teufel holen.«
Drüben hatte der Keiler Moussa erreicht und schleuderte ihn durch die Luft, als wäre er eines der bischöflichen Kissen. Man sah es, ohne etwas zu hören. Der Kutscher stöhnte auf und bekreuzigte sich. Das Gewehr sank herab.
Der Bischof langte in den Korb, um ein neues Stück Huhn herauszunehmen.
Das war ein Zeichen. Ein Keiler war erschienen. Ein großer, mit Hörnern und gespaltenen Hufen.
Der Graf war am anderen Ende des Sees. Er galoppierte am Ufer entlang und rief nach den Jungen, als er Pauls Aufschrei hörte. Sofort riß er sein Pferd herum und zog seine Pistole, wütend, weil er sein Gewehr nicht mitgenommen hatte. Das Land hier gehörte ihm, und er kannte es gut. Seit Jahren hatte man so nah bei Paris kein Wildschwein mehr gesehen, doch gleichwohl verfluchte er sich dafür, daß er so unvorbereitet und achtlos gewesen war. Paris hin, Paris her, er hätte es besser wissen müssen. Dies war noch immer ein Wald, und ein Wald war voller Überraschungen, die für den Unachtsamen tödlich sein konnten. Er hatte sein Leben damit verbracht, zu lernen, daß man die Vorsicht nicht vergessen durfte, und Leute zu begraben, die sie doch vergessen hatten. Und jetzt war es Moussa, der für seine Dummheit womöglich bezahlen mußte.
Mon Dieu, nicht mein Sohn!
Vor sich zwischen den Bäumen sah er die Lichtung, den Keiler und die große Eiche, aber nicht die Jungen. Das Tier war dabei, um den Baum herumzulaufen. Als Henri näher kam, erkannte er Moussas reglose Gestalt auf dem Boden. Das Grauen stieg ihm in die Kehle, als er weitereilte, wilder, schneller, und dann drang ein machtvolles Brüllen aus ihm hervor, ein heiserer Schrei, der den Keiler ablenken sollte, während dieser erneut auf Moussa losstürmte.
Es blieb ihm keine Zeit mehr, mit der Pistole zu zielen, keine Zeit, sie abzufeuern, er hatte keine Sekunde mehr zu verlieren. Roß und Reiter flogen über den Graben. Das Wildschwein wandte sich von Moussa ab und hob den Kopf dem Pferd entgegen, und in einem gewaltigen Kaleidoskop aus Beinen und Hauern und Lärm und Armen und Staub stürzten alle drei – Pferd, Reiter und Keiler – zu Boden.
Einen Augenblick lang war es still. Die Kämpfenden waren halb betäubt. Das Pferd hatte einen Stoßzahn in die Brust bekommen und litt Todesqualen. Der Keiler war durch den Zusammenprall zurückgeworfen worden und lag auf dem Rücken, benommen und schwer keuchend. Der Graf hatte sich im letzten Moment zur Seite rollen können, um nicht von seinem Pferd zerquetscht zu werden. Sein rechtes Bein war gebrochen, und es hatte ihm den Atem verschlagen. Die reine Willenskraft hatte dafür gesorgt, daß seine Finger die Pistole weiter umklammert hielten. Als der Staub sich jetzt legte, war es wiederum seine Willenskraft, die ihn mit dem Keiler um Gleichgewicht und Vorteil kämpfen ließ. Er versuchte hochzukommen, aber sein Bein klemmte unter dem Pferd; er stieß einen Schmerzensschrei aus und richtete sich auf, so gut er konnte. Der Schock trübte seinen Blick, dennoch suchte er sein Ziel, das hinter der Flanke seines Pferdes verborgen lag. Er hörte, wie der Keiler sich zappelnd mühte, und sah Moussas reglose Gestalt keine drei Schritt weit entfernt. Noch einmal versuchte er verzweifelt, sich zu befreien. Eine Woge von Übelkeit und Schwindel überkam ihn. Seine Hand wurde schlaff, die Augen schlossen sich, und er sackte bewußtlos zusammen.
Der Keiler kam mühsam wieder auf die Beine und schüttelte sich. Er war nicht mehr der Gejagte, sondern der Jäger, aber es war nicht Bosheit, die ihn trieb, sondern das Verlangen, am Leben zu bleiben und zu vernichten, was vernichtet werden mußte, damit er überleben konnte. Er hörte ein Geräusch, wandte sich um und schaute einer neuen Bedrohung ins Auge.
Aus nächster Nähe feuerte Serena.
Auch sie hatte Pauls Schrei vernommen, und während sie zu Pferde über das freie Feld flog, sah sie, wie die grauenhafte Szene sich abspielte. Noch nie hatte sie solche Wildheit, solche Entschlossenheit gesehen. Und dann stand sie über ihm, diesem Tier, das nicht sterben wollte, und sie zielte auf seinen Kopf und schoß. Die Beine des Keilers knickten weg, und er sackte ein. So verharrte er. Es folgte ein Augenblick der Stille, in dem nicht klar war, ob er stürzen oder einen neuen Anlauf versuchen würde. Noch einmal wollte er sich hochkämpfen; seine Hufe scharrten die Erde auf, sein Atem ging rasselnd, rauschend wie der Sturm in einem Blasebalg, und der Kopf schwankte hin und her. Die Hauer stießen ins Leere, hierhin, dahin, in die Luft. Er war immer noch nicht bereit aufzugeben.
Serena schoß noch einmal und noch einmal. Ihre Hand war ruhig. Sie hatte keine Angst.
Das Tier schaute beinahe spöttisch zu ihr auf, als wollte es sagen: Du kannst mich nicht besiegen. Ich gestatte dir nicht, mich zu besiegen.
Aber dann endlich stieß die Kreatur ein Stöhnen aus, schloß die Augen, sank auf den Bauch und verendete.
Am späten Nachmittag holten einige Mitglieder der Jagdgesellschaft einen Wagen und fuhren damit hinaus, um die Leichen des Jägers und des Keilers zu holen. Sechs Männer waren nötig, um das Wildschwein auf das Gefährt zu wuchten. Man legte den Kadaver draußen vor den Stall, und Gascon ließ ihn mit einer Plane bedecken, um die Hunde abzuhalten. Ein Strom von Besuchern zog vorbei und lüftete die Plane, um mit stummer Ehrfurcht einen Blick auf das Tier zu werfen. Sie maßen die Hauer und zählten die Wunden. Danach gingen sie in die Küche und erkundigten sich nach dem Befinden des Grafen und seines Sohnes. Madame Le Havre, die Köchin, sorgte dafür, daß alle etwas zu essen bekamen, und scheuchte sie dann wieder hinaus.
Dr. Fauss traf mit Verspätung ein. Er war ein alter Mann, wie alt, das konnte man unmöglich erkennen, aber er behandelte die Familie de Vries schon länger, als irgend jemand sich zurückerinnern konnte.
Er hatte einen langen Tag hinter sich. Nach einem arbeitsreichen Vormittag in der Stadt, in dessen Verlauf er Hustenleiden und Hysterien, Prellungen und Schrammen behandelt hatte, hatte er die Nachricht von dem Keiler erhalten. Gascon war in der Kutsche des Grafen zu ihm gekommen, und in der Abenddämmerung hatte der Arzt das Haus betreten.
Der Hauptteil des Herrenhauses war zweihundert Jahre alt. Es war zweigeschossig, aus Feld- und Ziegelsteinen erbaut, ursprünglich als Erweiterung zu einem sehr viel kleineren Gebäude, das im Jahre 1272 vom Grafen Auguste de Vries auf einem von Ludwig IX. geschenkten Grundstück errichtet worden war. Die Mauern waren dick und mit Efeu bewachsen. Es war ein behaglicher Landsitz, auf dem Henri wie auch sein Bruder Jules aufgewachsen war, und beider Familien bewohnten das Haus jetzt. Nach dem Tode des Vaters waren Haus, Land, Adelstitel und alles Geld formal an Henri gefallen, denn er war der ältere Bruder.
Es war ein wunderbares Haus, das anscheinend ausschließlich zum Vergnügen und zur Unterhaltung von Kindern erbaut worden war, voller Korridore, Treppenhäuser und Verstecke. Im Obergeschoß, zwischen der Mauer und der Schräge des Außendaches, gab es einen Geheimgang. Er führte von einem Ende des Hauses bis zum andern und verband die Schlafzimmer miteinander; durch verborgene Türen hinter der rückwärtigen Täfelung wuchtiger Wandschränke konnte man hineingelangen. Der Vater des Grafen hatte seinem Sohn diesen Gang gezeigt, und dieser hatte ihn Moussa gezeigt. Henri war jedesmal entzückt, wenn er aufgeregtes Tuscheln und unterdrücktes Kichern hörte, derweil jemand von einem Ende des Ganges zum anderen schlich.
Die Zimmer waren groß und informell. Die Küche war der Mittelpunkt des Hauses, und hier war es immer behaglich in der Wärme eines eisernen Kochherdes, der niemals ausging. In jedem Zimmer gab es einen Kamin. Wenn der Graf nicht auf Reisen war, verbrachte er den größten Teil seiner Zeit in der Bibliothek, die eine der schönsten Büchersammlungen Frankreichs enthielt. In den Tagen der Finsternis nach der Revolution wäre diese Bibliothek beinahe vernichtet worden; damals hatten wütende Meuten allenthalben die Herrenhäuser gestürmt, die Bücher verbrannt und denen die Köpfe abgeschlagen, die sie lasen. Zwar waren auch hier Bücher verlorengegangen, aber das Haus und seine Bewohner glücklicherweise nicht. In den Jahren seither war die Sammlung wieder gewachsen, und unter Henri hatte sie einen Glanz erreicht, der den früherer Zeiten noch übertraf. Jetzt waren die Regale gefüllt mit Papieren, ledernen Bänden und den Erinnerungen eines Lebens, das mit Reisen in Gegenden verbracht worden war, von denen die meisten Leute noch nicht einmal gehört hatten. Es gab Schnitzereien, Masken, Amulette und Elfenbeinstatuetten, und im Zentrum des Raumes stand die einzige Extravaganz, die der Graf besaß: ein großer Globus, in London handgemalt von den besten Kartographen der Welt. Sein Durchmesser betrug fast einen Meter, und Ozeane, Kontinente und Pole prangten in prachtvollen Farben. Mit großem Vergnügen deutete Henri auf Stellen in Afrika oder Asien, die nur schlecht oder gar nicht eingezeichnet waren, um dann genau zu schildern, was sich dort befand. Serena konnte es auch, und besser als er, wenn es um die Sahara ging, denn aus der Sahara stammte sie.
Dr. Fauss kam aus dem großen Schlafzimmer und schloß leise die Tür hinter sich. Er wollte gehen.
Leise klopfte er an die Tür des Jungenzimmers.
»Herein«, sagte eine leise Stimme.
In dem Zimmer standen zwei Betten. Neben dem einen saß Serena und hielt Moussas kleine Hand in der ihren. Im anderen Bett lag Paul. Beide Jungen schliefen.
»Ah, bon, Madame la Comtesse, da habe ich Sie gefunden.« Serena schenkte ihm ein müdes Lächeln. Sie wollte wissen, wie es Henri ging.
»Ihr Gemahl hat ebensoviel Glück wie Kraft. Ich habe das Bein gerichtet und geschient. Er wird einen Monat lang stillsitzen müssen, während es heilt. Ich nehme an, das wird ihn mehr plagen als der Bruch selbst. Ich lasse Ihnen noch ein Mittel da, bevor ich gehe. Gegen die Schmerzen geben Sie ihm Cognac.«
Sie nickte. »Und Moussa?«
Der Arzt zog sich einen Stuhl ans Bett, setzte sich und fühlte prüfend nach der Stirn des Jungen.
»Gräfin, ich muß gestehen, daß ich erstaunt bin.« Er schlug die Bettdecke zurück. Die kleine Gestalt des Jungen war übel zugerichtet. Ein langer Riß unterhalb der Rippen war mit groben schwarzen Stichen vernäht. »Er müßte tot sein. Der Hauer hat ihn hier gestreift. Ein Wunder, daß er nicht tiefer eingedrungen ist.« Er deutete auf einen Bluterguß, der von der Schulter bis zu den Leisten reichte. »Das wird morgen noch schlimmer aussehen. Es wird stark anschwellen. Sie müssen es kühlen.« Er deckte den Jungen wieder zu und lehnte sich auf seinem Stuhl zurück, erschöpft von den Mühen des Tages. »Das Schlüsselbein ist gebrochen, drei Rippen und ein Finger. Er hat eine Schädelfraktur und eine Gehirnerschütterung.«
»Eine ...?« Serena kannte das Wort nicht.
Der Arzt zeigte mit dem Finger an seine Schläfe. »Sein Schädel. Er ist gebrochen.« Er lächelte beruhigend. »Keine Sorge, Gräfin. Er hat einen starken Schädel. Einen Dickschädel wie sein Vater.«
In diesem Augenblick kam Pauls Mutter Elisabeth hereingestürzt. Wie immer war ihr Auftritt melodramatisch: eine Explosion von Locken und Farben und Parfüm. Sie war soeben aus der Stadt zurückgekehrt und hatte die Neuigkeit gehört, und jetzt war sie voller Panik.
»Paul!« schrie sie. »Was ist meinem kleinen Paul zugestoßen?«
»Beruhigen Sie sich, Madame.« Der Arzt war ihre Ausbrüche gewohnt. »Sie werden die beiden noch wecken. Paul ist unverletzt. Es geht ihm gut. Er ist ein Held.«
Sie eilte an das Bett, umhätschelte und umsäuselte den Jungen und bedeckte ihn mit Küssen. Paul erwachte und versuchte sich ihr zu entwinden, denn er war bemüht um seine Würde als Sechsjähriger. Als seine Mutter sich ein wenig beruhigt hatte, lächelte er. »Maman!« Strahlend richtete er sich auf. »Weißt du, was wir gemacht haben?«
»Oui, mon petit, ich habe von dem Wildschwein gehört. Du warst wunderbar.«
Paul verzog das Gesicht. Mütter hatten keine Ahnung. Das meinte er doch gar nicht.
»Nein! Wir haben auf einen Ameisenhaufen gepinkelt!«
Elisabeth verdrehte die Augen.
Bei Kerzenlicht saß Serena an Moussas Bett. Es war jetzt still im Haus, die Besucher waren gegangen, und alles schlief. Sie hatte nach Henri geschaut und sich dann neben ihrem Sohn niedergelassen. Mit dem Finger fuhr sie ihm über die Stirn und berührte ihn, wie es nur eine Mutter vermag; es war eine Berührung voller Freude über sein Leben, voller Staunen über sein Glück, voller Angst um den kleinen Körper, so wund und zerschlagen. Sie war erschöpft, aber Schlaf lag ihr fern. Ihre Gefühle waren in Aufruhr in dieser langen Nacht des Nachdenkens und durchfluteten sie abwechselnd mit Schuldbewußtsein, Erleichterung und dem Grausen vor dem, was hätte sein können.
Dies ist mein Sohn. Mein Fleisch und Blut, ein kleines Kind. Heute hatte der Tod angeklopft und keinen Einlaß gefunden. Wie leicht hätte es anders kommen können, dachte sie. Wie schnell ist ein Sohn verloren – oder ein Gemahl. Tausendmal durchlebte sie jeden Augenblick dieses Nachmittags und malte sich sinnlos aus, was hätte sein können. Obwohl er jetzt in Sicherheit war, kehrte das Grauen immer wieder zurück: ein Grauen, das ihr wie ein Kloß in die Kehle stieg, bis sie schreien wollte, ein Grauen, das ihr in der Brust hämmerte und ihr die Tränen in die Augen trieb. Ihre Empfindungen waren wild und körperlich und schwankten hin und her zwischen Übelkeit und Euphorie. Wie zerbrechlich war das Leben, wie unschuldig der Junge! Wie groß war ihr Glück!
Dies ist mein Sohn: so klein, so hilflos, so abhängig. Schon oft hatte sie dem Tod ins Auge gesehen, in der Wüste, wo das Dasein unsicher war. Den Vater verloren durch Verrat, die Mutter durch Krankheit, die Brüder und eine Schwester durch Unfall und Krieg. Das Leben war weder leicht noch gütig. Der Tod war nie willkommen, aber er war auch nie ein Fremder. Er kam, wann er wollte. Dies aber war ein ganz neues Gefühl für sie, erschreckend und anders als alles.
Dies ist mein Sohn. Sie hatte ihn im Leib getragen, sie hatte ihn gestillt und ihn wachsen sehen. Sie sah Henri in seinen tiefblauen Augen, sich selbst in seinen hohen Wangenknochen und seinem Lächeln. Er lachte gern, und sein Lachen trug Freude in ihr Herz. Stundenlang hatte sie ihn auf der Schaukel angeschoben, sie hatte Steine aus seinen Taschen geräumt und ihm geholfen, Insekten für seine Sammlung zu fangen. Sie hatte aufgeschrammte Knie und Ellenbogen behandelt und ihm zugesehen, wie er lernte, zu laufen und selbständig zu essen. Sie hatte ihn gelehrt, Tamaschek zu sprechen, ihre Muttersprache. Sie hatte ihm Kinderlieder vorgesungen und ihn getröstet, wenn die anderen Kinder sich über ihn lustig machten. Er war erst fünf gewesen, als es das erstemal passiert war. Sie hätte sich nicht träumen lassen, daß es so früh anfangen würde.
»Maman, was ist ein Halbblut?« So ratlos hatten seine Augen ausgesehen, so groß, so verletzt. Natürlich hatte keines der Kinder auch nur die leiseste Ahnung, was ein Halbblut sein mochte: Es war ein Wort, das sie bei den Eltern aufgeschnappt hatten, wenn diese sich abends unterhielten. Aber nach Kinderart verstanden sie es, Wörter grausam zu verwenden – gerade noch spielten sie fröhlich mit ihm, und im nächsten Augenblick sorgten sie dafür, daß er sich schrecklich und ausgestoßen fühlte. Es war eine doppelte Kränkung gewesen, denn das Kind hatte ihn demi-sang genannt, und das war ein Wort für Pferde, nicht für Menschen. Ein anderes Kind hatte einen Vers darauf machen können, und alle Kinder außer Paul hatten ihn gesungen.
Moussa war in Tränen ausgebrochen und weggelaufen.
Später krabbelte er auf Serenas Schoß, und sie strich ihm übers Haar und suchte nach tröstenden Worten, aber die Worte wollten sich nicht einstellen. Sie wußte, es war nicht das letztemal, daß er den Stachel des Mißfallens spüren würde, die Qual des Andersseins. Sie bekam es ja selbst jeden Tag zu spüren, seit sie mit Henri nach Frankreich gekommen war. Die Leute starrten sie an und lachten; sie tuschelten und zeigten mit dem Finger auf sie. Sie machten sich über ihren Akzent lustig und berührten ihre langen Locken, als wäre sie soeben unter einem Stein hervorgekrochen. Sie war stark, stärker als diese Leute, stark genug, um aufrecht zu stehen, ohne die Augen niederzuschlagen, und sie konnte ihrem Sohn nur sagen, was sie selbst wußte: »Es ist nicht wichtig, was sie reden. Du darfst dich nicht um sie kümmern. Du mußt stark sein.« Ihre Worte trafen auf die verständnislosen Ohren eines Fünfjährigen. Sie trösteten ihn nicht.
»Ich will nicht stark sein, Maman.« Er schluchzte bitterlich. »Ich will sein wie die andern.«
Dies ist mein Sohn: ihr Erstgeborener, ihr einziger. So hochgeboren und doch so niedrig. Ein edles Halbblut, wahrhaftig. In der Sahara wäre er ein Prinz in seinem Volk, denn bei den Tuareg wurde der Adel von der Mutter an den Sohn weitergegeben. Der Amenokal war das Oberhaupt der Tuareg, und er war ihr Bruder. Eines Tages würde Moussa vielleicht Amenokal werden, ungeachtet des französischen Blutes in seinen Adern. Und in Frankreich wäre er eines Tages ein Graf, und er würde den Mantel seines Vaters erben, ungeachtet des Tuareg-Blutes in seinen Adern. Sie schloß die Augen und versuchte sich vorzustellen, wie sein Leben verlaufen würde. Sie sah Dunkelheit, Aufruhr und Schmerz. Gefühle reichten tief, wenn es ums Blut ging.
Dies ist mein Sohn. Er trug ein Amulett um den Hals, ein Geschenk des Amenokals: einen Lederbeutel, dessen Inhalt geheim war – ein Vers aus dem Koran vielleicht, ein Stück Knochen oder ein Stück Papier mit magischen Quadraten. Der Amenokal würde nicken und sagen, es sei das Amulett gewesen, das den Keiler besiegt habe. Und Serena wußte es nicht; vielleicht stimmte es ja. Vielleicht barg es das Glück von Generationen, die Macht, zu helfen und zu heilen und zu schützen. Moussa hatte es getragen und ein Kindheitsfieber überlebt, das Dutzende andere Kinder seines Alters hatte sterben lassen. Heute hatte er es getragen und den Keiler überlebt. Der Arzt hatte es abnehmen wollen, als er Moussas gebrochenes Schlüsselbein mit einem Tuch umwickelt hatte, das er um die Schultern und unter den Armen hindurchschlang.
»Das müssen Sie dalassen«, hatte sie gesagt und seine Hand festgehalten. Sie war sonst weder religiös noch abergläubisch, und so hatte ihn die Entschlossenheit verwundert, mit der sie ihn aufgehalten hatte, aber sie hatte es getan. Vielleicht nur, weil es vom Amenokal war und sie an zu Hause erinnerte. Vielleicht, weil Moussa es vom Tag seiner Geburt an getragen hatte. Es gehörte auf die kleine Brust. Es paßte dorthin. Es war tröstlich und richtig, etwas, woran sie gewöhnt war. Und vielleicht – sie gestattete sich den Gedanken –, vielleicht kam es auf diesen Tag an. Das Amulett würde bleiben, wo es war.
Dies ist mein Sohn. Er regte sich im Kerzenschein und wimmerte vor Schmerzen. Sie beruhigte ihn und strich ihm das Haar aus der Stirn. Die Stunden vergingen, die Kerze brannte herunter, und aus der Nacht wurde Morgen. Endlich schlief sie ein und träumte von der Wüste.
Kapitel 2
Er war vom Himmel zu ihr heruntergefallen.
Henri hatte den Ballon im Dorf Bou Saada aufsteigen lassen, um den Winden zu folgen, die über das Hochplateau wehten, an der Bergkette des Atlas entlang, parallel zur nordafrikanischen Küste – Winden, so hoffte er, die ihn nach Marokko bringen würden. Er und Gascon hatten seit Wochen auf die richtigen Bedingungen gewartet, hatten jeden Tag prüfend zum Himmel geschaut, und jeden Tag hatten sie sich enttäuscht wieder abgewandt. Es hatte keinen Wind gegeben, nur äußerste Stille. Geduldig hatten sie sich um ihren Proviant gekümmert und ihre Ausrüstung erprobt, hatten alles untersucht und wieder untersucht, um sicher zu sein, daß es bereit war. Obwohl Henri nicht damit rechnete, länger als ein paar Tage in der Luft zu bleiben, war der Ballon mit Wasser und Lebensmitteln für zwei Wochen ausgerüstet. Er war ein Abenteurer, aber er war niemals leichtsinnig oder unbedacht.
Und dann endlich trat er eines Morgens hinaus, und eine kräftige Brise zerzauste ihm das Haar, und da wußte er, daß es soweit war. Er und Gascon eilten zu dem Platz, an dem ihr Luftschiff wartete. Sie füllten den Ballon zum Entzücken der erstaunten Araber, die in neugierigen Scharen jeden Tag gekommen waren, um sie zu beobachten, und die nun im Kreis hockten und Tee tranken und laut schwatzten, während die Seide sich hochwölbte und an den Leinen zerrte, die sie am Boden hielten. Endlich war das Ungetüm bereit. Henri und Gascon kletterten in den Korb, sehr zur Bestürzung des französischen Präfekten des Distrikts, der Henri im Laufe der Wochen ein dutzendmal – höflich selbstverständlich, denn schließlich gehörte der Mann ja zum Adel des Reiches – daran erinnert hatte, daß er ein großer Narr sei. Der Präfekt war außer sich vor Sorge, daß der Graf von seiner Präfektur aus in Algerien verlorengehen könnte. Es war Wahnsinn! Kein Europäer hatte je etwas Derartiges versucht. Die Fragen aus Paris würden kein Ende nehmen. Deshalb hatte er den Grafen beschworen: Konnte man die Reise nicht in Algier beginnen? Oder in Ain Sefra? Würde es seinen Bedürfnissen nicht genügen, wenn er mit dem Kamel nach Marokko reiste? Aber der Graf wollte nicht hören, und der Präfekt war niedergeschlagen und trank zuviel Absinth und sah seine Karriere vor sich, wie sie mit dem Ballon davonschwebte. Beschwörend spähte er ein letztes Mal zu Henri hinauf, als dieser die Halteleinen loswarf.
»Sie werden sterben!« weissagte er mit würdigem Ernst, als der Ballon sich von seinem Ankerplatz erhob.
»Aber nicht heute!« rief Henri fröhlich zurück, und dann winkte er zum Abschied und war verschwunden.
Er gewann schnell an Höhe und ließ die Scharen von Arabern dort unten zurück. Als der magische Aufstieg begann, stieß die Menge einen mächtigen Schrei des Beifalls und des Entzückens aus. Lautlos bewegte der Ballon sich nach Westen. Henri und Gascon sahen, wie die Menschen auf den Feldern winzig wurden, wie ihre Esel sich in Spielzeug verwandelten und ihre Häuser in kleine Schachteln. Wenn der Schatten des Ballons über sie hinwegzog, schauten die Leute hoch, und dann gerieten sie jedesmal in Aufruhr. Großes Geschrei erhob sich, manchmal von Schrecken, manchmal von Staunen erfüllt; der Ballon war zu hoch, als daß Henri und Gascon etwas hätten hören können, aber sie sahen, wie die kleinen, an die Erde gefesselten Leute gestikulierten und winkten und auf ihren Eseln im Kreis herumritten und zum Himmel deuteten. Manche verfluchten die Erscheinung, andere tanzten vor Freude, und wieder andere sanken betend auf die Knie.
Einige Stunden lang verlief alles reibungslos. Sie sahen Djelfa, dann Aflou und Ain Madhi und markierten alles auf ihrer Karte. Sie richteten sich in der ruhigen Tätigkeit des Ballonfahrens ein, betrachteten ehrfürchtig die unter ihnen vorüberziehende Landschaft und markierten Seen und Wasserläufe, die sie sahen, auf den Landkarten, die sie bei sich hatten; sie identifizierten Tiere, Vögel und Bäume und kümmerten sich um Schlepptau, Korbseile und andere Ausrüstungsteile des Ballons. Penibel registrierte der Graf die atmosphärischen Bedingungen, Windgeschwindigkeiten und Luftströmungen sowie Schwankungen von Temperatur und Druck während der Fahrt. Der Himmel war wolkenlos, so weit das Auge reichte, makellos und tiefblau. Aber am späten Nachmittag wechselte der Wind die Richtung und schwenkte nach Norden; kaum merklich erst, aber doch immer kräftiger trieb er sie auf die Berge zu, und bald würde er sie hinüberschieben.
»Wir müssen eine Entscheidung treffen, Gascon«, sagte Henri. »Wir können weiter in diese Richtung fahren«, er deutete nach Süden ins Unbekannte, »oder wir setzen ihn auf dieser Seite auf den Boden und warten auf sicheren Wind.«
Gascon spähte über die Berge hinweg. Er war schon seit Jahren bei dem Grafen und brauchte nicht erst zu fragen, was dieser gern tun würde. Es gefiel ihm, daß sein Herr ihn nach seiner Meinung fragte und ihn eher wie einen Gleichrangigen denn wie einen Diener behandelte. In dieser Hinsicht war der Graf anders als alle andern: Andere vornehme Leute pflegten einfach zu befehlen oder zu fordern. Der Graf pflegte zu fragen, auch wenn er es nicht mußte. Für Henri de Vries hätte Gascon alles getan, und mehrmals war er kurz davor gewesen, sein Leben für ihn zu lassen. Aber seine Loyalität war auch stets großzügig erwidert worden.
An jenem Tag, hoch über den Bergen des Atlas, war die Entscheidung nicht schwierig. Er teilte die Abenteuerlust des Grafen, und sie waren gut ausgerüstet. Er hatte keine Familie, nichts, was ihn zurückgehalten hätte.
»Durch Landen haben wir noch nie etwas herausgefunden, Monsieur«, antwortete Gascon.
Henri lächelte. »Ich hatte gehofft, daß du das sagen würdest.«
»Ja, Monsieur. Das weiß ich.«
»Alors, dann brauchen wir mehr Höhe.« Gascon warf Ballast ab, und der Ballon schwebte empor, wo die entgegenkommenden Winde seine Geschwindigkeit vergrößerten und sie über den Atlas trugen, hinweg über den Djebel Amour und weiter ins Unbekannte. Der Übergang war verstörend in seiner Intensität – als habe jemand eine mächtige Linie gezogen zwischen den grünen, fruchtbaren Nordhängen des Atlas und den rötlichbraunen Felsen und kargen Ausläufern auf der Südseite. Die Berge flachten zu einem Plateau ab, das Plateau wurde unversehens zu einer leuchtend goldenen Dünenkette. So schwebten sie zwischen Himmel und Erde, den Wind im Rücken, die Weite der Sahara vor sich. Sie aßen Dörrfleisch, tranken aus ihren Wasserflaschen und ließen die Welt lautlos unter sich hinwegziehen. Die Karten, die sie bei sich hatten, waren halbwegs akkurat bis zu den Bergen, denn Tausende von Franzosen hatten diese Gegend erforscht und sich dort angesiedelt. Aber nur wenige Europäer hatten sich über das Gebirge hinweg nach Süden vorgewagt, und noch weniger waren von dort zurückgekehrt. Es gab tausend Legenden, aber wenige verläßliche Erkenntnisse über das, was in dieser gewaltigen Region lag, die bei den Arabern im fruchtbaren Norden nur das Land des Durstes und der Angst hieß. Es war das Land der unzähligen Geschichten, in das sie da schwebten, bewohnt von einem geheimnisvollen Volk von Riesen, wie man erzählte. Die Araber nannten sie Tuareg, die Verstoßenen Gottes, das Schleiervolk, und wenn sie von ihnen redeten, so taten sie es mit einer Mischung aus Angst, Grauen und Bewunderung. Man kannte sie als vorzügliche Kämpfer; sie waren die Herren der Wüste und beherrschten die großen Karawanenstraßen mit ihrem niemals versiegenden Strom von Salz, Sklaven und Gold.
So schwebten sie den Legenden entgegen, die vor ihnen lagen, und als die Sonne zum Horizont sank, erlebten sie Sonnenuntergang und Mondaufgang gleichzeitig. Es verschlug ihnen den Atem, als der Mond voll, golden und prächtig heraufkam, während die Sonne rot lodernd in den sandigen Dunst am Horizont eintauchte. Wie gebannt standen sie im Korb und schauten von Horizont zu Horizont, um nicht einen Augenblick von all dem zu verpassen.
Henri besaß einen Messingsextanten aus London, den er in einer verschlissenen Ledertasche mit sich herumtrug. Damit bestimmte er jetzt ihre Position; sorgfältig visierte er die Sterne an, während die Dämmerung zur Nacht wurde. Er verzeichnete seine Berechnungen auf dem Spezialpapier, das er mitgebracht hatte, um Karten darauf anzufertigen. Der Mond schien so hell, daß er das Licht der kleinen Gaslaterne am Boden des Korbes kaum benötigte. Sie konnten die Wüste unter sich fast so klar und deutlich sehen wie tagsüber. »Wir sind hier«, sagte Henri und zeigte Gascon die Koordinaten, die er auf dem Papier mit einem kleinen x markiert hatte. »Wo immer ›hier‹ auch sein mag.«
Als er mit seiner Arbeit fertig war, zog Henri eine kleine Flöte aus der Tasche, ein hölzernes Instrument, das er irgendwo auf einem Markt gefunden hatte. Er besaß keine musikalische Ausbildung, aber er hatte ein gutes Ohr und konnte nachspielen, was er gehört hatte. Manchmal erfand er auch selbst eine Melodie, die zu seiner Stimmung paßte. An diesem Abend ließ er seine Töne mit dem Ballon durch die Luft schweben, samtene Klänge, in denen die Freiheit und die Ruhe ihrer Reise eingefangen waren und die auf die schlafende Wüste unter ihnen hinabsanken. Gascon lehnte sich zufrieden in die Seile und lauschte mit geschlossenen Augen.
Die Nacht hindurch wechselten sie sich ab; der eine schlief, während der andere ein wachsames Auge auf ihr Fortkommen hatte. Es war eine Nacht des Friedens und der Ehrfurcht, in der die mondbeschienene Erde unter ihnen vorüberzog. Die Luft war kalt und frisch, und sie kauerten sich unter schweren Mänteln zusammen. Als die Morgensonne aufging, beschien sie Dünen, die so sattgolden leuchteten wie der Mond. Die der Sonne abgewandten Dünenhänge waren von einer silbernen Reifschicht bedeckt; wie Schneewehen glitzerten sie im sanften Licht der Dämmerung.
Henri spähte aufmerksam auf die Karte. »Wir sind über dem Großen Westlichen Erg«, sagte er. Der Erg war eines der wenigen Sandmeere in einer Wüste mit tausend Gesichtern. Henri wußte, daß es ihn gab und wo er ungefähr lag, aber nicht, wie groß er war. Die Karte half nicht weiter. Ein arabischer Händler in Bou Saada hatte ihm berichtet, daß hinter dem Erg eine verkehrsreiche Handelsroute verlaufe. Landen könnten sie erst, wenn sie den Erg hinter sich hätten, denn zu Fuß würden sie niemals aus den Dünen hinausgelangen. Es war besser, weiterzufahren und darauf zu hoffen, daß der Wind noch einmal die Richtung wechseln und sie nach Westen treiben würde, wo das Atlas-Gebirge im Bogen nach Süden verlief. Bei richtigem Wind könnten sie die Berge noch einmal überqueren und wären in Marokko.
Aber der Wind hatte eigene Pläne. Er wehte kräftig, den ganzen Tag und die ganze Nacht – nach Süden.
Endlos wellten sich die Dünen in die Ferne, so weit das Auge reichte. In ungezählten Reihen lagen sie aufgehäuft, eine hinter der andern, methodisch angeordnet wie von einer Riesenschaufel der Götter. Glatt und weiblich sahen sie aus, spinnwebzart und rein. Manchmal wehten Windstöße zarte Sandsträhnen von ihren Gipfeln, und es sah aus wie die Schneeschleier an den Spitzen der Berge. Die eine Dünenkette war golden, die andere rötlich braun und die nächste gelb, und Licht und Schatten ließen den Sand immer wieder anders erscheinen. Die Dünen wiesen Grübchen auf, Wirbel und anmutig langgestreckte Linien. Das Gelände zwischen ihnen war flach, aber nicht immer ganz unfruchtbar; hier und da sproß Gestrüpp und Buschwerk, das sich ans Leben klammerte.
Manchmal sahen sie zwischen den Dünen auf kleine Gazellenherden, die an den kargen Gras- und Krautbüscheln weideten. Ein einsamer Schakal schnürte am Fuße der Dünen entlang und suchte nach Mäusen. Am Nachmittag entdeckte Gascon zwei Strauße, deren langgliedrige Beine durch den gestreckten Sonnenschatten noch weiter übertrieben wurden; sie sahen aus, als wären sie zwanzig Fuß hoch, lebhafte Riesen, die einherstolzierten und sprangen.
Henri machte sich sorgfältig Notizen und verzeichnete die Konturen des Landes, über das sie hinwegschwebten. Der Ballon entfernte sich immer weiter vom Atlas, bis sie mit ihren Feldstechern nur noch die blassen Umrisse der Berge vor dem Horizont erkennen konnten. Tief im Innern, in seinem Magen, spürte er das altvertraute Kribbeln der Angst, vermischt mit aufgeregter Erwartung, als er die Welt, die er kannte, verschwinden sah.
Und er liebte dieses Gefühl.