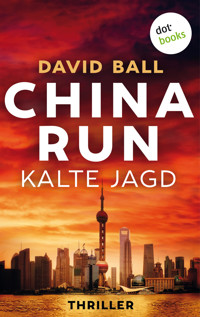Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Epos, das fesselnde Historie mit einer berührenden Geschichte verbindet: der Roman »Asha – Sohn von Malta« von David Ball als eBook bei dotbooks. Malta, 1565: Zwei Geschwister, durch ein grausames Schicksal getrennt, treffen sich nach zehn Jahren wieder – auf unterschiedlichen Seiten eines brutalen Konflikts, der ihre Heimat zu vernichten droht … Nico und seine Schwester Maria waren unzertrennbar, bis zu jenem Tag, als der kleine Junge von osmanischen Korsaren entführt wurde. Während Maria auf Malta auf die Rückkehr des Bruders hofft, wird er zum Galeerendienst in der Flotte des Sultans gezwungen. Doch der mutige Junge steigt in den Rängen der türkischen Armada auf – und wird zum gefürchteten Kapitän Asha. Nach vielen Jahren treffen die Geschwister wieder aufeinander, denn der osmanische Sultan kennt nur ein Ziel: Die Eroberung Maltas … und Nico und Maria müssen sich im Angesicht des Feindes die Frage stellen, wer sie wirklich sind! »Der Roman hat die Wucht von 20 Segelschiffen. Als hätte Hollywood ein 200-Millionen-Dollar-Projekt zwischen zwei Buchdeckel gepresst!« Bild am Sonntag »›Asha‹ ist ein Meisterwerk, das die Details der Historie mit brillanter Vorstellungskraft vereint!« Denver Post Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der epische historische Roman »Asha – Sohn von Malta« von David Ball. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1506
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Malta, 1565: Zwei Geschwister, durch ein grausames Schicksal getrennt, treffen sich nach zehn Jahren wieder – auf unterschiedlichen Seiten eines brutalen Konflikts, der ihre Heimat zu vernichten droht… Nico und seine Schwester Maria waren unzertrennbar, bis zu jenem Tag, als der kleine Junge von osmanischen Korsaren entführt wurde. Während Maria auf Malta auf die Rückkehr des Bruders hofft, wird er zum Galeerendienst in der Flotte des Sultans gezwungen. Doch der mutige Junge steigt in den Rängen der türkischen Armada auf – und wird zum gefürchteten Kapitän Asha. Nach vielen Jahren treffen die Geschwister wieder aufeinander, denn der osmanische Sultan kennt nur ein Ziel: Die Eroberung Maltas … und Nico und Maria müssen sich im Angesicht des Feindes die Frage stellen, wer sie wirklich sind!
»Der Roman hat die Wucht von 20 Segelschiffen. Als hätte Hollywood ein 200-Millionen-Dollar-Projekt zwischen zwei Buchdeckel gepresst!« Bild am Sonntag
»›Asha‹ ist ein Meisterwerk, das die Details der Historie mit brillanter Vorstellungskraft vereint!« Denver Post
Über den Autor:
David Ball wurde 1949 in Denver, Colorado geboren und ist ausgebildeter Journalist. Statt einer Tätigkeit als Reporter nachzugehen, beschloss David Ball, die Welt zu bereisen – bisher hat David Ball 65 Länder besucht und die Sahara viermal durchquert. Seine Romane sind in 11 Sprachen weltweit übersetzt worden.
Von David Ball erscheint bei dotbooks der historische Roman »Ikufar, Sohn der Wüste« sowie sein Thriller »China Run – Kalte Jagd«
***
eBook-Neuausgabe April 2021
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2003 unter dem Originaltitel »Ironfire« bei Bantam Books, New York.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2003 by David W. Ball
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2003 Schneekluth Verlag
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Gemälden von Girolamo Gianni, Cornelis Verbeeck
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-96655-401-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Asha – Sohn von Malta« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
David Ball
Asha – Sohn von Malta
Historischer Roman
Aus dem Amerikanischen von Rainer Schmidt
dotbooks.
Erstes Buch
Nico
Aus: Die Geschichte des Mittelmeers
von Darius, genannt der Bewahrer, Hofhistoriker beim Löwen des Ostens und des Westens, Sultan Ahmed
Malta!
Nie entschied sich das Schicksal von Imperien an einem Ort, von dem man es weniger hätte erwarten können.
Die drei Inseln Malta, Gozo und Comino bilden den Maltesischen Archipel. Es sind öde Inseln mit wenig Süßwasser und einer dünnen Schicht von schlechtem Mutterboden, auf dem nur die anspruchslosesten Feigen und Melonen gedeihen und nur die zähesten Menschen überleben können.
In vorgeschichtlichen Zeiten, lange vor der Bronzezeit, waren die Inseln von einem alten Volk bewohnt, das nichts als verfallene Tempel und tiefe Wagenspuren hinterließ. Phönizier folgten diesen Spuren, und nach ihnen Karthager und Römer. Auf seinem Weg nach Rom und in den Märtyrertod scheiterte der christliche Apostel Paulus in einer Bucht im Norden Maltas, und dort pflanzte er die Saat seines Glaubens, die besser gedieh als alle Feigen und Melonen.
Vandalen verwüsteten die Insel, während das Römische Reich in einen östlichen und einen westlichen Teil gespalten wurde. Malta fiel an Ostrom, an Byzanz, in dessen Händen es bis ins Jahr 870 christlicher Zeitrechnung blieb, als es von den Arabern eingenommen wurde, die mit ihren Eroberungsfeldzügen einen großen Teil der Welt überzogen, weit über Malta hinaus bis zur Iberischen Halbinsel.
Es folgte eine kurze, strahlende Zeit auf Malta, in der Moslems friedlich neben Christen und Juden lebten. Aber sie war nicht von Dauer.
Graf Roger der Normanne eroberte die Inseln im Jahr 1091 christlicher Zeitrechnung. In einem Disput über königliche Erbfolgelinien fiel Malta an den Deutschen Friedrich, den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Er nutzte es als Strafkolonie und vertrieb die Moslems für immer von der Insel. Die Deutschen ihrerseits wurden von den Franzosen unter Karl von Anjou vertrieben, die wiederum von den Aragoniern. Nach der Heirat von Ferdinand von Aragonien und Isabella von Kastilien verboten die Spanier sämtliche Religionen mit Ausnahme der römisch-katholischen, und der Aufstieg der Inquisition nahm seinen Anfang. Unterdessen waren die Mauren, die die Iberische Halbinsel fast siebenhundert Jahre lang besetzt gehalten hatten, von den christlichen Königreichen stetig zurückgedrängt worden. Der letzte islamische Vorposten, Granada, fiel im Jahr 1492 christlicher Zeitrechnung, was zu einem gewaltigen Exodus von Mauren und Juden aus den spanischen Territorien führte – Malta eingeschlossen, wo die Saat des heiligen Paulus inzwischen in voller Blüte stand.
Wer überlebte solche Umwälzungen? Menschen einer einzigen Religion, aber unterschiedlicher Herkunft und in vielfältigen Allianzen. Ihre Sprache war ein Gemisch von Arabisch, Semitisch und Italienisch, ihre Kleidung und ihre Kultur ein Gebräu aus Ost und West, und beherrscht wurden sie durch eine von Aragonien eingesetzte Oligarchie aus Adelsfamilien, auf deren Lehen sich die Bauernschaft, die einzige Konstante auf Malta, mit endloser Arbeit plagte. In seiner ganzen Geschichte litt Malta immer wieder unter Seuchen, Pest und plündernden Monarchen, unter glutheißen Sommern und Korsaren. Verachtet wegen seiner Armut an Kultur, fruchtbarem Land und Menschen, war Malta doch heiß begehrt wegen seiner vorzüglichen Häfen und einer strategischen Lage, die die Seewege zwischen Afrika und Sizilien beherrschte.
Diese Lage, gepaart mit der wachsenden Macht des Osmanischen Reiches im östlichen Mittelmeer, verlieh der Insel eine Bedeutung, die in keinem Verhältnis zu ihrer Größe stand.
In den frühen Jahren des vergangenen Jahrhunderts war es der eigennützige Akt eines anderen Kaisers des Heiligen Römischen Reiches, nämlich Karls V., der Malta zu einem bestimmenden Faktor der Geschichte machte, indem er die Insel ihren jüngsten Beherrschern übereignete: den Rittern des heiligen Johannes von Jerusalem.
Malta.
Eine winzige, raue Insel, gerade sechs Meilen lang und drei breit, in diesem gewaltigen Meer nicht größer als ein Sandkorn am Strand, doch, oh! – was für ein Sandkorn!
Und was für Schicksale, die davon abhingen!
– Aus Band VII
Die großen Feldzüge: Malta
Kapitel eins
Malta 1552
An dem Morgen, als die Sklavenjäger kamen, waren die Kinder auf Schatzsuche.
Ganz in ihr Treiben vertieft, sahen sie den Mast der Korsarengaleere nicht, und er war auch fast gänzlich verdeckt von den hohen Klippen rings um die kleine Bucht, in der das Schiff in der Nacht vor Anker gegangen war.
Sie sahen den toten Wachtposten nicht, der mit dem Kopf nach unten am Wachtturm hing. Es war Bartholomeo, ein älterer Junge, der in ihrer Straße wohnte; man hatte ihm im Schlaf die Kehle durchgeschnitten, von einem Ohr zum anderen. Sein Blut war schon hart verkrustet auf der Plattform, auf der er hätte Alarm schlagen müssen, auf einer Plattform, von der seine Mörder mehrere Holzplanken gestohlen hatten. Die Kinder sahen Bartholomeo nicht, weil sie sich vor ihm versteckten; sie blieben in den tiefen Gräben oder duckten sich hinter die niedrigen Steinmauern zwischen Feldern, die so trocken und unfruchtbar waren, dass selbst die Krähen sich nicht mehr die Mühe machten, dort nach Nahrung zu suchen. Solange sie hinter diesen Mauern blieben, wussten sie, dass Bartholomeo sie nicht sehen und ihre Pläne vereiteln konnte. Das würde er nämlich tun, und zwar aus reiner Bosheit. Bartholomeo war einfach niederträchtig.
Auch die Kolonne der Galeerensklaven konnten sie weder sehen noch hören, die sich hundert Schritt weiter östlich durch die Schlucht schlängelte – Männer, die schweigend arbeiteten und unter den aufmerksamen Augen ihrer Bewacher Wasser schöpften.
Und sie konnten die Galeere nicht riechen, denn der Mistral wehte von hinten, von Nordwesten. Stand der Wind richtig, ging der Geruch einer Galeere ihrem Anblick voraus, ein Gestank, der die Gefahr unmissverständlich ankündigte. Hätten sie sie gerochen, so hätten sie das Unheil gewittert. Sie hätten Zeit gehabt, Angst zu bekommen, hätten Zeit gehabt, zu fliehen.
Aber heute rochen sie nichts außer Marias Träumen.
»Vater wird uns auspeitschen«, sagte Nico ernst. Atemlos bemühte er sich, mit seiner Schwester Schritt zu halten, als sie ihn an die Südküste von Malta hinunterführte. Der Kalkstein glühte unter einer Sonne, die trotz der frühen Stunde schon sengend heiß brannte.
»Wir sollten doch die Jauchegrube sauber machen.«
»Er wird es gar nicht erfahren«, sagte Maria. Quecksilberflink bewegte sie sich auf ihren bloßen Füßen über die Steine und schlängelte sich zwischen den Feigenkakteen hindurch. Sie war zwölf, aber klein für ihr Alter, athletisch und schlank, und noch ließ ihre Gestalt nicht erkennen, dass sie ein Mädchen war. Ihre Kleider waren an manchen Stellen verschlissen, und sie trug ein Messer im Gürtel. Ihr Haar war kurz geschnitten und struppig wie das eines Jungen. Ihr Gesicht war schmutzig, ihre Haut tiefbraun von der Sonne, und in ihren grünen Augen leuchteten Entschlossenheit und Abenteuerlust. »Er ist heute beschäftigt; er muss zum capumastru, um Arbeit beim Bau der neuen Ritterfestung zu bekommen. Außerdem werde ich nicht aufgeben, bis wir es gefunden haben. Wenn du lieber Scheiße schaufeln als einen Schatz suchen möchtest, dann mach, was du willst. Mir ist es gleich.«
Zwei endlose Tage lang hatten sie in der Jauchegrube unter ihrem Haus gearbeitet und Eimer um Eimer menschlicher und tierischer Exkremente herausgehievt, um sie auf einem steinigen Feld außerhalb des Dorfes zu verteilen, wo die Familie Gemüse anzubauen versuchte. Diese unangenehme Arbeit machten sie zweimal im Jahr, wenn die Fliegen in der Küche überhand nahmen. Von den Fliegen abgesehen, wusste Maria nicht, was es für einen Sinn haben sollte. Auf diesem Feld war seit zwei Jahren nichts mehr gewachsen. So war es überall auf Malta. Der Regen war nicht gekommen, und das Getreide aus Sizilien auch nicht. Ihre kleinen Geschwister, Zwillinge, waren verhungert, wie die Hälfte aller Kleinkinder im Dorf Birgu in diesem Jahr. »Auf Malta wächst nichts als Steine und Elend«, sagte ihre Mutter oft. »Nichts als Mist, besser gesagt. Wenn es dafür einen Markt gäbe, wären wir reicher als in unseren kühnsten Träumen.«
Vielleicht war dies die einzige Angelegenheit, in der Maria mit ihrer Mutter übereinstimmte. Das Ausbringen der Jauche war sinnlos – nur eine der widerlichen Aufgaben, die ihr Vater zuteilte. Besser war es, hier zu sein und etwas Sinnvolles zu tun.
»Wir suchen schon eine Ewigkeit und haben nichts gefunden«, maulte Nico.
»Heute werden wir etwas finden. Aber du kannst ja nach Hause gehen, wenn du willst.«
Er würde natürlich niemals nach Hause gehen. Er betete seine Schwester an; sie war drei Jahre älter als er und die Sonne in seinem Leben. Sie beschützte ihn vor dem Zorn ihres Vaters und der Verzweiflung ihrer Mutter und all den Plagen einer feindseligen Welt. Sie war nicht wie die anderen Mädchen in ihrem Alter, ganz und gar nicht. Die meisten verhüllten ihre Gesichter mit barnuzas und blieben im Haus. »Eine Frau sollte man nur zweimal in der Öffentlichkeit sehen«, sagte Marias Mutter immer. »Am Tag ihrer Hochzeit und am Tag ihrer Beerdigung.« Maria hörte nicht auf sie. Sie war ein Wildfang mit hitzigem Temperament und hatte sich geschworen, sich niemals hinter einer barnuza zu verbergen. Die anderen Mädchen mieden sie. Und sie tat es ihnen gleich. Nico war das recht, denn so hatte er jemand, mit dem er herumstreunen konnte, jemand, der alles Mögliche wusste und Geschichten erzählen konnte, auf Felsen kletterte und Schätze suchte. Wenn sie ihn darum bäte, würde er ihr über den Rand der Klippen folgen, auch wenn seine treue Ergebenheit ihm oft Ärger mit ihrem Vater einbrachte.
»Ich will bloß nicht ausgepeitscht werden.«
»Es gibt Schlimmeres.«
»Was denn, zum Beispiel?« Nico meinte, den Ledergürtel seines Vaters auf dem Hintern zu spüren. Viel Schlimmeres konnte es kaum geben.
»Zum Beispiel, wenn wir ein Leben lang Scheiße schleppen müssen. Zum Beispiel, wenn wir zulassen, dass jemand anders den Schatz findet. Wir sind da«, sagte sie. Sie hatten eine Ansammlung von Ruinen erreicht, die auf einem Plateau mit Blick auf das Meer standen. Dieser Ort gehörte ihnen allein. Noch nie hatten sie eine andere Menschenseele dort gesehen. Der Staub im Wind der Äonen hatte den größten Teil der Ruinen unter sich begraben, aber noch immer standen hier die großen Megalithen eines Tempels, den ein uraltes, vergessenes Volk erbaut hatte. Ein paar steinerne Säulen ragten in den Himmel, während andere zu einem Trümmergewirr zusammengestürzt waren. Es gab unterirdische Kammern und zahllose Verstecke. Einen großen Teil davon hatten sie erkundet; sie waren durch Spalten gekrochen und hatten sich unter Steinplatten durchgewühlt, und manchmal hatten sie neue Gänge und Kammern entdeckt, indem sie ein wenig Geröll beseitigt und ein bisschen gegraben hatten.
Irgendwo in diesem Labyrinth, sorgsam verborgen in einer Kiste oder einem Topf hinter einer Steinwand, gab es einen Schatz; dessen war Maria sicher. Ein halbes Jahrhundert zuvor waren die Juden aus Spanien und seinen Besitzungen, Malta eingeschlossen, vertrieben worden. Viele glaubten, dass sie zu jener Zeit auf der Flucht vor der Verfolgung ihre unermesslichen Reichtümer vergraben hatten, um sie sich später zurückzuholen. Bis jetzt hatte Maria nur Muscheln und ein paar alte Knochen gefunden, aber selbst ohne die Hoffnung auf einen Schatz wäre sie hergekommen. Maria liebte die Ruinen – sie hatten eine Reinheit an sich, angefangen beim Geruch bis hin zu dem prachtvollen Blick auf das Meer. Sie konnte die Menschen spüren, die hier gebaut hatten: Menschen, die Geld und genug zu essen hatten und Kleider trugen, noch prächtiger als die der Johanniterritter, die tagtäglich wie Pfauen durch die Straßen von Birgu stolzierten. Diese Leute hatten getanzt und gelacht und große Festgelage veranstaltet. Maria erzählte Nico alles über sie, während sie am Fuße von Säulen in der Erde gruben und Steine umwendeten.
Nico wühlte im Geröll. »Wenn sie so großartig waren«, sagte er, »warum ist das hier alles, was von ihnen übrig geblieben ist?«
»Sie sind nach Franza gegangen. Da ist es grüner. Und alle sind reich.«
»Und wer sagt überhaupt, dass sie einen Schatz hier gelassen haben?«
»Ich sage das. Dr. Callus hat es mir erzählt. Er sucht auch die ganze Zeit danach. Ein paar Juden haben ihn zurückgelassen, als der König sie zwang, fortzugehen.«
»Juden würden kein Geld zurücklassen. Mutter sagt, Juden lassen eher ihre Kinder zurück als ihr Geld.«
»Na, die hier haben’s aber getan«, sagte Maria. »Gold und Silber. Sie konnten nicht alles tragen. Und ich werde es finden und verstecken, bis ich alt genug bin. Dann kaufe ich mir ein Schloss in Franza.« Am Kai hatte sie von Frankreich erzählen hören, von seinen Bergen und reichen Lupinenfeldern. Das hörte sich großartig an: Sie würde ein Schloss kaufen und Sklaven auf ihren Feldern arbeiten lassen, wo sie Lupinen züchtete.
»Was sind Lupinen?«, fragte Nico.
»Das weiß ich nicht genau, aber ich werde Unmassen davon haben. Und Diener. Und meine Kleider werden aus Seide gesponnen sein und meine Löffel aus Silber. Du darfst bei mir wohnen, wenn du willst.«
»Mädchen können keine Schlösser haben.«
Sie schnaubte verächtlich. »Königinnen wohl. Ich werde eins haben. Du wirst schon sehen.«
Sie gruben eine Weile, ohne mehr als Erde und Steine zu finden. Fast war sie bereit vorzuschlagen, sich in den Höhlen umzusehen, von denen die Klippen über dem Meer durchzogen waren. Ein paar davon waren bewohnt, aber nicht alle. Sie wusste, dass die Juden viele ausgeklügelte Verstecke gehabt haben mussten, und Höhlen eigneten sich gut dafür. Sie stieß die Spitze ihres Messers in den Boden und hörte ein Klingen. Sie scharrte die Erde mit den Fingern beiseite und fand einen kleinen Gegenstand. Er war oval und vom Alter verkrustet.
»Schau!« Sie hielt ihn hoch.
»Was ist das?«
»Munita. Eine Münze.«
»Für mich sieht es aus wie ein Stein.«
»Dein Kopf ist auch ein Stein! Sie ist alt, du Dummer, aber trotzdem kostbar.« Sie kratzte sie mit dem Messer sauber. Im Sonnenlicht sahen sie das Blinken von korrodiertem Metall. »Da, schau doch, siehst du es nicht? Ein Männerkopf. Er trägt einen Helm!« Nico sah es nicht, machte aber trotzdem große Augen.
»Du kannst sie behalten«, sagte sie großmütig und reichte sie ihm.
»Hier gibt es noch mehr. Was habe ich dir gesagt? Jetzt steck sie schon in die Tasche. Und was immer du tust, zeig sie keinem Erwachsenen. Die nehmen sie dir nur weg.«
»Grazzi«, hauchte Nico. Er konnte sein Glück kaum fassen. Er schob die Münze in die Tasche und arbeitete fieberhaft und mit neuer Begeisterung neben ihr. So gruben sie mehr als eine Stunde lang, und der Schweiß mischte sich mit der dicken Staubschicht auf ihren Stirnen, während sie keuchend nach ihren Träumen gruben. Maria förderte eine Schüssel zutage, gut erhalten, aber entzweigebrochen. Darunter entdeckten sie einen makellosen weißen Oberschenkelknochen. »Siehst du? Das ist ein Judenknochen«, sagte Maria zuversichtlich. »Eine Markierung. Die hinterlassen sie immer in der Nähe ihrer Schätze. Wir sind nah dran.«
Nico stieß einen leisen Pfiff aus. Sie gruben immer wilder.
Jäh hielt Maria inne. Sie zog ihn am Ärmel, damit er still war. »Was war das?«, flüsterte sie.
»Was?«
Sie legte den Kopf schräg und lauschte aufmerksam. Eine Drossel hüpfte zwischen den Steinen umher und suchte nach Insekten. An der Seite eines Felsens klebte eine winzige Eidechse. Der Wind wehte gleichmäßig, trocken und heiß. »Ich dachte, ich hätte Stimmen gehört.«
Einen Augenblick später schüttelte sie den Kopf. »Schon gut. Es war wohl nichts.«
***
Die Planken der algerischen Galiote knarrten leise, als das ankernde Schiff sich in der sanften Dünung wiegte. Das Seewasser plätscherte leise am Freibord. Soldaten standen am Heck, die Arkebusen schussbereit, und warteten nervös auf die Rückkehr der Sklaven, die an einer landeinwärts gelegenen Quelle Wasser holten. Das Schiff war in der Bucht gedreht worden, so dass der Bug dem offenen Meer zugewandt war, bereit zur schnellen Abreise.
Es war ein Meeresjäger, schnell und schlank; eine Galiote von der Art, wie sie die römischen Legionen befördert und den Handel Karthagos ermöglicht hatte. Ein Schönwetterschiff, lang und schnittig, mit geringem Tiefgang, so dass es in Flussmündungen und Lagunen auf der Lauer liegen und reiche Schiffsladungen erbeuten konnte. Zwar trug der Mast ein einzelnes, aufgegeites Lateinsegel, aber im Allgemeinen war es nicht der Wind, der es durch die See trieb, sondern die Kraft der Sklaven. Es war in erster Linie ein Ruderschiff. Drei Mann waren nackt an jede der vierundzwanzig Ruderbänke gekettet, die sich auf beiden Seiten hintereinander reihten, und sie bedienten die Ruder. In den langen Monaten der Schifffahrtssaison verließen sie ihre Bänke nie. Sie aßen, schliefen und erleichterten sich, wo sie saßen, bei gutem wie bei schlechtem Wetter.
Rais Ali Agha, der Kapitän des Algeriers, wäre niemals allein nach Malta gekommen, wenn die Not ihn nicht gezwungen hätte. Die Insel war die Heimat der Johanniterritter, der Ungläubigen, deren Hauptstützpunkt nur zwei Meilen weit entfernt war, in Birgu.
Er war gekommen, um ein paar schnelle Reparaturen durchzuführen und das dringend benötigte Wasser an Bord zu nehmen. Beinahe wäre er ein Opfer seines eigenen Erfolgs geworden. In Sizilien hatte ihm ein tollkühner Raubzug einhundertdreißig Sklaven eingebracht. Auf dem Weg nach Algier begegnete er dann einem französischen Kauffahrer ohne Geleit. Er nahm das Schiff, ohne einen Schuss abzufeuern, und brachte die Besatzung gefesselt unter Deck. Dann lud er Ballen von Seide und Kisten mit Gewürzen auf, bis die Galiote gefährlich tief im Wasser lag. Als er nicht mehr aufzuladen wagte, kappte er die Taue des Kauffahrers und nahm eilends Kurs auf die Heimat.
Wäre ihm nicht ein unerwarteter Frühlingssturm dazwischengekommen, hätte er sie auch erreicht. Aber mit seinem geringen Tiefgang war das Schiff auf Schnelligkeit ausgelegt, nicht auf den Kampf mit einer rauen See. Die Wogen hatten es wie einen Korken umhergeworfen. Eine kleine Kanone, eine in Portugal hergestellte verso, die er dem Franzosen abgenommen hatte, riss sich von den schweren Planken los, an denen man sie festgezurrt hatte. Das Geschütz rutschte wie wild über das Deck, zerschmetterte Wassertonnen, als wären sie Spielzeug, und zersplitterte dann Holz und die Beine des Steuermanns, als es zurückkam. Schließlich durchbrach es die Holzreling und kippte in den Laderaum.
Nur die gnädige Hand Allahs lenkte die Kanone auf eine Gruppe von Sklaven, so dass sie nicht den Schiffsrumpf durchschlagen konnte. Die Elenden hatten sich voller Angst vor dem Sturm zusammengekauert, und ihre Leiber milderten den Aufschlag der Kanone, so dass der Schiffsboden verschont blieb, aber die Mündung der Kanone durchschlug die Planken in Höhe der Wasserlinie, die wegen der schweren Ladung noch höher lag als sonst. Mit jeder Woge strömte Meerwasser herein. Das Schiff war in höchster Gefahr.
Nur die schnelle Reaktion des Kapitäns hatte sie alle vor dem Meeresgrund bewahrt. Siebzig Gefangene wurden über Bord geworfen, um das Schiff leichter zu machen; sie waren schwerer als die Seide und nicht so wertvoll wie die Gewürze. Die meisten waren Kinder, die im hinteren Laderaum gehalten worden waren, durch ein Schott von ihren Eltern getrennt. Ali Agha pflegte seine Gefangenen immer so aufzuteilen; auf diese Weise blieben sie friedlicher. Lieber hätte er die Erwachsenen über Bord gehen lassen, denn Kinder waren mehr wert, aber das Heck des Schiffes musste leichter werden, und sie hatten keine Zeit zu verlieren, hatten keine Zeit, die Gefangenen oder den Ballast zu verlagern. Die Schreie der Kinder wurden vom Sturmwind übertönt. Die Bootsmannspfeife gellte, und die Peitsche des Aufsehers knallte mehrmals, während alle Mann an Bord sich bemühten, das Schiff am Kentern zu hindern. Soldaten und Sklaven schöpften wie verrückt, um mit den Fluten, die in die Bilge strömten, Schritt zu halten; die Hälfte der Männer war seekrank bei der Arbeit, und ihr Erbrochenes mischte sich mit dem Seewasser, das über dem Kiel um ihre Knie schwappte.
Und fast so plötzlich, wie er begonnen hatte, ließ der Sturm nach, und das Meer beruhigte sich.
Ali Agha begutachtete den Schaden. Der Mast hatte gehalten, aber eine schlecht gesicherte Luke war gebrochen. Fast der gesamte Proviant war verloren, dazu ein großer Teil des Trinkwassers. Die dreihundert Menschen, die noch an Bord waren, konnten vielleicht ein paar Tage ohne Essen auskommen, inschallah, aber nicht ohne Wasser, und außerdem musste das Leck geflickt werden. Die nächste Landungsmöglichkeit war Malta. Widerstrebend nahm Ali Agha Kurs auf die Insel. Die Ritter waren hier zwar sehr nah, aber er vermutete, dass sie mit der Jagd auf seinen Großonkel, den legendären Korsaren Dragut Rais, alle Hände voll zu tun hatten. Ein paar Tage zuvor hatte Dragut die Johannitergaleere Caterinetta gekapert, die mit einem Vermögen in Scudi aus Marseille gekommen war – Geld, das die Ritter für ihre neue Festungsanlage in Birgu brauchten. Stürme es, wie es wolle, die gedemütigten Ritter würden wie ein wütender Hornissenschwarm hinter dem Korsaren herjagen.
Gleichwohl ging Ali Agha kein Risiko ein. Seine Zimmerleute hatten die Reparatur rasch erledigt; sie benutzten Holz von einem Wachtturm, der am Südufer gestanden hatte. Die Nähte um das geflickte Leck wurden dick kalfatert, um sie wieder wasserdicht zu machen, und dann bestrichen sie einen Teil des Rumpfes mit Fett, damit das Schiff seine alte Kampfform wiederbekam. Jetzt brauchte man nur noch auf die frischen Wasservorräte zu warten. Die Galeerensklaven ruhten müßig an ihren Rudern und schmorten dabei unter der weißen Sonne, die über den Grat der schützenden Klippen an der Bucht gestiegen war.
Wachen standen auf der Gangway über dem Laderaum und sorgten dafür, dass es still blieb. Es durfte keinen Laut geben, bis das Schiff den Bau der Ritter wohlbehalten verlassen hatte. Kurz nach dem Morgengrauen hatten zwei der gefangenen Sizilianer begonnen, sich um einen Essensrest zu streiten. Rasch hatte man ihnen die Kehle durchgeschnitten und die Leichen über Bord geworfen. Die Frau des einen schrie, und sofort folgte ihr lebloser Körper dem ihres Mannes ins Wasser. Rais Ali Agha schätzte es, wenn Besatzung und Passagiere gehorsam waren.
Ungeduldig blickte der Kapitän auf das offene Meer hinaus und spähte dann wieder zurück in die Schlucht. Die Sklaven brauchten zu lang mit dem Wasser. Wenn er entdeckt würde, solange er in der Bucht vor Anker lag, säße er in der Falle, und ein Entkommen wäre nahezu unmöglich. Die Gefahr wurde mit jedem Augenblick größer. Die turmhohen Klippen rings um die Bucht verbargen sein Schiff vor den Augen der Feinde, aber sie machten auch ihn blind für ihre Anwesenheit. Er war wohlvertraut mit dem gottverfluchten Land Malta, das ebenso trostlos wie gefährlich war. Er hatte den Archipel schon ein Dutzend Mal überfallen. Zumeist war er auf der nördlichen Insel Gozo gelandet, die immer schlecht gesichert war. Aber auch die Südküste hier kannte er, er hatte sie wegen ihrer Abgelegenheit und der wenig bekannten und schwer zugänglichen Süßwasserquelle ausgesucht.
Der Wächter auf dem Turm war als Erster gestorben, schon vor dem Morgengrauen, und Männer waren ausgeschwärmt, um alle Höhlenbewohner umzubringen, die sie finden konnten. Zwei Mann standen auf den Landzungen an der Seeseite auf Posten, aber Ali Agha beschloss, noch weitere auf die Klippen zu entsenden. Dort oben waren Ruinen, und man konnte beizeiten sehen, wenn Patrouillen zu Lande oder feindliche Galeeren sich näherten.
Auf seinen Befehl hin erkletterten zwei Mann die Klippen, mit Pistolen und Messern bewaffnet. Der Aufstieg war gefährlich, und sie kamen nur langsam voran. Endlich aber waren sie oben angekommen; sie drehten sich um und suchten das Meer ab. Einer von ihnen signalisierte, dass die Luft rein sei. Dann wandte er sich ab und marschierte mit seinem Kameraden landeinwärts, auf die Ruinen zu.
***
Nico sah sie als Erster.
Er suchte nicht mehr nach einem Schatz. Er schlug mit einem Stein auf einen anderen ein und versuchte, eine Kanonenkugel zu machen. Als er sich den Steinstaub aus den Augen wischte, fiel sein Blick auf die Klippen. Alles Blut wich aus seinem Gesicht. Angst und Schrecken füllten seinen Magen mit Säure. Maria war immer noch über ihre Arbeit gebeugt. Er zupfte an ihrem Hemd. Sie sah die Übelkeit in seinen Augen und folgte seinem Blick.
Ein Mann kletterte über den Rand der Klippen. Er war vierschrötig und vollbärtig und trug bei nacktem Oberkörper eine tief hängende Pluderhose. Nachdem er sich aufgerichtet hatte, drehte er sich um und half einem Kumpan über die Kante. Der zweite Mann war ein dürrer, dunkelhäutiger Maure mit einem Lederwams, das viel zu groß für seine schmächtige Gestalt war. Beide trugen Sandalen. Ihre Turbane wiesen sie als nordafrikanische Korsaren aus, jene Sklavenjäger, die die Albträume eines jeden Maltesers bevölkerten und mehr Opfer als Krankheit und Hungersnot zusammen forderten. Seit den Zeiten der Karthager hatten Sklavenjäger auf diesen Inseln gewütet, aber nie mit so verheerender Wirksamkeit wie die Korsaren von der afrikanischen Berberküste. Im vergangenen Jahr hatte der schrecklichste von allen, Dragut Rais, fast die gesamte Bevölkerung von Gozo verschleppt. Seine Männer zogen über die Inseln wie der Schatten des Todes. Bäume wurden gefällt, Brunnen vergiftet, Häuser niedergebrannt, Kirchen zerstört, Vieh abgeschlachtet. Als der Rauch sich verzogen hatte, waren mehr als fünftausend Seelen in den Laderäumen von Draguts Schiffen verschwunden.
Sogar Kinder, hatten Maria und Nico wohl tausendmal gehört.
Besonders Kinder.
Maria wusste jedoch nichts davon, dass sie je auf diesen Teil der Insel gekommen waren, wo so wenige Menschen lebten und die Klippen so hoch waren.
Aber das hatte nichts zu sagen. Jetzt waren die Korsaren hier. Einer von ihnen winkte zu dem Schiff hinunter. Dann wandten sich die beiden Männer den Ruinen zu.
»Alles in Ordnung«, sagte sie leise zu ihrem kleinen Bruder, und um seinetwillen legte sie eine Ruhe an den Tag, die sie nicht verspürte. Nico hatte nicht so viel Mumm wie sie, und ihre eigenen Eingeweide verknoteten sich vor Entsetzen. Sie wusste, dass er jeden Augenblick anfangen konnte zu heulen. Jetzt musste sie stark genug für sie beide sein.
Sie kauerten in einem großen Hof, der von Unkraut überwuchert und von einer Mauer umgeben war. An der Seeseite hatte die Mauer drei Öffnungen: zwei Fenster und eine Tür. Wenn sie sich über den offenen Hof zur Landseite schlichen, könnten sie sich dort hinter dem Geröll verbergen und dann durch die innere Wand in den Ruinen verschwinden, wo es zahllose Möglichkeiten gab, sich zu verstecken. Vielleicht könnten sie sogar versuchen, wegzulaufen und zum Wachtturm zu rennen, wo Bartholomeo ihnen helfen würde. Sie fragte sich, warum er nicht schon Alarm geschlagen hatte. Gewiss hatte er sie doch auch gesehen. Der Trottel war vermutlich eingeschlafen, dachte sie wütend.
»Du musst nach hinten zur Mauer huschen«, sagte sie. »Beeil dich, aber mach kein Geräusch. Wenn wir leise sind, merken sie gar nicht, dass wir hier sind.«
Sie krochen hastig rückwärts und schürften sich dabei Hände und Knie auf den scharfen Steinen blutig. Nico krabbelte geradewegs durch einen Distelbusch, aber ihm war vor Angst so schlecht, dass er den Schmerz gar nicht fühlte. Er betete murmelnd, während er über den Boden rutschte, und wünschte, er wäre zu Hause geblieben und hätte in der Jauchegrube gearbeitet, wie sein Vater es befohlen hatte. »Ahfirli, lieber Gott«, wimmerte er.
»Gott will nicht, dass es dir Leid tut«, zischte Maria. »Er will, dass du dich beeilst!«
Sie hatten den Schutthaufen, der ihnen Deckung versprach, fast erreicht, als in der Öffnung an der Seeseite ein Turban erschien. Maria packte Nicos Hemd und zog ihn auf den Boden. Wie tot lagen sie da und bemühten sich, mit der Erde zu verschmelzen. Zu ihrem Schrecken sahen sie, dass sie beim Kriechen Staub aufgewirbelt hatten, der jetzt im Hof in der Luft hing, von schrägen Sonnenstrahlen erleuchtet. Eine bessere Spur hätten sie nicht hinterlassen können.
Der Korsar ließ den Blick über das große Geviert wandern. Irgendetwas war hier, das wusste er. Er bedeutete seinem Gefährten, still zu sein. Die Mauern warfen dunkle Schatten über Unkraut und Steine, und er konnte kaum etwas sehen. Sein Turban drehte sich ein wenig, als sein Blick hin und her ging. Er legte den Kopf zur Seite und lauschte. Aber er hörte nur das ferne Rauschen der Brandung, die unten gegen die Felsen schlug. Er zog ein Messer aus seiner Schärpe und hielt es bereit; unbewusst ließ er es zwischen seinen großen Händen hin- und herwandern, während er wartete, die Klinge blitzte in der Sonne. Er presste die Faust um den Griff, lockerte sie wieder und presste noch einmal: geduldig, wachsam, abwartend. Endlose Augenblicke verharrten Jäger und Gejagte bewegungslos auf gegenüberliegenden Seiten des Hofes, und das einzige Geräusch war das ferne Raunen des Meeres.
Maria war sicher, dass ihr Herzklopfen sie verraten würde. Ihre Hand lag auf Nicos Ellenbogen. Er zitterte wie ein verängstigtes Kaninchen. Sie wagte nicht, ihn anzusehen, ihn auch nur zu beruhigen. Sie wagte nicht, den Kopf zu bewegen. Sie wagte nicht zu atmen.
Die Bewegungen des Turbans hörten auf. Ein dunkler Blick bohrte sich geradewegs in ihr Versteck. Die Augen des Korsaren wurden schmal. Er blinzelte, als sei er nicht sicher, ob er richtig sah. Maria spürte seine Augen wie glühende Kohlen, die sich in sie hineinbrannten. Sie brauchte ihren ganzen Mut, um nicht zurückzuzucken.
»Shoof, walahi!« Der Korsar rief seinem Kumpan eine Warnung zu und stürmte dann durch die Öffnung hinein.
»Lauf!«, schrie Maria.
Die Kinder sprangen auf und rannten durch eine Öffnung hinaus in einen schmalen Gang, der zwischen alten Kalksteinmauern dahinführte. Maria hielt Nicos Hand fest umklammert und zerrte ihn hinter sich her, wenn er stolperte, fing sie ihn auf. Sie liefen nach links, dann nach rechts, dann wieder nach links, immer tiefer in das Labyrinth hinein.
Hinter sich hörten sie die schweren Schritte des Korsaren. Maria erreichte eine schmale Öffnung im Gemäuer. Rau stieß sie Nico hindurch und warf sich ihm nach. Beide stürzten schwer und hasteten auf Händen und Knien zu einer weiteren Öffnung. Im Laufe der Jahrhunderte hatte der Boden sich mit Staub, Sand und Geröll bedeckt, so dass aus einstmals hohen Türöffnungen niedrige Durchgänge geworden waren. Sie mussten sich ducken, um hindurchzukommen. Maria stieß sich den Kopf an einem steinernen Türsturz. Sie schrie vor Schmerz auf und fiel auf die Knie. Nico blieb stehen, um ihr zu helfen. Er drehte sich um und sah einen Turban aufblitzen, als der erste Korsar sich durch die Öffnung zwängte. Der Anblick ließ ihn in wilde Tränen ausbrechen. Er sank zu Boden und schnappte nach Luft, in rasender Panik rau aufschluchzend. Er konnte sich nicht mehr bewegen. Der Korsar hatte unter lautem Grunzen die Schultern durch die Öffnung gebracht und mühte sich jetzt, den Unterkörper nachzuziehen.
Maria fasste sich als Erste wieder. »Komm weiter!« Und wieder riss sie Nico hinter sich her. Sie wusste, ihre einzige Hoffnung bestand jetzt darin, dass sie eine der unterirdischen Kammern erreichten, wo sie sich lautlos verstecken könnten. Sie krochen auf dem Bauch weiter, rutschten durch Spalten, Türöffnungen und Mauerbreschen, wühlten sich durch staubige Spinnweben. Manchmal sahen sie ein Stück offenen Himmel über sich, und dann wieder umgab sie pechschwarze Finsternis unter den Steinplatten. An einer solchen Stelle fühlten sie sich sicher und unsichtbar, und sie warteten. Einen Augenblick lang hörten sie nur ihren eigenen rasselnden Atem und schöpften Hoffnung. Doch dann drang gedämpftes Keuchen durch die Dunkelheit. Auch im Finstern lag keine Sicherheit. Die Jäger gaben nicht auf.
Rutschend, wühlend und kriechend drangen sie immer tiefer in das Labyrinth, stießen sich Hände und Knie blutig in kopfloser Flucht, und es kümmerte sie nicht mehr, ob sie dabei Lärm machten. Sie fanden einen Graben und rannten hinein. Sie rollten sich unter einer massiven Steinplatte hindurch, purzelten eine halb verschüttete Treppe hinunter und stürmten mit eingezogenen Köpfen in einen weiteren Korridor. Die Ruinen nahmen kein Ende.
Schließlich gelangten sie an eine Stelle, wo sie beide noch nie gewesen waren, und sie schlüpften durch eine Öffnung in eine Kammer. Hoch über ihnen war ein Teil der Decke eingestürzt. Ein dünner Sonnenstrahl erfüllte den Raum mit mattem Licht. Es war eine große Grabkrypta. Nischen waren in die Wände gehauen, reihenweise übereinander, und darin waren Skelette zu sehen. Die Schädel der Toten starrten sie mit leeren Augenhöhlen höhnisch an, und ihre Münder schienen angesichts ihrer Not zu grinsen.
Maria spähte zum Licht hinauf und überlegte, ob sich dort vielleicht ein Ausweg bot. Sie stand auf und versuchte hochzuklettern, aber die Wand, über der sich die Öffnung befand, war glatt. Ihre Füße fanden nirgends Halt.
Es gab keinen Ausweg. Sie saßen in der Falle.
Sie ließ sich zu Boden fallen und huschte in eine der Nischen, wo sie die Knochen des bisherigen Bewohners beiseite schob, um Platz zu machen. Sie presste sich an die Wand und zog Nico zu sich hinein. Noch immer schüttelte ihn ein krampfhaftes Schluchzen, das er mannhaft zu unterdrücken versuchte. Er vergrub das Gesicht an ihrer Schulter.
Sie hörten die Korsaren draußen vor der Kammer, die sich mit leiser Stimme berieten; offenbar wussten sie nicht genau, wohin das Wild verschwunden war. Es war still, und dann erschien ein Kopf in der Öffnung, durch die sie eben gekommen waren. Die Anstrengung ließ den Mann schwer atmen. Nico klappte ein Auge auf. Als er ihn sah, quollen ihm die Augen aus den Höhlen, und seine Brust hob und senkte sich heftig. Allen Bemühungen Marias zum Trotz erfüllte sein herzzerreißendes Schluchzen die Krypta. Maria drückte ihn fest an sich, und sie hörten den Mann zischen. »Ta-eh-la!« Maria presste sich noch dichter an die Wand. Nicos Schluchzen wurde lauter.
»Ta-eh-la!«, sagte der Mann noch einmal. Er schob sich herein. Es war der kleinere der beiden, der Maure, und sie zitterten, als sie ihn herankommen sahen. Das Weiße seiner Augen schimmerte unter den Falten des Turbans hervor, spöttisch, unentrinnbar. Sie drängten sich noch dichter aneinander. Der Maure streckte die Hand aus, und Maria trat nach ihm. Er schob ihren Fuß gewandt beiseite und packte Nicos Knöchel. Kreischend wurde Nico ihr aus den Armen gerissen. Dann hatte er auch ihren Fußknöchel gepackt, und sie glaubte, sein Griff werde ihr die Knochen zermalmen.
Keuchend vor Anstrengung schleifte der Korsar seine beiden Gefangenen mühsam über den steinigen Boden zum Eingang, wo sein Kamerad wartete, um ihm zu helfen. Nico wurde schlaff vor Angst, aber Maria trat und schlug um sich. Sie erwischte ein Stück von einem alten Knochen und fing an, damit auf den Mauren einzuprügeln, aber da sie in der Enge des Raumes nicht weit genug ausholen konnte, richtete sie wenig Schaden an. Der Maure presste Nico mit seinem Körper zu Boden und wollte sie schlagen. Der erste Hieb ging daneben. Er warf sich nach vorn und schlug noch einmal zu, und diesmal traf er ihren Mund. Sie fühlte, wie ein Zahn zersplitterte. Nur einen Moment lang erschrocken, dann erbost, wehrte sie sich wie eine Tollwütige. Sie ließ den Knochen fallen. Sie krallte ihm die Fingernägel in die Wange und versuchte, ihm die Augen auszukratzen. Als er wieder ausholte, schlug sie ihm die Zähne in den Arm und biss durch Haut und Fleisch. Sie schmeckte Blut. Er brüllte vor Wut und packte sie bei dem Muskel zwischen Hals und Schulter. Seine Finger fanden einen Nerv, der sie vor Schmerz erlahmen ließ. Sie schrie auf und zappelte nicht mehr. Mit ruckhaften Bewegungen schleifte er sie am Hals bis zur Öffnung.
Wenig später standen sie im Sonnenschein in einer Nische, alle vier keuchend und verschmiert von Dreck, Schweiß und Blut. Der Maure untersuchte seinen Unterarm, wo Maria ihn gebissen hatte; ein gezackter Halbmond hatte den Muskel aufgerissen. Wütend gab er ihr noch eine Ohrfeige. Daraufhin versuchte Nico wegzulaufen, aber der andere Korsar, der große diesmal, packte ihn beim Kragen. Die beiden Männer schleppten ihre jungen Gefangenen zum Rand des Ruinenfelds, beglückt über ihren Fang, so mühsam er auch vonstatten gegangen war. Solche tatkräftigen Kinder brachten auf dem Sklavenmarkt einen hübschen Preis.
Als sie sich den Klippen näherten, begann Nico zu schreien und sich zu winden, aber der Korsar hielt ihn fest; mühelos hob er ihn hoch und warf ihn wie einen Sack über die Schulter. Dann kletterte er vorsichtig eine kurze Böschung am oberen Rand der Klippen hinunter, und Maria sah, wie sie den Abstieg begannen. Sie wusste, dass ihre Chancen, sich selbst und Nico zu helfen, mit jedem Augenblick geringer wurden. Sie versuchte, das Messer in ihrem Gürtel zu erreichen, aber der Maure packte sie noch fester und wuchtete sie sich über die Schultern, den Kopf nach links, die Füße nach rechts. Jetzt lachte er über den Mut der Wildkatze auf seinem Rücken. In dem Glauben, es sei ein Junge, was er da schleppte, griff er dem Kind zwischen die Beine und wollte ihm die Eier quetschen, um sein Sträuben zu beenden. Als er entdeckte, dass er ein Mädchen trug, erschrak er so, dass er seinen Griff ein wenig lockerte. Maria spürte es gleich, und im nächsten Augenblick hatte sie ihr Messer. Die Klinge blitzte, als sie sie mit aller Kraft nach unten stieß. Sie wollte ihm den Bauch aufschlitzen, wie sie es bei den Fischhändlern gesehen hatte, wenn sie Thunfische ausnahmen. Sie war nicht stark genug, aber immerhin schnitt sie ihm die Haut an der Brust auf. Blut tränkte sein Hemd. Er schrie vor Wut und Schmerz laut auf, und seine linke Hand ließ sie los und griff instinktiv nach der Wunde. Mit zusammengebissenen Zähnen stieß sie noch einmal zu; diesmal zielte sie auf seine Gurgel. Gerade noch rechtzeitig hob er den Arm. Die Spitze des Messers fuhr hart in den Unterarmknochen. Es entglitt ihrer Hand, aber es genügte auch. Er schrie wieder und ließ sie los. Sie rollte von seinem Rücken herunter und landete auf Händen und Knien. Hastig rappelte sie sich auf und rannte um ihr Leben.
Der Korsar riss sich das Messer aus dem Arm und schleuderte es von sich. Er stürzte ihr nach, aber sie war zu flink. Er kletterte die felsige Böschung hinauf. Als er oben angekommen war, hatte sie schon das freie Feld erreicht und war auf halbem Weg zu den Ruinen. Er wusste, dass er sie einfangen konnte. Mit langen, sicheren Schritten verkleinerte er den Abstand zwischen ihnen. Als er sie fast eingeholt hatte, huschte sie durch die Tür und war wieder in den Ruinen.
In diesem Augenblick hörte er die Bootsmannspfeife: das Signal, dass das Wasser an Bord und die Galiote bereit war, den Anker zu lichten. Er fluchte, denn er wusste, dass Ali Agha nicht auf ihn warten würde. Wenn er nicht sofort zum Schiff zurückkehrte, würde er auf dieser mistverseuchten Insel festsitzen. Dieses Risiko war der Junge – das Mädchen – nicht wert. Behutsam, um die beiden Stichverletzungen und die schmerzhaftere Bisswunde zu schonen, machte er kehrt und lief zurück. Wo die Schlucht auf der gegenüberliegenden Seite der Bucht die Klippen teilte, sah er das Ende der Sklavenkolonne, die Wasser heranschleppte. Sie würden gleich an Bord sein. Er machte sich an den Abstieg.
Kaum war er über die Kante verschwunden, als Maria auch schon aus ihrem Versteck kam und zum Rand der Klippe lief. Der Maure war direkt unter ihr und kletterte an der steilen Felswand hinunter. Unter ihm, schon auf halbem Weg zum Strand, sah sie Nico, der immer noch auf den Schultern des Korsaren lag. Sie kreischte:
»Nico!«
»Mariaaaa!«, heulte Nico. Die beiden Korsaren blickten zu ihr hoch und konzentrierten sich dann wieder auf ihren Abstieg. Nico heulte wieder: »Maria, hilf mir!«
Verzweifelt sah sie sich um. Sie hob einen Stein auf, trat an die Felskante und schleuderte ihn hinunter. Sie wusste, dass sie auch Nico treffen konnte, aber irgendetwas musste sie tun. Unentschlossen war sie nie, und es war besser, Nico zu töten, indem sie ihn zu retten versuchte, als ihn zu töten, indem sie gar nichts tat. Zu kurz gezielt. Der Stein prallte neben dem Kopf des Mauren auf, der sie gefangen hatte. Er schaute mit finsterer Miene zu ihr auf, kletterte aber weiter hinunter. Sie sprang zurück und suchte einen neuen Stein heraus. Sie waren fast zu schwer für sie, aber mit großer Mühe schleppte sie einen in Kniehöhe zur Felskante. Mit aller Kraft wuchtete sie ihn hinüber. Der Maure blickte herauf, weil er ein Geräusch hörte, und der Stein traf ihn mitten im Gesicht. Lautlos taumelte er zurück, überschlug sich in der Luft und landete als formloser Haufen auf den Steinen am Wasser. Maria schrie wütend auf. Sie hatte den Stein nicht an diesen Kerl verschwenden wollen. Sie musste Nico helfen.
Nico heulte wieder auf, und sein verzweifeltes Klagen hallte von den Klippen auf der anderen Seite der Bucht wider. Hilflos mit den Armen rudernd, versuchte er sich vom Rücken des Korsaren hinunterzustürzen, doch vergebens. Der Korsar selbst hatte Mühe, an den Felsen Halt zu finden und nicht zu fallen. Maria warf noch einen Stein, einen leichteren diesmal. Dieser zerbarst neben dem Kopf des Korsaren und überschüttete ihn mit Splittern. Der Mann rutschte ab und hätte beinahe den Halt verloren. Er ließ Nico los, aber der klammerte sich jetzt in Todesangst mit beiden Armen an ihm fest. Seine Beine baumelten in der Luft. Einen schrecklichen Augenblick lang sah es so aus, als würden sie beide rückwärts in den Tod stürzen. Langsam und mit bedächtigen Bewegungen suchte der Korsar neuen Halt. Er schob Nico höher auf seinen Rücken und kletterte weiter.
Als Maria sah, dass sie ihn verfehlt hatte, ließ sie sofort einen neuen Stein über den Rand fliegen, und dann noch einen. Einer der Soldaten im Heck der Galiote blickte hoch und sah, was da vor sich ging. Er hob seine Arkebuse und feuerte hoch auf die kleine Gestalt. Die Kugel schlug dicht unter Marias Füßen in die Felswand. Aber obwohl es gefährlich wurde, hörte sie nicht auf. Sie war ohne Angst und blind für alles außer der Rettung ihres Bruders.
Endlich streifte einer der Steine den Korsaren am Kopf. Wieder wäre er beinahe abgerutscht, und seine plötzliche Bewegung bewirkte, dass Nico an seinem Rücken herabrutschte; er hielt sich mit einem Arm fest, fuchtelte mit dem anderen herum und suchte etwas, woran er sich festhalten könnte. Schließlich rutschte er ganz am Bein des Korsaren herunter und landete auf einem Felsensims. Maria hörte, wie er aufschrie, aber dann war er wieder auf den Beinen und schaute nach rechts und nach links. Rasch entschied er sich für einen Weg und begann seitwärts zu klettern, weg von dem Korsaren, der ihn über seinen Bemühungen, sich selbst zu retten, fast vergessen hatte. Maria versuchte Nico mit der Kraft ihres Willens voranzutreiben. Er war ein guter Kletterer und an den Felsen zu Hause, und gewandter als der Algerier war er sicher. »Isa, Nico!«, schrie sie anfeuernd. »Haffef! Haffef!« Sie hob Stein um Stein auf und warf sie hinunter.
Von seiner Bürde befreit, legte der Korsar die letzten fünfzehn Fuß bis zum Boden zurück. Er schaute zu Nico hinauf und warf dann einen Blick zum Schiff hinüber, um sich zu vergewissern, dass er noch Zeit hatte. Nach einer kurzen Berechnung stolperte er über die Steine und stellte sich unterhalb von Nico auf. Er zog seine Pistole und zielte auf den Jungen, der wie eine Fliege an der Felswand klebte. Er sagte etwas. Auf diese Entfernung würde er nicht danebenschießen.
Nico klammerte sich an die Wand und weinte. Er konnte sich nicht rühren. Seine Finger verkrampften sich, und er konnte sich nicht mehr festhalten. »Maria!«, schrie er. »Was soll ich tun?«
Maria fiel auf die Knie. Sie war erschöpft, und sie konnte die Steine kaum noch heben. Sie blutete im Gesicht, und ein Arm war taub. Sie warf noch einen Stein, und noch einen, aber sie traf nicht. Der Korsar beachtete sie nicht.
»Maria!«, rief Nico schluchzend. »Maria! Hilf mir, Maria!«
»Lauf weg, Nico!«
»Wohin denn? Wohin soll ich denn?«
Sie sprang auf und rannte am Abgrund entlang nach Osten, um eine bessere Stelle zum Werfen zu finden. Mehr konnte sie nicht tun. Sie hörte einen Pistolenknall und schrie auf; sie warf sich auf den Bauch und robbte zum Rand, um hinunterzuschauen. Nico lebte noch. Aus dem Lauf der Pistole in der Hand des Korsaren kam Rauch. Er hatte daneben gezielt, um dem Jungen Angst einzujagen, und es hatte gewirkt: Nico stieg hinunter.
»Nico, nicht aufgeben!«, schrie sie, aber wenn er sie hörte, ließ er es nicht erkennen. Einen Augenblick später war er unten. Der Korsar riss ihn hoch und klemmte ihn unter den Arm. Nico wehrte sich nicht; er hörte auf zu heulen und erschlaffte. Auf dem Weg zur Galiote blieb der Korsar bei der reglosen Gestalt seines Kumpans stehen. Ohne Nico loszulassen, leerte er die Taschen des Toten aus. Dann suchte er sich über die Steine hinweg seinen Weg zur Galiote, und wenig später ging er mit seiner Beute an Bord.
Maria weinte jetzt, voller Wut über ihre eigene Hilflosigkeit. Sie verachtete ihre Tränen. Immer weiter warf sie Steine, noch lange nachdem es irgendetwas nützen konnte; sie polterten an der Steilwand hinunter und fielen platschend ins Wasser.
Eine Pfeife schrillte. Achtundvierzig Ruder hoben sich und funkelten in der Sonne wie ausgebreitete Flügel an den Seiten des Schiffes. Trumm. Die Pauke des Bootsmanns ließ ihre volltönende Stimme erklingen. In einer einzigen Bewegung tauchten die Ruder in das Wasser der Bucht. Sie sah, dass Nico wie ein Tuchballen in den Laderaum geworfen wurde, und verlor ihn aus den Augen.
Trumm. Die Galeere setzte sich, von den Rudern angetrieben, in Bewegung, zunächst nur langsam. Matrosen enterten den Mast und lösten das Segel. Es flatterte schlaff, und als das Schiff aus der Bucht lief, schlug es hin und her, als sei es unschlüssig. Dann blähte es sich in einem Wind von achtern, der das Schiff erfasste wie mit einer Schlinge.
Trumm. Der Rhythmus des Bootsmanns wurde schneller, und die beiden hölzernen Schlegel schlugen abwechselnd auf die lederbespannte Pauke, während das Schiff in Fahrt kam. Im Takt der Trommelschläge tauchten die Ruder ins Wasser und schoben das Schiff voran.
Trumm. Die Stimme des Kapitäns hallte über das Wasser, als er seine Befehle brüllte. Der Steuermann stemmte sich ins Ruder. Das anmutige Schiff drehte hart nach Steuerbord, nach Westen.
Trumm. Das Dröhnen wurde leiser, als die Ruderer ihr Tempo gefunden hatten. Von der Höhe der Klippen aus wirkte die Galiote wie ein Wasserläufer, ein Insekt, das auf langen dünnen Beinen aus weißem Eichenholz über das Meer glitt. Maria blinzelte die heißen Tränen aus den Augen und sah ihm nach, bis das verhasste Insekt nur noch ein Punkt am Horizont war und ihren kleinen Bruder mit sich fortnahm.
»Nicolo«, flüsterte sie. »Nico, Nico.«
Trumm. Und er war nicht mehr da.
Kapitel zwei
»Bartholomeo! Bartholomeo!«, schrie Maria und rannte auf den Turm zu. Sie hatte die Leiter halb erklommen, als sie ihn sah; sein Gesicht war auf gleicher Höhe. Der Kopf war purpurfleckig geschwollen; Blut hatte sich darin angesammelt, nachdem er kopfüber aufgehängt worden war. Der Rest war auf die untere Plattform geflossen.
Ihr Schrei blieb ihr in der Kehle stecken, und sie gab keinen Laut von sich. Einen Augenblick lang konnte sie nicht einmal atmen. Sie stieg die Leiter hinunter, fiel von der letzten Sprosse, raffte sich auf und rannte wieder los. Sie flog über das offene Feld und schlängelte sich in panischer Hast zwischen den Steinen hindurch. Sie sprang über Hecken und niedrige Mauern, die sich zwischen den Äckern der einzelnen Bauern erstreckten. Erst wollte sie nach Mdina, zu den Zivilbehörden der Università, aber dann wurde ihr klar, dass sie einem kleinen Mädchen nicht zuhören würden. Auch ihre Mutter würde keine brauchbare Idee haben. Sie würde in Tränen und Vorwürfe ausbrechen, und dann würde sie in die Kirche gehen wollen.
Die Kirche. Vielleicht zu Dun Salvago, dem Priester. Nein, zu ihm auch nicht. Die Kirche würde Nico nicht helfen. Sie musste zu ihrem Vater, der in der neuen Festung arbeitete. Dort würden Ritter in der Nähe sein, starke, tapfere Männer, die etwas unternehmen konnten, um ihren Bruder zu retten. Ihr graute vor dem Zorn ihres Vaters, aber ihr blieb nichts anderes übrig.
Die Insel Malta war klein, nur zwanzig mal zwölf Meilen groß, und beinahe flach. Das Land neigte sich sanft von den Meeresklippen im Süden und Westen zu den Buchten und Häfen im Norden und Osten hinab. In einer dieser Buchten war der heilige Paulus gestrandet und hatte die Saat des Christentums gepflanzt, die sehr viel erfolgreicher aufgegangen war als irgendetwas anderes, das Menschen hier anzubauen versucht hatten. Der größte Teil der Insel war unfruchtbar und nur mit einer dünnen Schicht von schlechtem Mutterboden bedeckt. Es gab wenig Bäume, und die Vegetation war karg. Als Brennstoff verwandte man Gestrüpp und Guano. In der Mitte der Insel lag Mdina, die ummauerte Festungsstadt und mittelalterliche Hauptstadt. Jetzt lebten dort die maltesischen Edelleute, abgesondert vom Rest der Insel.
Maria war eine gute Läuferin, aber auf diesem steinigen, von tiefen Wassergräben durchzogenen Boden brauchte sie doch fast eine Stunde für den Weg. Je müder sie wurde, desto öfter stolperte sie, aber sie raffte sich gleich wieder auf und rannte weiter, getrieben von Entsetzen, Adrenalin und blanker Entschlossenheit. Sie rannte auf die felsige Halbinsel hinaus, die vom Berg Sciberras beherrscht wurde – eigentlich mehr Hügel als Berg. Auf seinen Hängen streiften Ziegen umher und knabberten an den Kaktusfeigen. Sie lief ostwärts über die Halbinsel, die zwei Häfen voneinander trennte. An ihrer Spitze, wo seit den Zeiten der Phönizier ein Leuchtturm stand, bauten die Ritter eine neue Festung, St. Elmo.
Sie warf einen Blick über den Hafen hinweg nach St. Angelo, einem alten normannischen Fort, das dem Orden des heiligen Johannes als Hauptquartier diente. Hinter der Festung lag das Fischerdorf Birgu, in dem sie wohnte. Neben dem Dorf verlief ein tiefer Wasserlauf; hier waren die Magazine, Arsenale und Docks des Ordens, die der Versorgung der Galeerenflotte der Ritter dienten. Maria fasste neuen Mut, als sie sah, dass dort eine Galeere am Kai lag und von Sklaven mit Vorräten beladen wurde. Sie werden Nico zurückholen!
Es herrschte reges Treiben zu Lande und zu Wasser. Boote aller Größen kamen von Birgu herüber und brachten Vorräte und Menschen. Burros stapften auf steinigen Pfaden um den Hafen herum, die Tragkörbe gefüllt mit Baumaterial. Sklaven und Sträflinge schufteten neben Arbeitern und Handwerkern aus Sizilien; sie hoben tiefe Gräben aus, zertrümmerten Felsen und schafften sie beiseite, behauten Steine, errichteten Mauern und Gerüste und schleppten Schutt, mit dem die Zwischenräume zwischen den äußeren und inneren Mauern gefüllt wurden. Winden knarrten, Hämmer trafen klingend auf Meißel. Männer schrien Befehle in verschiedenen Sprachen.
Maria rannte geradewegs in diesen Tumult hinein. »Mein Vater! Luca Borg! Taf fejn qieghed?« Auf Maltesisch rief sie, und dann wieder auf Italienisch – ein Dutzend Sprachen wurden auf Malta gesprochen. Aber bei den Arbeitern erntete sie nur verständnislose Blicke und Achselzucken. Sie hastete von einem zum anderen und brauchte eine halbe Stunde, bis sie ihren Vater gefunden hatte. »Vater! Vater!«
Luca Borg hatte einen Stiernacken und ein rotes Gesicht, gegerbt vom Wetter und von einem Leben voller Strapazen. Er war ein großer, starker und jähzorniger Mann gewesen. Die Hungersnot hatte jedoch Sehnen wie auch Mut dahinschmelzen lassen, und jetzt hing die Haut lose an seinen Knochen, und in seinen hohlen Augen lag ein gehetzter Blick. In der Not hatte er sein Werkzeug verscherbelt, um Essen für seine Familie zu kaufen. Es war nicht genug. Arbeitslos war er zu Hause geblieben und hatte zusehen müssen, wie seine beiden jüngsten Kinder starben. Dann hatte er sein Geld als Gelegenheitsarbeiter verdient, bis die Ritter mit dem Bau der Festung St. Elmo begannen. Luca kratzte Geld für sein neues Werkzeug zusammen und arbeitete seit kurzem wieder als Maurer.
Er war dabei, die Seite eines Kalksteinblocks mit einer breiten Axt zu bearbeiten, und hob jäh den Kopf, als seine Tochter herankam. »Maria? Was hast du hier zu suchen? Warum bist du nicht zu Hause?«
Sie wischte sich den Schmutz aus dem blutigen Gesicht und rang nach Atem. »Sie haben ihn geraubt, Vater! Sie haben Nico geraubt!«
»Ihn geraubt? Wer? Wo ist er?«
»Korsaren, Vater! Sklavenjäger, aus Afrika!«
»Jetzt gerade? Aus unserem Haus?« Er richtete sich kerzengerade auf und wollte loslaufen.
»Nein, Vater. In den Ruinen. Wir haben einen Schatz gesucht.«
»Ruinen? In welchen Ruinen?«
Maria holte tief Luft, und dann sprudelten die Worte aus ihrem Mund. »An der Südküste. In der Nähe des Wachtturms. Mich hätten sie beinahe auch gefangen. Ich habe versucht, Nico zu helfen, aber ich konnte es nicht. Sie haben ihn in ein Schiff geworfen und sind weggefahren. Ich hab’s versucht, Vater, wirklich. Ich konnte ihm nicht helfen, ich konnte sie nicht aufhalten. Ich habe Bartholomeo gesehen. Sie haben ihn ermordet. Überall war Blut.«
Lucas Augen verfinsterten sich, und seine Stimme war wie ein Donnerschlag. »Heilige Mutter Gottes! Was habt ihr denn an der Südküste gemacht? Ihr solltet doch die Jauchegrube ...« Er sprach den Satz nicht zu Ende, sondern ließ den Stein fallen, an dem er arbeitete, und schlug ihr mit dem Handrücken ins Gesicht, dass sie taumelnd in den Staub fiel. Tränen stiegen ihr in die Augen. Sie rappelte sich hoch und legte die Hand auf die Wange, entschlossen, sich von diesem Schmerz nicht zum Weinen bringen zu lassen. »Es tut mir Leid, Vater. Ich weiß, dass es falsch war, aber wir müssen ihm helfen. Wir müssen sie aufhalten!«
Luca raffte sein Werkzeug zusammen und hastete den Hang hinauf. Der capumastru, ein Baumeister aus Rhodos, war über einen Tisch aus dünnen Steinplatten gebeugt; er studierte Pläne, machte sich sorgfältig Notizen in einem Buch und gab den Vorarbeitern Anweisungen. In seine Arbeit vertieft, beachtete er Luca gar nicht. Luca trat von einem Bein auf das andere und drehte den Hammer in seinen großen Händen. Dann räusperte er sich. Der Mann blickte auf, verärgert über die Störung. »X’Gara? Xi trid. Was gibt’s?«
Luca nahm den Hut ab und berichtete hastig. Obwohl er den Baumeister turmhoch überragte, schüchterte der Mann ihn offensichtlich ein, und es klang fast entschuldigend, als er sprach. Der capumastru wartete nicht, bis er fertig war. »Dann haben sie ihn entführt?«, fragte er. »Er ist fort?«
»Si, mastru«, sagte Luca.
»Dann ist die Sache erledigt. Niemand kann ihn jetzt noch retten. Es gibt nichts zu tun. Du verschwendest deine Zeit und meine. Dein erster Tag auf der Baustelle, und schon machst du Probleme. Ich habe eine Festung zu bauen. Geh wieder an deine Arbeit.«
Luca zögerte. »Mastru, bitte. Ich muss Meldung machen«, sagte er.
»Also gut, dann mach Meldung. Am Kai ist ein Bruder. Aber beeil dich, oder du brauchst nicht zurückzukommen. Schon jetzt hast du einen Tageslohn verwirkt. Und nun lass mich in Ruhe. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen.«
Am Kai stand ein dienender Bruder des Johanniterordens bei einem Boot, das gerade entladen wurde. Er war kein vollwertiger Ritter; aber er trug das Halbkreuz und war Soldat. Nicht nur das schwarze Habit umhüllte ihn, sondern die ganze Arroganz des Ordens, als wäre er der Großmeister persönlich. Er redete mit dem Kapitän des Bootes und ignorierte Luca und Maria.
»Scusi, illustrissimo«, sagte Luca schüchtern, aber der Johanniter winkte ungeduldig ab. Maria zappelte nervös. Sie konnte sich die Verwandlung nicht erklären, die ihr Vater erfuhr, wenn er es mit einer Autoritätsperson zu tun hatte. Im Umgang mit seiner Familie war er ein Löwe. Jetzt war er ein Lamm. Maria selbst war ganz Löwe, und sie hatte keine Zeit, ein Gespräch über Bootsladungen abzuwarten. »Signore«, sagte sie in scharfem Ton auf Italienisch. »Dovete prestare ascolto! Ihr vergeudet Zeit! Ihr müsst etwas tun!«
»Iskot!« Luca hob die Hand, um sie zum Schweigen zu bringen.
Ihr Vater war der einzige Mensch, den Maria fürchtete, aber sie fürchtete nur die Prügel von ihm, nicht seine Zunge, und sie wusste, dass er sie jetzt nicht schlagen würde, nicht vor dem Ritter. Unbeeindruckt drängte sie weiter. »Ihr müsst uns sofort anhören«, sagte sie.
Luca Borg und der Bootskapitän sahen überrascht, dass der Ritter sich mit belustigter Miene umdrehte, um zu sehen, was das herrische Kind von ihm wollte. »Devo? Ich muss, junger Herr?«
»Sì«, sagte Maria. Sie musste jetzt das Reden übernehmen. Der Ritter sprach – wie die meisten seiner Brüder – kein Maltesisch.
Maria konnte Italienisch, weil ihre Mutter es zu Hause sprach, aber ihr Vater hatte nie mehr als ein paar Worte gelernt. Der Ritter lauschte ihrer Geschichte mit größerem Interesse als der capumastru, und er stellte ihr einen Schwall von Fragen. Wie hatte die Flagge des Schiffs ausgesehen? Wie viele Ruder? Ein Mast, oder zwei? Welche Form hatten die Segel? Schließlich schickte er seinen Pagen zur Burg, damit er dort Alarm schlug. »Geht mit ihm«, sagte er zu Maria und Luca. »Man wird dort weitere Fragen haben.«
Maria lief hinter dem Pagen her, aber ihr Vater zögerte. Sie drehte sich um. »Vater? Kommst du nicht mit?«
Luca Borg wusste, dass es zu spät war, seinen Sohn zu retten. Aber es war nicht zu spät, seinen Arbeitsplatz zu retten, um seine Familie – oder das, was davon übrig war – weiter ernähren zu können. »Wozu denn? Nicolo ist fort. Ich kann ihm nicht hinterherschwimmen. Ich kann mit diesen Leuten nicht einmal sprechen. Du warst dabei. Du kannst ihnen berichten. Dann komm und sag mir, was sie tun werden.« Damit stapfte er, gebeugt unter der Last seines Werkzeugs, wieder den Hügel hinauf.
Der Page führte sie zum Fort St. Angelo, der mittelalterlichen Burg. Am Tor übergab er sie einem anderen Pagen, der sie in einen Innenhof brachte und dort warten ließ, während er in den Tiefen der Burg verschwand. Kurz darauf wiederholte sie ihren Bericht vor einem anderen Ritter, einem leidenschaftlichen Spanier diesmal, der eine Halbrüstung trug. Wenige Augenblicke später verließ eine berittene Patrouille Birgu mit donnernden Hufen. Für Maria waren es prachtvolle, Furcht erregende Reiterengel, die einen Weg finden würden, ihren Bruder zu retten. Sie saß auf einer Bank und wartete, und dabei ließ sie die Beine baumeln, weil sie nicht bis zum Boden reichten. Eine Stunde verging, dann noch eine. Ritter kamen und gingen, und keiner beachtete sie. Sie ignorierten die Malteser immer, das wusste sie, und oft zeigten sie ihnen unverhohlene Verachtung. Sie wartete, sah sich um und nagte an der Unterlippe. Nach zwei Stunden kamen die Reiter zurück. Todesstarr lag der Leichnam des Korsaren quer über dem Hinterteil eines Pferdes, der Bartholomeos über einem anderen.