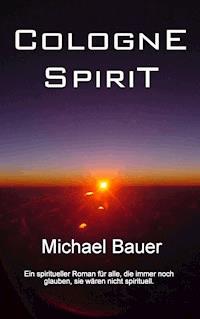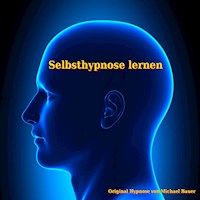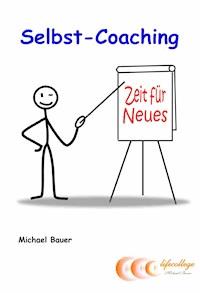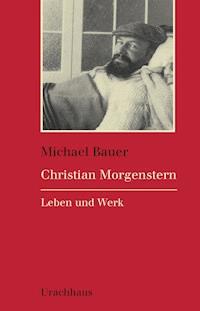
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Urachhaus
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Als Christian Morgenstern am 31. März 1914 starb, war außer seiner Frau Margareta auch Michael Bauer bei ihm. Bauer lebte später mit Margareta Morgenstern in ihrem Haus am Ammersee, umgeben vom Nachlass des Dichters, und begann 1922 mit der Arbeit an dieser umfangreichen Biografie, in der er vor allem den Menschen Morgenstern, den Sinnsuchenden, den Christen im Blick hat. Unter Tuberkulose - der gleichen Krankheit leidend wie sein Freund Christian Morgenstern, war Bauer oft zu Unterbrechungen des Schreibens gezwungen und konnte sein Werk schließlich nicht vollenden. Margareta Morgenstern und Rudolf Meyer führten die Biografie zu Ende und konnten sie 1933 erstmals veröffentlichen. Die herzliche Anteilnahme am Schicksal des Freundes, die große Nähe bei aller erforderlichen Distanz des Beobachtenden machen Michael Bauers Morgenstern-Biografie heute zu einem einzigartigen Quellentext für jeden, der sich eingehend mit Morgenstern beschäftigt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Michael Bauer
Christian Morgenstern
Leben und Werk
Inhalt
Vorwort
Kindheit 1871–1885
Jugend 1885–1893
»Eine Lerche Zarathustras« 1893–1895
Symphonie 1895–1896
Intermezzo 1897–1901
»Leben ohne Antwort« 1901–1905
»Ein Philosoph aus heitrer Höh«
Der Einsiedler 1905–1908
Erfüllungen 1908
Der Pfad 1909/1910
Vollendung 1910–1914
Nachlass. Nachruf
Bildteil
Bibliographischer Nachweis
Vorwort
Michael Bauer, der nahe Freund Christian Morgensterns in dessen letzten Lebensjahren, hat der Arbeit an diesem Buche seine eigene letzte Lebenszeit gewidmet. Es war sein Schmerz, es nicht mehr selbst beenden zu können. Er starb 1929 nach langem Kranksein an dem gleichen schweren Leiden wie Christian Morgenstern. Seine Aufzeichnungen hatte er mir übergeben mit dem Wunsche, dass ich die Biographie vollenden möge. Dieser Aufgabe habe ich mich zusammen mit Rudolf Meyer unterzogen. Seiner hingebungsvollen Mühe, seiner umfangreichen und eindringenden Mitarbeit hat das Buch Wesentliches zu verdanken.
Die ersten Abschnitte sowie das achte, neunte und elfte Kapitel hatte Michael Bauer selbst noch ausführlich bearbeiten können. Für die übrigen Teile lag sein Material meist nur fragmentarisch und zuweilen in mehreren Fassungen vor. Unsere Aufgabe bestand darin, unter Zugrundelegung seiner Vorarbeiten und seines Planes alles Fehlende zu ergänzen und seine Ausführungen einzufügen. Hieraus wird verständlich sein, wenn in der äußeren Gestaltung des Werkes die von uns nach Möglichkeit erstrebte Einheitlichkeit nicht immer ganz erreicht werden konnte. Innerhalb der Betrachtungsart ist sie aber überall vorhanden.
Die von Michael Bauer stammenden Stellen sind schwarz gedruckt, die ergänzten Passagen grau. Doch ist sein Anteil an dem Ganzen erheblich größer, als hieraus ersichtlich wird. Er selbst hatte die Arbeit noch umfassender geplant. Vor allem war ihm darum zu tun, Christian Morgensterns Gestalt in ihrer »Einzigartigkeit und Einmaligkeit« möglichst deutlich aus dem Zeithintergrund hervortreten zu lassen. Die Richtlinien, die er sich gesetzt hatte, waren auch für uns bestimmend: »Der Leser muß sich im Verlaufe der Biographie vor alle Urfragen unseres Lebens gestellt sehen und muß mit dem Dichter ringen und suchen und schließlich finden.«
Zugrunde gelegt wurde der Arbeit außer den gedruckten Werken der gesamte unveröffentlichte Nachlass Christian Morgensterns, wie er sich in seinen zahlreichen Taschenbüchern und Manuskripten sowie in seinen Briefen vorfindet. Das Buch enthält vieles, was hier zum ersten Male veröffentlicht wird an Gedichten und Fragmenten, angefangen von Entwürfen, die noch dem Zyklus »In Phanta’s Schloß« zugehören und einem geplanten humoristischen Werk: »Der Weltkobold«. Sodann Briefe, Aphorismen und Tagebuchaufzeichnungen aus den verschiedensten Schaffensperioden, eine Reihe bisher noch ungedruckter Galgenlieder und ernste Dichtungen bis in die allerletzten Lebenstage hinauf.
Außer Christian Morgensterns eigenen Briefen, die uns in dankenswerter Weise von seinen Freunden und Bekannten zur Verfügung gestellt wurden, sind auch viele der von anderen an ihn gerichteten Briefe mit herangezogen worden. Solche hat Christian Morgenstern in ungewöhnlich großer Zahl von seiner Kinderzeit an aufbewahrt.
Dem Verleger Herrn Reinhard Piper, durch dessen unermüdliches und mittätiges Interesse das Zustandekommen des Buches wesentlich gefördert wurde, spreche ich auch hier meinen herzlichen Dank aus. Ebenso Frau Gertrud Stern-Piper, die das Register anfertigte und die Korrekturen mitgelesen hat. Ganz besonders danke ich auch den Freunden, die mir bei der Revision des Textes behilflich waren.
Breitbrunn am Ammersee. 1. März 1933 Margareta Morgenstern
Zum besseren Verständnis nötige Anmerkungen und Daten wurden vom Verlag in dieser Neuausgabe in eckige Klammern gesetzt.
Kindheit
1871–1885
»Ich möchte sagen, daß ich immer noch im und vom Sonnenschein meiner Kindheit lebe.« Mit diesem Worte fasst der sieben- unddreißigjährige Christian Morgenstern die Erinnerung an seine Kindheit zusammen.
Er war das erste und einzige Kind junger lebensfroher Eltern, die beide in München geboren waren und auch dort lebten. Der Vater Landschafter, eine echte Künstlernatur, war bei der Geburt des Sohnes erst dreiundzwanzig Jahre alt. Die zwanzigjährige Mutter, eine edle, liebreizende Erscheinung, vielseitig künstlerisch begabt, wird vor allem als ausgezeichnete Klavierspielerin gerühmt. Eine besondere Vorliebe hatte sie für Mozart. Und als mozartisch wird man überhaupt den Geist des Hauses bezeichnen dürfen, das jeder frohen Geselligkeit und aller Kunst offen war.
Der am 6. Mai 1871 in München geborene Sohn erhielt in der Taufe die Namen: Christian Otto Josef Wolfgang. Christian nach dem Großvater Christian Morgenstern, dem bedeutenden Landschaftsmaler; Josef nach dem Großvater mütterlicherseits, dem ebenfalls angesehenen Landschafter Josef Schertel; Otto nach seinem Paten, dem Hamburger Kunsthändler Arnold Otto Meyer. Der Name Wolfgang aber sollte die Liebe der Mutter zu Wolfgang Amadeus Mozart bekunden.
Die Eltern wohnten in der damals noch wenig bebauten Theresienstraße. (Damals Nr. 12; im Jahre 1879 erhielt das Haus die Nr. 23.) Bald aber übersiedelten sie in eine Gartenvilla der Äußeren Nymphenburger Straße, die der Vater erwarb. Hier verlebte das Kind die Spätherbst- und Wintermonate. Sobald die Jahreszeit das Malen im Freien erlaubte, ging die Familie in eines der zu jener Zeit noch ganz ländlichen oberbayerischen Seedörfer Kochel, Murnau, Herrsching, Weßling usw., von denen manche noch nicht mit der Eisenbahn zu erreichen waren. Der Vater suchte als freier Landschafter gerne die Gebirgsseen auf, und das Kind wurde zu aller Freude überallhin mitgenommen – später auch in die Jagdreviere des Vaters, der ein begeisterter Jäger war. Oder es wurden größere Reisen unternommen. Zuerst »aus Lebenslust«, dann aus Rücksicht auf ein beginnendes Lungenleiden der Mutter. Christian Morgenstern erinnerte sich später besonders noch an eine lange Reise durch Tirol, die Schweiz und das Elsass, »die im wesentlichen in einer von zwei unermüdlichen Juckern gezogenen Kutsche zurückgelegt wurde«.
So hat der Knabe jeden Sommer seiner Kinderjahre im Umgang und Spiel mit der Natur verbringen dürfen. Von klein auf mochte er, wenn er seinen Vater mit dem Malergerät vor der Landschaft sitzen sah, immer wieder selbst versucht haben, mit Maleraugen zu schauen. Einen Dankbrief, den er mit sieben Jahren in einer sichtlich neu erworbenen großen Abc-Schützen-Schrift abfasste, unterschrieb er wichtig: »zukünftiger Landschaftsmaler«.
Von den Eltern als einziges Kind zärtlich geliebt, alle Menschen, die in das offene Haus kamen, durch sein frohgemutes, vertrauendes Wesen rasch gewinnend, so wuchs Christian Morgenstern heran – herzlich umhegt wie eine junge Pflanze in einem für alles Gedeihen wohlbereiteten Garten. Was dem Knaben wohl mitunter fehlte, waren die gleichaltrigen Spielgefährten. Noch als Mann klagt er, dass er in der Jugend so sehr den Besitz einer Schwester entbehren musste. Doch seine bewegliche Phantasie vermochte ihm stets die Einsamkeit zu beleben. Man geht gewiss nicht fehl, wenn man die große Liebe des Erwachsenen zur Einsamkeit mit seinen »einsamen stillfrohen« Spielen zusammenbringt.
In Morgensterns ruhig-strahlendem Auge lag es lebenslang wie ein Abglanz der Kindheitsjahre, in denen ihn Liebe umhegte und alle Kräfte des Vertrauens an den Tag lockte. – Für einen günstigen Umstand, der sein späteres Schaffen in glücklicher Weise unterbaute, darf man den regelmäßigen Wechsel zwischen Stadt- und Landleben in seiner Kindheit ansehen. Das Stadtkind, das in seinen Spielen fast ganz auf allzu fertiges Spielzeug angewiesen ist, erlebt in der freien Natur, im Wald, am Bach, am sandigen Hang eine unerschöpfliche Bereicherung für seine Phantasie. In der Natur sind Überraschungen an der Tagesordnung. Die Decke der in den Sand gegrabenen Höhle bricht plötzlich herab, das gestaute Wasser findet mit einem Male seinen Ausweg, ein gefährlich scheinender Käfer tritt auf den Plan. Wären wir Erwachsenen nicht gar so stumpf, wir hätten längst gefühlt, wie einengend für die Phantasie das fest umrissene, mechanische Spielzeug wirkt, wie schnell verbraucht das alles ist … Der kleine Christian konnte in seinen selbst geschaffenen Welten aufgehen. Einige Stücke Borke, ein paar bunte Scherben, Blätter und wimmelnde Ameisen genügten für seine Miniaturwelten, die er aus der Machtvollkommenheit seiner Phantasie beseelte und einem jeglichen darin Bedeutung und Wichtigkeit verlieh.
Über die Spiele in der Stadt erzählte der Vater noch später: von der kleinen Eisenbahn mit Uhrwerklokomotive, einem weiten Geleisachter samt Unterführung, Tunnel und anderem, und wie er selber manches Mal mit dem Kinde gemeinsam gespielt hat. Das fröhliche Geschrei des kleinen Christian, wenn der blecherne Zug an irgendeiner Wendung der Schienen im Zimmer entgleiste, war ihm davon am deutlichsten in der Erinnerung geblieben.
Diesen Spieltrieb hat Morgenstern sich noch bis in die Mannesjahre hinein bewahrt. In sein Tagebuch schreibt er 1907: »Ich könnte heute noch im Walde wie ein Knabe spielen: aus Steinen und Holzstücken Häuser bauen, mit dürren Zweiglein Rasen abstecken und Haine bilden, einen Felsblock zum Range eines Alpengipfels erheben und einem Hirschkäfer und seiner Frau die Herrschaft über das alles verleihen. Und dieses kleine Reich würde mich glücklicher machen und meine Phantasie umständlicher erregen und beschäftigen als ein noch so großes der Wirklichkeit. So habe ich einmal mit fünfunddreißig Jahren acht Tage am Strande von Sylt mit Bauen und Zimmern einer Strandhütte verbracht und war wohl selten so von Herzen froh, wie bei diesem harmlosen Spiel.« Nietzsches Ausspruch: »In jedem echten Manne ist ein Kind versteckt, das will spielen« ist hier bestätigt. Morgenstern hat später seine »Galgenlieder« »dem Kinde im Manne« gewidmet.
Draußen in der Nymphenburger Straße in München ist noch ein Stück des großen Gartens zu sehen, in dem Christian Morgenstern viele Tage seiner Kinderzeit froh verspielt hat. Unter einer Tanne befand sich eine Grotte, in der sich selbst bei nicht guter Witterung verweilen ließ. Auf einem Beet in diesem Garten blühten Sonnenblumen, die das Kind sich selbst gezogen und von denen der reife Mann noch leuchtenden Auges – und wie konnten diese Augen bei Erinnerung an Schönes leuchten! – erzählt hat. Eine dieser herrlichen Sonnenblumen, die zweiundfünfzig Blüten aus einer Wurzel trieb, gleich dem Jahre, das uns zweiundfünfzig Sonntage schenkt, empfand Morgenstern fast als ein Sinnbild seiner Kindheit. Er ließ später ein Exlibris mit dieser Sonnenblume für sich entwerfen.
Im Erdgeschoss der Gartenvilla wohnte der Oberleutnant Max Baumgartner, der den Knaben sehr liebte und oft ganze Manöverfeldzüge mit Zinnsoldaten für ihn veranstaltete. Auch der jugendliche Vater und dessen Vetter, der Maler Constantin Bauer, nahmen gern an den phantasiereichen Spielen des munteren Kindes teil und erfanden selbst allerlei Lustiges dazu. Seiner erfinderischen Necklust, die auch später noch von Freunden an ihm hervorgehoben wird, standen höchstens die Großmutter und ihre Schwester zuweilen etwas ratlos gegenüber. Doch große Herzenshöflichkeit, die ihm von Kindheit an eigen war und blieb, ließ es nie dazu kommen, dass sein Necken je hätte verwunden können.
Die Ausbildung des Knaben war völlig planlos. Durch den häufigen Aufenthaltswechsel der Eltern kam es in den ersten Jahren nie zu einem regelmäßigen Schulbesuch; hier und dort Privatunterricht und ein paar Wochen einmal eine Dorfschule in Oberbayern (Murnau) waren zunächst die harmlosen Begegnungen mit der »Pädagogik«. Zu Hause bedurfte es keiner, wie der Vater erzählte. Durch das fein empfindende Gewissen und den ihm eingeborenen Herzenstakt war das Kind sehr leicht lenkbar; im Übrigen überließ man es seinem freien Wachstum. Bezeichnend für das überzarte Gewissen des Knaben ist ein Kindheitserlebnis: Im Spiel mit einem Bauernbuben hatte er diesen versehentlich mit einem Steinchen neben das Auge getroffen, und obgleich nichts Schlimmes geschah, war die Pein darüber, dass er ihn aus Unachtsamkeit in Gefahr gebracht hatte, so groß, dass sie noch nach Jahrzehnten in ihm nachwirkte.
Eine frohe Kindheitserinnerung aber schildert er in einer Prosaskizze »Der erste Kuß«. Bei einer Theateraufführung von Kindern im oberbayerischen Seefeld lernt er, selbst erst siebenjährig, ein etwa dreizehnjähriges Mädchen kennen. Sie ist auf Ferien, aus ihrer Klosterschule gekommen und trägt ein graues, faltenlos zum Fuße reichendes Kleid. Ein Madonnenantlitz blickt ihn an und entzückt seine leicht bewegliche Kinderseele. Er widmete dieser Begegnung später ein Gedicht, »Kinderliebe« genannt, mit der Frage:
Wo weilst du, Liebe – nun wohl Mutter längst,
doch ewig junge Beatrice mir –?
Werke und Briefe, Bd. I
Reinheit und Andacht zum Schönen sprechen, wie schon aus diesen Versen, aus allen seinen Liebesliedern.
Die künstlerische Atmosphäre des Vaterhauses ist es wohl, die in diesen Jahren am stärksten seine Knabenseele bildet. Drei Generationen väterlicherseits waren Maler. Sein Großvater, Christian Ernst Bernhard Morgenstern, hat vor allem das Meer und die Alpen verherrlicht. 1805 in Hamburg geboren, war er nach dem Tode seines Vaters, des Miniaturmalers Johann Heinrich Morgenstern, schon in frühester Jugend aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen, sich im Ausland zu betätigen; zunächst in Russland, dann, mithilfe eines Stipendiums, in Norwegen und Kopenhagen. 1829 übersiedelte er nach München und wurde bald als Entdecker des Dachauer Moores und als Maler der bayerischen Alpen bekannt. Er war einer der frühesten Gestalter der romantischen Stimmungslandschaft. »Weißt Du« – schreibt der Enkel 1894 an eine Freundin –, »mein Großvater steht wieder in mir auf, mit seiner Liebe zu Mondscheinnächten und phantastisch gewaltigen Lüften, zu weiten Ebenen und zur weitesten Ebene, dem Meere. Ich bin Maler bis in den letzten Blutstropfen hinein. – Und das will nun heraus ins Reich des Wortes, des Klanges; eine seltsame Metamorphose.«
Aus der Ehe dieses Großvaters mit Luise von Lüneschloß, der Tochter eines badischen Offiziers (dem Herrenchiemsee gehört hatte), entstammte als einziger Sohn Carl Ernst Morgenstern, des Dichters Vater. »Meine Großmutter väterlicherseits«, schrieb der Dichter einmal, »war eine wundervolle Frau, voll Humor und Lebenskraft, – voll Sanftmut und Güte, ihrem Wesen nach ganz Aristokratin. Sie spielt in meiner Kindheit eine bedeutende Rolle.« Selbst die Malerei ausübend, wurde sie eine verständnisvolle Gefährtin des großen Künstlers.
Auch des Dichters Großvater mütterlicherseits war ein begabter Landschaftsmaler: Josef Schertel, geboren 1810 in Augsburg, gestorben 1869 in München. Er gehörte zu den vertrauten Freunden des Malers Christian Morgenstern.
Adalbert Stifter schrieb bewundernde Worte über ein Gemälde Schertels, welches der Linzer Kunstverein angekauft hatte und das der Kaiserin von Österreich so gut gefiel, »daß es ihr der Verein überlassen mußte«.
Über diesen Großvater sagt der Dichter in einer Tagebuchaufzeichnung (1898), die ein Gespräch festhält: »Sie sind ein Grübler – – ›Das habe ich wohl vom Vater meiner Mutter her. Der war Maler. Ein starkes Talent, stärker als mancher berühmter gewordene, aber fast krankhaft gewissenhaft; mißtrauisch, überbescheiden sich selbst gegenüber; ein Mann, der ein fertiges Bild wieder wegzukratzen imstande war, wenn ihm ein Zug darin ungenügend schien.‹ «
Josef Schertels Tochter Charlotte heiratete den Sohn des Malers Christian Morgenstern: Carl Ernst, des Dichters Vater, der eine Zeit lang Schertels Schüler war.
Von diesem vielfältigen Malererbe, das oft kurz vor dem Erwachen den Dichter als »ein Heer von landschaftlichen Sichten« erfüllte, schrieb er in dem gleichnamigen Gedicht:
Das sind der Vordern fortgepflanzte Wellen,
die meinen Sinn bereitet und bereichert,
das Erbe ihrer Form- und Farbenzellen,
darin die halbe Erde aufgespeichert.
Werke und Briefe, Bd. I
Morgenstern hat von der modernen Landschaftsmalerei einmal gesagt, sie sei »ein weiterer Schritt der Erde zur Erkenntnis und Liebe ihrer selbst«. In diesem Sohn und Enkel der Malerfamilie wird das Erbe zum Innenlicht!
Aber Christian Morgensterns Wesen entfaltet sich auch in einem musikalischen Element. Der Dichter beklagt es später noch oft, dass sein Vater ihm nicht als Kind die Möglichkeit gegeben habe, sich musikalisch auszubilden; denn mit der Musik sei ihm eine ganze Welt verloren gegangen. – Aufmerksam hatte das kleine Kind schon dem Mozart-Spiele der Mutter gelauscht und lernte so auch selbst früh diesen innig-klaren, kindlich-heiteren Künstler lieben. Die Mutter hat auch mit offensichtlichem Talent ernste und heitere Verse geschrieben. Alles, was als verinnerlichende Kraft in dem Sohne wirkte, empfing er in einem von ihm selbst sehr tief genommenen Sinne von seiner Mutter. »Im Sohn will die Mutter Mann werden.« Sie schuf in ihm gleichsam das Gegengewicht gegen den Augenmenschen. Aber schon mit neun Jahren verliert er die zarte junge Mutter. Sie ist im Jahre 1881 in Bad Aibling gestorben. Ein schweres Lungenleiden hatte sie in den letzten Lebensjahren gehindert, sich noch in vollem Maße der Erziehung des Knaben zu widmen. Eine Wolke zieht sich vor die Sonne seiner Kinderjahre. Hemmungen von außen und innen setzen bald darauf ein. Doch in allem Schweren, das ihm begegnet, fühlt er die Mutter als »Genius unsichtbar an seiner Seite«.
»Vielleicht war es dieselbe Kraft« – sagt er –, »die, nachdem sie ihn auf dem physischen Plan verlassen hatte, geistig fortan sein Leben begleitete und, was sie ihm leiblich gleichsam nicht hatte geben können, ihm nun aus geistigen Welten heraus mit einer Treue schenkte, die nicht ruhte, bis sie ihn nicht nur hoch ins Leben hinein, sondern zugleich auf Höhen des Lebens hinauf den Weg hatte finden sehen, auf denen der Tod seinen Stachel verloren und die Welt ihren göttlichen Sinn wieder gewonnen hat.« Die Mutter hatte das Kind zum Beten angeleitet; sie gehörte der katholischen Konfession an, doch lebte eine undogmatische, freie, innerliche Frömmigkeit in ihr. Der Sohn wuchs in dem protestantischen Glauben seines Vaters auf.
Die letzten Worte der Mutter waren: »Herr, vergib uns unsere Schuld« und, als ob sie die »Herrlichkeit« schon schaute, noch ein beseligtes: »Ach, wie schön!«
Der Vater hat den Sohn um viele Jahre überlebt.
Nach dem Tode der Mutter begann das Wanderleben des Knaben nun noch in einem anderen Sinne als bisher. Die Lektüre von Krapotkins Jugend, die ihn als Bild planvoller organischer Erziehung begeisterte, löste in Morgenstern später einmal die bitteren Worte aus: »Fast alles, was ich geworden bin, verdanke ich mir selber, einigen Privatpersonen und dem Zufall. Von irgendeiner bewußten organischen Kultur um mich herum, die das Einzelindividuum zu benutzen und systematisch auszubilden vermocht hätte, spürte ich nie etwas. Weder Eltern noch Lehrer noch irgendwer hat mich je kraftvoll in die Hand genommen und in großem Sinne erzogen. Und wenn ich, ein Mensch von ursprünglich glänzender Begabung, alles in allem ein Dilettant geblieben bin, so hat die Hälfte der Schuld daran gewiß die Unsumme von Dilettantismus, von Halbheit und Kulturlosigkeit, die ich überall gefunden habe, wohin mich meine bewegte Jugend geführt hat« (»In me ipsum«), Werke und Briefe, Bd. V.
Zunächst wurden einige erzieherische Experimente mit dem Knaben angestellt. Der Vater gab nach dem Tode der Mutter das Münchner Haus auf und zog nach Starnberg. Da aber die Schulverhältnisse in dem damals noch recht kleinen Ort für den Knaben unzulängliche waren, nahm der Vater eine Erzieherin, die Tochter des Malers Geiser, für den Sohn ins Haus. Sie führte ihn auch in die Welt der Märchen ein. Doch dieser liebevolle Unterricht währte nur ein paar Monate. Dann suchte der Vater nach einer anderen Lösung, und so war es ihm sehr willkommen, dass der ihm befreundete Hamburger Kunsthändler Arnold Otto Meyer, der Taufpate des kleinen Christian, sich bereit erklärte, diesen zur Erziehung aufzunehmen. Im April 1881 brachte ihn der Vater nach Hamburg. Dort sollte er eine sehr gerühmte Schule besuchen. Ein Bildchen aus jener Zeit, das ein zartes, waches, blasses Büblein zeigt, und ein Brief, den die Tochter des Hamburger Freundes später an den Knaben schrieb, geben einen guten Eindruck von der damaligen Artung des Kindes. »Du kleiner Kold, Du!! … Hab Dir auch noch gar nicht gedankt für das ausgezeichnet gelungene Gedicht … Dichte man immerzu. Klimperst Du auch noch? Singst Du wieder Storch, Storch Steiner … Machst Du noch immer so schöne Aufsätze vom Schuster Stuhmer und von Trunkenbolden? … Gehst Du auch noch immer einen tänzelnden Schritt?« (27. August 1882). Aber schon nach einem Jahre wurde Christian dem Vater zurückgeschickt. Es ist schwer, klar zu sehen, was vorgegangen war. Alle Freundlichkeit, die der Knabe in Hamburg erfuhr, konnte den Gegensatz nicht überbrücken zwischen den umhegten Jahren im Elternhaus und der fremden Umwelt jetzt. Den Aufzeichnungen zufolge scheint bald eine tiefe Verkennung eingesetzt zu haben. Das Kind, bisher von Liebe umgeben, darbte innerlich. Seine schon von klein auf gezeigte Neigung, durch Necken gerade seine heimliche Zärtlichkeit kundzutun, wurde jetzt vielleicht oftmals missverstanden, und Verschlossenheit war die Folge. – Jedoch dies Hamburger Jahr war dennoch glücklich zu nennen im Vergleich mit der Zeit, die nun begann.
Nach der Rückkehr aus Hamburg gab ihn der Vater, dessen häusliche Verhältnisse es noch nicht erlaubten, den Sohn bei sich zu haben, nach dem bayerischen Landshut an der Isar in eine Erziehungsanstalt, wohin auch andere Starnberger Bekannte, wenn die Zeit der Mittelschule herankam, ihre Söhne schickten.
Hier scheinen seine eigentlichen Schulleiden, die von da an lange Jahre ihre Schatten in das Leben des Knaben warfen, ihren Anfang genommen zu haben. Das Missverhältnis zu seinem früheren Leben springt nur zu sehr in die Augen: Aus dem reichen Hamburger Hause in den Massenbetrieb des Internats versetzt, der »einsame und stillfrohe« Knabe inmitten einer Schar von Kameraden, die offensichtlich häufig genug nur durch einen derben Zugriff vonseiten der Lehrer im Zaum zu halten waren.
Es mag zugegeben werden, dass es für seine Lehrer, die ja gezwungenermaßen in festen Geleisen arbeiteten, nicht ganz leicht war, hinter die eigentliche Begabung und Veranlagung des kleinen Christian zu kommen. Es rächte sich, dass der bisherige Unterricht durch den häufigen Ortswechsel: winters in der Stadt, sommers auf dem Land – erst Starnberg, dann Hamburg, jetzt Landshut – keinen geschlosseneren Zusammenhang gehabt hatte. Aber ein Knabe von solcher Aufgewecktheit und raschen Fassungsgabe wie er musste sich, wenn anders die Lehrer ein wenig Verständnis für ihn besaßen, überall zurechtfinden. Doch er geriet in dieser Anstalt bald in große Schwierigkeiten. Es sind auf blau karierten Blättern, wie sie billige Wachstuchnotizbücher enthalten, etliche Aufzeichnungen aus dieser Zeit vorhanden, in denen er sich erbittert über die rohe Behandlung auslässt. Er erwähnt, dass er wegen Umdrehens bei einer Klassenvermahnung heftigste Schelte und soundso viele »feste Ohrfeigen« bekam. Dies war die erste körperliche Züchtigung, die er im Leben erfahren hat, denn der Vater hat ihn, wie er mir erzählte, niemals gezüchtigt: »weil er doch immer durch Worte zu leiten war«. Dann halte man hinzu, wie sich bei einem phantasievollen, liebesgewohnten (und dadurch liebebedürftigen) Kind ein äußerst empfindliches Ehrgefühl herausgebildet hatte. Und dieser Knabe nun in einem Schulinternat, wo nur böser Wille vorausgesetzt wurde und ein heimlicher Krieg zwischen Schülern und Lehrern bestand, wo die Lehrer die Schüler und die Schüler die Lehrer als ihre Quälgeister betrachteten.
Mit dieser Periode begann der Riss zwischen dem Schulleben und dem, was er neben und trotz der Schule versuchte, als Leben zu gestalten.
Ein paar Jahre später würde der Knabe durch Kritik, die er seinen Erfahrungen gemäß den Lehrern gegenüber geübt hätte, wohl eine Art Sicherung gefunden haben. Aber ein elfjähriges Kind kritisiert noch nicht, um sein Gleichgewicht zu retten. Es leidet noch ungeschützt, an das Geschick wie verhaftet. Die Schulen machten gerade von der Kraft, mit der er zu allem zu bringen gewesen wäre, keinen Gebrauch: von der Phantasie. – In diese Zeit fallen schon dichterische Versuche des Knaben; er besingt u.a. den Schnee in Hexametern und schreibt Beobachtungen über die »auffällige Röte des Abendhimmels« auf.
Was ihm in den entscheidenden Jahren besonders fehlte, war die Persönlichkeit, zu der er in liebender Verehrung hätte aufblicken können. Es ist nicht abzusehen, wie viel Bestärkung der Lebenssicherheit und des Lebensvertrauens er gewonnen hätte, wenn er für diese Jahre seine Mutter hätte behalten dürfen.
Vom Vater war er getrennt; doch tauschten sie regelmäßig Briefe aus. Von ihm empfängt er liebevoll aufmunternden und ermahnenden Zuspruch. So schreibt der Vater ihm am 12. November 1883 nach Landshut: »Im Übrigen mein lieber Schäning, sei vernünftig und laß um Gottes willen keine traurigen oder sentimentalen Gedanken Dich überkommen. Wir müssen die augenblickliche Situation eben hinnehmen, wie sie ist, und daß sie für Dich im Vergleich zu der meinigen goldig ist, darfst Du glauben. Habe Du nur keine andere Sorge als zu lernen und finde darin Zerstreuung. Was das andere, die Behandlung betrifft, so gebe ich zu, daß ein weiches Gemüt davon härter betroffen wird und bedaure lebhaft solches; indes wer einmal ein Mann und als Deutscher Soldat wird, blicke ruhig drein, selbst bei etwaigen Ungerechtigkeiten, sie müssen frühzeitig ertragen gelernt werden. Wenn Du besser griechisch kannst wird Dir wohl ein Sprichwort vorkommen:
ὁ μὴ δαρεὶς ἄνδρωπος οὐ παιδεύεται
wörtlich zu deutsch: ›Der nicht geschundene Mensch wird nicht gebildet.‹ Es liegt darin eine große Wahrheit, denn in der Regel ist aus allen jenen Menschen, welche das Leben recht gehunzt und recht gequält in der Jugend, später ein tüchtiger Charakter und etwas Bedeutendes geworden. Ein Beispiel Dein Großvater Morgenstern.
Ich versichere Dich, lieber Schäning, daß es mir selbst am Leidesten tut, wenn ich Dich so bald nicht sehen kann; ich muß mich eben der zwingenden Gewalt fügen und warten, bis bessere Zeiten kommen, und sie werden kommen. Ich hoffe, daß wir alle vereint in einer Stadt leben können, und das tröstet mich und läßt mich in der festen Hoffnung, daß die Zukunft besser wird, die Gegenwart leichter ertragen, und so mußt Du es auch machen und ein fideler heiterer Kerl sein …
Schreibe recht bald wieder, schütte Dein Herz aus in Deinen Briefen Deinen Eltern; sie sind Deine besten Freunde, und ich werde noch allemal ein Pflaster auf Deine Wunden finden. Also Glück auf und herzliche Küsse und Grüße von Deinen Dich liebenden Eltern.«
Inzwischen hatte der Vater in Starnberg wieder geheiratet: Amélie von Dall’Armi. Als er bald darauf einen Ruf als Professor an die Kgl. Kunstschule zu Breslau erhielt, übersiedelten sie dorthin. Sie bezogen eine Wohnung in der Breitenstraße 24 und nahmen jetzt den Sohn zu sich. Am 30. März 1884 durfte er Landshut verlassen. Die neue Mutter nahm sich fürsorglich des Knaben an. Äußerlich war sein Leben von jetzt an noch einmal für einige Jahre geborgen. Seelisch jedoch blieb er sich viel allein überlassen. – Die Eltern zogen den Sommer über meist in das schlesische Gebirge hinaus. Der Vater arbeitete mit seiner Landschafterklasse oft monatelang in der Natur. Während der Schulferien war der Sohn bei ihm auf dem Lande.
Es ist ergreifend, aus den Briefen und Aufzeichnungen der nächsten Jahre zu sehen, wie zärtlich und liebevoll aufblickend der Sohn am Vater hängt. An ihn glaubt! Wenn er in der Einsamkeit der beginnenden Jünglingsjahre sich nach einem Vertrauten sehnt, der seine inneren Fragen verstehen und seine Kämpfe mittragen könnte, so wandern seine Gedanken zuerst zu ihm: »Aber mein geliebter Vater, – er hat ja keine Zeit!«, entschuldigt er immer wieder, wenn er sich mit seinen Freuden und Leiden allein gelassen fühlt. Der Vater war von einem leicht beweglichen, sich liebevoll an der unmittelbaren Gegenwart entzündenden Künstlernaturell, und in dieser Hinsicht waren beide von gleicher Wesensart. Im Umgang von gewinnendem Wesen, als fröhlicher Gesellschafter allgemein beliebt, besaß der Vater jedoch die Neigung, alle Lebenspflichten von sich zu weisen, sobald sie ihm Unbequemlichkeiten verursachten. Solche auf sich zu nehmen war er nur widerstrebend bereit, was sich in der Folge für das Leben des Sohnes schmerzlich fühlbar machte und schließlich zum vollkommenen Bruche führte. Noch aber waltete das innige Band zwischen den beiden, von der Liebenswürdigkeit des Vaters und dem tiefen Vertrauen des Sohnes immer wieder neu geknüpft. Später, als die Trennung vollzogen war, sah der Sohn auf die Stunde zurück, wo der Vater ihn, den Zehnjährigen, in Hamburg fremden Menschen übergab: »Auf der Lombardsbrücke zu Hamburg war es wohl das letzte Mal, daß Du mich küßtest, Vater, mit einer Liebe, wie sie mir nie mehr in meinem ganzen Leben entgegengeströmt ist, mit einer überquellenden Zärtlichkeit, die die Kindesseele wie in Gottessegen einhüllte und durchdrang, daß sie heute noch, reif und hart geworden, bei dieser Erinnerung weint und zittert in unsäglicher Liebe und Wehmut.« Der Abschied auf dieser Brücke wird zum Sinnbild. Damals gingen sie nach verschiedenen Seiten – jeder in seiner Richtung … Und noch einmal, nach jahrelanger Trennung, möchte der Sohn dieses Schicksal wenden: »Heute liegt eine große leere Brücke zwischen uns – noch ist es eine Brücke! – Wird sie vergeblich harren, daß einer von uns sie betritt und zum anderen hinübereilt und jenen Augenblick noch einmal auferstehen läßt, wo wir so nichts waren als unendlich liebendes Kind und unendlich liebender Vater?« Notizzettel o.J.
Der Vater wird ihm immer mehr zum Erkenntnisrätsel. Dies Rätsel lässt ihn nicht mehr los, schon als der Vater längst ihn losgelassen hatte:
Vom Vater hab ich, was verführt,
doch von der Mutter, was besteht,
von ihm das Feuer, das mich schürt,
von ihr den Wind, der’s aufwärts weht.
Jugend
1885–1893
In den nun folgenden Jahren besuchte Christian Morgenstern in Breslau das Gymnasium Maria Magdalena. Aber auch dies musste ihn bald genug enttäuschen. Dem Enthusiasmus für alles Große, der ihn, je älter er wurde, immer mehr beseelte, wurde auch hier nicht genug Nahrung gegeben. Wäre die Schule in Ordnung gewesen, so hätte sie, wenn auch ringsum Unkultur herrschte, doch das Bild einer höheren Kultur vor die Seele stellen können. Da die Jugend von Begeisterungskraft erfüllt ist, so wäre durch solchen Kontrast zwischen der Wirklichkeit und dem Ideal der Wille zum Schaffen nur gesteigert worden. In Wahrheit aber musste die Schule eher lähmend wirken. Sie verstand den Knaben nicht und trieb ihn dadurch in Opposition. Im Grunde war er immer, auch später, darauf angewiesen, autodidaktisch seinen Weg zu suchen.
So sehen wir ihn denn bald ein merkwürdiges Doppelleben führen. Neben der Schule, für die er immer wieder aus Pflichtgefühl die besten Vorsätze fasste, lief bald ein vielfältiges selbst geschaffenes Leben einher.
An erster Stelle sind hier seine sehr früh einsetzenden dichterischen Versuche zu nennen. Der Dreizehnjährige schreibt kleine historische Tragödien, aber auch scherzhafte Verse, z.B. im Stil Friederike Kempners: »O Afrika, du Land der Träume, du der Kamele Heimatland.« Der lateinische Unterricht reizt ihn, schon damals kleine Travestien zu verfassen; es entstehen Umdichtungen in Knittelversen von Stellen aus der Jason- und Troja-Sage. Als er, sechzehnjährig, ein Trauerspiel »Alexander von Bulgarien« zusammen mit anderen Dichtungen in einer befreundeten Familie vorgelesen hatte, schrieb er danach in sein Tagebuch: »Alles Ulkige gefiel, mit dem Trauerspiel fiel ich so ziemlich durch.«
Weiter heißt es, dass er mit seinen humoristischen Gedichten bei seinen Klassenfreunden »Furore« mache, »die nur leichtes Futter vertragen. Ich werfe manchmal absichtlich ein paar Gedichte in die Klasse, damit sie mich, da ich doch in den Fächern nichts besonders Gutes leiste, nicht für dumm, sondern nur für faul halten. Schande über mich!«
Damals ging eine hohe Welle von Kolonialbegeisterung durch Deutschland. Christian errichtete mit einigen Kameraden in wochenlanger Arbeit eine »Angra Pequena«-Baude. »In phantasievoller erfinderischer Weise verwandelte er das Gärtchen und die Laube, die ihnen zur Verfügung standen, in ein Indianerwigwam, ja, in ein Universalparadies für jungenhaften Abenteurersinn im Stile Lederstrumpfs und Robinsons«, erzählt sein Jugendfreund Oskar Anwand aus dieser Zeit. – Bald gab es für die intimsten Freunde eine Angra Pequena-Geheimsprache, in der sich schon die Freude am Laut und an geheimnisvollen Lautgebilden, die wir aus den »Galgenliedern« kennen, ausdrückte. Es folgten eine Geheimschrift und eine hektographierte »Baudenzeitung«, mit Beiträgen von ihm und seinen Freunden, die von den Mitschülern begeistert aufgenommen wurde. – Später trieb er mit größtem Eifer neben dem Schulunterricht das Studium des »Volapük« und führte in dieser künstlichen Weltsprache eine weitreichende Korrespondenz.
Daneben gehen echte Knabeninteressen. Er legt ein Notizbuch mit allerlei technischen Einfällen an, ersinnt »Luftballon-Bataillone« und anderes. Es werden Tiere gezüchtet, und wenn er fern ist, muss ihm ein Freund über das Gedeihen der Zucht treulich Bericht erstatten: »Deinen Tieren geht es recht gut; der Molch hat sich heute glücklich gehäutet und sieht jetzt wieder sehr schön und glänzend aus.« Um sich die trockene Naturkunde schmackhafter zu machen, schreibt er eine »Mineralogia popularis« mit allerlei witzigen, zum Teil auf Wortspielen beruhenden Beschreibungen der Metalle und anderer Stoffe.
Mit besonderer Freude treibt er schon damals das Schachspiel. Voll Stolz notiert er sich in ein Heft die den Eltern abgewonnenen Partien. Die Liebe zu diesem Spiel hat ihn durch das ganze Leben begleitet; er pflegte später auf seinen Reisen ein Taschenschachspiel mit sich zu führen, um Schachaufgaben zu lösen und zu erfinden.
»In meinem sechzehnten Jahre etwa wurde mir das erste Glück philosophischer Gespräche«, erzählt er in seiner Autobiographischen Notiz in Stufen. »Schopenhauer, vor allem auch schon die Lehre von der Wiederverkörperung traten in mein Leben ein.« Gedichte des Sechzehn- und Achtzehnjährigen, die in dem Nachlass-Bande »Mensch Wanderer« veröffentlicht sind, zeugen dafür; ebenso der Entwurf zu einer Dichtung (Tagebuch 1888/89): »Faust, Kindheit, Mannesalter, Greisenalter mit Grundlegung der Lehre von der Wiedergeburt.« – In den nun folgenden Jahren sucht Christian Morgenstern sich nachdenkend ein Lebensverständnis zu erwerben. Er beginnt immer stärker neben dem, was die Schule an ihn heranbringt und von ihm fordert, selber erkennend Fuß zu fassen. Das alte δóῃ μοι ποὔ στὤ (gib mir, wo ich stehen kann) zieht sich von nun an als ständige Forderung durch sein geistiges Streben. Bezeichnend ist die Tagebuchstelle, in der er aufzählt, was er alles außerhalb der Schule treiben und studieren möchte: nicht nur Volapük, auch Philosophie, Politik, Kunstgeschichte, Theater. Dazu kommen die bildenden Freundschaften, die Berufspläne und die eigenen Dichtungsversuche, die seine Zeit in Anspruch nehmen.
Die Erschütterung über die Krankheit eines geliebten Freundes wird ihm Anlass, dem Rätsel seines eigenen Lebens nachzusinnen. Damals – mit siebzehn Jahren – schreibt er in sein Tagebuch: »Wie gerne würde ich seine Krankheit auf mich nehmen, wenn nur er, der blühende, schöne Jüngling seinen trostlosen Eltern und der für ihn so schön und herrlich liegenden Zukunft erhalten werden könnte … Ich bin müde geworden, habe einsehen gelernt, daß auf dieser Welt für mich nicht mehr viel zu holen sein möchte, und so habe ich nun den erklärlichen Wunsch, wenigstens in einer anderen Welt etwas zu vollbringen. Es ist sonderbar, meine Gedanken schweifen jetzt oft von der Erde ab und möchten die Geheimnisse der Unendlichkeit, der Gottheit erforschen. Und weil ich weiß, daß dies, solange ich an meinen Leib gebunden bin, nicht möglich ist, so denke ich mir das Leben nach dem Tode viel schöner. Aber es ist frevelhaft, über das köstlichste Gut, die Gesundheit, zu klagen, und wenn ich einmal krank werde, so werde ich mich schmerzlich daran erinnern, daß ich sie, die Krankheit, in einer seltsamen Stunde einst erwünscht habe. Ach, ich bin so tief traurig über meinen armen, lieben Freund … Aber es ist wahr, gerade die Besten, Reinsten werden von hier abgerufen, gleich als sollte mit ihnen ein neues, göttliches Reich gegründet werden.«
Aber trotz oder wohl gerade wegen dieser steten Hinwendung zu einer unsichtbaren Welt, in der er andere, noch höhere Entwicklungsmöglichkeiten für die Seele ahnt, fühlt er sich frühe schon dem kirchlichen Christentum entfremdet. Eine Aufzeichnung aus der Breslauer Schulzeit spiegelt dieses religiöse Entwurzeltsein und das Suchen nach einem neuen Gotteserlebnis:
»– – Ich wanderte langsam nach Hause zu, der reizvollen Abendbeleuchtung mich fügend, aber es trieb mich an unserem Tor vorbei, und ich stieg auf die Holteihöhe … Oben war es still und leer. Dann blickte ich hinunter auf den imposanten Oderstrom, zur Seite das mächtige Regierungsgebäude und ein paar hohe Bäume daneben, alles im Abendlicht mit scharf gezeichneten Umrissen – alles von den im Wasser gespiegelten Laternen bis zum lichtgewölkten Himmel voll Poesie, voll feierlicher Andacht. Ich stand versunken da. Meine Einbildung ließ mich statt der Oder die Alster in Hamburg sehen. Vor mir die gewaltige Lombardsbrücke, über die ich so oft als Schulknabe gegangen, dann bog der Weg links ab, und dann kam ich in jene kleine Straße, an deren Ende meine Schule lag. Auch von den Kameraden dort grüßte ich manchen. Mein Auge schweifte wieder zurück an dem Quai entlang, auf dessen Mitte ich selbst mich befand, aus dem Fenster eines Hotels schauend, das ich einst mit meinen Eltern bewohnt. Und noch etwas weiter: da steht die Petrikirche, mit ihrem hohen spitzen Turm, in der ich so oft mit dem großmächtigen Gesangbuch neben Meta Meyer oder neben der guten Tante Louise, dem lieben Onkel Otto, andächtig saß und sang: Ein feste Burg ist unser Gott, ein’ gute Wehr und Waffen … Ich drehte mich um, denn es wurden Schritte hörbar. Ein armer Laternenanzünder brannte eine Lampe an. Ja, dachte ich, wir sind alle solch armselige Anzünder; am liebsten möchten wir die ganze Welt in Flammen setzen und können schließlich froh sein, wenn wir hier und dort ein Herz finden, das wir anfachen dürfen, ganz so, wie dieser Mann sein Lämpchen. Ich weiß nicht, wie es kam, aber die Tränen kamen mir in die Augen, und ich hätte am liebsten die Hände gefaltet und gerufen: Du lieber Gott, wie ist alles so schön, was für ein weites, liebendes Herz gabst Du mir, ich kann nicht anders als mit ihm auch Dich wieder umfassen, – ›ich will einen Gott haben‹ –– und ich – hatte ihn wieder. Mag man mich schelten, wie man will; in Kirchen werde ich nicht gehen, aber wenn ich einsam wandere in der schönen erhabenen Natur, dann will ich stehen bleiben, oder ins weiche Gras mich niederlassen, und will zu den Sternen emporsehen und auf die Felsen, die Bäume, die Bäche, und mein Geist wird alles bevölkern mit lieben Gestalten, mit Hoffnungen, Träumen, Erinnerungen – das wird mein Gebet sein zum ewigen Gott, dessen Wehen ich spüre in meiner Brust. Meinen Gott wieder! Reiner, edler, gewaltiger wieder!«
Er durchschaut das Unechte im Gebaren seiner Erzieher und schreibt später darüber: »Heuchelei – das erste, was ich sah«:
Und lieber Gott und aber lieber Gott.
Ich fühlte, fromm, mir Seligkeit verbrieft.
Dann kam der Sturz. Der wilde Schmerz und Spott.
Und doch. Was tat’s. Selbst ihr habt mich – vertieft.
Werke und Briefe, Bd. II
Mittlerweile ist der Selbstbildnerwille in ihm zum Durchbruch gekommen. An seinem achtzehnten Geburtstag trug er in sein Tagebuch ein: »Wie ein aus düsterem Grabe Auferstandener recke ich meine Glieder. Ja, Gott, Gott sei’s gedankt – ich fühle mich freier, mutiger, hoffnungsfreudiger – ich lebe. Ja, jetzt erst beginnt mein Leben! Jetzt erst ist es mir klar geworden, daß in mir verborgene Kräfte schlummern, die wert sind, vom goldenen Sonnenstrahl geweckt zu werden. Jetzt erst habe ich erkannt, daß es meine schwerste Sünde war, meinen Geist bisher verkümmern, verderben zu lassen.«
Er fühlt, dass sein Geist »nicht unwert ist der Gnade, die über ihn ausgegossen, daß er vielmehr berufen ist, Großes zu wirken«. Als er, bald nach Beendigung der Gymnasialzeit, dem Werke Nietzsches begegnet, formuliert er das, was er an all seinen Erziehern immer vermisst hat:
Man muß Künstler sein, will man Lehrer sein –
Aus dieser künstlerischen Anschauung vom Menschenwesen ergab sich für ihn auch der Unsterblichkeitsgedanke. In dem sehr frühen Entwurf eines Gesprächs zwischen einem Christen und einem Atheisten lässt er den Christen die Fortdauer der menschlichen Existenz mit der Begründung verteidigen: »Stellen Sie sich die unzähligen Menschenleben als ebenso viele gewaltige Torsos vor, als Bruchstücke angefangener Bauten, die, soll hier nicht allen Gesetzen der Schönheit und Vollkommenheit Hohn gesprochen werden, eine Fortbildung, eine Weiterbildung gebieterisch fordern.« – Es ist charakteristisch für Morgenstern, dass er hier als Begründung für den Gedanken der Unsterblichkeit kein religiöses Dogma ins Feld führt, sondern das Bewusstsein der Welt als eines harmonischen Ganzen, als eines göttlichen Kunstwerks.
In diese Entwicklungsjahre leuchtet eine Jugendfreundschaft hinein, die sich immer mehr zu einer Lebensfreundschaft ausgestaltet hat. Achtzehnjährig lernt Christian Morgenstern an einem Sommertage Friedrich Kayssler auf einem Breslauer Spielplatz kennen. Kayssler hat die Erinnerung an diese erste Begegnung festgehalten: »Im Sommer 1889 vor den Hundsferien hocken ein paar Schuljünglinge zwischen fünfzehn und siebzehn auf einer Reckstange und baumeln mit den unverhältnismäßig langen Beinen. Das Turngerät steht im Gartenhof eines behaglichen Mietshauses einer großen schlesischen Stadt. Einige Schritte vom Reck längs dem Grenzzaun des Grundstücks kauert eine Art gestreckten Schuppens, mit geteerter Dachpappe gedeckt. Er heißt die ›Baude‹ und ist von oben bis unten, von innen und außen das eigenhändige Machwerk aller Schuljünglinge, die in diesem Hause wohnen. Sie haben es aus Kistenbrettern gebaut, gedeckt, gedielt, selbst tapeziert und halb als Kajüte, halb als Studentenkneipe abenteuerlichgemütlich mit allem Erdenklichen ausgepolstert, was das Meer der Ereignisse an den Strand eines Jünglingslebens in jenen Jahren warf, vom Bootsriemen rund um den Treibball zum Rapier und Säbel einerseits, vom Lederstrumpf über Schopenhauer bis zum Aktuellsten der damaligen Epoche, dem Volapük, andererseits. Die Erbauer der Baude sind lebhafte Leute, ein brodelndes Gemisch von Kaufmanns-, Gelehrten- und Künstlersöhnen, ein wirres Gemengsel verschiedenfarbiger Interessenfäden, die wohl nur solange zusammenbleiben, als Jugend ein Knäuel aus ihnen macht. Einer der Hauptvorkämpfer des Volapük dieser Gruppe, gewisser Verdienste halber bereits mit einem Diplom ausgezeichnet, das in seiner Primanerbude im zweiten Stock oben eingerahmt hängt, ein Achtzehnjähriger, steht langbeinig aufgepflanzt vor den Reckstangenjünglingen und demonstriert ihnen seinen neuesten Entwurf: eine selbsterfundene Sprache. Auf ein paar flatternden Heftseiten hält er die ersten Bruchteile eines imaginären Wörterbuchs in der Hand und verkündet die Urworte dieser noch nicht dagewesenen Sprache unter unauslöschlichem Gelächter.
Er ist sehr schlank und groß, hat einen fast kleinen Kopf mit einer sehr hohen reinen Stirn und trägt einen gut sitzenden Anzug mit englischen Karos, um die ich ihn sofort sehnsüchtig beneide. Seine Augen sind tief und gut, aber auf ihrem Grunde schießt es hin und her von unerwarteten Listen und Einfällen, so daß keiner weiß, wessen er sich im nächsten Augenblick zu versehen hat. Er gilt als ausgemachter Dichter und unberechenbarer Kopf, im bürgerlichen Schulsinne als Freigeist. Man traut ihm viel zu in bezug auf Talente aller Art, aber auch auf Neckereien und Streiche, auf die man stets gefaßt sein muß. Sie kommen immer auf echt dichterische Weise, nämlich gegen alle Berechnung und Logik, darum treffen sie fast immer ins Schwarze; zuweilen können sie auch schmerzhaft sein, aber nur körperlich, und immer haben sie Humor, niemals Bosheit, nur List und Schlauheit im besten Indianersinne. Vielleicht hängt es damit irgendwie zusammen, daß ihn die Kameraden mit dem Namen des xenophonischen Feldherrn Bessos getauft haben, mit dem er sonst wirklich nichts zu tun hat. Man dichtet ihm gern eine Gefolgschaft an, und wenn wieder einmal etwas Unberechenbares in der Luft liegt, was sie seinen Einfällen zuschreiben möchten, so heißt es: ὲ Bἤσσοῃ ψαί οτόν: ›Bessos und die um ihn!‹
Als es sich gelegentlich herausstellte, daß ich auch dichtete, hieß es sofort: ›Natürlich, Bessos hat ihm befohlen zu dichten!‹
Sein bürgerlicher Name war Christian Morgenstern, und die Wörterbuch-Bruchstücke und ihr Widerhall, die an jenem Juninachmittag die Luft vor der Baude erschütterten, waren nichts andres als die Ahnherrn des späteren hochgeachteten ›Lalula‹ aus den Galgenliedern, von denen nicht nur der Rabe Ralf, auch Palmström und Korf, Gingganz und Palma Kunkel in direkter Linie abstammen. Die Quelle aber, aus der diese Ahnherrn nur wie übermütig sprühende Tropfen waren, lag tief hinter den ausgelassen guten Augen auf dem Grunde der Seele dieses langbeinigen Bessos. Aus ihr strömten fast um dieselbe Zeit Verse anderer Art:
Wie oft wohl bin ich schon gewandelt
auf diesem Erdenball des Leids,
wie oft wohl hab ich umgewandelt
den Stoff, die Form des Lebenskleids?
Wie oft mag ich schon sein gegangen
durch diese Welt, aus dieser Welt,
um ewig wieder anzufangen
von frischem Hoffnungstrieb geschwellt?
Es steigt empor, es sinkt die Welle –
so leben wir auch ohne Ruh;
unmöglich, daß sie aufwärts schnelle
und nicht zurück – dem Grunde zu.
Von dieser Quelle ahnte ich noch nichts, als ich fünfzehnjährig zu Besuch auf der Reckstange saß und von den Urworten der Bessossprache tief begeistert war.
Ich lernte ihn damals zum erstenmal kennen. Es war mein erster unmittelbar künstlerischer Eindruck, der mir mitten im alltäglichen Leben aus der Person eines Menschen lebendig entgegenkam. Daß ich heute noch, nach fast vierzig Jahren, das Karo seines Anzugs deutlich vor mir sehe, beweist nur, wie unwiderstehlich die Anziehungskraft in dieser Begegnung wirkte. An diesem Nachmittag war es das Ungewohnte, Imposante dieser aus dem Nichts geschöpften lustigen Sprachgebilde, drei Monate später waren wir innige Freunde für immer aus wesentlich tieferen Gründen.
Unerschöpflich waren die Quellen, die man damals in sich entdeckte, von entscheidender Bedeutung die Gedanken, die sich in jenen Jahren kristallisierten. Alles war groß, was man damals erlebte, groß auch das Kleinste, weil es erstmalige bewußte Bedeutung hatte. Zum erstenmal erlebte man Geist und Natur; zum erstenmal einen großen Dichter, zum erstenmal den Zauber des Mondes, zum erstenmal fühlte man Unendlichkeit unter Augusthimmeln. Ein erstes großes Freundschaftserlebnis schloß wie ein magischer Schlüssel tausend Türen auf, deren Vorhandensein man nie geahnt hatte. Man erfuhr zum erstenmal, daß alle diese sonderbaren Gefühle, die man sich selbst kaum eingestand, von denen man glaubte, daß sie nur einmal in der Welt existieren könnten – daß sie alle in einem anderen Menschen in verwandter Gestalt lebten, aus- und eingingen wie zu Hause. Ich glaube, es sind die entscheidendsten Jahre, diese ersten Jahre erwachten Bewußtseins für die Schönheit und den Geist, der im Innern der Welt wohnt. In diesen Jahren baut sich die Seele den Kompaß, nach dem sie in Wahrheit steuern wird. Morgensterns Verse von der Wiedergeburt, die er mit sechzehn Jahren schrieb, sind klarer Beweis dafür. Seine Weltanschauung ist hier in den Grundzügen niedergelegt. Wie viele Wandlungen hat sie in seinem Leben durchgemacht und ist doch in denselben Weg wieder eingemündet, der in jenen Versen damals begann. Ich, als der um drei Jahre Jüngere, hatte den um so viel tieferen Gewinn von diesen gemeinsamen Jahren. In allem, was mir zum erstenmal begegnete, war der Freund schon um Wege voraus.
Wenn ich an diese Jugendjahre denke, wird mir wie an einem lebendigen Beispiel klar, was einen das Leben nur stückweise in seltenen verstreuten Stunden im Lauf der Jahrzehnte erst allmählich gelehrt hat: was Zusammenhang der Dinge in Wahrheit bedeutet. Dieselben Elemente, die jene Jahre der Entwicklung in scheinbarer Unordnung ausfüllten: Spiel und tiefster Ernst eng beieinander, finden sich auch im Lebenswerk Morgensterns als untrennbare Einheit wieder. Ein kleines Heft, die Doktordissertation eines fremden philosophischen Studenten [R. Heckel] über das Problem der Wiedergeburt, deren Einzelheiten ich vergessen habe, ist für die Richtung meiner Gedanken auf einem bestimmten Gebiet von großem Einfluß gewesen. Ich bekam sie damals von Morgenstern. Vielleicht hat er sie mir am Nachmittag desselben Tages gegeben, an dem nachts die denkwürdige Wasserschlacht zwischen den Knaben unserer Pension stattfand. Sie wurde dadurch entfesselt, daß Morgenstern einem von uns eine gefüllte Wasserschüssel unter das sorgfältig glattgestrichene Bettlaken bugsiert hatte, in die der ahnungslos Schlafsuchende unter Schauern des Entsetzens versank. Die Schlacht nahm phantastische Formen an; sie tobte durch die monderhellten Schlafzimmer von sechs handfesten Pensionsjünglingen und wurde mit Waschkrügen und Gläsern geliefert. Morgenstern verteidigte eine Festung: das kleinste Zimmer mit dem einzigen verfügbaren Wasserhahn. Das waren folgenschwere Ereignisse von unvergeßlicher Romantik, und doch nichts als Spiele, aber eben Spiele Wand an Wand mit tiefstem Lebensernst. Am Morgen darauf konnte man über dasselbe Buch gebeugt dasitzen, Seele an Seele, und Gespräche durchleben, deren Resultat maßgebend wurde für Jahrzehnte der Entwicklung.«
Es fügte sich, dass die beiden Jünglinge bald nach dieser ersten schicksalhaften Begegnung kurze Zeit gemeinsam in einer Pension lebten (in derselben, in der die »Wasserschlacht« damals stattfand). Morgenstern für einige Monate während einer Sommerreise der Eltern; Kayssler, der früh verwaist war, lebte dort und besuchte von da aus das gleiche Gymnasium wie Morgenstern. In jenen Wochen festigte sich die Freundschaft; beide begegneten sich von vornherein in der großen Liebe zur Kunst. Wenn auch Kayssler sagt, dass ihm – dem Jüngeren – der Freund schon um Wege voraus war, so bezeugt doch der Briefwechsel, wie weit er, der Frühreife, fähig war, mit den innersten Interessen Morgensterns mitzuschwingen. Ihre Briefe aus der Schülerzeit offenbaren eine Begeisterungskraft, die damals – und immer – die beiden Freunde auszeichnete. »Glaube mir« – schreibt Christian Morgenstern, kurz nachdem sie Freundschaft geschlossen –, »daß eine Stunde der Begeisterung mehr gilt als ein Jahr gleichmäßig und einförmig dahinziehenden Lebens. Die Ruhe ist Dein Feind, sie ist mein Feind, ist der aller Menschen – ich meine die Ruhe der untätigen Behaglichkeit!«
Das Beisammensein der Freunde in Breslau war kurz bemessen. Im Herbst des Jahres 1889 verließ Christian Morgenstern das Gymnasium, um die Militär-Vorbildungsschule des Obersten v. Walther zu besuchen. Sein Vater hatte, da er in dem Sohne keinen Maler entdecken konnte, mit ihm eine militärische Laufbahn im Sinne. Der lebensprühende, zwar zarte, doch gesunde Jüngling mit der schlank gewachsenen Gestalt schien sich vorzüglich zum Offizier zu eignen.
Aber ein halbes Jahr später sitzt er wieder auf der Schulbank. Er schreibt an die Münchener Verwandten – an die Großmutter und ihre Schwester, die beide mit zärtlicher Fürsorge seine Entwicklung aus der Ferne mitverfolgen –, was ihn zu diesem Entschlusse geführt hat: »Ich muß gestehen, meine Neigung zum Soldatenstande oder besser zum Soldatenberufe war nie eine tiefe, echte. Mich hält die Poesie, die Kunst, der Drang nach Wahrheit zu sehr in ihrem Bann … ich kann nun einmal nicht anders, es ist wohl diese heiße Liebe zum Schönen das Erbteil der Künstlergeschlechter, aus denen ich stamme … So werdet Ihr begreifen, daß ich nach wochenlangen Herzenskämpfen meinen Eltern den Schmerz bereiten mußte, zu erklären, ich könne durchaus nicht die eingeschlagene Bahn weiterverfolgen, ich hätte den festen Entschluß, wenn sie mich wieder zum Gymnasium zurückkehren ließen, dort nachdrücklich zu arbeiten und dann zu studieren.«
Da Morgenstern nicht auf das Magdalenen-Gymnasium zurückkehren mochte, trat er Ostern 1890 in die Prima des Gymnasiums zu Sorau ein. Die zwei Jahre in dem kleinen Niederlausitzer Städtchen schenken ihm Lebensbedingungen, in denen er innerlich aufzublühen vermag. Ein Freundeskreis bildet sich bald. Heitere Geselligkeit und künstlerisch-geistiges Zusammenstreben entwickeln sich. »Ich bin ganz gern hier«, schreibt er an die Münchener Verwandten, »es ist eine nette kleine Stadt, das Gymnasium ist in jeder Beziehung angenehmer als in Breslau, und die Pension bei Professor Ilgen ist ebenfalls völlig zufriedenstellend. Wir sind drei Freunde zusammen, alle Breslauer und schon von früher her gut bekannt, und bewohnen zwei Stuben … Mein Stubenkamerad ist Franz Carl Zitelmann, ein sehr lieber, begabter Mensch. Der Verkehr hierselbst ist auch sehr gemütlich, ich hatte in Breslau nicht einen so kameradschaftlichen, jugendfrischen Kreis. – Die Familie Ilgen ist sehr nett, besonders Frau Ilgen … Besonders auf mich ist sie stolz (obwohl ich’s gar nicht verdiene), da ich ihr einmal für ihre niedlichen Mädchen ein Puppentaufgedicht machte und sie mit mir als Verfasser des beiliegenden Prologs glänzen konnte ... Nach der allseitigen Anerkennung zu schließen, gefiel mein Gedicht den wackeren Sorauern sehr, – ich hätte hier Gelegenheit, eitel zu werden, wenn ich die Lust dazu hätte.«
Schnell erobert er sich die Herzen und das Vertrauen seiner Kameraden. Sein Stubengenosse Franz Carl Zitelmann schließt sich ihm immer näher an. »Du bist der einzige Mensch, dem ich mein Herz ausschütten kann«, schreibt er aus den Ferien an Christian Morgenstern. Und noch einige Jahre nach ihrer gemeinsamen Schulzeit von einem Gebirgsausflug: »… Nur schade, daß Du nicht den Reiz der Landschaft durch Deine liebenswürdige Erscheinung vergeistigst.« »Du einziger wesentlicher Mensch.«
Ein anderes Mal versichert ihm sein Freund Kayssler: »daß Du der einzige Mensch bist, dem ich mich rückhaltlos hingeben kann, mein Vertrauen ganz entgegenbringend, mit dem ich über alles sprechen kann.« Und Morgenstern seinerseits schreibt an Kayssler: »Man hat mich oft wegen meines blinden Glaubens an das Gute im Menschen verspottet; solang ich einen solchen Freund mein eigen nenne wie Dich, will ich diesen Glauben nicht fallen lassen – und wenn ich von allen andern betrogen werden sollte!« Und der Primus unter seinen Mitschülern schreibt ihm noch aus dem ersten Studienjahr: »Lieber Christian, es gibt Dinge und Vorgänge in meinem Geistesleben, über die ich nur allein mit Dir sprechen möchte, allein mit Dir.«
Wem die Beziehungen von Seele zu Seele so sehr zu den bedeutsamsten Wirklichkeiten des Lebens gehörten wie Morgenstern, dem musste das Begegnen mit diesem oder jenem Menschen, das Getrenntwerden durch Lebensumstände oder Tod ein merkwürdig geheimnisvolles Element des Schicksals sein. Ihn erfüllte es mit Glück, wenn er ganz vertrauen konnte und im fruchtbaren Gespräch (das ja Goethe in seinem Märchen »köstlicher als das Licht« nennt) sich froh bereichert fühlte und bereichern durfte.
Doch schon in der Jugend empfindet er jedes Band, das sich von ihm zu einem andern Menschen hinüberknüpft, als innere Verantwortung. »Nicht tändeln, um Gottes willen nicht tändeln mit Menschenleben«, ruft er sich selbst und den Freunden zu. Er fordert Wachsamkeit im Bewahren der inneren Freiheit.
Als er für die anmutige Schwester eines Sorauer Freundes schwärmt und sie in lyrischen Gedichten besingt, schreibt er hierüber in einem Briefe an Kayssler (22. August 1890): »Preise meine Vernunft, meine Denkklarheit – ich könnte ja ebensogut in höchster Leidenschaft ausrufen: Mein muß sie werden und ob die ganze Welt mir entgegenstünde! Und weißt Du, was das wäre? Wahnsinn.« Es ist für ihn »nichts als ein Jugendtraum«.
Er erzählt einmal, dass ihm bis zu seinem achtzehnten Lebensjahre überhaupt jede Gelegenheit gefehlt habe, mit einem Mädchen freundschaftlichen Umgang zu pflegen. In einem Breslauer Tagebuch (1892) heißt es: »Gestern abend durchirrte ich planlos die Stadt. Inmitten der traurigen Nachtgestalten ergriff mich ein Durst nach Mädchenschönheit, nach weiblicher Anmut und Reinheit, eine Sehnsucht – nicht nach flachem Genuß – nein, nach Liebe. Aber auch hier steht der ernste Stern über mir.«
Wirklich heimatlich wurde dem Jüngling erst in Sorau zumute, als er der Familie Goettling begegnete. Gerhard Goettling, sein Mitschüler, wird ihm Freund, die ältere der beiden Schwestern – Marie – eine wahre Freundin. Der Vater der Geschwister war der für alle großen Lebensfragen aufgeschlossene Archidiakonus und das Pfarrhaus Mittelpunkt künstlerisch beseelter, liebegetragener Menschlichkeit. Die erste Schilderung dieser für ihn bedeutsamen Begegnung finden wir in einem Brief an Kayssler (7. Oktober 1891): »Ich bin nämlich hier seit jüngster Zeit ein reiner Pastorale geworden, wenn man mit diesem Titel ein Menschenkind benennen will, das fast ausschließlich in Pastorenhäusern verkehrt und verhätschelt wird …« Und nach einer Darstellung von Missionsfest, Predigt, Pfarrhausidyllen und was er sonst auf diesem Gebiete mitzumachen hatte, fährt er fort: »Nun muß ich aber auch von Göttlings sprechen, mit denen ich gerade in jüngster Zeit aufs herzlichste befreundet worden bin. Die Menschen haben mich so gern, sie sind so natürlich und gut zu mir, daß ich gar nicht sagen kann, wie wohl es mir oft tut. Dazu ist die ältere Tochter ein so klar denkendes und tief empfindendes Wesen, daß die Unterhaltung mit ihr eine äußerst anregende ist. Ich muß sagen, daß ich ihr bereits viel verdanke. Wir haben uns in vielen Ansichten getroffen, und ich habe wieder einmal gefunden, daß sich das Bild des Lebens in einem warmen, schlichten Frauenherzen viel reiner und würdiger spiegelt, als wir Männer, die wir zu sehr mit den Details beschäftigt sind, für gewöhnlich auffassen können. Aber eine Empfindung ist es, die die letzten Tage in meiner Brust mächtiger denn je geweckt und genährt haben. Es ist die Empfindung der ungeheuren Pflicht der Liebe, die jeder einzelne von uns gegen seine Nächsten und zumeist gegen die für uns arbeitende, leidende Klasse hat.«
Wie ein Sohn wird er im Hause des »Onkel Moor« und der »Moorinnen« (wie man scherzhaft die Goettlings nannte) aufgenommen. Im Winter 1891/92 knüpft sich das Band zu Marie Goettling so innig zu einer reinen, geschwisterlichen Liebe, dass er Kayssler mitteilt: »Wir haben uns gefunden, wir haben beide das gleiche Ziel vor Augen und im Herzen – warum sollten wir nicht gute, treue Freunde sein, die im Geiste zusammengehen, gehoben schon durch das bloße Bewußtsein eines solchen Zusammengehens? Weil wir Weib und Mann sind? Ich rechne nur nach Menschen, nicht nach Geschlechtern.« Es ist keine schwärmerische Liebe, sondern ein Sichverstehen »in ewigen oder wenigstens höheren Dingen«. – »Was uns verbindet, das ist der gleiche Drang nach Vollendung des Guten, die gleiche Liebe zu unseren Mitmenschen und endlich die gegenseitige Achtung – die persönliche herzliche Teilnahme des einen am anderen« (25. Januar 1892). Er empfindet das besonnene, um einige Jahre ältere Mädchen wie eine während seiner ganzen Kindheit entbehrte Schwester. Und folgende Verse aus dem Jahre 1892, die sich in seinem Nachlass finden, gelten vermutlich ihr:
Ich liebe mir die klaren Frauenaugen,
aus denen eine freie Seele leuchtet;
die nicht, die zehrend sich in andre saugen,
die Hauch der Leidenschaft verschleiernd feuchtet.
Nicht die christlich-konfessionelle Weltansicht, aber das innere Christsein dieser Menschen wurde für ihn in diesen wichtigsten Entwicklungsjahren bedeutungsvoll. Als Christian Morgenstern zu Ostern 1892 die Universität Breslau bezieht, kann er in einem Briefe an die Freundin aussprechen: »Dank für die geistige Heimstätte, die Ihr mir, dem in vielem Vereinsamten, dem nach Verständnis und Trost Verlangenden, so liebreich geboten, Dank vor allem für den Segen, den Dein reines, tiefes Gemüt in mein Herz ausgeströmt hat. – Wenn Gott mein Flehen nach Vertiefung und seelischer Läuterung erhört, dann werde ich vielleicht einen Teil meiner Schuld gegen Euch abtragen können, indem ich mich mit meinem ganzen Sein dem Guten und Wahren weihe.« Noch ein Jahrzehnt später, als Marie Goettling nach Amerika ging, widmete ihr der Dichter das tief verehrende Gedicht »Einer Jugendfreundin«:
Du warst ein reines Licht an meinem Wege
Werke und Briefe, Bd. II
Der reiche Briefwechsel zwischen Morgenstern und Kayssler ist ein Spiegel dieser Sorauer Jahre. Was sie bewegt und begeistert, teilen sie einander mit. »Freude, schöner Götterfunken!« und die herrliche »Hymne an die Freundschaft« werden ihre Lieblingsgedichte. Beglückt lesen sie Schillers »Philosophische Briefe«. Bei der »Theosophie des Julius« ruft Morgenstern aus: »Wie sehr muß es jeden Denkenden ins Herz treffen: ›Sollten meine Ideen wohl schöner sein als die Ideen des ewigen Schöpfers?‹ «
Kayssler hingegen schreibt: »Ich habe neulich in einem Gedicht gesagt, Natur und Kunst wären eines gewesen, als sich die Weltseele teilte, und würden sich am Ende der Endlichkeit und Beginn der Unendlichkeit wieder finden, sie gingen sich entgegen.« Ein andermal findet sich in ihrem Briefwechsel das Wort: »Religion ist das Sehnen nach der Geistersonne.« Morgenstern empfiehlt dem Freunde: Wilhelm Meister, Körners Dramen und Briefe, Kleist, Uriel Acosta (worin er den Monolog des Knaben Spinoza besonders liebt); ferner Byrons Don Juan, der ihm die Langweile der Physikstunde vertreibt, Langbehns Rembrandt als Erzieher, an dem ihm das Wesen des Individualismus zum ersten Male besonders stark aufgeht. Dazu kommen die Klassiker der griechischen und lateinischen Literatur. Seine Liebe zu Horaz (»neben Homer das einzig Wahre«) wird damals begründet. Sophokles’ Antigone preist er dem Freunde, und am 1. Mai 1891 kann er ihm mitteilen, dass er von dem Rektor seines Gymnasiums den Auftrag erhalten habe, den Ajax des großen Tragikers für eine Schüleraufführung in Verse zu übertragen. »Ich gehe mit aufrichtiger Begeisterung an die Sache, denn das Drama hat großartige Stellen und ist ›tieftragisch‹. 135 Verse sind schon fertig; aber es sind noch etwa 1000 …« Ob dieser Plan zur Durchführung gekommen ist, wissen wir nicht.
Dass sich der Idealismus der Freunde auch auf das praktische Handeln erstreckte, mag aus einem Briefe Morgensterns anschaulich werden. »Die letzte Woche brachte mir eine ganz angenehme Überraschung; ich erhielt mit mehreren Kameraden eine der sogenannten ›Strobschützprämien‹ von 16 Mark. Mit 6 Mark bezahlte ich mehrere Schulden u.a., 10 Mark gehören idealen Zwecken. Es sind davon schon 4 Mark nach Berlin abgegangen, wodurch ich mir das erste Vierteljahr der Deutschen Dichtung (Okt. 90 bis Dez. 90) nachbeziehe. Sage mir, ob Du für die übrigen 6 Mark Verwendung weißt. Kennst Du einen armen Menschen, so wollen wir es ihm schenken. Was? oder was hast Du sonst im Auge? Mache tausend Vorschläge!«
Dieser Briefwechsel – durch das Zusammensein in den Ferien immer wieder neu angeregt – war in der ersten Zeit in Sorau das Einzige, worin sich Morgenstern ganz frei zu geben vermochte. »In meinem hiesigen Bekanntenkreise«, schreibt er im September 1890, »wo viele sind, die ich lieb und gern habe, stehe ich doch in gewisser Hinsicht einsam da. Ja, ich werde als Original bezeichnet. Vor allem aber fehlt diesen Menschen – und das bricht mir fast das Herz – jene jugendliche himmelstürmende Begeisterung. Es ist alles so trocken vergnügt, so nüchtern, so blasiert, so leidenschaftslos!« Aber der junge Dichter versucht, seine Funken in die Herzen zu werfen.
In Sorau fand jedes Jahr am 1. September ein Schülerbergfest statt: die »Justfeier«. Dabei wurde, nach alter Sitte, auf einer Höhe ein Baum abgebrannt, der »Melderbaum« genannt:
… des Forstes schönster Baum, dazu erlesen,
als stolze Riesenfackel aufzulodern,
als wie ein Opfer für den Gott der Freude.
So heißt es in dem großen Prolog, den Christian Morgenstern gleich im ersten Sorauer Jahre 1890 für die »Justfeier« dichtete. Der im Feuer aufgehende »Melderbaum« ist ihm das Sinnbild ihrer flammenden Jugendbegeisterung. Diese Dichtung, die damals veröffentlicht wurde, fand großen Beifall in den Sorauer Kreisen. Eine weitere Verbreitung dieser Gelegenheitsverse wünschte Morgenstern jedoch nicht.
Laß die alten Lieder ruhen,
wird sie keiner missen.
Von den ausgetretnen Schuhen
will ich nichts mehr wissen.
Als Marie Goettling im Jahre 1908 ihm den Prolog wieder zusandte, antwortete er ihr: »Dank auch noch für den Melderbaum! Na, den sollte man auch lieber schlafen lassen. ›Gut – aber dumm‹ (wie Serenissimus von Bismarck sagte).« Hieraus mag verständlich werden, dass er selbst dieses Gedicht in keine seiner späteren Sammlungen aufgenommen hat. Unberechtigterweise ist mehrere Jahre nach seinem Tode dennoch ein Nachdruck erfolgt von fremder Seite.
In den starken Weltanschauungskämpfen, die von jetzt ab einsetzen, bleibt er führerlos. Denn seine Freunde sind fast alle jünger als er; die Erzieher aber haben kein Organ für die neue Lebensstimmung der jungen Generation.