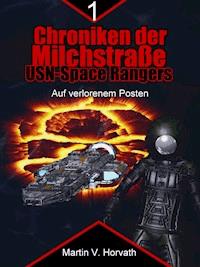Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Jahr 2299 In der Milchstraße tobt ein grausamer Konflikt. Nach mehr als vier Jahren des zähen Ringens zeichnet sich ein Sieg des Bündnisses zwischen der Interstellaren Union und den Pon-Arikanern über das Volk der Kehhl'daaraner ab. Beunruhigende Gerüchte über eine angebliche Superwaffe der Kehhl'daaraner trüben jedoch die Freude über den bevorstehenden Sieg, könnte die tatsächliche Existenz dieser Waffe doch alles ändern. Das FLEETCOM der United Space Navy beauftragt deshalb zwei ihrer besten Männer, Zeb. J. Curwen und Runako Thenga, damit, der Sache auf dem Grund zu gehen. Dabei werden sie vom zwielichtigen Schmuggler Cillian Withman und dessen geheimnisvolle Freundin Jennifer Brooks unterstützt. Man begibt sich auf eine gefahrvolle Reise ins tschanganische System ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft; die drei Schwestern, Zeit ist ihre Mutter.
Das eine kann ohne das andere nicht existieren.
Kennst du die Vergangenheit, so begreifst du die Gegenwart. Begreifst du die Gegenwart, so siehst du die Zukunft.
Alles ist eins: der Anfang und das Ende, welches wiederum ein Anfang ist.
Alles ist eins: Alles ist Anfang und Ende zugleich. Das ist die Natur des Universums.
– Zitat von Pedokus dem Älteren
Pykejonischer Philosoph
Inhaltsverzeichnis
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechszehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Dreißig
Einunddreißig
Zweiunddreißig
Dreiunddreißig
Vierunddreißig
Fünfunddreißig
Sechsunddreißig
Siebenunddreißig
Achtunddreißig
Eins
Ein seltsamer Ort außerhalb von Raum und Zeit, ein bizarres Fragment des unendlichen Multiversums – ein absonderliches Paralleluniversum, zu dem ein menschliches Geschöpf kein Portal besaß.
Er existierte in der Vergangenheit sowie in der Gegenwart und Zukunft, in allen drei Zeitebenen und in keiner.
In jenem wundersamen Bereich des Multiversums kam es zu einer Zusammenkunft von Wesen, deren Natur die ihrer Umgebung an Eigentümlichkeit noch übertraf.
Sie besaßen keinen Körper, nichts Greifbares, Materielles – pure Energie, einzig allein Gedanken – das war alles. Eine Existenzform, derart weit über der Menschlichen, dass sie dem Göttlichen nahe kam.
Einst in grauer Vorzeit, da waren sie dem Menschen nicht unähnlich, humanoide Wesen aus Fleisch und Blut. Doch vor fünf Jahrtausenden machte ihre Evolution einen gewaltigen Sprung nach vorne, der Geist trennte sich vom Körper, wurde zu reinem Geist.
Weil diese Lebewesen physisch nicht existierten, verfügten sie über keinerlei Sprechorgane. Verbale Kommunikation betrieben sie seit Äonen nicht mehr, ihre Unterhaltungen verliefen rein über die geistige Ebene. Die Art ihrer Verständigung war derart exotisch, dass ein Mensch sie nie begreifen würde.
Hätten sie jedoch Münder, würden sie kommunizieren wie Sterbliche, dieses Gespräch würde folgendermaßen ablaufen:
»Schon bald wird sich die Prophezeiung erfüllen!«, gab der Erste von sich.
Der Erste: Er war der Erste, der den Wandel in die neue Existenzebene vollzog. Und er war derjenige, der sein Volk schon in den Tagen, in denen es noch körperliche Form besaß, anführte. Auch aus diesem Grund hatte er den Platz des Ersten inne.
»Bist du dir da sicher?«, gab der Zweite zur Antwort.
Der Zweite: In den alten Zeiten, in denen ihr Volk noch stofflich existierte, da besaß der Zweite den Körper einer wunderhübschen Frau. Doch das hatte keine Relevanz mehr. Jetzt, wo sie körperlose Wesen aus reiner Energie waren, da war der Unterschied zwischen den Geschlechtern trivial geworden.
»Ja, ich bin mir sicher! Ich habe unsere Kinder beobachtet, ihren Weg durch die Zeit verfolgt. Sie sind bald so weit, unser Vermächtnis in Empfang zu nehmen. Der Tag ist nicht fern, an dem der Auserwählte das Licht der Welt erblickt.«
»Kannst du dir sicher sein, dass die Bilder, die du gesehen hast, richtig interpretiert wurden?«, wollte der Dritte wissen.
Der Dritte: In der Ära der Körperlichkeit, da war er ein Schwerverbrecher, zahlreiche Leute starben durch seine Hand. Doch auch das hatte keine Bedeutung mehr. Alles was vor der Zeit des Erwachens – wie jenes Volk den Übergang in die Körperlosigkeit bezeichnete – geschah, war ohne Bedeutsamkeit. Mit der Leiblichkeit endete eine Welt, eine Neue wurde geschaffen.
»Ich habe gesehen, wie unsere Kinder den Trabanten ihres Heimatplaneten betreten. Bald werden sie zu weiteren Welten vorstoßen. Ja, ich bin mir sicher! Wenn du es mir nicht glaubst, schlage ich vor, du siehst es dir selbst an«, erwiderte der Erste keck.
Das war typisch für den Ersten, er konnte manchmal ziemlich unverschämt sein.
»Was ist mit dem Auserwählten? Ich habe seinen Lebensweg studiert. Was ich sehen konnte, war nicht ermutigend. Ich wurde Zeuge seines Todes, als er das Geschenk vernichtet. Dieser Lauf der Ereignisse widerspricht unseren Plänen«, gab der Vierte von sich.
Der Vierte: In dieser Runde war er der Vierte, jedoch der Zweite, der den Übergang vollzog. In seiner vormalig körperlichen Form existierte er als einflussreicher Politiker. In gewisser Weise war er das noch immer, ein wichtiger Berater des Ersten und dessen Freund.
»Auch wenn wir in die Zukunft blicken können, so sehen wir uns außerstande zu wissen, wie sie sich entwickelt. Die Zeit ist wie ein Fluss, der sich durch die Landschaft schlängelt. Es gibt verschiedene Strömungen, zahlreiche Nebenflüsse. Auch wir, die außerhalb des Zeitenstromes leben, können nicht wissen, welchen Weg das Wasser von der Quelle aus nimmt, bis es sich schließlich in den Ozean ergießt. Alles wird sich fügen wie es will.«
»Der Tod des Auserwählten wäre eine Katastrophe. Die Vernichtung des Geschenks erst recht. Du weißt genauso gut wie ich, dass eine große Dunkelheit über diese Galaxis kommen wird. Nur das Geschenk kann unsere Kinder davor bewahren, von ihr verschluckt zu werden.
Unter keinen Umständen darf das Geschenk vernichtet werden! Denn ohne die Macht des Geschenks haben unsere Kinder keine Chance, der Dunkelheit zu entrinnen«, warf der Fünfte ein.
Der Fünfte: Sein stoffliches Leben war das eines Gesetzeshüters. Auch wenn dieses Leben fünf Jahrtausende in der Vergangenheit lag, so hatte er seine Fähigkeiten als Ermittler nicht eingebüßt. Und sie werden bald wieder gebraucht. Der Erste hatte die Absicht, ihn auf eine wichtige Mission zu schicken. Davon ahnte der Fünfte in diesem Moment jedoch nichts.
»Wie ich gerade sagte, können auch wir die Zukunft nicht vorhersehen«, hielt der Erste dagegen. »Was Surya gesehen hat, muss nicht zwangsläufig eintreten. Ich bin zuversichtlich, dass alles gut wird.«
»Und ich hoffe, dass du damit recht hast«, meinte der Dritte.
Hätten die Wesen Köpfe, würden die anderen nun zustimmend nicken.
»Wir müssen abwarten. Es wird sich zeigen, welchen Weg der Fluss der Zeit nehmen wird«, sprach der Erste in einem feierlichen Ton. »Und Zeit haben wir genug. Uns gehört die Ewigkeit.«
Zwei
Irak
Sommer 2004
Eine karge Berglandschaft. Schroffe Felsen, enge Schluchten, bleierne Hitze.
Ein altersschwacher Jeep fuhrwerkte auf einer Schotterpiste durch die Berglandschaft. Mühsam rollte er eine Steigung hinauf, der Motor röhrte, der Fahrer kämpfte mit der Gangschaltung.
»Verfluchte Schrottkarre!«, tobte er. Kies knirschte unter den Rädern, das gequälte Heulen des Motors wurde stärker. Der Fahrer trat das Gaspedal durch und betete dafür, dass diese verdammte Rostlaube nicht den Geist aufgab.
Ein erleichtertes Seufzen drang aus dem Mund des Mannes, als der Jeep die Steigung überwunden hatte, nun gemächlich eine abschüssige Stelle hinunterrollte. Das Heulen war verklungen, jetzt tuckerte der Motor wieder sanft vor sich hin.
Der Fahrer warf einen Blick zu seinem GPS-Empfänger, um eine Antwort auf die Frage zu bekommen, wie weit es noch zum Ziel war.
Der Mann, der diesen verrosteten Jeep über eine staubige Schotterpiste lenkte, hörte auf den Namen Gregory West. Er war Archäologe von Beruf, arbeitete für das Britische Museum.
Als er sich dazu entschloss, in den Irak zu gehen, um dort Ausgrabungen zu machen, hielten ihn seine Kollegen für leichtsinnig. Es war lebensgefährlich in Tagen wie diesen im Irak zu arbeiten. Seit dem Sturz des Saddam-Regimes war die Sicherheitslage im Irak katastrophal, immerzu gab es Anschläge von Aufständischen. Ausländer wurden am laufenden Band entführt, nicht selten fand man Tage später ihren abgeschlagenen Kopf irgendwo am Straßenrand. Leute wie Gregory West waren besonders gefährdet, denn West war britischer Staatsbürger, gehörte zu jener Sorte Leute, die im Visier von Al-Kaida und ihren Sympathisanten lagen.
West war sich im Klaren darüber, in welch großer Gefahr er sich begab, doch er ignorierte sie, seine Neugier war größer als Furcht und Vernunft. Er musste einfach in den Irak, um die Hinterlassenschaften der alten mesopotamischen Kulturen zu erforschen. Er war geradezu besessen davon, schon seit den Tagen seiner Kindheit.
Das war auch der Grund, weshalb er diese Reise in ein Dorf namens Nukhayb, welches sich etwa zweihundert Kilometer nördlich von Bagdad in dem von Kurden kontrolliertem Gebiet befand, auf sich nahm. Dort, genauer gesagt in den umliegenden Bergen, soll es Höhlen geben, in denen uralte Artefakte zu finden waren.
Der Jeep fuhr in eins der unzähligen Schlaglöcher. West wurde durchgeschüttelt, ein ärgerliches Murmeln kroch über seine Lippen. Er hasste diese Straße!
Er steuerte diesen vom Rost zerfressenen Geländewagen in eine enge, unübersichtliche Kurve. Stark abfallende Felswände versperrten die Sicht, weshalb er den anderen Wagen erst spät bemerkte.
Bremsen quietschten, Kies knirschte. Ein Glück, dass er schnell reagiert hatte, sonst wäre er mit dem anderen Fahrzeug kollidiert. Der Fahrer des anderen Wagens lenkte ihn behutsam an Wests Jeep vorbei, blieb stehen, kurbelte das Seitenfenster hinunter, fluchte auf Arabisch. Dann stieg er aufs Gaspedal und brauste davon.
West ließ zischend Luft aus seiner Lunge entweichen, er hatte einen ziemlichen Schreck bekommen. Ein Autounfall hätte ihm gerade noch gefehlt. Der Motor heulte protestierend auf, als er aufs Gas stieg, der alte Jeep sich wieder in Bewegung setzte.
In den nächsten Minuten ließ West seine Gedanken kreisen.
Er fragte sich, was ihn dort in Nukhayb erwartet. Seinem Informanten zufolge sollen in den vielen Höhlen wertvolle Artefakte aus der babylonischen Zeit zu finden sein. In den letzten Jahren hatte man Keilschrifttafeln, Tonkrüge und einiges mehr in den Höhlen gefunden. Vor Kurzem war eine Neue entdeckt worden. Da sie erst kürzlich entdeckt wurde, war West zuversichtlich, dass sie noch nicht von den Leuten der Gegend geplündert wurde, wie es bei den anderen oft der Fall war.
West hatte keinen Grund, an den Worten seines Informanten zu zweifeln. Bislang erwiesen sich die Hinweise, die Muhammad ihm gab, stets als korrekt.
Der Jeep kämpfte sich eine weitere Steigung hinauf, erneut gab der Antrieb ein klagendes Geräusch von sich. Und diesmal mischte sich unglücklicherweise auch noch ein leises Zischen hinzu. Aus dem Kühlergrill stieg Dampf auf, der Motor war eindeutig überhitzt.
»Verdammte Karre! Mach mir jetzt bloß nicht schlapp!«, schimpfte er. Zum Glück hatte er ein Satellitentelefon und ausreichend Wasser bei sich, bei einer Panne in dieser unwirtlichen Gegend war beides unverzichtbar.
Muhammad war zwar eine zuverlässige Informationsquelle, doch von Autos verstand er offenbar nichts. Die Transportmittel, die er West zur Verfügung stellte, gehörten auf einen Schrottplatz und nicht auf die Straße. Wochenlang war West mit einem vergammelten Range Rover durch die Gegend gefahren, bis die Kiste in der Nähe der Ruinen von Babylon den Geist aufgab. Er musste mit dem Taxi zurück nach Bagdad. Als West Muhammad das Problem erklärte, versprach dieser seinem britischen Freund schnell Abhilfe zu schaffen. Zwei Tage später kam er mit diesem Jeep daher. Er sah so aus, als stamme er aus dem Zweiten Weltkrieg. Vielleicht war dem so.
Der Wagen wurde angehalten, mit einem missmutigen Grummeln auf den Lippen stieg West aus dem Jeep. Er umrundete das Gefährt, öffnete die Heckklappe, nahm ein Paar Handschuhe aus dem Rucksack mit seiner Ausrüstung. Schließlich wollte er sich nicht die Finger verbrennen.
Kurz darauf stand er vorm Jeep, die Motorhaube war geöffnet, vom Motor stieg mächtig viel Dampf auf, West direkt ins Gesicht. Sieht nicht gut aus, ging es ihm durch den Kopf.
Als er in Nukhayb ankam, dämmerte es bereits, wie erwartet. West war froh hier zu sein – froh, dass er es überhaupt hierher geschafft hatte. Als aus dem Kühlergrill Dampf aufstieg, befürchtete er schon, festzusitzen. Zum Glück sprang der Wagen wieder an, als der Motor abgekühlt war.
Mit letzter Kraft kämpfte sich der Jeep eine Böschung hinauf, dieser alte Klepper von einem Geländewagen hatte in letzter Zeit eindeutig zu viele Steigungen überwinden müssen, das hielten seine korrodierten Eingeweide nicht mehr aus.
Vom dahinscheidenden Tage kündete alleinig ein orangeroter Lichtschein, der die Gipfel der Berge im Westen einhüllte, rot glühende Wolken im Osten, deren Feuerglut von der aufziehenden Dunkelheit zunehmend verschluckt wurde.
Der Mond lugte zwischen spitzen Gipfeln hervor, in einer Pracht, wie man sie in Europa nur selten zu Gesicht bekam.
Als der Jeep die Anhöhe überwunden hatte, nun in einen schmalen Talkessel hineinrollte, da erblickte West das Dorf. Einfache, für diese Gegend typische Lehmziegelbauten lehnten sich beiderseits an die steilen Felswände. Weitere Gebäude standen entlang der schmalen Schotterstraße. Licht flutete aus zahlreichen Fenstern in die Nacht, die langsam aber sicher das Land in ihren Besitz nahm.
Der Wagen rollte durch das Dorf. Zu jener späten Stunde waren nur noch wenige Leute anzutreffen. West sah eine Gruppe alter Männer, die sich vor einem Haus angeregt unterhielten, eine Mutter scheuchte ihre Kinder ins Haus. Das Dorf legte sich schlafen.
Der Jeep hielt vor einer kleinen Behausung am anderen Ende des Dorfes, hinter ihr ragten steil abfallende Felsen auf. Dort oben, versteckt zwischen den Felsen, soll jene dunkle Höhle sein, deretwegen er hergekommen war.
Vor dem Haus stand ein junger Orientale, schlaksige Gestalt, braun gebrannter Teint. Ein dichter, rabenschwarzer Bart, Haare in derselben Kolorierung und dunkle, aufgeweckt blickende Augen. Es war Muhammad. Ein alter Mann in der traditionellen Tracht der Menschen dieser Region leistete ihm Gesellschaft. Auf einen Hirtenstock gestützt stand er da. West vermutete, dass es sich bei dieser Person um Abu Al-Mawardi handelte, dem Ziegenhirten, den Muhammad erwähnt hatte, jener Mann, dem die Entdeckung der Höhle zu verdanken war.
West stellte den Motor ab, die rostige Tür gab ein grässliches Quietschen von sich, als er aus dem Wagen stieg.
»Salam aleikum«, begrüßte Muhammad ihn.
»U aleikum assalaam«, gab West zurück. Die Männer umarmten sich, klopften sich gegenseitig auf den Rücken.
West maß Muhammad mit gespielter Verärgerung: »Welch Schrottkarre hast du mir da wieder aufgeschwatzt? Ich wäre damit beinahe liegen geblieben!«
»Ist ein guter Wagen«, behauptete Muhammad. »Aber wenn du was Besseres willst, kann ich mir bei den Amis ja einen Hummer ausborgen.«
Das war ein Scherz. Ein ziemlich schlechter. In Zeiten wie diesen machte man solche Witze nicht. Deswegen konnte West nicht sonderlich darüber lachen.
Die drei Männer gingen in das bescheidene Haus des Hirten.
Er stellte West seine Familie vor: seine Frau, die drei Söhne und zwei Töchter.
Im Gemeinschaftsraum des Hauses kamen alle zusammen. Bei Tee erzählte Al-Mawardi, wie er die Höhle entdeckte. »Es ist drei Tage her, seitdem ich meine Ziegen den steilen Weg hinter dem Haus hinauftrieb. Ich gehe oft diesen Weg, schon seit Jahren, noch nie ist mir diese Höhle aufgefallen.«
Der Mann sprach Arabisch, weshalb Muhammad die Worte übersetzen musste. Als West ihn fragte, weshalb der Hirte diese Höhle nie zuvor sah, obwohl er sich ständig in dieser Gegend aufhielt, musste West erst warten bis Muhammad die Frage und die Antwort übersetzt hatte.
Der Hirte gab folgende Antwort: »Die Felsen sind steil und brüchig, es kommt oft zu Steinschlag. Die Höhle ist wahrscheinlich lange Zeit verschüttet gewesen und bei einem kürzlich stattgefunden Steinschlag freigelegt worden.«
Die Worte des Hirten leuchteten ihm ein, vermutlich war dem so.
Er fragte den Hirten, ob er in der Höhle war. Al-Mawardi verneinte. Er hatte zwar einen Blick hineingeworfen, doch das war alles.
»Wissen noch andere davon?«, harkte West nach.
Erneut verneinte Al-Mawardi. Außer ihm und Muhammad kannte niemand die Lage der Höhle.
West war froh darüber, bedeutete dies doch, dass sich wie erhofft noch keine Räuber über die Höhle hergemacht hatten.
Er war ganz kribbelig, konnte es kaum erwarten, einen Blick in diese Höhle zu werfen. Doch damit musste er bis morgen warten, heute war es zu spät dafür.
Nach dem Gespräch brachte Al-Mawardi seinen Gast in einen schlichten Raum, in dem er sich zu Ruhe begeben konnte.
West bedankte sich und bereitete sich auf die Nachtruhe vor. Nach der anstrengenden Fahrt war er froh, sich ausruhen zu können. Es dauerte nicht lange und der Schlaf bemächtigte sich seines Bewusstseins.
Wie aus dem Nichts erschien eine seltsame Gestalt im Dorf, ging zielstrebig auf die Gruppe alter Männer zu, die sich vor einem Haus versammelt hatte und sich gegenseitig Geschichten erzählte.
»Vor Kurzem ist ein Europäer eingetroffen. Ich will wissen, wo er ist!«, sprach der Fremde mit gebieterischer Stimme.
Einer der Alten sah die Gestalt, die in eine weiße Robe gekleidet war – eine tief ins Gesicht gezogene Kapuze verbarg dieses vor neugierigen Blicken – trotzig an. Worte in einer herausfordernden Klangfarbe kamen aus dem Mund: »Wer will das wissen? Wer bist du, was hast du in unserem Dorf verloren, und was willst du von diesem Europäer?«
»Du stellst zu viele Fragen … alter Mann!! Es wundert mich deshalb, dass du trotzdem ein gutes Alter erreicht hast. Neugierige Leute sterben normalerweise jung. Vielleicht hast du ja sehr viel Glück gehabt in deinem Leben. Ich rate dir, es nicht zu strapazieren.!«
»Er ist beim Ziegenhirten Al-Mawardi zu Gast«, gab ein anderer Mann Auskunft.
»Danke!«, sprach der Fremde, wandte sich ab, bog um eine Hausecke und verschwand.
Am nächsten Morgen beim ersten Hahnenschrei, jungfräuliche Sonnenstrahlen küssten das Land, war West wieder auf den Beinen.
Er holte einen prall gefüllten Trekkingrucksack – in dem sich all das Zeug befand, welches ein Archäologe für eine Ausgrabung benötigte – aus dem Jeep, schnallte ihn sich auf den Rücken. Es gab noch einen Zweiten, den Muhammad bekam. Das Abenteuer konnte beginnen.
Sie folgten jenem steilen Pfad, den Al-Mawardi beschrieben hatte, der sich zwischen schroff aufsteigenden Felsen hindurch hoch in die Berge hinauf schlängelte.
Die Meter schmolzen unter ihren Stiefeln dahin, Minuten enteilten, das Dorf im Tal schien zu schrumpfen, sich zu einer Miniatur zu wandeln, als sie immer weiter emporstiegen.
In den frühen Morgenstunden war es noch recht kühl, eine sanfte Brise fächelte West ins Gesicht, brachte Erfrischung. Er war froh darüber. In der Hitze der Mittagssonne wäre solch ein Aufstieg eine mörderische Tortur.
Nach einer Weile stieß Muhammad einen Schrei aus und deutete auf ein kleines Loch in einer Felsspalte oberhalb des Pfades – dort, wo er eine Wende nach rechts vollführte. Das musste die gesuchte Höhle sein.
West blickte drein wie ein Kind vorm Weihnachtsbaum, und im Moment fühlte er sich auch wie an Weihnachten.
Er schnallte den Rucksack ab, stellte ihn auf den Boden, kramte darin herum, fischte ein Stäbchen heraus und knickte es. Eine chemische Reaktion bewirkte, dass es zu leuchten begann. Dann stieg er eine Böschung hinauf. Schotter knirsche unter seinen festen Wanderstiefel, Steinchen kullerten den Hang hinunter. Er hielt die Leuchte in das Loch, welches gerade mal so groß war, dass man hindurchschlüpfen konnte. Im matten Schein des Leuchtstabes erblickte er eine Wand und Stalaktiten. Mehr war im Moment nicht zu erkennen. Um mehr zu sehen, musste er in die Höhle.
Er ging auf die Knie, zwängte sich durch das schmale Loch.
Er erhob sich wieder, ließ den Leuchtstab wandern. Das diffuse grünliche Licht des Stabes offenbarte, dass er sich in einer Grotte befand. Aus zerborstenem Gestein gluckerte Wasser. Am Boden erblickte er das, was er zu finden hoffte: Tontafeln! Einige waren zerbrochen, viele jedoch noch intakt. Dazwischen standen mehrere Tonkrüge.
Er führte den Stab an eine der Tafeln heran, um sie genauer unter die Lupe zu nehmen. Ja, es war eindeutig eine Keilschrifttafel. Den Schriftzeichen nach zu urteilen, stammte sie aus sumerischer Zeit.
West begab sich wieder zu dem Loch, steckte den Kopf hindurch und rief: »Muhammad, hol die Ausrüstung!«
Muhammad nickte, packte Wests Trekkingrucksack und kletterte den Hang hinauf. Dort angekommen, stellte er ihn vor dem Eingang ab, dann entledigte er sich seines Eigenen. Er holte aus dem einen Rucksack alles heraus, was West für seine Arbeit brauchte. Zuerst eine Lampe, die mehr Licht bot als der Leuchtstab. Muhammad reichte sie West durch das Loch hindurch.
West stellte sie auf den Boden und drehte sie auf. Jetzt erst, als das Licht stärker war, bemerkte er es. Da war eine verborgene Nische, und darin lag etwas. Der Gegenstand war etwa so groß wie ein menschlicher Körper, Stoff umhüllte ihn. Er wurde sich sogleich bewusst, dass diese Höhle eine Grabkammer war und in dieser Höhlung der Leichnam lag.
Er nahm die Lampe wieder auf, trat bedächtig an die Nische heran, bückte sich und ließ die Lampe über das Bündel wandern. Der Leichnam war in Leinen gewickelt, wie er feststellte.
Er platzierte die Lampe neben sich, nahm ein Messer zur Hand und begann behutsam den Kokon aus Leinen aufzuschneiden. Fauliger Geruch stieß ihm entgegen. Er riss das Leinen auseinander. Aus dem geschaffenen Spalt lugte ein zu einer schauerlichen Fratze verzehrtes, mumifiziertes Gesicht, hervor.
West war verzückt. Eine Mumie! Hier im Norden des Iraks. Ein Jahrhundertfund!
Wie für eine Mumie zu erwarten, war der Leichnam ziemlich gut erhalten. Geschwärzte Haut zog sich über die Knochen, am Kopf waren noch Büschel von Haaren. Die purpurne Toga, die der Verstorbene bei seiner Beerdigung getragen hatte, war ebenfalls in einem verhältnismäßig guten Zustand.
Wests Blick fiel auf ein Schmuckstück, das auf der Brust der Mumie ruhte.
Es war ein Medaillon von mindestens zehn Zentimeter Durchmesser. Er war irritiert, als er es genauer betrachtete. Irgendwas war seltsam daran.
Er beugte sich nach vorne, um das Kleinod gründlicher zu mustern. Da waren Schriftzeichen eingraviert, die er noch nie zuvor gesehen hatte. Es handelte sich nicht um Sumerisch, auch nicht um Babylonisch, noch um eine andere Schrift, die er kannte, es war etwas ganz anderes. West stand vor einem Rätsel.
Als noch geheimnisvoller erwies sich jedoch das Medaillon selbst. Es gab ein seltsames irisierendes Leuchten von sich. Es schimmerte im Lichte seiner Lampe nicht so, wie ein Gegenstand aus Metall es normalerweise tat.
War das Medaillon überhaupt aus Metall? Oder bestand es aus einem ganz anderen Material? Perlmutt vielleicht.
Nein! Perlmutt irisierte zwar auch, jedoch nicht in der Art, wie es dieses Medaillon tat.
Aus irgendeinem Grund kam das verwirrende Gefühl über ihn, dass dieses Medaillon irgendeine Energie abstrahlt.
Quatsch!, schallte er sich.
Seine linke Hand streckte sich nach dem Schmuckstück, die Finger umfassten es und er erlebte seine nächste Überraschung. Es fühlte sich nicht wie Metall an, sondern wie – Haut!
Er erhielt keine Gelegenheit, über jene bizarre Eigenschaft dieses Medaillon nachzudenken, denn unerwartet hallte von draußen ein gellender Schrei herein. Er meuchelte die Stille, ließ West schaudern. Es war ein entsetzter Todesschrei, der aus Muhammads Kehle drang.
Panik packte West wie die Pranke eines Untiers. Etwas Schreckliches war geschehen. Angst schnürte seine Kehle zu, das Herz begann zu rasen. Das Medaillon entglitt seiner Hand, fiel in den Staub.
Er stürzte sich auf das Loch, wollte so schnell wie möglich raus aus der Grotte, um zu erfahren, welch schreckliches Schicksal Muhammad ereilt hatte.
Doch das konnte er nicht. Ein Mann versperrte ihm jäh den Weg.
West hatte keine Ahnung, wie der Fremde in die Grotte kam, hatte nicht bemerkt, dass jemand durch das Loch gekrochen war. Es könnte natürlich sein, das seine Sinne so sehr auf die Mumie konzentriert waren, dass er die Annähung dieses Mannes nicht bemerkte. Oder der Unbekannte war schon in der Höhle, bevor West sie betrat. Das plötzliche Auftauchen des Fremden war ihm genauso ein Rätsel wie das Medaillon.
Wo auch immer diese mysteriöse Person hergekommen war, in West reifte die Überzeugung: Was auch immer mit Muhammad geschehen war, dieser Mann trug die Verantwortung dafür.
West starrte den Mann entsetzt an.
Es war eine seltsame Gestalt, ein Hüne von mindestens zwei Meter Körperlänge, gekleidet in eine eng anliegende weiße Kleidung, darüber ein weiter Umhang mit Kapuze in derselben Farbe. Das Gesicht war nicht zu erkennen, der Unbekannte hatte einen Schal um Nase und Mund gewickelt. Nur der Nasenrücken und die Augen waren zu erkennen.
Die Augen! Es waren Augen, die West das Blut in den Adern gefrieren ließ. Mein Gott! – Sie hatten violette Pupillen!
Waren es Kontaktlinsen? Vielleicht. Doch nicht allein die Farbe der Augen, auch der Blick ließ West erschaudern. Diese Augen strahlten pure Kälte aus, es war der Gesichtsausdruck eines gewissenlosen Killers.
»Was haben Sie mit Muhammad gemacht?«, brach es aus ihm hervor. Er fühlte sich seltsam, eine Mischung aus Furcht und Zorn durchströmte ihn.
Die Hand mit jenem Messer, mit dem er das Leinen durchtrennt hatte, zitterte.
Es handelte sich um ein Jagdmesser mit ziemlich scharfer Klinge. Doch es gab ihm kein Gefühl der Sicherheit. West war überzeugt, dass dieser Mann ihm das Messer ohne Mühe abnehmen und es gegen ihm verwenden konnte.
»Ich habe ihn getötet«, erwiderte der Fremde emotionslos. »Dasselbe werde ich jetzt auch mit Ihnen machen.«
In dem Moment, in dem diese Worte zwischen den Lippen des Hünen hervorkamen, fraß die Angst die Wut. West hatte den Eindruck, als würde das Herz für einen Wimpernschlag stehen bleiben, um dann wie verrückt zu schlagen – gleich einem Irren gegen seine Rippen hämmern, als wollte es aus seinem Körper heraustreten, um vor dem Unvermeidlichen zu flüchten.
Das Messer löste sich von der rechten Hand.
»Weshalb? … weshalb wollen Sie mich töten? Ich habe Ihnen nichts getan!«, presste er mühsam hervor. Das blanke Grausen trocknete seine Kehle aus, ließ ihn erstarren.
»Sie haben etwas gefunden. Etwas, das nicht gefunden werden darf. Jetzt noch nicht, es ist zu früh«, erklärte der Fremde mit seiner unheimlichen, abgestumpften Stimme. »Sie hätten diese Grotte nie betreten dürfen, Professor West. Wären Sie in Bagdad geblieben, hätte ich nur diesen Muhammad und den Ziegenhirten beseitigt.«
Der Hüne hielt einen Moment inne, dann zeigte er zum ersten Mal Emotionen, als er einen Fluch ausstieß. »Verdammt! Das hätte ich gleich nach der Entdeckung der Grotte machen sollen, dann hätten Sie nie von ihrer Existenz erfahren und ich müsste Sie nun nicht töten. Dummer Fehler! Dem Großmeister wird das sicher nicht gefallen.«
Welcher Großmeister?, schoss West ein Gedanke durch den Kopf. Was zum Teufel wird hier gespielt?
Er wusste, dass er auf diese Frage nie eine Antwort bekommen wird. Für ihn war sicher, dass er aus dieser Grotte nicht mehr lebend rauskommt.
Als diese Erkenntnis über ihm kam, wurde er etwas ruhiger, gab sich seinem Schicksal hin. Das Einzige, was er noch machen konnte, war beten, dass es schnell und schmerzlos ging.
Der Fremde griff unter seinen Umhang. Dabei fiel Wests Blick auf ein seltsames Tattoo auf dem Handrücken des rechten Unterarmes.
Eine Erinnerung blitze in seinem Geist auf. Dieses Zeichen hatte er schon einmal gesehen. Erst kürzlich. Es befand sich auf diesem mysteriösen Amulett. Überrascht riss er die Augen auf.
In Wests Kopf begann es zu arbeiten. Er fragte sich, ob es einen Zusammenhang zwischen der Mumie und diesem Unbekannten gab. Zwischen ihm und dem seltsamen Medaillon. Wer war jener Großmeister, von dem der Mann sprach? Gehörte er einer geheimen Bruderschaft an? So viele Fragen, doch keine Zeit, sie zu beantworten.
West wünschte sich, dem Tod entrinnen zu können, damit er die Gelegenheit bekam, all jene Rätsel zu lösen. Doch der Sensenmann hatte kein Erbarmen mit ihm. Er hatte beschlossen, dass West hier und jetzt sein Ende findet: Schluss! Aus! Basta! Ende der Vorstellung!
Der Fremde richtete den Lauf einer seltsamen Waffe auf ihn, sie sah irgendwie futuristisch aus. Ein gleißendes Licht blendete West. Instinktiv hob er die Hände. Es war das Letzte, was er in seinem Leben tat, denn Nanosekunden später war Gregory West nicht mehr, hatte sich in Luft aufgelöst, so als hätte er nie existiert.
Die Gestalt steckte die Waffe weg, warf einen Blick auf das Medaillon, das West hat fallen lassen. Dort wo es jetzt lag, sollte es bleiben, mindestens für die nächsten dreihundert Jahre.
Er machte kehrt, zwängte sich durch das Loch ins Freie. Dort war keine Spur von Muhammad und den beiden Trekkingrucksäcken zu finden, auch sie waren verschwunden.
Der Unbekannte schritt den Geröllhaufen hinab, folgte anschließend den Pfad hinunter ins Tal.
Doch schon nach einigen Schritten blieb er stehen, warf seinen Umhang zurück, zog erneut die Waffe, zielte auf einen Felsen direkt über dem Loch. Ein feuriger Strahl schoss aus dem Lauf der Waffe, schlug in den Felsen ein. Es krachte und knirschte, dann brach der Felsen aus der Wand und fiel genau vor das Loch. Die Grotte war versiegelt, das Geheimnis bewahrt. Er hatte seinen Auftrag zum größten Teil erledigt, nur noch eins war übrig: der Ziegenhirte! Auch er musste verschwinden. Bei Anbruch der Nacht wird er ins Dorf gehen, um auch das zu erledigen.
Er wollte sich gerade in Bewegung setzen, als seine Ohren ein Geräusch vernahmen, ein Laut, der den Hünen vor Schreck zusammenfahren ließ. Genauer genommen waren es zwei Laute. Zuerst horchte er den Klang von knirschendem Kies, dann – Klatschen! Da war eindeutig jemand.
Der Hüne sah sich um, erblickte eine Gestalt, wie er sie noch nie zuvor gesehen hatte, die gerade hinter einem Felsen hervorkam.
Der Fremde hatte seltsame geschuppte Haut, aus dem Hinterkopf ragten Hörner. Eine Knochenplatte, an der Stirn beginnend, sich zum Hinterkopf ziehend, bedeckte das Haupt. Bernsteinfarbige Augen mit mandelförmigen Pupillen.
»Das hast du gut gemacht!«, sprach der Fremdling in einem hämischen Ton.
»Wer bist du?«, fragte der Hüne herrisch.
»Ich bin dein Ende und all derer die so sind wie du!«, entgegnete der Fremde kryptisch. »Schon bald wird das Ende deines Ordens kommen. Dann wird niemand mehr da sein, der am Tag der Entscheidung den Auserwählten beschützen kann.«
Dem Hünen lag eine Frage auf der Zunge, doch sie wurde nie ausgesprochen. Denn plötzlich geschah etwas Seltsames mit dem Fremden. Ausgehend von der Nase breitete sich eine silberne Metallschicht über seinen ganzen Körper aus, er verwandelte sich in eine lebende Silberstatuette. Doch damit war die Metamorphose nicht abgeschlossen. Der Unbekannte streckte die Hände von sich. Erstaunt beobachtete der Hüne, wie sich die Fingerspitzen in Staub verwandelten. Dieser Prozess breitete sich auf den ganzen Körper aus, bis der Fremde nur noch eine silbern glänzende Staubwolke war.
Das Schauspiel hatte nur wenige Sekunden gedauert.
Der Hüne grübelte über das, was da gerade vorgefallen war, stellte sich Fragen. Doch nur für einen Moment, schon bald war sein Denken wieder voll auf seine Aufgabe gerichtet. Er setzte den Weg nach Nukhayb fort.
Am 4. August 2004 verschwanden im kleinen Dorf Nukhayb im Norden des Iraks drei Menschen unter mysteriösen Umständen. Was dort geschah, wurde nie geklärt.
Drei
295 Jahre später:
Bahia de Angeles
Vereinigte Republik Kalifornien
Montag, der 18. Dezember 2299
6:54 Ortszeit
An der Westküste des nordamerikanischen Kontinents brach ein neuer Tag an. Die Schemen der Nacht wichen zur Seite, überließen der Helligkeit des Tages das Zepter.
Die Sonne lugte zaghaft zwischen den schneebedeckten Gipfeln der San Gabriel Mountains hervor, beglückte die noch im Schlaf liegende Natur mit ihren wärmenden Strahlen, Schatten tanzten über die Landschaft. Wie ein zarter Schleier lag Dunst über der Bucht, ein sanfter salziger Meeresduft erfüllte die Luft.
Auf der Veranda eines Hauses in Santa Monica, direkt an der Angel Bay gelegen, da stand ein Mann und sah gedankenverloren auf sie hinaus.
Von hier aus bot sich ihm ein herrlicher Blick auf die gegenüberliegende Seite, wo die Skyline von Bahia den Himmel küsste. Die Glasfassaden der atemberaubenden Wolkenkratzer brachen die Lichtstrahlen, welche die erwachende Sonne der nach ihnen lechzende Natur schenkte. Das Licht des Leben spendenden Sterns transformierte Gebäude zu funkelnde Edelsteine.
Bahia de Angeles , in früheren Tagen unter dem Namen Los Angeles bekannt, war mit einer Bevölkerungszahl von vierunddreißig Millionen die größte Stadt des Planeten. Jene Bauwerke, die sich in Downtown Bahia dem Himmel entgegen reckten, konnten sich rühmen, die Höchsten auf dem Planeten zu sein, die meisten davon waren an die fünfhundert Meter hoch. Das Auffälligste von allen trug den Namen Federal Bank of Terra Building. Eine gewaltige Nadel, die eintausendneunhundertsiebzig Meter in den Himmel stach.
Der Blick des Mannes wandte sich einem Gebilde zu, das nicht minder eindrucksvoll war. Die Griffith Bridge , die auf zwei Kilometer die Bay überspannte und Downtown mit der Stadt Angel Bay City verband. Die gewaltigen weißen Pfeiler der Hängebrücke ragten über zweihundert Meter in die Höhe. An den dicken Stahltrossen waren in den letzten Tagen Feuerwerkskörper angebracht worden, die am Sylvesterabend abgefeuert werden sollen. Hier in der Bucht von Bahia wird am 31. Dezember eine ordentliche Party steigen, wahrscheinlich die Beste, die die Stadt je gesehen hat. Genau das Richtige, um das neue Jahrhundert zu begrüßen.
Seemöwen segelten über die Bay hinweg, auf der Suche nach Nahrung. Einige ihrer Artgenossen saßen an den Piers und kreischten sich gegenseitig an.
Möwen waren nicht das Einzige, was durch die Luft schwebte. Auch einige Antigrav-Gleiter – die fliegenden Autos – waren unterwegs. Diese Luftfahrzeuge waren im 23. Jahrhundert das drittwichtigste Verkehrsmittel, nach den MLCs und der Magnetschwebebahn, sie hatten im Laufe der Zeit das Flugzeug ersetzt.
Zu dieser frühen Stunde, in der die Stadt noch am Erwachen war, befanden sich noch nicht allzu viele Gleiter in der Luft. Wenn aber Rushhour herrschte, ging es am Himmel über Bahia zu wie in einem Bienenstock, er war dann mit Gleitern vollgestopft. In jener Hinsicht hatte sich seit den Tagen des alten Los Angeles nicht viel verändert, außer dass es in der Luft nicht zu Staus kommen konnte.
Auch auf der Oberfläche waren Staus unbekannt. Das elektronische Verkehrsleitsystem sorgte dafür, dass der Verkehr nie ins Stocken geriet. Obwohl bereits zu jener Tageszeit zig Tausende von Brennstoffzellen angetriebene Magnetic Leviation Cars entlang der supraleitenden Fahrbahn über die Griffith Bridge glitten, kam der Blechwurm nie aus dem Schritt. Im zügigen Tempo schlängelte er sich über die Brücke.
Der Mann, der auf der Veranda dieses Hauses innehielt, erfasste die Geschehnisse um ihn herum lediglich in einem geringen Umfang, sein Geist war weit entfernt von hier, seine Gedanken durchwanderten die unendlichen Weiten des Alls.
Er war groß und stämmig, hatte kräftiges kastanienbraunes Haar, das an diesem Morgen zersaust war. Augen in einem Grün gleich eines Smaragdes, die inmitten eines jungenhaften Gesichtes lagen, das ihn jünger erscheinen ließ, als er tatsächlich war. Diese Augen strahlten Verwegenheit und Standhaftigkeit aus.
Normalerweise.
Zurzeit zeigte sich in ihnen ein Hauch von Melancholie. Und nicht nur das, kräftige Augenringe zeugten von einer unruhigen Nacht. Es war eine Nacht, in der er von Albträumen verfolgt wurde, wie in den meisten Nächten – grausame Träume von Zerstörung und Tod.
Jener Mann, der auf der Terrasse stand, die Arme auf der hölzernen Brüstung gelehnt, hieß Zebediah Jonah Curwen, von seiner Mutter und den Freunden einfach nur Zeb. J. genannt. Er war Offizier der Space Navy der Interstellaren Union – ein verdammt guter! Manche Leute vertraten jedoch die Ansicht, dass er wegen seiner freien Auslegung der Dienstvorschriften aus der Navy entlassen werden sollte.
Viele Jahre lang befehligte er einen Zerstörer der Dreadnought-Klasse mit dem Namen WAYFARER UNDER STARS. Bis das Schiff vor etwa einem Monat ein Opfer des Krieges wurde, jenes grausamen Gemetzels, welches seit dem Jahr 2295 den Orionarm – den bislang von Menschen erforschten Teil der Milchstraße – heimsuchte.
Vier mächtige Sternenreiche waren in den Konflikt involviert. Auf der einen Seite die Union und die Pon-Arikanische Föderation, auf der anderen das Kehhl’ daaranische Empire und das Reich von Taan-Shanarr.
Der Schrecken brach im August des Jahres 2295 über die Galaxis herein.
Auf der Nordhalbkugel der Erde genossen die Leute die Hitze des Sommers, vergnügten sich an den Stränden. Sommeridylle.
Niemand machte sich ernsthafte Sorgen wegen des sich stetig zuspitzenden Konflikts zwischen der Union und dem Empire bezüglich des W’xana-Systems, welches beide Seiten für sich beanspruchten. Selbst die Diplomaten sahen keinen Grund für Beunruhigung. Im Rat der Union war man zuversichtlich, den Konflikt auf friedliche Art beilegen zu können. Niemand ahnte, dass die Verhandlungen nur dazu dienten, Zeit für den Aufmarsch der kehhl’daaranischen Flotte an strategisch wichtigen Positionen zu schinden.
Die Kehhl’daaraner verstanden es geschickt, Regierung und Militärs der Union zu täuschen. Selbst die Geheimdienste konnten die wahren Absichten der Kehhl’daaraner nicht durchschauen.
Und so kam es, dass der ohne Kriegserklärung erfolgte Angriff der Kehhl’daaraner die Interstellare Union überraschte wie ein Blitz aus heiterem Himmel.
Was monatelang vorbereitet wurde, das wurde am 16. August in die Tat umgesetzt. An diesem Tage öffneten sich draußen in den dunklen Weiten des Alls die Tore zur Hölle.
Eine gewaltige Streitmacht der Kehhl’daaraner, acht Flottenverbände mit insgesamt neunhundert Schiffen, griff in breiter Front Außenposten und Kolonien in den Grenzsektoren an. Der Überfall der Kehhl’daaraner gab den in den Grenzsektoren stationierten Flottenverbänden der United Space Navy kaum eine Chance zur Gegenwehr. Dutzend Schlachtschiffe wurden vernichtet, ohne einen einzigen Schuss abgegeben zu haben. Zahlreiche tapfere Männer und Frauen der Space Navy starben in ihren Kojen, ohne je zu erfahren, was sie getötet hat.
Die Sektoren siebzehn und achtzehn fielen innerhalb von zwei Stunden, die 2. Flotte wurde aufgerieben. Ein Desaster, das in der Geschichte der Space Navy ohne Beispiel war. Nie zuvor mussten die vereinigten Raumstreitkräfte der Union derart hohe Verluste innerhalb kürzester Zeit erleiden.
Die Union versank im Chaos.
Die Medien berichteten pausenlos von der Invasion. In den Generalstäben der Militärs und im Rat der Union jagte eine Krisensitzung die Nächste, während die Kehhl’ daaraner immer weiter ins Territorium der Union eindrangen.
An jenem 16. August 2295 stand es nicht gut um die Union.
Am Ende dieses schicksalhaften Tages befand sich eine kehhl’daarranische Streitmacht nur noch zwanzig Lichtjahre von D-Goriaa, eine der Hauptwelten, entfernt. Eine andere rückte unaufhaltsam zur Erde vor.
Um 21:16 ZULU wurde von den Beobachtungsposten auf Eris und Pluto die ersten Schiffe der Vorhut der anrückenden Streitmacht gesichtet.
Um 21:19 brach der Kontakt zu Eris ab.
Drei Minuten später meldete sich auch Pluto nicht mehr.
Um 21:55 trafen die kehhl’daaranische Flotte und die eiligst in Marsch gesetzte terranische Heimatflotte sowie die 4. Flotte im Orbit des Jupiters aufeinander. Eine gewaltige Schlacht, deren Spuren man heute noch sehen konnte – um den Planeten gab es nun einen Ring, der aus Schiffwracks bestand – entbrannte.
Um 4:43 des 18. August 2295 war die Schlacht entschieden. Unter großen Opfern war es der Space Navy gelungen, die Kehhl’daaraner aus dem Sol-System zu vertreiben.
Während der Schlacht lösten sich Einmannjäger aus dem gegnerischen Flottenverband und jagten der Erde entgegen. Das planetarische Verteidigungsnetz konnte sie aufhalten, jedoch nicht alle, einige schlüpften hindurch und griffen Ziele auf der Erde an.
Eines der Ziele war die Hauptstadt der Interstellaren Union, New Newyork.
Ein todbringender Plasmatorpedo – dabei handelte es sich um eine etwa einen Meter durchmessende Sphäre, die eine zerstörerische Plasmawelle aussenden konnte – abgefeuert von einem der Jäger, kurz bevor er von einer Tachyonpuls-Kanone in Stücke gerissen wurde, jagte durch die Atmosphäre, streifte einige Gebäude in Midtown Manhattan, bis er schließlich in einem der Bürotürme eines Gebäudekomplexes – in dem sich das Oberkommando der United Space Navy befand – einschlug. Ein gewaltiger Feuerball schoss aus der Fassade, innerhalb von Sekunden entwickelten sich im Inneren des Gebäudes Temperaturen von mehreren Tausend Grad Celsius, Stahlträger schmolzen wie Butter an der Sonne. Es dauerte nur Minuten, bis das Gebäude krachend in sich zusammenstürzte und über zweitausend Offiziere der Space Navy unter sich begrub.
Und doch hatte man Glück im Unglück. Der Torpedo war ein Blindgänger, die gefürchtete Plasmaschockwelle blieb aus. New Newyork entging knapp der Vernichtung.
Neben New Newyork war eines der Hauptangriffsziele die Region Yorkshire and the Humber im Vereinigten Königreich aufgrund der bedeutenden Rüstungsbetriebe in den Städten Sheffield, Leeds und Bradford. Dem vorausschauenden Handeln der britischen Regierung – die schon vor Jahren für den Fall eines Angriffes ein Netz von Deflektorgeneratoren in der ganzen Region errichten ließ, welche in der Lage sein sollen, ganz Yorkshire and the Humber unter einen Schutzschild zu hüllen – war es zu verdanken, dass es trotz eines massiven Beschusses mit Plasmatorpedos keinerlei Schäden gab.
Jakarta hatte nicht soviel Glück wie New Newyork und die Region Yorkshire, die Stadt wurde den Erdboden gleichgemacht. Weil sich ein wichtiger Energieverteilungsknoten für den asiatischen Raum in Jakarta befand, brach in Südostasien und Australien die Stromversorgung zusammen.
Insgesamt wurden ein Dutzend Ziele rund um den Globus angegriffen. Gewaltige Schäden und der Verlust an Menschenleben in die Millionen waren zu beklagen.
Es war das erste Mal seit mehr als einhundertfünfzig Jahren, dass auf der Erde die Waffen sprachen und dementsprechend ein Schock für die Menschen des 23. Jahrhunderts, die Kriege eigentlich nur aus Geschichtsbüchern und Nachrichtensendungen kannten. Diese interstellaren Kriege waren normalerweise weit entfernt, sodass die Menschen auf der Erde keinen direkten Bezug dazu hatten. Dass die Erde plötzlich selbst in einen interstellaren Konflikt verwickelt wurde, führte zu einem kollektiven Schock bei den Menschen, den sie bis heute nicht ganz überwunden hatten. Die Ereignisse vom August 2295 waren als das 8/95-Trauma bekannt.
Heute, im Dezember des Jahres 2299 hatte sich die Lage in diesem Krieg grundsätzlich geändert. Jene Erfolge, die die Kehhl’daaraner zu Beginn des Krieges für sich verbuchen konnten, waren nur von kurzer Dauer, die Space Navy konnte sie zurückschlagen und aus sämtlichen Sektoren der Union vertreiben. In den Jahren 2296-97 erfolgte der Gegenschlag. Gewaltige Raumflotten der Union und ihrer Verbündeten setzten den Kehhl’daaranern hart zu, bescherten den Echsen schwere Niederlagen. Kehhl’daar Vul’kor, Xul’rul, Mos’kur – die Liste kehhl’daaranischer Grenzwelten, die dem Ansturm nicht standhalten konnten und fielen, war lang – und sie wurde von Tag zu Tag länger. Inzwischen waren große Teile des Kehhl’daaranischen Empires von der Union besetzt, es stand vor einer Niederlage. Den Taan-Shanarr erging es nicht anders, sie wurden von den Pon-Arikanern immer weiter zurückgedrängt.
Curwen hoffte, dass der Krieg somit bald ein Ende findet, denn er hasste ihn wie die Pest. Vor allem jetzt, nachdem sein Schiff zerstört war und er aufgrund dessen zum Nichtstun verdammt wurde. Und er verabscheute ihn, weil dieses grausame Abschlachten ihm jene grässlichen Albträume bescherte.
Seit der Zerstörung der WAYFARER UNDER STARS befand er sich im Zwangsurlaub, weil man zurzeit leider keine Verwendung für ihn hatte. Es wurde ihm zwar ein neues Kommando in Aussicht gestellt, doch dieses ließ bislang auf sich warten. Zudem waren die neunmalklugen Seelenklempner bei der Navy der Meinung, dass Curwen sich von seinem posttraumatischen Stress erholen soll, den er sich angeblich durch die Vernichtung der WAYFARER UNDER STARS zugezogen hatte.
Einen Vorteil bot dieser aufgezwungene Urlaub natürlich. Er konnte endlich wieder einmal zu Hause sein, hier in Santa Monica, im Haus seiner Mutter. Ein seltenes Vergnügen.
Anfangs war es ganz nett, wieder an jenem Ort zu verweilen, an dem er aufgewachsen war, für einige Zeit das Leben zu genießen und nicht an die Tragödien, welche sich dort draußen tagtäglich abspielten, zu denken, doch schön langsam wurde es öde.
Der Tag verdrängte unaufhörlich die Nacht, die Sonne war ein Stück weiter gewandert und hing nun als glühende orangefarbene Scheibe über den Gipfeln der Berge. Eine schwache Brise war aufgekommen, die den Duft der Bucht in seine Nase wehte.
Keine Wolke war am Himmel zu sehen. Es wird wieder ein herrlicher Tag werden, wie die meisten in Südkalifornien. Erneut ein Tag, der von Langeweile geprägt wurde – Stunden, die Curwen nicht sinnvoll zu füllen imstande war.
Er fragte sich, ob er heute womöglich seinen alten Kumpel Runako Thenga in Berkeley besuchen soll, er war das letzte Mal vor einer Woche bei ihm gewesen.
Dem ehemaligen Ersten Offizier der WAYFARER UNDER STARS hatte das gleiche Schicksal ereilt wie Curwen, vermoderte nun in seinem Haus in Berkeley. Im Gegensatz zu Curwen hatte er keine Familie, lebte allein, wodurch er noch viel mehr von Langweile gequält wurde.
Curwen atmete tief durch, ließ noch mehr von dem stimulierenden Duft des Meeres in seine Nase.
Er hatte schon Dutzende Welten besucht, eine schöner als die andere, doch an keinem Ort fühlte er sich wohler als hier in Südkalifornien, es war eben seine Heimat.
Nein! Das war nicht korrekt! Nur zwischen den Sternen, in der Unendlichkeit des Alls fühlte er sich wahrlich zuhause, das war seine eigentliche Heimat – eine Heimat, von der er im Augenblick abgeschnitten war.
Verdammt! Er hatte das Warten satt. Er wollte wieder dort raus und kämpfen.
Sicher, er hasste den Krieg, aber noch mehr betrübte es ihn, auf dieser Veranda zu stehen, sich an dem zugegeben eindrucksvollen Sonnenaufgang zu erfreuen, während dort draußen Tausende Männer und Frauen der Space Navy ihr Leben ließen. Diese Untätigkeit verabscheute er um das Vielfache mehr als den gottverdammten Krieg. Er kam sich vor wie ein Deserteur.
Er vernahm das Knarren des Holzbodens, als jemand über diesen schritt. Im Laufe der Jahre war es intensiver geworden, ein Beleg dafür, dass an der Veranda der Zahn der Zeit nagte.
Er drehte sich um, erblickte seine Mutter, die mit sanften Schritten auf ihn zukam. Sie war in jenen Morgenmantel gekleidet, den er ihr voriges Jahr zu Weihnachten geschenkt hatte. Er konnte ihn seinerzeit nicht persönlich überreichen, dafür gab es keine Gelegenheit, was er sehr bedauerte.
Er wandte sich um, richtete den Blick erneut auf die Bucht, ließ einen schwermütigen Seufzer aus seinem Mund entweichen.
Seine Mutter gesellte sich zu ihm. Gemeinsam sahen sie zu, wie die Möwen ihre akrobatischen Kunststücke in der Luft vollführten, blickten zum Strand, wo ein paar Jogger ihre morgendlichen Runden machten. Ein Moment des Schweigens. In seiner Kürze unbedeutend im Vergleich zur Unendlichkeit des Universums, nicht einmal ein Wimpernschlag, doch kam es Curwen vor wie eine Ewigkeit.
Seine Mutter, Roxanne Curwen, war eine Frau von zweiundsiebzig Jahren, die aber nicht älter als vierzig aussah. Ihr schulterlanges rotbraunes Haar war nur an wenigen Stellen ergraut, hauptsächlich an den Schläfen, in ihrem Gesicht zeigten sich nur geringfügig Falten.
Das hatte sie zum einen der fortschrittlichen Medizin des 23. Jahrhunderts zu verdanken – die mittels Genetik und Nanotechnik die Lebensspanne der Zellen enorm verlängern konnte – zum anderen der Tatsache, dass es in der Natur der Menschen des 23. Jahrhunderts lag, extrem lange zu leben.
Ein langfristiger positiver Effekt der Verstrahlung der Erde infolge des Dritten Weltkrieges war ein robusteres Immunsystem der Nachkommen der Überlebenden.
Beide Faktoren, hoch entwickelte Medizin und eiserne Konstitution der Menschen, führten zu einer Lebensspanne von hundertfünfzig bis zweihundert Jahren.
Curwen war davon überzeugt, dass seine Mutter auch ohne robuste Gene und lebensverlängernde Medizin noch spitze aussehen würde.
Sie war eine starke Frau, die allem trotzen konnte, auch dem Alter. Es war erstaunlich, welch mächtiges Feuer in diesem zierlichen, fast schon zerbrechlich wirkenden, Körper brannte. Und deswegen hatte Curwen aller größten Respekt vor seiner Mutter, sie war einfach eine außergewöhnliche Frau.
Die Curwens: Sie waren eine alte Familie von Raumfahrern und Helden, ihre Linie reichte bis zu Matt Curwen zurück, dem zweiten Menschen auf dem Mars.
Als im Jahre 2159 die Space Force der Terranischen Liga und 2212 die Space Navy Terran Defense Force gegründet wurden, da waren natürlich auch die Curwens dabei.
Zeb. J. Curwens Vater – J. J. Mason – hatte es in seiner Laufbahn bis zum Admiral gebracht. Jahrelang kommandierte er die Battle-Group 14, zu der der legendäre Space-Carrier PACIFICA gehörte.
Im Kahan-Geij Krieg stand J. J. Mason Curwen in zahlreichen Schlachten an vorderster Front. Er erhielt mehrere Auszeichnungen wie zum Beispiel den Navy Star Erster Klasse und das Platin Navy Cross.
Auch Zeb. J.s älterer Bruder Thomas hatte seine Berufung in der Navy gefunden, und seine kleine Schwester Angela war vor einem Jahr in die Navy eingetreten.
Sein Vater war schon seit Langem tot – starb, als Zeb. J. zehn Jahre alt war. Er fiel in der Schlacht von Nutor, dem letzten großen Gefecht im Kahan-Geij Krieg.
Auch sein älterer Bruder weilte nicht mehr unter den Lebenden. Er kam vor sieben Jahren bei einem ziemlich tragischen Unfall an Bord der EXCALIBUR ums Leben. Als leitender Ingenieur arbeitete er in einem Wartungsschacht in der Nähe einer Luftschleuse, die sich plötzlich öffnete und ihn ins Weltall hinausschleuderte. Er hatte keinen Raumanzug getragen, weshalb er selbstredend nur wenige Sekunden im Vakuum überlebte.
Curwens Mutter hatte beide Schicksalsschläge erstaunlich gut verkraftet, aber er war sich nicht sicher, ob sie damit fertig werden würde, wenn sie auch noch ihn oder seine Schwester, im schlimmsten Fall beide, verlieren würde. Er befürchtete, dass dem nicht so war.
Es gab Grenzen der Leidensfähigkeit, die nicht überschritten werden sollten. Der Verlust der letzten lebenden Verwandten stellte nach Zeb. J. Curwens Auffassung eine solche dar. Würde ihm und seiner Schwester etwas zustoßen, seine Mutter alleine zurückbleiben, wäre das ihr Ende. Das Feuer in ihr würde verlöschen und eine alte verbitterte Frau übrig bleiben. Das wollte er ihr auf keinen Fall antun. Weshalb Curwen stets darauf bedacht war, heil von einem Einsatz zurückzukehren.
Roxanne Curwen machte dem Schweigen ein Ende, als sie das Wort ergriff. Mit ihrer typisch sanften, melodiösen Stimme sprach sie zu ihm: »Ich weiß, was in dir vorgeht. Du willst endlich wieder da oben sein – im Weltraum!«
Curwen richtete seinen Blick nach rechts, dahin, wo seine Mutter stand, sah ihr in die grünen Augen, genauso grün wie seine eigenen. »Ist das so offensichtlich?« Auf seinen Lippen zeigte sich ein zaghaftes Lächeln.
»Wenn du seit einer Woche jeden Morgen und Abend hier stehst und den Blick in den Himmel richtest, dann ist wohl klar, was los ist. Du hast Sehnsucht nach dem Weltall. Es ruft dich und du willst seinem Ruf folgen und es macht dich fertig, dass du das nicht kannst. Es plagen dich auch Schuldgefühle. Du kannst es nicht ertragen, dass deine Kameraden dort draußen kämpfen und sterben, während du hier eine schöne Zeit verlebst.«
»Ich bin für dich wohl ein offenes Buch«, bemerkte Curwen.
»Ich bin ja auch deine Mutter, und eine Mutter hat einen ganz besonderen Draht zu ihrem Kind«, gab Roxanne zurück, setzte hinzu: »Ich gebe dir einen Rat. Setze dich mit dem Oberkommando in Verbindung und bitte um ein neues Kommando.«
Curwen stieß einen frustrierten Seufzer aus, zum wiederholten Mal, das wurde schon zur Gewohnheit. »Schlechter Rat. Ich habe in den letzten Wochen schon Dutzende Male diese Bitte geäußert. Jedes Mal gab es dieselbe Antwort: Man wird mir auf jeden Fall ein neues Kommando geben, jedoch jetzt noch nicht. Man bittet mich um Geduld.
Geduld! Ich habe keine Geduld mehr. Ich sitze schon seit einem Monat hier herum. Wie lange wollen sie mich noch warten lassen? Bis der Krieg vorbei ist?«
»Lass uns nicht mehr über dieses für mich eher unangenehme Thema reden, sondern lieber frühstücken. Ich habe leckere Fluffernutter gemacht. Die isst du doch so gerne.«
Erneut wanderte ein Lächeln über Curwens Lippen. Seine Mutter hatte recht. Jetzt zu frühstücken war besser als auf dieser Veranda Wurzeln zu schlagen und Trübsal zu blasen. Also wandte er seinen Blick von der Angel Bay und dem erwachenden Bahia de Angeles ab und schlenderte ins Haus.
Curwens Mutter hatte wieder einmal ganze Arbeit geleistet. Der Tisch im Esszimmer war reich gedeckt mit Fluffernutters, Frühstückseiern, frisch gepressten Orangensaft und herrlich duftenden Kaffee. Es war wieder einmal viel zu viel. Seine Mutter neigte oft zu Übertreibung.
Als er am Tisch Platz nahm, fiel sein Blick auf eine altmodische Zeitung aus Papier die dort lag, zwischen einem Teller, auf dem sich die Fluffernutters stapelten, und eine Karaffe mit Orangensaft. Normalerweise wurden Tageszeitungen aus dem Grid auf sogenannte MDDs geladen, kleine Computer die wie Plastikfolien aussahen, die man auch zusammenfalten konnte. Zeitungen aus Papier waren heutzutage sehr selten und meist limitierte Sonderausgaben.
»Seit wann liest du altmodische Zeitungen aus Papier?«, erkundigte sich Curwen bei seiner Mutter, die am anderen Ende des Tisches Platz genommen hatte.
»Nun, ich dachte, ein wenig Abwechslung kann nicht schaden.«
Curwen stimmte seiner Mutter nickend zu, Abwechslung machte das Leben interessant und dadurch erst lebenswert.
Er griff nach der Zeitung – es war eine Ausgabe der Bahia de Angeles Post, eine der besten Zeitungen der Stadt – las die Schlagzeile auf der ersten Seite. Die Meldung, die er dort zu lesen bekam, überrasche ihn. Es stand dort nämlich in großen Lettern, dass die Taan-Shanarr kapituliert hatten, den Kehhl’daaranern war also ihr Verbündeter abhandengekommen. Nun mussten sich die Echsen dem Gegner alleine stellen.
Diese Mitteilung kam etwas überraschend.
Es war zwar eine unleugbare Tatsache, dass die Lage der Taan-Shanarr verzweifelt war, doch hatte Curwen nicht geahnt, dass sie sich als derart aussichtslos erwies, dass den Taan-Shanarr nichts anderes übrig blieb, als zu kapitulieren. Bedienungslos – dem Artikel zufolge.
Er hob die Zeitung hoch, richtete eine Frage an seine Mutter: »Wann ist diese Meldung rausgekommen?«
»Das wurde gestern Abend in einer Sondermeldung von ENC bekannt gegeben. Zu dieser Zeit warst du weiß der Henker wo.«
»Zu deiner Information! Ich war auf einer Kneipentour in Hollywood. Bin den Hollywoodboulevard entlang spaziert, war in diversen Lokalen wie dem Asteroid und bin danach erneut spazieren gegangen.« Und ich hatte einen One-Night-Stand, setzte er gedanklich hinzu.
Er hatte eine hübsche Frau abgeschleppt, war mit ihr im Bett.
Es war nicht das erste Mal, Zeb. J. Curwen tat so etwas oft. Doch jedes Mal, wenn er mit einer Frau im Bett war, überkam ihm nach dem Sex ein Gefühl der Leere, der Trostlosigkeit. Es war nur Sex, pure Lust, nicht mehr nicht weniger. Echte Gefühle zu einer Frau, sprich Liebe, hatte er seit Jahren nicht mehr empfunden. Er war innerlich kalt.
Dieses Gefühl der Düsterkeit, Trostlosigkeit, es marterte ihn seitdem Krieg herrschte. Und je länger der Krieg andauerte, umso schlimmer wurde es. Dieser gottverdammte Krieg hatte eine tiefe Wunde in seine Seele geschlagen. Eine Wunde, die er nicht zu erkennen gab. Nach außen hin wirkte er stets locker, fröhlich – unerschütterlich. Eine Maske, die er nicht ewig aufrechterhalten konnte. Irgendwann wird die Wahrheit ans Licht kommen.
Das tragische Schicksal der WAYFARER UNDER STARS hatte seinen Schmerz verstärkt, so als hätte jemand Salz in eine offene Wunde gestreut.
»Ich habe Zerstreuung gesucht und Langeweile gefunden«, setzte er hinzu. »Das Asteroid war die totale Pleite. Normalerweise ist es ein beliebter Treffpunkt für Space Navy-Offiziere, doch gestern hatte ich das Gefühl, der Einzige dort zu sein. Kein Wunder, die anderen sind alle im All, nur ich sitze zu Hause herum.« Er lachte bitter. »Ich höre mich schon wie ein altes Jammerweib an, nicht wahr?«
»Ach! So schlimm ist es nicht«, hielt seine Mutter dagegen. Ein Schmunzeln zog sich über ihre Lippen.
Curwen überflog den Artikel über die Kapitulation der Taan-Shanarr, meinte dann: »Diese Nachricht ist die Beste, die ich in letzter Zeit gehört habe, könnte das doch bedeuten, dass der Krieg bald ein Ende findet. Ohne die Taan-Shanarr sind die Kehhl’daaraner noch verwundbarer als es ohnehin der Fall ist.«
»Reden wir nicht mehr über diesen schrecklichen Krieg, trink lieber deinen Kaffee. Du siehst aus, als hättest du ihn bitter nötig. Wenn du ihn noch länger stehen lässt, wird er zudem kalt.«
Damit hatte Curwens Mutter wieder einmal recht, den Kaffee hatte er wahrlich nötig. Er war hundemüde. Das kam davon, wenn man bis zwei Uhr morgens unterwegs war und am nächsten Tag um halb sechs wieder aus dem Bett hüpft, dadurch war man kaum ausgeschlafen.
Warum war er eigentlich so früh aufgestanden? Im Urlaub konnte er an sich so lang schlafen, wie er wollte. War wohl dumme Gewohnheit. An Bord eines Space Navy Schiffes herrschte Dreischichtbetrieb, Curwen hatte auf der WAYFARER UNDER STARS stets die Erste übernommen, sich um neun Uhr abends schlafen gelegt. Das war seine tägliche Routine an Bord der WAYFARER UNDER STARS, schon seit Jahren. Und deswegen hatte er es auch zu Hause so gehandhabt, er konnte gar nicht anders. Nur am gestrigen Abend, da hatte er sich nicht daran gehalten, da war er erst um drei Uhr morgens zu Bett gegangen und schon um halb sechs wieder wach. Diese grässlichen Albträume taten ihr Übriges, sie ließen ihn nicht ruhig schlafen. Totale Übermüdung war das Resultat.
»Wieso hast du eigentlich diese schreckliche Uniform angezogen? In dem einen Monat, seitdem du hier bist, hast du sie kein einziges Mal angezogen, wieso ausgerechnet heute?«
»Ich wollte nur wissen, ob sie noch passt«, entgegnete Curwen und klopfte sich auf den Bauch. »Im letzten Monat habe ich offenbar an manchen Stellen zugelegt.«
Seine Mutter gab ein Kichern von sich, verzog ihre Mundwinkel zu einem Grinsen: »Es wird wohl Zeit, dass du wieder in den Weltraum zurückkehrst, sonst gehst du mir hier noch in die Breite.«
Curwen nahm einen kräftigen Schluck von seinem Kaffee zu sich.
Er mochte den Geschmack von echtem Kaffee, den seine Mutter dem Synthetischen vorzog. Es ging eben nichts über Natürlichkeit.
In der Space Navy gab es nur künstlichen Kaffee, dort waren alle Lebensmittel synthetisch. Echte Lebensmittel brauchten Platz, den es auf Raumschiffen der Space Navy oft nicht gab, weshalb man auf längeren Missionen künstliche Lebensmittel in Konzentratform mitnahm. Zudem konnte nur so gewährleistet werden, dass ein Raumschiff mindestens sechs Monate ununterbrochen in Einsatz sein konnte.
Frisches echtes Essen, einer der Vorzüge des zivilen Lebens. Viele Kollegen konnten ihn für diesen einmonatigen Landurlaub nur beneiden, doch er fühlte sich nicht beneidenswert, eher wie ein abgelegtes Kleidungsstück.
Zum Teufel doch mal! Er wollte wieder in den aktiven Dienst zurück. So verlockend das bürgerliche Leben auch sein möge, es war letztendlich nichts für ihn, er war ein Curwen und folglich befand sich sein Platz im Weltraum.
»Eine Nachricht für Captain Curwen!«, schallte es plötzlich durch den Raum. Es war die elektronische Stimme des Smart-Home-Assistent – ein Computer, der alle Funktionen im Haus steuerte.
»Stell sie durch«, befahl Curwen. Er fragte sich zugleich, wer ihn sprechen wollte.
Eine blank polierte Platte in der Mitte des Esstisches begann zu leuchten. Ein Lichtstrahl schoss heraus, fächerte sich zu einem Trichter auf. In seinem Zentrum formte sich das holografische Abbild eines hochrangigen Offiziers der Space Navy: Vizegroßadmiral William Chaykin! Er war die Nummer Zwei in der Flottenhierarchie nach Großadmiral Calandria Luengo und zudem der Befehlshaber der Terran Defense Force.
Chaykin war klein von Statur, jedoch mit voluminösem Körperbau gesegnet. Anders gesagt, kurz und dick. Es war jedoch nicht klug, einem Vizegroßadmiral so etwas zu sagen.
Seine Haare hatten einen pechschwarzen Farbton, sprossen spärlich auf seinem Kopf, über dem Nacken zeigte sich eine kahle Stelle. Zu guter Letzt war da noch ein scheußlicher Schnauzbart, der sich an den Enden nach oben kringelte. Dieser Schnauzer stellte eine modische Katastrophe dar, denn Schnauzbärte waren so was von out. So groteske wie der des Vizegroßadmirals erst recht, er sah damit aus wie ein alter preußischer Offizier. Diesem komischen Ding in Chaykins Gesicht sollte man mit einem Rasierer zu Leibe rücken. Doch das konnte man Chaykin nicht nahe legen. Der würde sich tierisch aufregen und demjenigen, der es gewagt hatte, so etwas zu sagen, derart flink auf einen abgelegenen Eismond Strafversetzen, dass der Unglückliche dort festsitzt, bevor ihm bewusst wurde, was geschehen war. Chaykin stand im Ruf, ein herrisches Naturell zu besitzen, weshalb es ratsam war, ihm nicht zu widersprechen.
Wenn Chaykin Curwen sprechen wollte, war es wohl wichtig, das Warten hatte ein Ende. Das hoffte Curwen zumindest.
»Captain!!«, krähte das Hologramm, das nicht größer war als zwanzig Zentimeter.
Bei einer Holo-Com Verbindung war es nicht üblich, den anderen Gesprächsteilnehmer in Lebensgröße darzustellen, meistens begnügte man sich mit einem verkleinerten Abbild oder man projizierte nur Kopf und Schulter. Curwen verglich es mit einem Liliputaner aus Gullivers Reisen.
Der Bonsai-Chaykin war drollig anzusehen. In dieser Größe war ihm der alte Leuteschinder durchaus sympathisch. Ein Gekicher entkam seinem Mund.
»Was gibt es zu lachen?«, fauchte das Hologramm sauertöpfisch.
»Ihr holografisches Ebenbild ist sehr klein geraten. Sieht so aus, als wäre es eingelaufen. Kann es sein, dass Sie es zu heiß gewaschen haben?«, ließ sich Curwen zu einem Scherz hinreißen.
Der Vizegroßadmiral konnte über den Witz überhaupt nicht lachen, seine Miene blieb todernst. »Echt spaßig! Ich erwarte Sie umgehend im Hauptquartier!«
»Um was geht es?«
»Das kann ich Ihnen im Moment nicht sagen, es geht hier um einen Geheimauftrag von aller größter Wichtigkeit. Die Details erfahren Sie von mir persönlich. Die Sache ist zu brisant, um sie über Holo-Com zu besprechen. Also bewegen Sie Ihren Arsch so schnell wie möglich nach New Newyork.«
Das Hologramm entschwand derart schnell, dass Curwen keine Möglichkeit bekam, »Ja Sir!« zu sagen.
Roxanne lächelte ihren Sohn an. »Wie es aussieht, bist du wieder im Dienst. Ich hoffe, dass du jetzt glücklich bist.«
»Das bin ich Mom«, gab Curwen zur Antwort. »Kann ich mir deinen Gleiter ausleihen? Mit ihm komme ich am schnellsten nach N.N.Y.«
»Und wie bekomme ich ihn wieder zurück?«
»Keine Sorge! Ich werde jemanden beauftragen, den Gleiter zurückzubringen. Ich weiß nur allzu gut, dass du an ihm hängst, schließlich hat er Vater gehört.«
»Nun gut. Nimm ihn, bevor ich es mir anders überlege.«
Curwen erhob sich, umrundete den Esstisch, ging hinüber zu der Seite, an der seine Mutter saß, gab ihr einen dicken Kuss auf die Wange. »Du bist die Beste!«, flüsterte er ihr zu, machte sich daraufhin auf den Weg. Wie gut, dass er heute Morgen seine Uniform angezogen hatte, das sparte ihm eine Menge Zeit.
Das Esszimmer hatte er bereits hinter sich gelassen, befand sich nun auf dem Flur, direkt vor der Haustür, als seine Mutter ihm nachrief: »Bitte sei vorsichtig!«
»Keine Sorge, das werde ich. Wie immer. Mir wird nichts geschehen. Das verspreche ich.«