
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
*** Ausgezeichnet mit dem Leipziger Lesekompass 2021 *** Der spannende Auftakt einer neuen Agenten-Serie à la Spy Kids – rasant, riskant und richtig gut! Der 12-jährigen Sara drohen mehrere Jahre Jugendhaft. Dabei hat sie das System der New Yorker Justizbehörde doch nur gehackt, um ihre kriminellen Pflegeeltern zu entlarven! Doch dann bietet ihr der mysteriöse Agent »Mother« einen Ausweg an: Sie soll bei den »City Spies« einsteigen, einem Team von fünf Kindern aus aller Welt, die ein schottisches Internat besuchen, in Wahrheit aber für den britischen MI6 arbeiten. Sara sagt Ja – und landet mitten in einer heiklen Mission: Eine geheime Organisation und ein fieser Plan gefährden den Jugendumweltgipfel in Paris. Der erste Band der temporeichen Spionage-Serie schaffte es aus dem Stand auf die New-York-Times-Bestsellerliste – fünf smarte Kids und jede Menge Action! »Eine rasante Geschichte, spannend, witzig und mit knackigen Dialogen.« Booklist Alle Bände der Serie: City Spies – Gefährlicher Auftrag (Band 1) City Spies – Tödliche Jagd (Band 2) City Spies – Gewagtes Spiel (Band 3) City Spies – Geheime Mission (Band 4)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
James Ponti: City Spies – Gefährlicher Auftrag
Aus dem Englischen von Wolfram Ströle
Der 12-jährigen Sara drohen mehrere Jahre Jugendhaft. Dabei hat sie das System der New Yorker Justizbehörde doch nur gehackt, um ihre kriminellen Pflegeeltern zu entlarven! Doch dann bietet ihr der mysteriöse Agent »Mother« einen Ausweg an: Sie soll bei den »City Spies« einsteigen, einem Team von fünf Kindern aus aller Welt, die ein schottisches Internat besuchen, in Wahrheit aber für den britischen MI6 arbeiten. Sara sagt Ja – und landet mitten in einer heiklen Mission: Eine geheime Organisation und ein tödlicher Plan gefährden den Jugendumweltgipfel in Paris.
Band 1 der spannenden neuen Agenten-Serie: rasant, riskant und richtig gut!
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Geheimakten
Danksagung
Viten
Das könnte dir auch gefallen
Leseprobe
Für Denise: meine Frau, beste Freundin und Komplizin
1.
EIN MANN NAMENS MOTHER
Sara betrachtete den Wasserfleck an der Wand und stellte sich vor, er sei eine Insel, vielleicht weil er tatsächlich so aussah. Oder aber weil sie sich so verzweifelt auf ein tropisches Paradies wünschte, weit weg von Brooklyn und dem kleinen Zimmer im siebten Stock des Familiengerichts von Kings County.
Sie saß am Tisch ihrem Pflichtverteidiger gegenüber, einem bulligen Mann in einem zerknitterten Anzug. Randall Stubbs, so hieß er, hatte sich über ihre Akte gebeugt und blätterte sie durch. »Sieht nicht gut aus«, brummte er. Offenbar lernten Anwälte im Studium, Gemeinplätze von sich zu geben. »Du kannst von Glück sagen, dass sie dir ein so großzügiges Angebot gemacht haben.«
»Ach ja?«, fragte Sara überrascht. »Was für eins denn?«
Randall Stubbs blickte von der Akte auf. »Du bekennst dich in allen Punkten schuldig und bekommst zweieinhalb Jahre Jugendarrest.«
Zweieinhalb Jahre Knast kamen Sara zwar nicht großzügig vor, aber dort war es vermutlich auch nicht viel schlimmer als bei ihren letzten Pflegefamilien. Für eine Zwölfjährige war sie ziemlich tough. Mit so was kam sie klar.
»Und natürlich hast du strengstes Computerverbot«, fügte der Anwalt hinzu.
Das war allerdings unannehmbar.
»Wie lange denn?«
»Für die Dauer deiner Strafe. Vielleicht auch noch länger, als Bedingung für deine Entlassung. Das entscheidet der Richter.«
»Aber ich habe mich doch nur …«
»Was?«, fiel er ihr ins Wort. »In das Computernetz sämtlicher Behörden der Jugendstrafjustiz von New York eingehackt? Wolltest du das sagen? Ich finde, da passt das Wort ›nur‹ überhaupt nicht.«
»Ich weiß, aber ich wollte doch …«
»Was du wolltest, spielt keine Rolle. Entscheidend ist, was du getan hast. Du kannst von Glück sagen, dass du erst zwölf bist. Wenn du dreizehn wärst, hätte man deinen Fall wahrscheinlich an ein höheres Gericht verwiesen, um ein Exempel zu statuieren.«
Sara erschrak und bereute zum ersten Mal, was sie getan hatte. Nicht weil sie damit gegen das Gesetz verstoßen hatte. Ob legal oder nicht, sie war überzeugt, dass sie richtig gehandelt hatte. Aber sie hätte nie damit gerechnet, dass man sie von dem einzigen Platz auf der ganzen Welt verbannen könnte, der ihr sinnvoll erschien und an dem sie sich zu Hause fühlte. Und das war der Platz vor einer Computertastatur.
»Ich werde nie wieder etwas hacken«, sagte sie. »Versprochen.«
»Ach, versprochen?«, erwiderte Stubbs sarkastisch. »Vielleicht kannst du dem Richter ja dein großes Indianerehrenwort geben. Dann sind bestimmt alle glücklich.«
Es fiel Sara schwer, sich zu beherrschen, wenn sie wütend war. Zahlreiche Betreuer und mindestens zwei Schulpsychologen konnten das bestätigen. Trotzdem versuchte sie jetzt ruhig zu bleiben, während sie den Mann ansah, der ihr doch eigentlich helfen sollte. Sie durfte ihn nicht verärgern, er war ihre einzige Hoffnung auf einen guten Ausgang. Also holte sie tief Luft und zählte bis zehn, wie ihr eine Betreuerin einmal geraten hatte, deren Namen sie schon längst wieder vergessen hatte.
»Aber man kann mir doch nicht Computer verbieten«, sagte sie und die Verzweiflung war ihr deutlich anzuhören. »Ich kann doch sonst nichts. Computer sind meine Spezialität.«
»Tja, das hättest du dir überlegen sollen, bevor …«
Sara wäre vermutlich genau jetzt ausgerastet, wäre nicht im selben Augenblick die Tür aufgegangen und ein Mann eingetreten, der in jeder Beziehung das genaue Gegenteil ihres Anwalts war.
Er war groß und schlank und hatte einen wilden Schopf schwarzer Haare. Sein Anzug war makellos, mit zur Krawatte passendem Einstecktuch. Und er sprach mit einem britischen Akzent.
»Tut mir leid, wenn ich störe«, sagte er höflich. »Aber ich glaube, Sie sitzen auf meinem Platz.«
»Da haben Sie sich im Zimmer geirrt«, knurrte Stubbs. »Und wenn ich jetzt bitten darf – ich bin mitten in einer Besprechung mit meiner Mandantin.«
»Nur dass sie laut diesem Dokument ab sofort meine Mandantin ist«, erwiderte der Mann und zeigte Stubbs ein Schriftstück. Sara musste unwillkürlich lächeln.
Stubbs beäugte ihn misstrauisch. »Das verstehe ich nicht. Das Mädchen kann sich doch keinen schnieken Anwalt wie Sie leisten. Sie hat kein Geld.«
»Natürlich nicht. Sie ist zwölf. Zwölfjährige haben kein Geld. Sie haben Fahrräder und Rucksäcke. Aber diese Zwölfjährige hat zufällig auch einen Anwalt. Auf diesem Papier steht, dass ich beauftragt bin, Ms Sara Maria Martinez zu vertreten.« Er wandte sich an Sara und lächelte. »Bist du das?«
»Ja, Sir.«
»Ausgezeichnet. Das heißt, dass ich hier richtig bin.«
»Wer hat Sie denn beauftragt?«, fragte der Pflichtverteidiger.
»Eine interessierte Partei«, sagte der Mann. »Alles Weitere geht Sie nichts an. Wenn Sie jetzt also bitte gehen würden, Sara und ich haben eine Menge zu besprechen. Wir müssen in Kürze vor einem Richter erscheinen.«
Stubbs brummte etwas in sich hinein und stopfte seine Unterlagen in eine Aktentasche. »Ich werde das überprüfen.«
»Es gibt da eine reizende Dame namens Valerie, die Ihnen dabei behilflich sein kann«, sagte der Brite. »Sie finden sie beim Urkundenbeamten der Geschäftsstelle im sechsten Stock.«
»Ich weiß schon, wo ich sie finde«, erwiderte Stubbs barsch und drängte an ihm vorbei nach draußen. Er wollte noch etwas sagen, schnaubte dann aber nur und entfernte sich.
Als er weg war, schloss der neue Anwalt die Tür und setzte sich Sara gegenüber. »Erstaunlich«, sagte er verwundert. »Der war ja richtiggehend beleidigt.«
Sara hatte zwar keine Ahnung, wer einen Anwalt für sie engagiert haben sollte, aber sie war mit dem Wechsel sehr zufrieden. »Das Gefühl hatte ich auch.«
»Aber jetzt verrate mir eins«, sagte der Anwalt und ließ die Verschlüsse seiner Aktentasche aufschnappen. »Stimmt das wirklich? Dass du dich in das Computersystem der Jugendstrafjustiz dieser Stadt eingehackt hast?«
Sara zögerte.
»Hab keine Angst. Aufgrund des Anwaltsgeheimnisses darf ich an niemanden weitergeben, was du hier drinnen sagst. Ich muss nur wissen, ob es stimmt.«
Sie nickte kaum merklich. »Ja, schon.«
»Ausgezeichnet«, sagte er mit einem Augenzwinkern. Er holte einen kleinen Laptop aus seiner Aktentasche und schob ihn über den Tisch. »Dann tu das bitte jetzt noch mal.«
»Was soll ich?«, fragte Sara.
»Dich in diese Justizdatenbank einhacken. Du musst mich zu deinem bevollmächtigten Anwalt machen, bevor Mr Stubbs das im sechsten Stock überprüft.«
»Heißt das, Sie sind gar nicht mein Anwalt?«, fragte sie.
»Habe nie eine juristische Fakultät betreten«, sagte er verschwörerisch. »Also hopphopp. Eine Mitarbeiterin von mir wird Mr Stubbs im Flur aufhalten, aber das kann sie nicht ewig.«
Sara schwirrte der Kopf und sie wusste nicht, was sie denken sollte. »Hören Sie, ich kenne Sie nicht. Aber das Gericht muss mir doch einen Anwalt zur Verfügung stellen. Also, einen richtigen.«
»Ja, und das war der Typ mit dem Senffleck auf der Krawatte.« Der Mann schüttelte den Kopf. »Ich weiß ja nicht, wie du darüber denkst, aber ich fand ihn nicht sonderlich beeindruckend. Dieses Gericht hier hat dich außerdem in den vergangenen neun Jahren in sechs Pflegefamilien und neun Schulen vermittelt. Die haben also nicht gerade tolle Arbeit geleistet. Das war Pfusch von vorn bis hinten. Was meinst du, sollen wir nicht mal was Neues ausprobieren?«
Sara sah ihn an und dann den Computer. Sie war versucht, auf seinen Vorschlag einzugehen, aber auch verwirrt. »Also, ich glaube nicht …«
»Was sagte er denn, was passieren würde?«, fiel der Mann ihr ins Wort. »Ich wette, er hat schon einen Deal mit dem Staatsanwalt ausgehandelt.«
»Zweieinhalb Jahre Jugendknast und Computerverbot.«
Der Mann schüttelte den Kopf. »Das kriege ich sogar ohne Jurastudium besser hin.«
Aus Gründen, die sie selbst nicht ganz verstand, glaubte Sara ihm. Vielleicht war es ja nur Wunschdenken. Oder Verzweiflung. Jedenfalls vertraute sie auf ihr Bauchgefühl und begann zu tippen.
»Wunderbar«, sagte er. »Du wirst es vermutlich nicht bereuen.«
»Vermutlich?« Sie zog die Augenbrauen hoch. »Sollten Sie mir nicht Mut machen?«
»Nur Dummköpfe und Lügner behaupten, etwas, auf das sie keinen Einfluss haben, würde mit Sicherheit eintreten«, erwiderte er. »Aber ich bin optimistisch und schätze deine Chancen auf … siebenundachtzig Prozent.«
Sara lächelte und tippte weiter. »Was ist das für ein Laptop?«
»Ein maßgeschneiderter«, sagte er.
»Ich dachte, das geht nur bei Anzügen.«
»Auch ein Computer sollte bestmöglich passen. Der hier ist eine Spezialanfertigung.«
»Jemand hat diesen Computer für Sie gebaut?«
Er nickte.
»Also, wer immer das war, er versteht jedenfalls was davon.«
»Warte, bis du erst den großen siehst«, sagte der Mann. »Du wirst ihn lieben. Das heißt, wenn wir bis dahin nicht beide hinter Gittern sitzen.«
Sara kannte sich mit Computern aus, aber mit so einem hatte sie noch nie zu tun gehabt. Er war schnell und leistungsstark und sie brach mühelos durch die Firewall, die die Datenbank der Jugendstrafjustiz schützen sollte.
»Die haben nicht mal das Schlupfloch dicht gemacht, durch das ich reingekommen bin«, sagte sie ungläubig.
»Die Mühlen der Behörden mahlen langsam«, sagte der Mann. »Schwergewichtige Anwälte hoffentlich auch.«
In weniger als zwei Minuten war Sara in der Datei der Pflichtverteidiger angelangt. Vergnügt löschte sie den Eintrag für Randall Stubbs. »Wie heißen Sie?«
»Ausgezeichnete Frage«, sagte der Mann und zog drei Pässe aus seiner Aktentasche. »Was klingt am besten?«
Er las den ersten vor. »Croydon St. Vincent Marlborough der Dritte.« Er verzog das Gesicht. »Fast ein wenig übertrieben, was meinst du?«
Sie nickte. »Schon.«
»Dann nehmen wir den nicht.« Er las den nächsten vor. »Nigel Honeybuns.« Er musste kichern. »Honeybuns? Gefällt mir.« Er steckte ihn in ein Fach seiner Aktentasche. »Ich glaube, den bewahre ich für ein anderes Mal auf.«
»Wir sollten uns doch beeilen«, erinnerte Sara ihn.
»Ach ja, richtig, also dann.« Er las den letzten vor. »Gerald Anderson. Klingt wie ein richtiger Anwaltsname. So langweilig, dass man ihn gleich wieder vergisst. Und genau das wollen wir. Dann heiße ich so, Gerald Anderson.«
Er gab ihr den Pass, damit Sara den Namen abtippen und in die Datenbank eingeben konnte.
»Ich klicke eben noch auf ›update‹«, sagte sie anschließend, »dann ist alles klar.«
Der Mann lächelte ein wenig nervös und lauschte stumm. »Keine Alarmsirene.« Er öffnete die Tür und steckte den Kopf nach draußen. »Es kommt auch niemand gerannt, um uns zu verhaften. Gut gemacht, Sara.«
»Nur dass ich jetzt einen Anwalt habe, der eigentlich keiner ist.«
»Ich habe im Fernsehen eine Menge Gerichtsfilme gesehen«, sagte er. »Ich weiß, wie man vor einem Richter auftritt.«
»Sie meinen, vermutlich«, erwiderte Sara.
Er lächelte. »Richtig … vermutlich. Aber davor möchte ich von dir noch Genaueres über deinen Hack wissen.«
»Das steht doch bestimmt alles da drin«, sagte sie und zeigte auf die Akte.
»Da steht nur, was du getan hast«, erwiderte er. »Ich will wissen, aus welchem Grund.«
»Der Anwalt, also der, der das wirklich studiert hat, meinte, der Grund spiele keine Rolle.«
»Vielleicht nicht für ihn. Vielleicht auch nicht einmal für den Richter. Aber für mich spielt er eine große Rolle.«
Sara musste kurz überlegen, was sie antworten sollte. Es sollte möglichst sachlich klingen. Auf keinen Fall wollte sie sich aufregen. Sie hasste es, vor anderen Gefühle zu zeigen. »Meine letzten Pflegeeltern …«
»Leonard und Deborah Clark?«
»Ja, genau die.« Sie schnaubte. »Die nehmen mehr Kinder, als sie bei sich unterbringen können, weil der Staat sie pro Kind bezahlt. Mehr Kinder heißt mehr Geld, egal ob sie es für uns ausgeben oder nicht. Das überprüft eigentlich niemand. Wir wurden in Zimmer gesteckt, die viel zu klein waren. Und statt jedem eine Portion Essen aufzutun, wurden die Schüsseln einfach in die Mitte des Tischs gestellt, damit es nach mehr aussah, als es in Wirklichkeit war. Das hieß dann ›Familienessen‹, was ein Witz ist, weil wir überhaupt nicht wie eine Familie behandelt wurden. Vor ungefähr einem Monat kam ein Junge namens Gabriel neu zu uns. Er hatte Angst und war traurig und fühlte sich einsam. Genau das, was man von einem Fünfjährigen erwarten würde. Mich mochte er, weil wir die einzigen beiden Latinos im Haus waren.«
»Du hast spanisch mit ihm gesprochen?«
»Manchmal. Bis es uns verboten wurde. ›Gewöhnt euch gefälligst dran, englisch zu sprechen‹, sagte Mr Clark, ›weil ihr seid jetzt in Amerika.‹«
Der Anwalt schüttelte den Kopf. »Und was hast du ihm geantwortet?«
»Ich habe gesagt, dass Puerto Rico doch auch schon zu Amerika gehört, dass ich fast mein ganzes Leben in Brooklyn verbracht habe und dass er erst mal selber lernen sollte, gutes Englisch zu sprechen.«
Der Mann lachte. »Frech.«
»Keine Ahnung, aber er ist rot angelaufen, also hat es seinen Zweck erfüllt.«
»Hat er dich bestraft?«
Sara nickte, wieder ernst. »Aber mir haben seine Strafen nichts ausgemacht. Gabriel dagegen schon.«
»Wofür wurde er bestraft?«
Sara schwieg und der Mann betrachtete sie forschend. Er wollte ihre Augen sehen, wenn sie sprach.
»Er hat einmal nachts ins Bett gemacht«, sagte sie schließlich. »Als Strafe haben die Clarks ihn in den Flurschrank gesperrt. Ich konnte ihn weinen hören. Denen war das egal. Sie hätten ihn die ganze Nacht weinen lassen. Also stand ich auf und ließ ihn raus.«
»Was passierte dann?«
»Dann sperrten sie mich zusammen mit ihm in den Schrank. Ich sollte lernen, mich zu benehmen. Also habe ich das Schloss von innen geknackt und uns rausgelassen.« Den Tränen nah, verstummte sie einen Moment.
»Und dann?«
»Dann sperrten sie uns auf dem Dach aus. Wir mussten die ganze Nacht draußen bleiben. Es war kalt und schrecklich. Als ich am nächsten Morgen in die Schule kam, holte ich mir eine Erlaubnis für den Computerraum und machte mich an die Arbeit. Zuerst hackte ich die Datenbank der Jugendbehörden, um nachzusehen, wie viele Kinder man schon zu den Clarks geschickt hatte. Dann hackte ich das Bankkonto der Clarks, um zu erfahren, wie viel Geld sie bekamen und wofür sie es in Wirklichkeit ausgaben.«
»Von dem Bankkonto steht in der Anklage nichts«, sagte der Mann und blätterte durch ein paar Seiten.
Sara grinste. »Nein, die Bank hat die Anzeige zurückgezogen. Sonst würde ja die ganze Welt erfahren, dass ein zwölfjähriges Mädchen ihr Sicherheitssystem geknackt hat.«
»Herrlich«, sagte der Mann. »Das kann ich vielleicht später noch gebrauchen. Was hast du mit den Informationen gemacht?«
»Ich habe alles meiner Sozialarbeiterin geschickt. Und wissen Sie, wie blöd ich bin? Als die Polizisten bei uns klingelten, dachte ich, sie würden die beiden Clarks verhaften. Ungefähr fünfundvierzig Sekunden lang war ich richtig froh.«
»Aber stattdessen haben sie dich verhaftet?«
Sara nickte.
»Die anderen Kinder mussten sogar auf die Veranda kommen und zusehen, wie ich in Handschellen abgeführt wurde.« Sie kniff die Augen zu, fest entschlossen, keine einzige Träne zu vergießen. »Die Clarks sagten nur, das ist, was Kriminellen eben blüht.«
Der Mann hatte das alles schon am Vorabend über eine Wanze mitgehört, aber er ließ sich solche Geschichten gerne ein zweites Mal erzählen. Er wollte wissen, ob sie sich veränderten. Das war immer ein guter Hinweis auf ihren Wahrheitsgehalt. Außerdem sagte ihm das Gesicht, das Sara beim Erzählen machte, alles, was er wissen musste.
»Du hattest also genug gute Gründe für das, was du getan hast«, fasste er zusammen. »Damit kann ich arbeiten. Damit kann ich viel für dich herausholen.«
»Vermutlich, meinen Sie doch bestimmt.«
Er grinste. »Nein, diesmal weiß ich es sicher. Du musst dafür allerdings etwas sehr Schwieriges tun. Etwas, zu dem du laut den Berichten in deiner Akte vollkommen unfähig bist.«
»Was denn?«, fragte sie.
»Du musst mir vertrauen. Egal was ich sage oder tue, du musst mir vertrauen.«
»Wie kann ich das?«, fragte sie. »Ich kenne nicht mal Ihren Namen.«
»Klar kennst du den. Ich heiße Nigel Honeybuns. Und Gerald Anderson. Und manchmal sogar Croydon St. Vincent Marlborough der Dritte. Es hängt alles von den Umständen ab.« Er zuckte mit den Schultern. »Aber meine Freunde und Kollegen, und ich hoffe doch, dass du dich demnächst auch dazu zählst, nennen mich Mother.«
Zum ersten Mal seit ihrer Verhaftung musste Sara lachen.
»Mother? Das ist aber ein ungewöhnlicher Name für einen Mann.«
»Stimmt«, sagte er und lächelte sie an. »Aber ich bin auch ein ungewöhnlicher Mann, findest du nicht?«
2.
CRUNCHEM HALL
Was in Saras Akte stand, stimmte. Sie traute anderen Menschen nicht. Vor allem nicht Erwachsenen. Gerechterweise muss man sagen, dass sie ihr auch nicht viele Anlass dazu gegeben hatten. Sie war einigen netten Lehrern begegnet. Und hatte zwei gute Pflegefamilien gehabt. Aber das war schon alles gewesen. Als sie jetzt in einer Zelle darauf wartete, in den Gerichtssaal gerufen zu werden, kamen ihr Bedenken, ob sie einem Mann vertrauen sollte, der sich Mother nannte und in seiner Aktentasche mindestens drei falsche Pässe aufbewahrte.
»He, du, kannst du mir was borgen? Du hast doch Geld.«
In der Zelle befanden sich außer Sara nur noch drei andere Mädchen, aber sie brauchte trotzdem kurz, bis ihr klar wurde, dass sie gemeint war. Sie musste fast lachen, so absurd war die Frage.
»Ich habe kein Geld.«
Sie saßen sich auf blauen Holzbänken gegenüber, nur einen guten Meter voneinander entfernt. Das andere Mädchen, das älter war und viel größer, lehnte sich vor.
»Ich hab deinen Anwalt gesehen«, sagte sie. »Glänzender Anzug, teure Schuhe. Du musst Geld haben, wenn du dir so einen Anwalt leisten kannst. Vielleicht kann ja auch er mir was geben. Oder ich passe auf dich auf. Damit dir im Jugendknast nichts passiert. Das kostet deine Familie nicht viel.«
»Lass sie in Ruhe.«
Die Warnung kam vollkommen überraschend von einem Mädchen namens Emily, das in der vorangegangenen Nacht die Zelle mit Sara geteilt hatte. Ihren perfekt manikürten Fingernägeln nach zu schließen, war sie im Kosmetiksalon mehr zu Hause als in einer Gefängniszelle. Sie hatte Sara erzählt, sie sei wegen Ladendiebstahls verhaftet worden und ihre Mutter habe sie die Nacht hinter Gittern verbringen lassen, um ihr eine Lektion zu erteilen.
»Mit dir redet keiner, Prinzessin«, sagte das erste Mädchen.
»Wenn Sara jemanden braucht, der auf sie aufpasst, dann mache ich das«, erwiderte Emily. »Also danke, aber wir brauchen dich nicht.«
Das erste Mädchen stand drohend auf. Ihre Aufmerksamkeit galt jetzt ausschließlich Emily. »Wie willst du denn jemanden beschützen?«
»Wirklich, Leute«, versuchte Sara zu beschwichtigen. »Das ist alles ein Missverständnis. Ich habe kein Geld. Und ich brauche niemanden, der mich beschützt.«
Emily beachtete sie nicht, sondern stand ebenfalls auf und starrte das andere Mädchen an. »Nur mit denen da«, sagte sie und streckte ihre Daumen.
»Was? Willst du mit dem Handy, das du geklaut hast, jemanden herzaubern?«
»Nein«, erwiderte Emily ruhig. »Ich mach einfach das.« Und blitzschnell stieß sie die Daumen seitlich tief in den Brustkorb des größeren Mädchens. Das Mädchen schnappte nach Luft und taumelte rückwärts. Starr vor Staunen sah Sara zu, wie Emily sie packte, damit sie nicht fiel, und ihr dann half, sich wieder zu setzen.
»Es tut eine Weile weh und gibt vielleicht blaue Flecken, aber du bist nicht ernsthaft verletzt«, sagte Emily leise. »Aber ich kann dir nicht versprechen, dass ich mich nächstes Mal auch so zurückhalte, also überleg es dir lieber, bevor du wieder jemandem drohst.«
Sara saß immer noch wie betäubt da, als ein Wärter an die Tür kam.
»Martinez, Sara«, rief er.
Sie war so abgelenkt, dass sie ihn nicht hörte.
»Martinez, Sara«, wiederholte er.
»Das bin ich.«
»Mitkommen«, sagte er und schloss die Zellentür auf.
Sara blickte zu Emily hinüber und die sagte: »Viel Glück bei der Verhandlung.«
»Danke.« Sara stand auf und wandte sich zum Gehen. Mit einem Kopfnicken wies sie auf das Mädchen, das immer noch heftig schnaufte. »Und auch dafür danke.«
Emily lächelte. »Was tut man nicht alles für seine Zellenschwester.«
Sara folgte dem Wärter in den Gerichtssaal und setzte sich neben Mother an den Angeklagtentisch. In Gedanken war sie noch bei dem, was zwischen den beiden Mädchen passiert war.
»Alles in Ordnung?«, fragte Mother, als er ihr Gesicht sah.
»Ja«, sagte sie. »Alles bestens.«
»Gut, weil ich deine volle Aufmerksamkeit brauche. Und vergiss bitte nicht, was ich über das Vertrauen gesagt habe.«
Sie wusste nach wie vor nicht, was sie von ihm halten sollte, aber jetzt war auch keine Zeit mehr, darüber nachzudenken. Der Gerichtsdiener kündigte bereits die Ankunft des Richters an.
»Erheben Sie sich für Seine Ehren, Richter Lyman J. Pancake. Die Verhandlung ist eröffnet.«
Mother grinste. »Pancake? Vielleicht hätte ich doch Honeybuns wählen sollen. Zusammen wären wir ein richtiges Frühstücksbuffet gewesen.«
Sara lachte nicht. Sie war nicht zu Scherzen aufgelegt.
Das galt auch für Richter Lyman J. Pancake.
Er mochte einen lustigen Namen haben, schien ansonsten aber keinerlei Humor zu besitzen. Vielleicht hatte er sich ja sein ganzes Leben lang Pfannkuchen-Witze anhören müssen und seine Gutmütigkeit war erschöpft. Seinen Gesichtsausdruck konnte man am zutreffendsten als angesäuert beschreiben, als hätte er gerade Zitronenlimonade ohne Zucker getrunken. Die wenigen Haare, die er noch hatte, bildeten einen Halbkreis weißer Borsten rund um seinen Hinterkopf. Nach einigen Formalitäten fragte er: »Auf was plädiert die Angeklagte?«
Mother blickte nur kurz von seiner Aktentasche auf. »Schuldig, Euer Ehren.«
Sara wusste, dass sie schuldig war, hatte aber geglaubt, sie würden erst noch verhandeln, bevor sie das zugaben. Soweit sie das vom Fernsehen kannte, behaupteten Schuldige normalerweise erst einmal, sie seien unschuldig.
Der Richter wandte sich an die Staatsanwältin. »Gibt es eine Verfahrensabsprache, Ms Adams?«
Die Staatsanwältin war groß gewachsen und hager und hatte kurze, blonde Haare. Ihrem jugendlichen Gesicht nach zu schließen, hatte sie ihre Ausbildung erst vor wenigen Jahren abgeschlossen und ihrem erleichterten Lächeln nach war sie froh, vielleicht auch ein wenig überrascht, dass die Angeklagte auf schuldig plädierte.
»Nein, Euer Ehren«, antwortete sie. »Ich hatte ein Vorgespräch mit dem ursprünglichen Anwalt von Ms Martinez, aber es kam noch zu keiner Verständigung.«
»Die wirkt richtig erleichtert«, flüsterte Sara nervös. »Ich glaube, Sie hätten nicht auf schuldig plädieren dürfen.«
»Stimmt das, Mr Anderson?«, fragte der Richter.
Statt zu antworten, blätterte Mother nur durch seine Papiere. Sara brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass er sich nicht angesprochen fühlte, weil er seinen falschen Namen nicht parat hatte.
»Stimmt das, Mr Anderson?«, wiederholte der Richter ein wenig lauter.
Sara stieß ihn an. »Sie sind doch Mr Anderson.«
»Ups«, flüsterte er zurück. »Ich sagte doch, dass man den Namen gleich wieder vergisst.« Er wandte sich an den Richter. »Stimmt was, Euer Ehren?«
»Dass Sie sich mit der Staatsanwaltschaft bisher nicht über das Verfahren verständigt haben?«
»Meines Wissens hat die Gegenseite eine Strafe von zweieinhalb Jahren Jugendarrest angeboten«, sagte Mother.
»Das war vielleicht als eine von mehreren Möglichkeiten im Gespräch«, bemerkte die Staatsanwältin mit einem selbstzufriedenen Lächeln. »Aber wie gesagt, eine offizielle Absprache gibt es nicht. Und jetzt, wo wir in öffentlicher Sitzung ein Schuldbekenntnis haben, bin ich nicht geneigt, sie so billig davonkommen zu lassen.«
Sara sackte in sich zusammen. Das war eine dramatische Entwicklung zum Schlechten.
»Kein Problem«, sagte Mother. »Denn wir finden das Angebot ebenfalls unbefriedigend.«
»Ich garantiere Ihnen, Sie werden kein besseres bekommen«, sagte die Staatsanwältin.
»Das will ich ja auch gar nicht. Ich will ein schlechteres.«
Jetzt war Sara völlig durcheinander.
»Entschuldigung, was?«, fragte der Richter.
»Zweieinhalb Jahre reichen nicht«, erklärte Mother. »Meine Mandantin hat hoch sichere Computerdateien gehackt. Darüber hinaus ist sie in das Finanzsystem einer multinationalen Bank eingedrungen – auch wenn Letzteres nicht zu den offiziellen Anklagepunkten gehört.«
»He«, protestierte Sara. »Wie war das mit dem Anwaltsgeheimnis?«
»Das würde nur gelten, wenn ich wirklich Anwalt wäre«, flüsterte er und wandte sich wieder an den Richter. »Euer Ehren, dies ist ein schwerwiegendes Vergehen, das mit mehr als zweieinhalb Jahren bestraft werden muss. Ich persönlich finde, meine Mandantin sollte unter staatliche Aufsicht gestellt werden, bis sie achtzehn ist.«
»Was reden Sie da?«, flüsterte Sara aufgeregt. »Das sind sechs Jahre.«
»Einen Moment, Euer Ehren«, sagte Mother mit erhobenem Finger. »Ich muss mich mit meiner Mandantin beraten.«
Er beugte sich über Saras Ohr. »So verrückt es klingt, das ist jetzt der Punkt, an dem du mir vertrauen musst.«
»Aber Sie verlangen eine härtere Strafe, als man uns angeboten hat«, sagte Sara. »Das ergibt doch keinen Sinn.«
»Es ergibt einen, wenn ich fertig bin. Gib mir noch anderthalb Minuten.« Er nahm seine Armbanduhr ab und hielt sie ihr hin. »Dann kannst du entscheiden.«
Sara bemerkte zum ersten Mal, dass der Rücken seiner linken Hand mit Brandnarben bedeckt war. Die Narben reichten über das Handgelenk hinaus und verschwanden unter dem Ärmel. Irgendwie hatte sie die bisher übersehen.
Er las ihr Gesicht. »Ein Feuer«, sagte er. »Ich erzähle dir mehr davon, wenn wir nachher draußen sind. Aber jetzt bitte ich dich um anderthalb Minuten Vertrauen.«
Seltsamerweise waren es die Narben, die sie überzeugten. Sie deuteten an, dass mehr in ihm steckte, dass er nicht nur große Reden schwang und einen schönen Anzug besaß. Er hatte etwas durchgemacht, und das hatte ihn abgehärtet. Vielleicht ebenso sehr wie sie.
Sie nahm die Uhr und betrachtete sie. »Sieht ziemlich billig aus für jemand, der angeblich ein teurer Anwalt ist.«
»Ich habe schon lange vor, mir was Schickes zu kaufen«, sagte er. »Vielleicht können wir das tun, wenn wir hier fertig sind.«
Sie nickte endlich zustimmend. »Na gut … aber sobald neunzig Sekunden um sind, erzähle ich dem Richter von den falschen Pässen.«
»Braves Mädchen.«
»Euer Ehren, darf ich?«, sagte die Staatsanwältin. »Wir könnten rasch eine Verständigung darüber aufsetzen, dass Ms Martinez bis zu ihrem achtzehnten Geburtstag in einer überwachten Wohngruppe verbringt.«
»Das wäre auch unbefriedigend«, sagte Mother.
»Hatten Sie nicht eben gesagt, sie sollte bis zur Volljährigkeit im Jugendarrest bleiben?«
»Ja, aber nicht in einer solchen Wohngruppe. Dort lernt sie doch nur, wie sie eine bessere Kriminelle wird. Ich denke an eine Alternative.«
Sara ließ den Sekundenzeiger nicht aus den Augen. Mother hatte noch eine Minute und sieben Sekunden.
»Wo?«, fragte der Richter.
»Crunchem Hall«, antwortete Mother.
»Crunchem Hall?« Pancake versuchte den Namen einzuordnen.
»Eine Spezialeinrichtung für eine kleine Gruppe von Jugendstraftätern. Meine Mandantin bekommt dort eine Eins-zu-eins-Betreuung und Beratung und eine erstklassige Ausbildung.«
»Schicken wir sie in ein Gefängnis oder in ein Ferienlager?«, fragte die Staatsanwältin. »Für so was kommt der Steuerzahler nicht auf.«
»Sämtliche Gebühren werden von einer privaten Stiftung übernommen«, sagte Mother und hob ein Blatt Papier aus seiner Aktentasche hoch. »Hier sind die Unterlagen. Sara Martinez kostet den Steuerzahler keinen Cent.«
Sara wusste nicht, was sie davon halten sollte, als sie sah, was auf den »Unterlagen« stand. Es handelte sich um die Speisekarte eines Sandwichladens in der Nähe des Gerichts. Laut Uhr blieben Mother noch sechsundzwanzig Sekunden.
»Das klingt zu gut, um wahr zu sein«, sagte der Richter. »Und darum ist es das vermutlich auch. Wir belohnen kriminelles Verhalten nicht mit Luxusunterbringung. Ms Martinez hat das Gesetz gebrochen und kommt in eine überwachte Wohngruppe, wenn wir hier fertig sind.«
Zehn Sekunden.
»Vielleicht denken Sie noch mal darüber nach«, sagte Mother. »Ms Martinez geht entweder nach Crunchem Hall oder wir plädieren auf ›nicht schuldig‹ und führen einen Prozess, den Sie beide bereuen werden, das garantiere ich Ihnen.«
»Wie das?«, fragte der Richter verblüfft.
Mother machte eine kurze Pause.
Seine Zeit war abgelaufen und er sah Sara an. Sara war hin- und hergerissen. Sie wusste nicht, worauf das alles hinauslief, aber es schien immerhin … auf etwas hinauszulaufen. Mother benutzte einen falschen Namen, war kein Anwalt und sein wichtigstes Beweisstück war eine Liste von siebenundzwanzig verschiedenen Sandwiches. Außerdem fiel ihm das Lügen beunruhigend leicht. Doch trotz allem schien er mit dem Gang des Gesprächs vollkommen zufrieden zu sein. Sie gab ihm die Uhr zurück und er lächelte.
»Jetzt wird es gleich lustig«, vertraute er ihr leise an.
Er wandte sich an den Richter. »Wenn es zum Prozess kommt, werde ich als Erstes darauf bestehen, dass Sie den Fall abgeben.«
»Mit welcher Begründung?«
»Mit der Begründung, dass Sie gegen meine Mandantin voreingenommen sind. Denn als sie sich in die Datenbank der Jugendjustiz einhackte, entdeckte sie auch kompromittierende persönliche Mails von Ihnen.«
Sara hatte keine Ahnung, wovon er redete. Sie hatte keine einzige E-Mail entdeckt.
»Der E-Mail-Server wurde nicht gehackt«, widersprach der Richter.
»Warum habe ich dann hier eine Mail, die Sie vor zwei Wochen verfasst haben?«, sagte Mother und las von einem Blatt Papier ab: »›Habe gestern mit dem Bürgermeister zu Abend gegessen und ich kann Ihnen sagen, dieser Mann ist eine absolute …‹«
Der Richter schlug gleich mehrmals mit seinem Hammer auf den Tisch, um Mother am Weiterlesen zu hindern.
»Ich lege das mal einen Moment weg«, sagte Mother und legte das Blatt auf den Tisch. »Es fanden sich auch die Mails verschiedener Anwälte, zum Beispiel diese.« Er begann ein anderes Blatt vorzulesen. »›Wie kannst du einen Menschen ernst nehmen, der Pancake heißt? Wo hat der denn studiert? Vielleicht an der Muffin-Universität?‹«
»Einspruch!«, rief die Staatsanwältin, die in diesem Moment begriff, dass sie selbst diese E-Mail an eine Freundin geschrieben hatte.
»Er sollte Einspruch erheben, nicht Sie«, sagte Mother. »Sie machen sich ja über seinen Namen lustig.«
»Euer Ehren, er will uns erpressen.«
Mother lachte. »Nein, das ist keine Erpressung. Aber die nächste Mail kommt einer Erpressung schon ziemlich nahe.« Er griff nach einem weiteren Blatt und begann laut zu lesen. »›Was die Juristenkonferenz vergangene Woche in Atlantic City betrifft, erzählen Sie meiner Frau bitte nicht, dass …‹«
»Ruhe im Gericht!«, brüllte der Richter und schlug erneut mit seinem Hammer zu. »Ruhe!«
Sara blickte zu Mother auf und er zwinkerte ihr zu.
Er wandte sich wieder an den Richter. »Es gibt Dutzende solcher Mails und ich werde dafür sorgen, dass sie alle vorgelesen und öffentlich zugänglich gemacht werden, was für Sie beide höchst peinlich sein dürfte. Es sei denn …« Er verstummte einen Moment, um dem Richter Gelegenheit zu geben, über Alternativen nachzudenken.
»Erzählen Sie mir mehr über Crunchem Hall«, sagte der Richter. »Wer leitet diese Einrichtung?«
»Miss Trunchbull«, antwortete Mother. »Sie führt ein eisernes Regiment.«
»Ah ja, Miss Trunchbull«, sagte der Richter. »Hart … aber gerecht, wenn ich mich richtig erinnere. Erzählen Sie mir mehr.«
Vier Stunden später wurde Sara Maria Martinez aus der Untersuchungshaft entlassen und in die Obhut eines Mannes gegeben, der behauptete, ein Anwalt namens Gerald Anderson zu sein. Er unterschrieb einige Formulare und sie traten durch eine Drehtür des Gerichtsgebäudes in einen sonnigen Nachmittag in Brooklyn.
Sara atmete die frische Luft ein. Dann fragte sie: »Wollen Sie mir vielleicht erklären, was da drinnen eben passiert ist?«
»Wir haben gewonnen«, sagte Mother. »Es war ehrlich gesagt ein wenig mühsam.«
»Ich bin nicht so sicher, ob man das einen Sieg nennen kann«, sagte Sara. »Ich wurde zu sechs Jahren Jugendarrest verurteilt.«
»Stimmt, aber du musst sie in einer erfundenen Einrichtung verbringen, und das dürfte nicht allzu schwer sein.«
Sara sah ihn verwirrt an. »Von was reden Sie?«
»Crunchem Hall ist die Schule in Matilda«, erklärte Mother. »Miss Trunchbull ist die böse Direktorin. Beides existiert nur in einem Kinderbuch.« Er machte eine kurze Pause und fügte dann hinzu: »Mal abgesehen von dem Film und dem Musical, die mir übrigens auch gut gefallen haben.«
»Sind Sie verrückt?«
»Ich hatte nur anderthalb Minuten Zeit und musste mir etwas einfallen lassen. Der Trick war, Namen zu verwenden, die einem irgendwie bekannt vorkommen. Dadurch wirken sie glaubhafter.«
»Aber was, wenn die beiden sich an das Buch erinnert hätten?«
»Die Staatsanwältin erschien mir noch zu jung für Kinder und der Richter ist so alt, dass die letzte Gutenachtgeschichte, die er vorgelesen hat, bestimmt schon Jahrzehnte zurückliegt. Deshalb dachte ich, dass wir vermutlich auf der sicheren Seite sind.«
»Wieder das ›vermutlich‹.«
»Das Leben ist voller Unwägbarkeiten, Sara, daran musst du dich gewöhnen.«
»Aber wenn diese Einrichtung ein erfundener Ort ist, warum wollten Sie dann unbedingt, dass ich verurteilt werde, bis ich achtzehn bin?«
»Weil sich Jugendgerichte und Jugendämter jetzt nicht mehr für dich interessieren«, erklärte Mother. »Man hat dich weggesperrt, bis du erwachsen bist. Niemand wird nach dir fragen. Kein Sozialarbeiter wird deinen Fall verfolgen und bei dir anklopfen. Du bist durch das Raster des amerikanischen Rechtssystems gefallen.« Er lächelte stolz. »Perfekt.«
»Sie meinen, ich bin frei?«
»In jeder Beziehung.«
»Was passiert dann jetzt?«
»Das ist die interessante Frage. Du musst einige wichtige Entscheidungen treffen. Aber zuerst möchte ich dich zu einer Autofahrt einladen.« Er zeigte auf eine Limousine, die in der Nähe wartete. »Ich möchte dir etwas zeigen.«
»In einer Limousine?«
»Ich dachte mir, angekommen bist du in Handschellen hinten in einem Panda-Wagen. Also sollten wir wenigsten stilvoll abfahren.«
»Panda-Wagen?«
»Ein Polizeiauto«, erklärte er. »Das ist schwarz und weiß, wie ein Panda.«
Sara folgte ihm. »Wie kamen Sie eigentlich auf Matilda?«
»Es wurde von Roald Dahl geschrieben. Er ist mein Lieblingsautor.«
»Sie scheinen Kinderbücher sehr zu mögen.«
»Stimmt, aber Dahl ist nicht deshalb mein Lieblingsautor«, sagte Mother. »Sondern weil er Schriftsteller war und Spion.« Mother blieb stehen und sah sie an. »Genau wie ich.«
Sara lachte.
»Das ist kein Witz«, sagte er. »Ich bin Agent des britischen Geheimdiensts, auch als MI6 bekannt. Deshalb habe ich die vielen Pässe und deshalb hatte ich auch die Mails. Ich leite ein Elite-Team, das nur auf Einsätze höchster Priorität geschickt wird.«
»Zu verhindern, dass ich in den Jugendknast komme, war also ein Einsatz von höchster Priorität?«, fragte Sara argwöhnisch.
»Das war kein Einsatz, sondern eine Rekrutierung. Eine notfallmäßige.«
»Was soll das heißen?«
»Wir stehen kurz vor einer wichtigen Operation«, sagte er. »Und haben soeben festgestellt, dass wir eine Person mehr im Team brauchen. Also dachten wir, wir fliegen kurz rüber und finden heraus, ob vielleicht du diese Person bist.«
»Wir?«, fragte Sara.
Mother öffnete die hintere Tür der Limousine und ein vertrautes Gesicht blickte Sara vom Rücksitz an.
»Emily?«, fragte sie, als sie ihre »Zellenschwester« erkannte.
»Eigentlich heiße ich Sydney«, antwortete das Mädchen mit einem australischen Akzent. »Freut mich, dass Mother dich rausholen konnte.«
3.
BROOKLYN
Statt in einem Gefangenenbus verließ Sara das Gericht in einer Limousine zusammen mit zwei Leuten, die behaupteten, Spione zu sein. Überraschenderweise glaubte sie ihnen das aufs Wort. Sie wusste nur nicht, was für eine Rolle sie selbst in ihren Plänen spielte.
»Nur damit ich das richtig verstehe«, sagte sie, als sie auf der Atlantic Avenue nach Brooklyn hineinfuhren. »Ihr beide seid ein Team?«
»Teil eines Teams«, antwortete Sydney.
»Und ihr seid hierhergekommen, um herauszufinden, ob ich in dieses Team reinpasse?«
»Richtig«, sagte Mother.
»Und passe ich rein?«
»Bisher sieht alles sehr vielversprechend aus«, sagte er. »Aber um sicher zu sein, müssen wir weitere Tests durchführen.«
»Was heißt weitere Tests? Ich habe doch noch gar keine gemacht.«
»Doch, schon zwei«, erwiderte er. »Der erste war, als ich dich bat, dich in das Portal der Jugendjustiz einzuhacken. Das war ›Arbeiten unter Druck‹. Eine entscheidende Fähigkeit.« Er wandte sich an Sydney. »Sie hat es in unter zwei Minuten geschafft.«
»Bemerkenswert«, sagte Syndey.
»Der zweite war, mir vor Gericht zu vertrauen«, fuhr er fort. »Dadurch hast du gezeigt, dass du mit unerwarteten Umständen umgehen kannst. Auch entscheidend.«
»Ich wäre zu gern im Gerichtssaal dabei gewesen«, sagte Sydney.
»Ja, zu schade«, witzelte Mother. »Ich war sensationell.«
Sydney verdrehte die Augen und wechselte einen Blick mit Sara. »Ich war übrigens vorhin noch einkaufen.« Sie gab Sara zwei große Einkaufstaschen. »Hoffentlich gefallen dir die Sachen. Deine Größe musste ich schätzen.«
Sara betrachtete die Taschen. »Du hast mir was zum Anziehen gekauft?«
»Nur um die Zeit zu überbrücken, bis wir dich richtig einkleiden können.«
»Obwohl du an den meisten Tagen deine Schuluniform tragen wirst«, fügte Mother hinzu.
Sarah sah ihn misstrauisch an. »Meine Schule hat keine Uniform.«
»Darüber wollte ich sowieso mit dir sprechen. Du wirst auf eine neue Schule namens Kinloch Abbey gehen.«
»Klingt so erfunden wie Crunchem Hall«, sagte Sara. »Lassen Sie mich raten. Das kommt aus James und der Riesenpfirsich.«
»Auch ein schönes Buch. Aber nein, diese Schule hat sich keiner ausgedacht«, erklärte Mother. »Sie ist ganz real und liegt in Schottland.«
Sara wartete auf ein nachgeschobenes Lachen, das das Ganze als Witz abtat, aber es blieb still. Sie wartete noch ein wenig länger, aber die beiden lachten immer noch nicht.
»Im Ernst?«
»Sie ist ziemlich schnieke«, sagte Sydney. »Ein Teil davon ist in einer Burg untergebracht. Aber wenn du das verkraftet hast, wird sie dir gefallen.«
»Wir gehen nach Schottland?«
Statt zu antworten, beugte sich Mother zum Fahrer. »Können Sie hier bitte links abbiegen und uns zum Haus Nummer 197 bringen?«
»Die Zeit drängt«, erinnerte Sydney ihn. »Wenn wir den Flug verpassen, verlieren wir einen ganzen Tag.«
»Ich weiß, ich weiß«, versicherte er. »Nur ein kurzer Abstecher zu Bildungszwecken. Außerdem interessiert es mich selbst.«
»Entschuldigung«, fiel Sara ihm ins Wort, »aber können wir noch mal über das mit Schottland sprechen?«
»Gleich«, sagte Mother. Die Limousine parkte vor einem dreistöckigen, aus roten Ziegeln erbauten Stadthaus. »Sag mir zuerst, was du über Winston Churchill weißt.«
»Absolut nichts«, antwortete sie verwirrt. »Der Name klingt irgendwie … vertraut, aber das war’s auch schon.«
»Nicht zu fassen«, sagte Mother missbilligend. »Aber das wird sich in Kinloch schnell ändern. Jetzt brauchst du nur zu wissen, dass Churchill im Zweiten Weltkrieg Premierminister war und Großbritannien und womöglich die ganze Welt vor der Vernichtung bewahrt hat. Er ist einer meiner persönlichen Helden und hat mehr für den britischen Geheimdienst getan als jeder andere.«
»Okay«, sagte Sara. »Aber warum erzählen Sie mir das?«
»Weil seine Mutter in diesem Haus geboren wurde.« Er zeigte aus dem Fenster. »Stell dir das vor. Die Mutter des Mannes, der Großbritannien gerettet hat, kam nicht etwa aus London oder Oxford oder von einem herrschaftlichen Anwesen in Surrey, sondern aus Brooklyn, genau wie du. Es ist also in gewisser Weise folgerichtig, dass wir hierher zurückgekehrt sind, um dich zu finden. Brooklyn liegt uns in den Genen.« Er wandte sich wieder an den Fahrer. »Wir können weiterfahren.«
Die Limousine setzte sich in Bewegung.
»Das ist ja alles interessant«, sagte Sara. »Aber es beantwortet nicht meine Frage. Wollen Sie mich im Ernst nach Schottland bringen? Ich habe nämlich nicht mal einen Pass.«
Mother ließ die Schlösser seiner Aktentasche aufspringen und reichte ihr zwei britische Pässe, beide mit ihrem Bild und einem falschen Namen. »Nimm den, der dir besser gefällt.«
»Natürlich«, sagte sie kopfschüttelnd. »Sie haben immer einen Pass parat. Wie haben Sie sich das Foto von mir beschafft?«
»Sagte ich nicht, wir sind Spione? Dinge zu beschaffen ist unsere Spezialität. Und was deine erste Frage angeht, ja, wir bringen dich nach Schottland. Ob du aber dort bleibst oder nicht, hängt ganz von dir ab.«
»Wie meinen Sie das?«
»Du wirst bald in Kinloch zur Schule gehen. Kinloch ist eins der besten Internate von ganz Großbritannien. Du bekommst dort eine erstklassige Ausbildung. Wenn es dir gefällt, kannst du bis zum Schluss bleiben und anschließend an einer Universität studieren. Das wäre Option Nummer eins.«
»Und wenn es mir nicht gefällt?«, fragte Sara.
»Option zwei. Wenn du am Ende des Schuljahrs beschließt, dass Kinloch nicht das Richtige für dich ist, oder du das Leben in den Staaten zu sehr vermisst, suchen wir dir hier in Amerika ein angemessenes Zuhause. Etwas anderes als die Familien, in die man dich bisher gesteckt hat. Wir finden eine gute Umgebung für dich. Darum werde ich mich kümmern. Allerdings müssten wir den Großraum New York wohl meiden, weil man hier ja glaubt, du würdest unter Aufsicht in einer Einrichtung leben.«
»Gutes Argument«, sagte Sara. »Aber was hat das alles mit Spionen und dem MI6 zu tun?«
»Gar nichts.« Er beugte sich verschwörerisch zu ihr. »Das mit dem Geheimdienst wäre Option drei.«
Sara sah die beiden an. »Dann will ich mehr über Option drei hören.«
»Du besuchst Kinloch nicht als Internats-, sondern als Tagesschülerin«, sagte Syndey. »Und du wohnst zusammen mit Monty, mir und dem restlichen Team auf der Farm.«
»Monty?«, fragte Sara. »Wer ist das?«
»Dr. Alexandra Montgomery«, erklärte Mother. »Sie ist Biophysikerin-Schrägstrich-Kryptologin mit einer Leidenschaft fürs Backen. Stell sie dir vor als Mischung aus Marie Curie und Mary Poppins.«
»Sie ist genial«, sagte Sydney. »Du wirst sie lieben.«
»Und das restliche Team?«
»Jugendliche wie du und ich, die Mother auf der ganzen Welt ausfindig gemacht hat«, sagte Syndey. »Unglaubliche Leute.« Sie überlegte kurz. »Ich meine, die Jungs machen mich wahnsinnig und meist würde ich sie am liebsten erwürgen, aber davon abgesehen sind sie unglaublich.«
»Wie viele seid ihr denn?«
»Zwei Jungs und noch ein Mädchen«, sagte sie. »Paris, Rio und Kat. Wenn du zum Team stößt, brauchst du eine neue Identität. Weil es schwierig ist, die vielen Decknamen auseinanderzuhalten, nennen wir uns gegenseitig einfach nach unseren Heimatstädten. Das ist wenigstens noch eine kleine Verbindung zu unserer Vergangenheit.«
»Es gibt eine Stadt, die Kat heißt?«, fragte Sara.
»Kathmandu«, antwortete Mother. »Liegt in Nepal, ist aber ziemlich lang, deshalb sagen wir einfach nur Kat.«
»Ich wäre also Brooklyn«, sagte Sara. Der Name gefiel ihr.
»Wenn du mitmachen willst«, schränkte Mother ein.
»Was genau würde das denn heißen?«
»Du würdest zusätzlich zum Unterricht in Kinloch noch in Spionage, Gegenspionage, Selbstverteidigung, Code-Knacken und allerlei anderen interessanten Sachen ausgebildet werden.«
»Von den allerlei anderen Sachen finde ich ›Sprengstoffe‹ am besten«, sagte Sydney. »Ich mag es, wenn’s kracht.«
»Es handelt sich also um eine Spionageschule?«
Mother nickte. »Aber nicht nur um eine Schule. Wir gehen auch auf wirkliche Einsätze, blicken echten Gefahren ins Auge.«
»Und Sie meinten, es stehe eine Operation bevor, bei der ich dabei sein soll«, sagte Sara.
Mother seufzte. »Normalerweise bekommt man vor praktischen Einsätzen erst eine umfassende Ausbildung, aber momentan haben wir einen Engpass. Die Operation findet in drei Wochen statt und wir sind um eine Person unterbesetzt.«
»Und wenn ich diese Person wäre?«
»Dann würde ich deine Rolle natürlich möglichst begrenzen, aber du müsstest mit uns mitkommen.«
»Cool«, sagte Sara mit einem Grinsen. »Klingt um einiges spannender als Jugendknast.«
Sie hätte gerne weitere Fragen zu dem bevorstehenden Einsatz gestellt, wurde aber abgelenkt, als die Limousine in eine vertraute Straße einbog. Es handelte sich um ihr altes Viertel und schon der Anblick ließ sie zusammenzucken. Hier war alles das Gegenteil von schnieken Internaten und Burgen. Stattdessen gab es Maschendrahtzäune mit Stacheldraht, Fenster mit Eisengittern und Graffiti auf der Mauer einer verlassenen Lagerhalle.
»Warum sind wir hier?«, fragte sie.
»Wir werden ein Meer überqueren«, sagte Mother. »Ich dachte, du willst vor der Abreise vielleicht noch mal zu Hause vorbeischauen.«
»Das ist nicht mein Zuhause«, erwiderte Sara. »Nur ein Haus, in dem ich gewohnt habe. Das ist ein großer Unterschied.«
»Zur Kenntnis genommen«, sagte er. »Aber jedenfalls wirst du nicht mehr zurückkehren. Wenn du also aus sentimentalen Gründen etwas mitnehmen willst, wäre jetzt Gelegenheit dazu.«
»Es gibt da eine Schuhschachtel mit ein paar Sachen, die mir wichtig sind«, sagte Sara. »Aber ich kann sie nicht holen.«
»Warum nicht?«
»Die Clarks sind zu Hause. Wenn man bedenkt, dass ich sie verhaften lassen wollte, werden sie die Schachtel kaum rausrücken.«
»Sie brauchen ja nichts davon mitzubekommen«, schlug Mother vor.
»Ich soll in das Haus einbrechen?«
»Wir sprechen in unserem Gewerbe von einer ›verdeckten Operation‹«, sagte er. »Wir machen daraus deinen ersten Alphatest.«

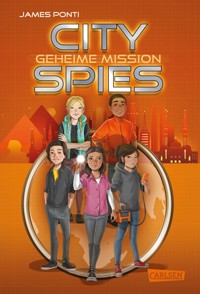















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











