
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Diese 5 Spy Kids habens drauf: ein starkes Team, eine actiongeladene Story, ein Riesenspaß! Wieder jagen die City Spies für eine geheime Mission um die Welt. Die Rettung eines entführten Schiffs, vollgepackt mit Schülerinnen aus reichem Hause, ist nur der Anfang. Denn die kriminellen Drahtzieher haben offenbar auch mit dem Foto zu tun, das dem jungen MI6-Team beim letzten Auftrag zugespielt wurde. Das Bild enthält versteckte Hinweise auf einen Verräter in den Reihen des MI6 – und auf einen Mord! Jetzt ist doppelte Vorsicht gefragt. Die Spur führt die fünf Teenager nach San Francisco und wird zur gefährlichen Schnitzeljagd im Schatten der Golden Gate Bridge. Band 2 der temporeichen Spionage-Serie, die es aus dem Stand auf die New-York-Times-Bestsellerliste schaffte – fünf smarte Kids und jede Menge Action! Alle Bände der Serie: City Spies – Gefährlicher Auftrag (Band 1) City Spies – Tödliche Jagd (Band 2) City Spies – Gewagtes Spiel (Band 3) City Spies – Geheime Mission (Band 4)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
James Ponti: City Spies – Gefährlicher Auftrag
Aus dem Englischen von Wolfram Ströle
Wieder jagen die fünf City Spies für eine geheime Mission um die Welt. Die Rettung eines entführten Schiffs, vollgepackt mit Schülerinnen aus reichem Hause, ist nur der Anfang. Denn die kriminellen Drahtzieher haben offenbar auch etwas mit dem Foto zu tun, das dem jungen MI6-Team beim letzten Auftrag in Paris zugespielt wurde. Das Bild enthält versteckte Hinweise auf einen Verräter in den eigenen Reihen des MI6! Jetzt ist doppelte Vorsicht gefragt. Die Spur führt die fünf Teenager nach San Francisco und wird schnell zur gefährlichen Schnitzeljagd im Schatten der Golden Gate Bridge.
Band 2 der spannenden Agenten-Serie: rasant, riskant und richtig gut!
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Geheimakten
Danksagung
Viten
Für meine Brüder Carey und Terry,die von Anfang an bei den Abenteuern dabei waren
1.
DIE SYLVIA EARLE, NORDSEE
Es begann zu dämmern, deshalb waren die schwarzgekleideten Entführer, die mit militärischer Präzision über das Deck des Meeresforschungsschiffes Sylvia Earle vorrückten, kaum zu sehen. Sie kamen zu siebt und trugen Stiefel mit rutschfesten Sohlen, mit denen sie auf dem nassen Metall Halt fanden, und Sturmhauben, die ihre Gesichter verbargen und sie zugleich vor der kalten Meeresluft schützten. Praktisch alle Passagiere und die Besatzung schliefen noch, die Eindringlinge stießen deshalb auf keinen Widerstand, als sie die Brücke stürmten und die nichtsahnende wachhabende Offizierin überwältigten.
Weder wurde Alarm ausgelöst noch über Funk ein Hilferuf abgesetzt.
Das bedeutete, wenn jemand die Sylvia Earle noch retten konnte, dann am ehesten die Person ein Deck tiefer, die sich gerade schlaftrunken und gähnend nach ihrer besten Freundin umsah. Ihre Bewegungen waren alles andere als militärisch präzise und sie trug auch keine Spezialkleidung, sondern einen bequemen Schlafanzug, bestehend aus neonblauer Jogginghose, Ravenclaw-T-Shirt und Wollsocken, die mit Comic-Narwalen bedruckt waren. Laut Passagierliste hieß sie Christina Diaz, aber das war nur ein Deckname des britischen Geheimdienstes. Ihre Kameraden vom MI6 kannten sie als Brooklyn.
Und sie war zwölf Jahre alt.
Geweckt hatte sie nicht die Ankunft der Entführer, sondern das endlose Schnarchen zweier ihrer Kabinenmitbewohnerinnen. Sie schaltete die kleine Leselampe über ihrem Bett ein, weil sie wissen wollte, ob ihre Freundin Sydney ebenfalls wach lag. Aber Sydneys Koje war leer. Brooklyns erste Vermutung war, dass die Mitspionin aufgestanden war, um die Bordtoilette zu benutzen. Doch als Sydney auch nach einer Weile nicht zurückkam und das Schnarchen noch lauter wurde, beschloss Brooklyn, sie zu suchen.
Leise stieg sie von der oberen Koje herunter und schlüpfte durch die Tür nach draußen in den Gang. Sie war auf dem Weg zur Kombüse, um nachzusehen, ob Sydney den Gefrierschrank nach einem Eis durchstöberte, als die Stimme eines Mannes über den Lautsprecher kam. Es war das erste Anzeichen dafür, dass etwas nicht stimmte. Denn Männer waren auf der Sylvia Earle nicht vorgesehen. Auf dem Schiff befanden sich sechzehn Schülerinnen, sieben weibliche Besatzungsmitglieder, drei Wissenschaftlerinnen und eine Dokumentarfilmerin. Auf der einwöchigen Fahrt sollten die Mädchen dazu angeregt werden, naturwissenschaftliche Berufe zu ergreifen. Alle Mitreisenden waren weiblich … bis jetzt.
Sie hatten einen ungeladenen Gast.
»Achtung, Achtung!« Die Stimme hatte einen leicht skandinavischen Akzent und klang so monoton, dass man davon eine Gänsehaut bekam. »Entschuldigen Sie, wenn ich Sie wecke, aber wir haben das Schiff übernommen. Begeben Sie sich unverzüglich zum Hauptdeck und bewahren Sie Ruhe. Wenn Sie unseren Anweisungen folgen, wird niemand zu Schaden kommen. Wenn nicht, sind Sie selbst für die Folgen verantwortlich.«
Schlagartig war Brooklyn hellwach und sie rannte zu ihrer Kabine zurück. Der MI6 hatte sie und Sydney auf diese Reise geschickt, um zwei Mädchen zu schützen: Judy Somersby, deren Mutter ein hochrangiges Mitglied des Parlaments war, und Alice Hawthorne, trotz ihrer erst dreizehn Jahre die offizielle Lady Hawthorne, Tochter des Herzogs von Covington. Sie bekleidete Rang zweiunddreißig der Thronfolge, und wer das nicht wusste, bekam es im Gespräch mit ihr erstaunlich oft zu hören.
»Sofort aufstehen!«, befahl Brooklyn, kaum dass sie die Tür aufgerissen hatte.
Die Kabine war klein und voll – zwei Stockbetten, getrennt nur durch einen kaum schulterbreiten Gang. Alice und Judy lagen in den unteren Kojen, und als sie nicht sofort reagierten, griff Brooklyn nach ihren Decken und zog sie wie bei einer Zaubernummer mit einem Ruck weg.
»Aufstehen, habe ich gesagt!«
»Moment mal«, rief Alice. »In diesem Ton sprichst du nicht mit mir. Weißt du nicht, dass …«
»Was?«, fiel Brooklyn ihr ins Wort. »Dass du auf Platz zweiunddreißig der Thronfolge stehst? Wenn du nicht tust, was ich sage, ist gut möglich, dass alle ab Platz dreiunddreißig demnächst einen Platz vorrücken.«
Judy setzte sich verschlafen auf und murmelte: »Wovon redest du?«
»Piraten haben das Schiff gekapert. Ich vermute mal, die sind hinter euch her.«
»Piraten?« Judy sah sie verwirrt an. »Du meinst, mit Holzbeinen und Papageien?«
»Ja, und einem Krokodil mit einer lauten Uhr im Bauch«, ergänzte Brooklyn ironisch. »Wir sind hier nicht im Märchen, es handelt sich um wirkliche Verbrecher des einundzwanzigsten Jahrhunderts. Und ihr beide seid das Wertvollste auf dem Schiff.«
Von draußen war Unruhe zu hören und einer der Entführer brüllte, alle sollten sich zum Hauptdeck nach oben begeben.
»Soll das ein Scherz sein?«, fragte Alice. »Weil es überhaupt nicht witzig ist.«
»Apfelschnaps!«, rief Brooklyn.
»Was?«, fragte Judy verwirrt.
»Apfelschnaps«, wiederholte Brooklyn ein wenig verunsichert. »Das ist doch das Codewort, ja? Eure Eltern haben es euch doch gesagt?«
Der MI6 hatte den Eltern der beiden Mädchen das Notfall-Codewort gegeben. Wenn sie es jemand sagen hörten, sollten sie den Anweisungen der oder des Betreffenden ohne Widerrede Folge leisten. Weder Alice noch Judy hatten das besonders ernst genommen und, wenn überhaupt, am ehesten noch mit einer Autoritätsperson in Uniform gerechnet, nicht mit einem zwölfjährigen Mädchen in einem Harry-Potter-Schlafanzug. Aber natürlich konnten sie nicht wissen, dass das vielleicht größte Geheimnis des britischen Geheimdiensts ein experimentelles Team fünf junger Agenten im Alter von zwölf bis fünfzehn Jahren war, die sich City Spies nannten. Ihr Erfolg beruhte zu einem großen Teil darauf, dass niemand sich vorstellen konnte, dass es Spione wie sie überhaupt gab. Deshalb rechnete auch niemand mit ihnen. Und selbst wenn es jemand gewusst hätte, hätte ihm niemand geglaubt.
»Schon, aber …«, stotterte Alice.
Im selben Augenblick trat ein Hüne von Mann in die Tür, ein solcher Koloss, dass sogar seine Muskeln noch Muskeln hatten. »Alle aufs Hauptdeck!«, blaffte er und durch die Öffnung seiner Sturmhaube konnte man gelbe Zähne sehen. »Jetzt ist keine Zeit mehr für Make-up.«
Er klang drohend, und Alice und Judy waren entsprechend eingeschüchtert. Brooklyn wirkte dagegen eher … ärgerlich.
»Was soll das heißen?«, fragte sie.
Der Mann hatte mit panischem Kreischen gerechnet und war auf eine solche Frage nicht vorbereitet. »Wie bitte?«
»Der Scherz mit dem Make-up«, sagte sie. »Glauben Sie, weil wir Mädchen sind, denken wir nur an unser Aussehen? Ja? Also, das ist wirklich sexistisch.«
»Rauf an Deck, aber dalli!«, brüllte der Mann. Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, kam er durch die Tür und baute sich vor den Betten auf.
Genau dort wollte Brooklyn ihn haben.
Sie legte die Arme auf die oberen Kojen, um sich abzustützen. Dann schwang sie wie eine Turnerin am Barren die untere Körperhälfte hoch und vollführte einen perfekten Scherentritt gegen die Unterseite seines Kinns. Der Mann erstarrte und sackte zusammen.
Brooklyn wandte sich an die Mädchen. »Kommt ihr jetzt mit? Denn von denen gibt’s noch mehr, von meiner Sorte im Moment aber nur mich.«
Die beiden blickten auf den Koloss am Boden und dann auf das schmächtige Mädchen, das ihn gefällt hatte.
»Wir kommen mit!«, riefen sie gleichzeitig und standen hastig auf.
»Zieht Schuhe an«, sagte Brooklyn und zwängte die Füße in ihre Sneakers. »Wir müssen klettern.«
»Wo rauf?«, fragte Alice alarmiert, aber da war Brooklyn schon aus der Tür.
Auf dem Gang herrschte das reinste Chaos. Eine Alarmsirene schrillte und Notleuchten blinkten. Die anderen Passagiere drängten in Richtung Treppe, während Mr Gänsehaut weiter im Lautsprecher zu hören war. Brooklyn schenkte dem allen keine Beachtung und schlug die entgegengesetzte Richtung ein, dicht gefolgt von Alice und Judy. Die ganze Zeit hielt sie nach Sydney Ausschau, die eigentlich beim ersten Alarmzeichen sofort zur Kabine hätte zurückkehren sollen. Brooklyn hatte keine Ahnung, wo sie war, und das machte ihr Sorgen.
»Wohin gehen wir?«, fragte Alice.
»Das sage ich nicht laut, weil niemand es hören darf«, erklärte Brooklyn. »Kommt einfach mit.«
Sie drehte sich um und sah, dass der Hüne wieder zu sich gekommen war und gerade aus der Kabine trat. Er rieb sich das schmerzende Kinn und blickte suchend durch den Gang. Als er Brooklyn sah, verzerrte er wütend das Gesicht.
»Du!«, brüllte er. Er setzte sich in Bewegung und stieß dabei wie ein Filmmonster alle in seinem Weg zur Seite. »Jetzt habe ich dich!«
»Schneller«, drängte Brooklyn die Mädchen. »Wir kriegen Gesellschaft.«
Sie rannten in einen Raum mit der Aufschrift NASS-LABOR und machten die Eisentür hinter sich zu. In dem Labor standen Präsentationstische, wissenschaftliche Instrumente und flache Salzwassertanks mit allerlei Meeresgetier, das sie im Lauf der Woche untersucht hatten. Brooklyn suchte nach einem Schloss an der Tür, aber es gab keins.
»Und jetzt?«, fragte Judy.
»Verstecken«, sagte Brooklyn. »Mit dem werde ich schon fertig.«
»Wie?«, fragte Alice.
»Weiß ich noch nicht.« Brooklyn ließ den Blick über einen Tisch wandern, auf der Suche nach etwas, womit sie sich gegen den Mann wehren konnte. »Bei der Planung der Operation haben wir alle möglichen Varianten durchgespielt, aber leider nicht, wie man einen solchen Koloss mit extrem schlechten Zähnen unschädlich machen kann.«
»Wir?«, fragte Alice verwirrt.
»Operation?«, fügte Judy ähnlich durcheinander hinzu.
Brooklyn beachtete sie nicht, sondern schaltete das Deckenlicht aus, sodass die einzige Beleuchtung von den in die Wände eingebauten Aquarien kam. Der ganze Raum war jetzt in schummrig blaues Licht getaucht und das sacht hin und her schwappende Wasser der Aquarien überzog alles mit geisterhaften Schatten.
Brooklyn suchte weiter nach irgendeiner Waffe, bis sie hörte, wie die Tür aufging. Hastig duckte sie sich hinter einen Tisch und tat keinen Mucks. Vielleicht hatten sie Glück und der Mann hatte nicht genau gesehen, in welchem Raum sie verschwunden waren.
»Los, kommt raus, wo immer ihr euch versteckt habt«, sagte er und drückte auf einen Schalter. Zischend gingen die Neonröhren an. »Ich weiß, dass ihr hier drin seid.«
Von wegen Glück.
Der Mann wollte ihnen Angst machen, also beschloss Brooklyn, tapfer zu sein. Sie richtete sich hinter dem Tisch auf und hob das Kinn. Die rechte Hand hielt sie dabei auf dem Rücken, sodass der Mann nicht sehen konnte, was sie im letzten Augenblick gefunden hatte.
»Das erste Mal hast du mich warm erwischt«, sagte er und zog die Sturmhaube ab. »Weil ich wegen dieser Mütze nicht richtig sehen konnte. Aber das passiert mir nicht noch mal.«
»Kalt«, verbesserte Brooklyn.
»Was?«
»Sie sagten ›warm‹ erwischt, aber es heißt ›kalt‹ erwischt. Solche Redewendungen sind vertrackt. Was sprechen Sie sonst? Schwedisch? Norwegisch?«
Der Mann knurrte und Brooklyn beschloss, ihn nicht mehr zu verbessern und keine Fragen mehr zu stellen. Stattdessen versuchte sie die Lage einzuschätzen, wie sie es gelernt hatte. Der Mann war groß, wirkte aber ein wenig benommen. Ohne die Haube sah sie die Schwellung an seinem Kinn. Sicher hatte er eine Gehirnerschütterung. Das war sein Schwachpunkt. Kräftemäßig war sie ihm nicht gewachsen, aber vielleicht konnte sie ihn überlisten.
»Am besten gehen Sie einfach«, sagte sie, die Hand immer noch auf dem Rücken. »Ich will Ihnen nicht schon wieder wehtun.«
»Was hast du da?«, fragte er höhnisch. »Eine Waffe?«
»Noch besser.« Sie holte die Hand vor und hielt sie zur Faust geballt vor ihr Gesicht, um ihm zu zeigen, dass sie … einen leuchtend gelben Gummihandschuh trug. Den Handschuh hatte sie noch schnell vom Tisch geschnappt, bevor sie sich dahinter versteckt hatte. Es war eine dramatische Geste, aber kein bisschen einschüchternd.
»Ein Gummihandschuh?« Der Mann ließ ein dröhnendes Lachen hören. »Was willst du damit machen? Abspülen, wie ein braves Mädchen?«
Brooklyn schüttelte enttäuscht den Kopf. »Schon wieder die sexistischen Kommentare«, sagte sie. »Lernen Sie denn überhaupt nichts?«
Der Mann kam auf sie zu und sie griff blitzschnell in einen Wassertank und warf etwas auf ihn. Er fing es reflexartig auf und lächelte, überzeugt, ihren jämmerlichen Angriff abgewehrt zu haben. Dann tat er einen Schmerzensschrei.
»W-w-was ist das?«, stammelte er verwirrt.
»Sie spüren es schon, nicht wahr?«, sagte Brooklyn mit einem zuversichtlichen Lächeln. »Das ist ein Rosen-Seeigel. Er hat einen hübschen Namen, aber was er mit Ihrem Körper anrichtet, ist ziemlich hässlich.«
Der Mann blickte auf das stachlige Geschöpf in seiner Hand. Es war rund, etwa zehn Zentimeter im Durchmesser und hatte kleine, rosafarbene Blätter, die an Blumen erinnerten. Er ließ es auf den Boden fallen, aber es war schon zu spät. Seine Hand begann anzuschwellen.
»Das Kribbeln in Ihrer Hand wird durch das Gift der Blättchen verursacht«, fuhr Brooklyn fort. »Es wird schon bald in Ihren Blutkreislauf gelangen, und dann gehen die Beschwerden erst richtig los.«
Der Mann sah sie ängstlich an.
»Zuerst werden die Finger taub, dann die Lippen. Und sobald die Zunge betroffen ist, können Sie nicht mehr um Hilfe rufen.«
Der Mann wollte etwas sagen, merkte aber, dass er die Lippen kaum noch bewegen konnte.
»Sie müssen sich also folgende Frage stellen«, fuhr Brooklyn fort. »Wollen Sie uns weiter verfolgen, bis das Gift Ihren ganzen Körper lahmlegt? Oder wollen Sie uns in Ruhe lassen und das Gegengift einnehmen, das Ihnen das Leben rettet? Ich überlasse die Wahl ganz Ihnen.«
Er wollte antworten, brachte aber nur »Ge-ge-gi« heraus.
Brooklyn schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, ich kann Sie nicht verstehen.«
»Ge-ge-gi!«, bettelte er.
»Ich verstehe Sie zwar immer noch nicht, aber vermutlich meinen Sie Gegengift. Das wäre eine kluge Wahl.«
Der Mann nickte panisch.
»Das Mittel ist im Erste-Hilfe-Koffer hinten im Kämmerchen.« Brooklyn zeigte auf eine Kammer, in der Laborproben und wissenschaftliches Zubehör aufbewahrt wurden. »In der gelben Flasche mit der Aufschrift ›Gegengift‹.«
Der Mann stolperte hinüber und betrat die Kammer, um nach dem Gegengift zu suchen. Er suchte auch noch, als Brooklyn die Tür hinter ihm zuschlug, den Riegel vorschob und ihn einsperrte. Zwar hämmerte er dagegen, doch er kam nicht mehr heraus. Er rief um Hilfe, aber seine gedämpften Schreie waren vollkommen unverständlich.
Die beiden Mädchen kamen aus ihren Verstecken. »Der Erste-Hilfe-Schrank steht doch dort«, sagte Judy und zeigte auf einen Wandschrank aus Metall mit einem roten Kreuz darauf.
Brooklyn zuckte mit den Schultern. »Schon, aber in den kann ich ihn ja nicht einsperren.«
»Du lässt ihn einfach so sterben?«, fragte Alice ungläubig.
»Natürlich nicht.« Brooklyn hob den Seeigel vorsichtig vom Boden auf. »Rosen-Seeigel können zwar tödlich sein, aber der hier ist dazu viel zu klein. Die Wirkung dürfte in etwa einer Viertelstunde nachlassen. Ihr wüsstet das auch, wenn ihr bei der Laborstunde gestern aufgepasst hättet. Soweit ich mich erinnere, seid ihr durch den Raum spaziert, um eine Stelle zu finden, an der ihr Handyempfang habt, was insofern lustig ist, als wir uns mitten auf der Nordsee befinden und es hier keinen einzigen Mobilfunkmast gibt.« Sie setzte den Seeigel behutsam wieder in das Aquarium.
Alice sah sie neugierig an. »Wer bist du noch mal?«
»Ich bin das Mädchen, mit dem ihr in den fünf Tagen, die wir uns schon eine Kabine teilen, kein einziges Wort gesprochen habt.« Brooklyn zog den Gummihandschuh von ihrer Hand ab und ließ ihn auf den Tisch fallen. »Okay, verschwinden wir.«
Sie ging in eine Ecke des Labors und öffnete eine Luke, hinter der eine Leiter zum Maschinendeck hinunterführte.
»Wir gehen da runter?«, fragte Judy.
»Richtig«, sagte Brooklyn. »Dort haben wir das ideale Versteck gefunden.«
»Du sprichst schon wieder von ›wir‹«, sagte Judy. »Wer ist ›wir‹ und was ist das für eine Operation?«
»Der MI6 hat Hinweise auf eine mögliche Bedrohung erhalten, die gleichzeitig dem Parlament und der königlichen Familie gilt«, erklärte Brooklyn. »Man ging davon aus, dass der Schauplatz London sein würde, Westminster oder der Buckingham Palace, aber dann hat jemand festgestellt, dass ihr beide diese Schiffsreise macht, und beschlossen, nur für den Fall Agenten mitzuschicken.«
»Du bist eine Agentin des MI6?«, fragte Alice ungläubig.
»Lass uns nicht darüber diskutieren, was ich bin«, sagte Brooklyn. »Wir steigen jetzt einfach diese Leiter hinunter, bevor jemand anders ins Labor kommt.«
Tatsächlich waren drei Agentinnen des MI6 an Bord. Sydney und Brooklyn hatten den Auftrag, Alice und Judy zu schützen, und eine erwachsene Agentin war in die Schiffsbesatzung eingeschleust worden mit der Aufgabe, gegen mögliche Piraten zu kämpfen.
Entsprechend ihrem streng geheimen Status innerhalb des Geheimdienstes hatten Sydney und Brooklyn keine Ahnung, wer diese Agentin war, wie auch die Agentin keine Ahnung hatte, dass Sydney und Brooklyn nicht nur zwei intelligente Schülerinnen waren, die sich für Meeresbiologie interessierten.
»Igitt«, sagte Alice, als sie am Fuß der Leiter ankamen. »Wonach stinkt es hier?«
»Dieser Gestank wird euch das Leben retten«, sagte Brooklyn. Sie musste lauter sprechen, um über den Generatoren gehört zu werden, die das Schiff mit Strom versorgten. »Er ist eine Mischung aus Salzwasser, Dieselkraftstoff und Schmieröl. Wir befinden uns in den Eingeweiden des Schiffes und unser Ziel ist der Maschinenraum des Heckstrahlruders.«
»Habe ich das auch nicht mitbekommen, weil ich nicht aufgepasst habe?«, fragte Judy in ihrem gewohnten abfälligen Ton.
»Nein«, sagte Brooklyn. »Den kennt niemand, deshalb ist er ja auch ein so ausgezeichnetes Versteck.«
Tief im Schiffsbauch gelangten sie in einen Raum voller Maschinen. Quer hindurch verlief eine riesige stählerne Welle, die den Maschinenraum mit dem Propeller verband. Weil das Schiff vor Anker lag, drehte die Welle sich nicht. Über ihr befand sich eine Plattform, die so groß war, dass zwei Mädchen sich darauf verstecken konnten.
»Dort oben findet euch niemand«, sagte Brooklyn und zeigte auf die Plattform. »Steigt hinauf und wartet. Rührt euch nicht von der Stelle, bis ich euch hole oder jemand anders, der das Codewort ›Apfelschnaps‹ kennt.«
Alice rümpfte wieder die Nase über den Gestank und wollte etwas sagen, aber Brooklyn ließ sie nicht zu Wort kommen.
»Und eins versprech ich euch wenn ihr jetzt anfangt zu jammern, schicke ich die Piraten hier runter. Kapiert?«
Alice nickte. »Ja.«
»Versteckst du dich nicht mit uns?«, fragte Judy.
Brooklyn schüttelte den Kopf. »Nein. Ich muss ein Notsignal absetzen. Aber ihr seid hier sicher.«
Alice sah sie an. »Danke, äh …« Sie verstummte, weil sie ganz offensichtlich Brooklyns Namen nicht wusste.
»Im Ernst?«, fragte Brooklyn ungläubig. »Wir leben seit fünf Tagen auf engstem Raum zusammen und du weißt trotzdem nicht, wie ich heiße?«
»Schon verstanden«, sagte Alice. »Ich bin eine total verwöhnte Zicke. Aber ich werde das wiedergutmachen. Sag mir, wie du heißt, und ich verspreche dir, dass ich es nicht vergessen werde. Nie.«
Brooklyn wollte etwas antworten, überlegte es sich aber anders. »Eigentlich ist es besser, wenn du es nicht weißt«, sagte sie. »Denn wenn alles vorbei ist und die Leute euch fragen, wie ihr es überstanden habt, erwähnt ihr mich am besten gar nicht.«
2.
SYDNEY
In ihren drei Jahren beim MI6 hatte Sydney schon kopfüber an einem Felsen gehangen, war durch das Eis eines zugefrorenen Teichs gebrochen, hatte sich mehr als einmal die Augenbrauen versengt und war mit einem selbst gebastelten Sprengsatz in den Händen über die Waggondächer eines schnell fahrenden indonesischen Personenzugs gerannt. Einmal war sie sogar der albanischen Geheimpolizei entkommen, indem sie sich in einer Abwasserleitung versteckt hatte. Einer Leitung, die in Gebrauch war.
Aber viel schlimmer noch als alle schwierigen, gefährlichen und entsetzlich stinkenden Seiten des Jobs war für Sydney, dass sie niemandem davon erzählen konnte. Züge, Augenbrauen und Kanalisation, alles unterlag der Schweigepflicht. Nur das Team durfte davon erfahren, sonst niemand.
Nicht umsonst lautete die erste Hälfte des Wortes Geheimagent »geheim«.
Und während der Woche auf der Sylvia Earle hatte sie besonders darunter gelitten. Umgeben von den tollsten Wissenschaftlerinnen, die sie gern beeindruckt hätte, und einer Schar ziemlich eingebildeter Mädchen, die sie gern ein wenig zurechtgestutzt hätte, konnte sie doch kein Wort darüber sagen, was ihr Leben so wahrhaft spektakulär machte. Stattdessen verlangte der Job von ihr, dass sie möglichst unsichtbar und anonym blieb.
Was ihr auch gut gelang. So gut, dass während der ganzen Entführung niemand außer Brooklyn bemerkt hatte, dass sie verschwunden war. Sie befand sich nicht unter den Mädchen, die man auf dem Hauptdeck zusammengetrieben hatte, und auch nicht unter denen, die sich in der Wäschekammer versteckt hielten und dort von den Piraten entdeckt worden waren. Sie war nirgends zu finden, weil sie, während die Piraten die Sylvia Earle übernahmen, im Meer tauchte.
In zwölf Metern Tiefe, um genau zu sein.
Sydney hatte das Schiff heimlich zu einem unerlaubten Tauchgang verlassen, in der Hoffnung, dadurch einen klaren Kopf zu bekommen. Etwas machte ihr seit Wochen zu schaffen, ohne dass sie es genau hätte benennen können. Etwas an ihrer Rolle im Team fühlte sich nicht mehr richtig an, und immer wenn sie über etwas nachdenken musste, tat sie das am liebsten am oder im Meer.
Sie war in Australien in Strandnähe aufgewachsen und fühlte sich im Wasser am meisten zu Hause, egal ob beim Surfen, Schwimmen oder Tauchen. Sie war staatlich geprüfte Tauchlehrerin und an der Elite-Tauchschule der Royal Navy ausgebildet worden. Das bedeutete, dass sie von Bergungsaktionen auf offener See bis hin zu Unterwassersabotage alles beherrschte. Und natürlich wusste sie auch genau, dass man mitten in der Nacht nicht allein tauchen ging. Aber zu wissen, was richtig war, bedeutete für Sydney nicht immer, auch entsprechend zu handeln.
Laut ihrer jüngsten Beurteilung durch den MI6 war sie »praktisch allergisch gegen jede Art von Vorschriften«. Trotzdem war es selbst für sie ungewöhnlich, so viele auf einmal zu brechen. Im Moment waren es mindestens sechs:
In den Tauchschrank einbrechen
Unerlaubt Taucherausrüstung »ausleihen«
Ohne erwachsenen Aufpasser ins Wasser gehen
Ohne genügend Tageslicht ins Wasser gehen
Tauchen ohne Partner
Und besonders schwerwiegend: während einer Mission des MI6 einfach verschwinden
Letzteres wurde noch dadurch verschlimmert, dass Sydney die Alpha der Mission war, anders ausgedrückt, dass sie den Einsatz vor Ort leitete. Vor sich selbst hatte sie ihren Verstoß dadurch gerechtfertigt, dass nach fünf ereignislosen Tagen auf See bestimmt nichts mehr passieren würde.
Der MI6 hatte von Anfang an recht, dachte sie, als sie sich im Taucherraum umzog. London ist ein viel wahrscheinlicheres Ziel als ein Forschungsschiff, das durch die Shetlandinseln fährt.
Außerdem musste sie ständig an das Phytoplankton denken.
Bei einer ihrer Laboreinheiten hatte die Chefwissenschaftlerin ihnen von dem biolumineszierenden Phytoplankton erzählt, mikroskopisch kleinen Meeresorganismen, die im Dunkeln leuchteten. Zu Demonstrationszwecken hatte sie das Licht ausgeschaltet und ein mit Wasser gefülltes Glas hochgehalten, in dem sich einige Exemplare der Gattung befanden.
Sie hatte das Glas geschüttelt und das Wasser hatte sich in einen Wirbel magisch blauen Lichts verwandelt. Sydney war fasziniert. Als die Frau weiter erklärte, man habe die Probe eben erst dem Gewässer entnommen, in dem die Sylvia Earle ankerte, begann Sydney zu planen.
Der Plan war aber trotz allem mehr ein Traum gewesen, bis das Schnarchen sie mitten in der Nacht geweckt hatte. Lady Hawthorne und Judy Somersby schnarchten so viel und laut, dass Sydney ihnen die Spitznamen Blashorn und Brummhummel verpasst hatte. Bisher hatte sie den beiden das Kopfkissen um die Ohren hauen wollen, wenn sie sie beim Schlafen störten, aber diesmal sah sie es als Chance. Es war kurz vor vier, sie hatte also gerade genug Zeit, tauchen zu gehen und wieder aufs Schiff zurückzukehren, bevor die anderen aufwachten.
Die erste halbe Stunde klappte alles perfekt. Sie glitt durchs Wasser und zog einen Schweif aus Licht hinter sich her. Die Probleme, die ihr zu schaffen gemacht hatten, schienen jetzt weit weg. Und dass sie gegen die Vorschriften verstieß, gab ihrem rebellischen Herzen einen zusätzlichen Kick. Sie war entspannt und zugleich aufgekratzt.
Dann hörte sie den Motor.
Es konnte nicht die Maschine der Sylvia Earle sein, dazu klang er zu klein, aber das schrille Winseln war unmissverständlich. Ein anderes Boot näherte sich ihnen, und zwar sehr schnell, dem Geräusch nach zu urteilen.
Von so tief unten war es kaum mehr als ein über ihr vorbeiziehender Tintenfleck. Als das Boot bei der Sylvia Earle längsseits ging, begann Sydneys Herz zu klopfen. Sie musste so schnell wie möglich zum Schiff zurück, aber sie musste auch aufpassen. Wenn sie zu rasch aufstieg, konnte das ernsthafte gesundheitliche Probleme verursachen und die Situation nur noch schlimmer machen.
Auf halbem Weg nach oben musste sie einen fünfminütigen Dekompressionsstopp einlegen, damit ihr Körper sich an den geänderten Wasserdruck anpassen und das im Blut gelöste Gas wieder abbauen konnte.
Während sie wartete, hörte sie den Motor erneut aufheulen. Sie blickte nach oben und sah, dass das Boot zum Heck der Sylvia Earle fuhr. Sie war jetzt nahe genug, um die Umrisse zu erkennen. Es handelte sich um ein leistungsstarkes Zodiac-Schnellboot, ein Schlauchboot für bis zu zwölf Personen. Die Royal Marines verwendeten solche Boote für Überfallkommandos, aber Sydney war sich ziemlich sicher, dass auf diesem Boot keine Royal Marines waren.
Sie blickte auf ihre Taucheruhr und sah, dass sie noch weitere vier Minuten und dreizehn Sekunden warten musste. Statt sich darüber aufzuregen, dass sie sich in diese Lage gebracht hatte, versuchte sie die Zeit zu nutzen und zu überlegen, was sie tun sollte. Sie ging den Plan durch, den sie am Anfang des Einsatzes gemeinsam entworfen hatten. Er war gut. Brooklyn war zwar noch neu beim MI6, hatte aber bereits gezeigt, dass sie eine hervorragende Agentin war. Sydney war überzeugt, dass sie es schaffen würde, Alice und Judy zu dem Versteck im Maschinenraum des Heckstrahlruders zu bringen. Das bedeutete, dass die beiden vorerst sicher waren.
Was würde Mother jetzt tun?, fragte sie sich.
Mother war der MI6-Agent, der ihr Team leitete. Er dachte sich immer wieder Sprüche aus, sogenannte Mother-Sprüche, die ihnen helfen sollten, sich die Grundprinzipien der Spionagekunst zu merken. Sydney versuchte sich an einen passenden Satz zu erinnern. Es fiel ihr auch einer ein: Es ärgern einen viele Sachen, doch können sie dich stärker machen. Der Spruch forderte dazu auf, Negatives in Positives zu verwandeln, Schwächen in Stärken.
Sie war nicht an ihrem Platz, was negativ war, ein Nachteil. Dafür war sie an einem Ort, an dem niemand sie vermutete, was ein großer Vorteil sein konnte. Sie hatte das Überraschungselement auf ihrer Seite.
Noch fünfzehn Sekunden.
Das reicht, dachte sie, begann wie wild mit ihren Flossen zu treten und stieg rasch zur Oberfläche auf.
Zuerst überprüfte sie, ob sich noch jemand an Bord des Schlauchboots befand. Das Boot war leer, also schwamm sie hinüber, zog sich daran hoch und blickte hinein. Als sie die braune Holzkiste mit den Seilgriffen sah, stieg Panik in ihr auf.
»Mist!«, rief sie leise, denn sie kannte solche Kisten aus ihrer Ausbildung. »Das ist nicht gut.«
Es handelte sich um einen Munitionsbehälter der britischen Army für C4, einen militärisch verwendeten Plastiksprengstoff. Noch schlimmer war: Der Behälter stand offen – und war leer. Sie musste davon ausgehen, dass der Sprengstoff eingesetzt werden sollte, und zwar irgendwo auf der Sylvia Earle.
Es fiel ihr immer schwerer, Ruhe zu bewahren.
Sie sah sich nach einem Funkgerät um, mit dem sie Hilfe holen konnte, fand aber nur ein kleines gelbes Walkie-Talkie. Sie vergewisserte sich, dass die Lautstärke auf leise gestellt war, und schaltete es ein. Zuerst blieb alles still, dann hörte sie einen Wortwechsel.
»Habt ihr sie gefunden?«, fragte eine Stimme ungeduldig.
»Nein«, kam die zögernde Antwort. »Ihre Kabine ist leer.«
»Und Karl?«
Es folgte eine kurze Pause. »Ist auch spurlos verschwunden.«
Der erste Sprecher stöhnte ungeduldig. »Dann findet sie, aber schnell!«
Sydney wusste nicht, wer Karl war, aber die anderen, nach denen die Männer suchten, waren vermutlich Alice und Judy, was bedeutete, dass Brooklyn ihren Auftrag erledigt hatte. Gut gemacht, dachte Sydney erleichtert. Jetzt bin ich dran. Was soll ich tun? Sie dachte wieder an den Sprengstoff. Wie kann ich helfen?
Ein anderer Mother-Spruch fiel ihr ein. Wenn du einmal weißt nicht weiter, denk gründlich nach, das macht gescheiter.
Sie musste herausfinden, wo die Bombe war. Das war zu schaffen. Sie kannte sich nicht nur mit Sprengstoffen aus, sondern hatte, bevor der Einsatz losging, zusammen mit Brooklyn detaillierte Pläne der Sylvia Earle studiert.
Wo würde ich die Bombe deponieren, wenn ich ein Verbrecher wäre?, überlegte sie. Auf der Brücke? Im Maschinenraum? In einer Kabine?
Dann fiel ihr ein, dass das Schnellboot einen Moment längsseits der Sylvia Earle angehalten hatte. Die Bombe ist gar nicht auf dem Schiff, dachte sie und musste lächeln. Denn dort könnte sie jemand finden. Die Piraten haben sie außen am Rumpf befestigt.
Sie zog sich die Tauchermaske wieder über das Gesicht und glitt lautlos ins Wasser zurück. Es war Zeit, sich an die Arbeit zu machen.
3.
21 MINUTEN UND 13 SEKUNDEN
HAUPTDECK DES FORSCHUNGSSCHIFFES SYLVIA EARLE
Emil Blix hatte noch nie jemanden entführt und seine mangelnde Erfahrung machte sich jetzt bemerkbar. Mit der Erstürmung der Brücke hatte alles gut angefangen, aber seitdem hatte die Lage sich stetig verschlechtert. Zuerst hatte es viel länger als erwartet gedauert, die Passagiere auf dem Hauptdeck zu versammeln. Dann war einer seiner Leute verschwunden, nachdem er über sein Walkie-Talkie noch um etwas gebettelt hatte, das wie »Ge-Ge-Gi« klang. Entscheidend war allerdings, dass seine Leute die beiden Personen nicht hatten finden können, die er eigentlich entführen wollte.
»Wo sind die zwei?«, rief er ungeduldig und hielt Fotos von Alice und Judy hoch. Er sprach zu einem Dutzend Mädchen, die aneinandergedrängt auf der Beobachtungsplattform für Meeressäuger standen. Von hier aus hatten sie am Vortag mit staunenden Augen eine Herde von Orcas am Steuerbordbug vorbeischwimmen sehen. Jetzt war ihr Blick ängstlich auf Blix gerichtet, der vor ihnen auf und ab ging.
Es war kurz nach sechs und die frühe Morgenluft war kalt und feucht. Eine Vierzehnjährige namens Ashlee wollte besonders mutig sein und sagte: »Wir wissen es nicht. Wir haben alle geschlafen. Niemand hat sie gesehen.«
»Eine von euch muss es wissen!«, brüllte Blix. Er hatte, nachdem alle Handys beschlagnahmt waren, seine Sturmhaube abgenommen und man konnte sehen, dass er vor Wut rot angelaufen war. »Wenn ihr es mir nicht sagt, wird das schlimme Folgen haben!«
Seine Worte zeichneten sich durch zweierlei aus: Sie klangen bedrohlich und sie entsprachen der Wahrheit. Der Sprengsatz, den er am Rumpf des Schiffes befestigt hatte, würde in einundzwanzig Minuten und dreizehn Sekunden explodieren. Die Zeit wurde allmählich knapp für Emil Blix.
Brooklyn verfolgte das Geschehen von einem Versteck hinter der eisernen Treppe, die vom Hauptdeck zum Ruderhaus hinaufführte. Geduckt spähte sie durch den Spalt zwischen zwei Stufen zu den Mädchen auf der Plattform. Von der Schiffsbesatzung oder den Wissenschaftlerinnen stand niemand bei ihnen, woraus sie schloss, dass die Erwachsenen an einem anderen, sichereren Ort festgehalten wurden. Aber auch Sydney fehlte.
Wo bist du, Syd?, dachte sie. Was hast du vor?
AUSSENRUMPF DER SYLVIA EARLE
Sydney hatte zwei Zahlen im Kopf, die sie möglichst auseinanderhalten musste. Die eine Zahl war die Fünfundsechzig. So viele Meter war die Sylvia Earle lang. Sydney wusste das, weil sie während der Vorbereitung auf den Einsatz sämtliche Daten, die mit dem Schiff zu tun hatten, auswendig gelernt hatte. Fünfundsechzig Meter wirkten nicht besonders lang, wenn man eine schematische Darstellung auf einem Computerbildschirm betrachtete. Schließlich war die Bahn eines Schwimmbeckens bei den Olympischen Spielen auch schon fünfzig Meter lang. Aber als sie jetzt auf der Suche nach dem Sprengsatz am Schiff entlangschwamm, fühlte sich die Strecke sehr lang an. Und sie kam kaum voran, weil sie gegen die Meeresströmung anschwimmen und über und unter dem Wasser nachsehen musste und weil sie außerdem eine schwere Taucherausrüstung trug, die der Sicherheit diente und nicht der Schnelligkeit.
Die andere Zahl war die Fünfzig. Auf sie zeigte die Nadel an ihrem Luftdruckventil. Die Zahl war rot, denn wer bei ihr angekommen war, musste seinen Tauchgang demnächst beenden. Sie hatte höchstens noch für eine Viertelstunde Luft im Tank, und das auch nur, wenn sie ruhig und gleichmäßig atmete. Vor Aufregung atmete sie aber natürlich tiefer ein und verbrauchte die wenige noch verbleibende Luft schneller.
Sie entdeckte den Sprengsatz schließlich am hinteren Ende des Schiffes. Er hing etwa einen Meter unter der Wasserlinie am stählernen Rumpf, befestigt mit einer magnetischen Vorrichtung, einer sogenannten »Haftmine«. In der Marine-Tauchschule hatte Sydney von diesen Minen gehört. Eine ihrer problematischen Eigenschaften war, dass Haftminen darauf eingestellt werden konnten, zu explodieren, sobald sich jemand an ihnen zu schaffen machte.
Noch problematischer war allerdings der Ort, an dem sie befestigt war. Haftminen waren nicht dazu gedacht, Schiffe in die Luft zu jagen oder sie wie Torpedos zu versenken. Sie sollten sie manövrierunfähig machen. Wenn diese Mine ausgelöst wurde – sei es durch Fernbedienung oder Zeitschaltuhr –, würde sie ein Loch in den Rumpf sprengen, durch das Wasser ins Schiff eindrang. Wenn Küstenwache und Navy am Tatort eintrafen, hätten sie alle Hände voll damit zu tun, die Passagiere zu evakuieren und irgendwie das Schiff zu retten, was den Piraten zusätzliche Zeit zur Flucht verschaffte.
Aber es drohte noch eine weitere Gefahr. Als Sydney den Strahl ihrer Tauchlampe über den Rumpf gleiten ließ, sah sie nur wenige Meter vom Sprengsatz entfernt die Querstrahlsteueranlage, die der Stabilisierung des Schiffes diente. Das hieß, dass die Mine an der Außenwand des Maschinenraums des Heckstrahlruders befestigt war.
Wenn Brooklyn nach Plan vorgegangen war, befanden sich Judy und Alice jetzt im Herzen der Sprengzone.
HAUPTDECK DER SYLVIA EARLE
Brooklyn wusste, dass sich eine dritte Agentin des MI6 an Bord befand, aber sie wusste nicht, wer es war. Sie und Sydney hatten auf der Fahrt versucht, es herauszufinden. In den ersten Tagen hatten sie vermutet, dass es sich um eine bestimmte Wissenschaftlerin handelte, dann hatten sie sich für Hannah Delapp als wahrscheinlichste Kandidatin entschieden. Hannah war die Zweite Offizierin und die Mädchen hatten sie unter Verdacht, weil sie als neuestes Mitglied der Besatzung erst für diese Fahrt auf das Schiff gekommen war. Sie übernahm normalerweise die Nachtschicht auf der Brücke, war aber trotzdem oft auch nachmittags unterwegs, wenn sie eigentlich hätte schlafen sollen, und schien das Leben auf dem Schiff aufmerksam zu verfolgen.
»Total die Spionin«, hatte Sydney wissend erklärt.
Hannah hatte Dienst gehabt, als das Schiff überfallen wurde, was bedeutete, dass die Piraten sie womöglich überwältigt hatten, bevor sie einen Notruf absetzen konnte. Brooklyn musste davon ausgehen, dass niemand an Land von der Gefahr wusste. Und sosehr sie Sydney finden wollte, ihre vordringliche Aufgabe war, das Sicherheitsalarmsystem des Schiffes zu aktivieren. Es funktionierte wie der stille Alarm einer Bank. Wenn Brooklyn es auslöste, würde an Bord der Sylvia Earle niemand etwas hören, aber auf dem Festland würden die Alarmglocken schrillen und man würde sofort Hilfe an ihre Position entsenden.
Die Schwierigkeit war, dass der Auslöseknopf des Systems sich auf der Brücke befand, und Brooklyn wusste nicht, wie sie dorthin kommen sollte, ohne von den Piraten gesehen zu werden. Sie musste die Entführer durch ein dramatisches Manöver so lange ablenken, dass sie die Treppe zur Brücke hinaufsprinten konnte, bevor jemand begriff, was geschah.
Das Beste, was ihr einfiel, war der riesige Portalkran am Heck des Schiffes. Der Kran war dazu gedacht, Boote und Bojen aus dem Meer zu heben, aber vielleicht konnte sie ihn auch dazu benutzen, die Eindringlinge ans Heck zu locken. Wenn es ihr nur gelang, ihn in Gang zu setzen, dann mussten die Entführer nachsehen, was los war, und das verschaffte ihr vielleicht schon die nötige Zeit. Sie überlegte gerade, ob es wohl eine Fernbedienung gab, da spürte sie eine Hand auf der Schulter.
Eine sehr große Hand.
Sie drehte sich um. Ihr alter Freund, Mr Ge-ge-gi, hatte es geschafft, aus der Kammer des Nasslabors auszubrechen. Sein Kinn war geschwollen, sein Gesicht mit roten Flecken übersät und seine Lippen waren dick und violett. Trotzdem tat Brooklyn so, als sei er ein alter Freund, den sich lange nicht gesehen hatte.
»Na, das nenne ich eine Überraschung«, sagte sie mit einem Lächeln. »Sie erholen sich ja richtig gut. Haben Sie das Gegengift gefunden?«
Seine Antwort bestand aus einem Knurren, dann packte er sie an der Schulter und zerrte sie hinter der Treppe hervor. Während er sie zu Brix führte, suchte Brooklyn in Gedanken fieberhaft nach einer Art von Plan.
Leider ohne Erfolg.
»Wo warst du denn, Karl?«, fragte Blix ärgerlich. »Ich habe versucht, dich zu erreichen …« Er bemerkte Karls Verletzungen und verstummte für einen Moment. »Was ist mit deinem Gesicht passiert?«
Karl wollte etwas antworten, aber Zunge und Lippen gehorchten ihm noch nicht vollständig, der »Rosen-Seeigel« klang deshalb wie »Hosenziegel«. Statt es noch einmal zu versuchen, zeigte er nur auf die Fotos von Alice und Judy in Blix’ Hand und dann auf Brooklyn.
Die Botschaft war auch ohne Worte gut zu verstehen.
Blix sah Brooklyn an. »Du weißt, wo sie sind.« Er lächelte finster und fügte hinzu: »Wie schön.«
Brooklyn versuchte sich herauszureden. »Also, eigentlich weiß ich nur …«
Aber Karl ließ sie nicht ausreden. Er hielt ihr mit seiner linken Pranke den Mund zu und sagte etwas, das so ähnlich klang wie »Sie weiß es«.
»Ausgezeichnet«, sagte Blix höhnisch. »Bring mich zu den beiden, aber schnell.«
»D-d-das g-geht nicht«, stotterte Brooklyn.
Blix trat dicht an sie heran und senkte den Kopf, sodass sie praktisch Nase an Nase voreinanderstanden. »Aber sicher geht das.«
Brooklyn suchte nach einem hilfreichen Mother-Spruch, aber ihr fiel kein einziger ein. Sie konnte nur noch Zeit schinden. Und das funktionierte am besten, wenn sie aufhörte, wie eine Spionin zu denken, und sich stattdessen wie eine Zwölfjährige verhielt. Falsche Tränen traten ihr in die Augen.
»Wenn ich Sie zu Alice und Judy bringe, dann sehen die mich doch«, schluchzte sie. »Und die auch.« Sie nickte in Richtung der anderen Mädchen. »Alle werden wissen, dass ich Ihnen geholfen habe. Und wissen Sie, was die für Eltern haben? Judys Mutter sitzt im Parlament und Alice ist Mitglied der königlichen Familie. Die werden mein Leben ruinieren. Ich fliege aus der Schule und alles geht den Bach runter.«
Blix kicherte. »Das ist nicht mein Problem.«
Brooklyn wischte sich ein paar Tränen von den Wangen und wandte den Blick ab, wie um sich zu fassen. Da fiel ihr der Rundgang über das Schiff ein, den sie kurz nach der Abfahrt aus Aberdeen mit der Kapitänin gemacht hatten, und in ihrem Kopf nahm ein Plan Gestalt an. »Ich kann Sie wirklich nicht zu ihnen bringen«, sagte sie ruhiger. Flüsternd fügte sie hinzu: »Aber ich kann Ihnen zeigen, wo sie sind.«
»Was soll das heißen?«
»Es gibt hier einen genauen Plan des Schiffes. Gehen Sie mit mir da hin und ich zeige Ihnen, wo Judy und Alice sich verstecken. Dann sehen die beiden mich nicht und niemand erfährt, dass ich Ihnen geholfen habe.«
»Du hast hier nichts zu …«
Brooklyn fiel ihm ins Wort: »Wollen Sie sie finden oder nicht?«
Blix war zwar nicht in der Stimmung, sich von einer Zwölfjährigen herumkommandieren zu lassen, aber er durfte keine Zeit verschwenden. Bis zur Explosion der Bombe dauerte es nicht einmal mehr siebzehn Minuten, und damit sein Plan aufging, mussten Alice und Judy noch vorher im Schlauchboot sitzen.
»Also gut«, sagte er. »Wo befindet sich dieser Plan?«
Jetzt wäre es an Brooklyn gewesen, zu lächeln, aber sie unterdrückte es lieber. »Oben im Ruderhaus … auf der Brücke.« Wie sich herausstellte, brauchte sie den Kran gar nicht. Sie war selbst die Ablenkung.
AUSSENRUMPF DER SYLVIA EARLE
Im Unterschied zu den Bomben in Action-Filmen, bei denen auf gut lesbaren digitalen Displays immer alle sehen konnten, wie viel Zeit sie noch hatten, gab die Haftmine Sydney keinerlei Hinweis darauf, wann sie explodieren würde. Weil die Piraten sie bestimmt nicht zündeten, solange sie selbst noch an Bord waren, musste sie sich vermutlich keine Sorgen machen, bevor sie den Motor des Schnellboots hörte. Na ja, »keine Sorgen« war vielleicht der falsche Ausdruck, aber jedenfalls redete sie sich das ein.
Dagegen wusste sie, dass sie nur noch für wenige Minuten Luft im Tank hatte. Die Nadel des Luftdruckventils stand inzwischen deutlich im roten Bereich der Anzeige. Sydney versuchte ganz langsam und flach zu atmen, während sie die Mine betrachtete.
In der Ausbildung hatte sie mit Haftminen gearbeitet, die für das Militär hergestellt worden waren, aber die hier sah mehr aus, als sei sie in einer Garage zusammengebaut worden. Das war gut und schlecht. Gut, weil die Mine dann vielleicht irgendeinen Fehler hatte, den Sydney sich zunutze machen konnte. Schlecht, weil sie womöglich zufällig losging.
Sie sah aus wie eine Schüssel aus Metall mit zwei langen, am Rumpf entlang ausgestreckten Fingern. Die Magneten saßen an den Fingern. Sydney untersuchte gerade einen davon genauer, da hörte sie ein unschönes Geräusch. Ein Klicken in ihrem Atemregler. Sie hatte es noch nie gehört, aber sie wusste, was es bedeutete.
Sie hatte keine Luft mehr.
4.
BUMM!
Umbra war ein weltweites Verbrechersyndikat, dem es ausschließlich ums Geld ging. Selbst die Entscheidung, Alice und Judy zu entführen, war nur profitorientiert und hatte keinerlei politische Hintergründe. Das Syndikat hatte keine Meinung zur britischen Monarchie und ihm war egal, welche Partei Judys Mutter im Parlament vertrat. Wichtig war allein, dass die Familien der beiden Mädchen die Mittel hatten und auch bereit sein würden, ein hohes Lösegeld für ihre Töchter zu zahlen.
Blix hatte die Gelegenheit, die Operation durchzuführen, sofort ergriffen. Er hatte bis dahin hauptsächlich als Schmuggler gearbeitet, der gestohlene Waren von Nordseehafen zu Nordseehafen transportierte. Dies war seine Chance, den Bossen der Organisation zu zeigen, dass er mehr konnte.
Es war ein Test … und er war dabei, kläglich zu scheitern.
Ihm war inzwischen klar, dass er mehr Leute hätte mitbringen sollen. Auf dem Schnellboot waren sie zu siebt gewesen, aber vier waren damit beschäftigt, die Geiseln zu bewachen, jeweils zwei eine Gruppe, und einer war auf der Brücke und überwachte die Kommunikation. Ihm blieb also nur Karl, und wegen dessen unerklärtem Verschwinden lagen sie im Zeitplan zurück.
Blix hoffte, dass Brooklyn die Lösung für seine Probleme war. Wenn sie ihn zu Alice und Judy führte, waren sie wieder auf Kurs. Als er mit ihr zur Brücke hinaufstieg, sah er zu seiner Überraschung, dass Karl ihnen folgte. »Wohin willst du?«
»Mit euch mitkommen«, nuschelte Karl.
»Warum?«
Karl wies mit einem Nicken auf Brooklyn. »Die hat ganz schön Tricks auf Lager.«
»Sie ist zwölf«, gab Blix zurück. »Ich denke doch, ich habe alles unter Kontrolle. Warum hilfst du nicht bei den Geiseln? Mit deinem Gesicht müsstest du sie immerhin einschüchtern können.«
Karl nickte betreten und machte sich auf den Weg zur Beobachtungsplattform, während Blix und Brooklyn die Treppe weiter hinaufstiegen.
»Hast du sein Gesicht so zugerichtet?«, fragte Blix mehr aus Neugier als aus Ärger.
»Ich weiß nicht, wovon Sie reden«, antwortete Brooklyn wenig überzeugend.
Blix lachte. »Sehr interessant.«
Brooklyn betrachtete ihn beim Gehen, auf der Suche nach Details, die sie später an den MI6 weitergeben konnte. Er hatte schwarze Haare und einen dicken Bart. Hinter seinem Ohr verlief eine gezackte Narbe, außerdem bemerkte sie zwei Tattoos: einen blauroten Wolf seitlich an seinem Hals und eine Gruppe von drei Sternen auf dem Rücken seiner linken Hand.
»Woher wissen Sie eigentlich, dass ich zwölf bin?«, fragte sie. »Haben Sie biografische Angaben zu allen Passagieren?«
»Nein, aber ich aber drei Töchter im Teenageralter. Ich weiß, wie ein zwölfjähriges Mädchen aussieht.« Er brach ab und fügte dann hinzu: »Ich weiß auch genau, wie trickreich sie sein können.«
Brooklyn war überrascht. Dass Terroristen Eltern sein könnten, war ihr nie in den Sinn gekommen. »Sie haben Kinder?«

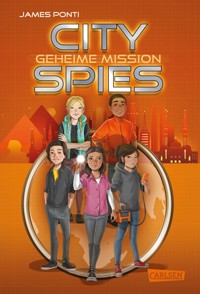















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











