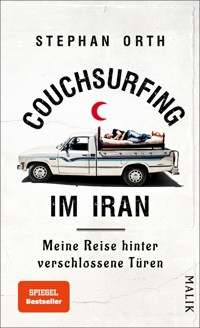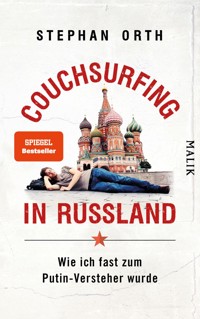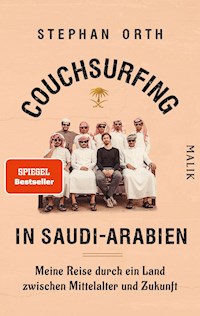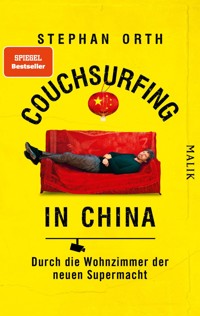13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vom Mut, der Hoffnung und einem Leben im Ausnahmezustand Bestsellerautor Stephan Orth hat den Krieg Russlands gegen die Ukraine von Anbeginn intensiv miterlebt. Durch seine ukrainische Freundin Yulia verbindet ihn ein besonderes Band mit dem Land. Wie geht es den Menschen, die geblieben sind? Wie sieht ihr Alltag aus, was gibt ihnen Hoffnung? Und was hat das alles mit uns zu tun? Mit diesen Fragen reist er nach Kyjiw und Odesa, nach Charkiw und in die Karpaten. Er wohnt bei Einheimischen, hört ihre Geschichten, ist beeindruckt von ihrem Mut und Lebenswillen – und packt selbst beim Wiederaufbau mit an. Persönliche Einblicke und Begegnungen auf Augenhöhe Sein bewegender Bericht verleiht den Ukrainerinnen und Ukrainern eine Stimme und ermöglicht uns eine Perspektive, die weit über den Krieg hinausreicht. »Stephan Orth versteht es hervorragend, Land und Leute für den Leser lebendig werden zu lassen.« Westdeutsche Allgemeine Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.malik.de
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Couchsurfing in der Ukraine« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Mit 48 farbigen Fotos, 45 Schwarz-Weiß-Abbildungen und einer Karte
Die Schreibweise von Orten und Namen in diesem Buch folgt, soweit dies passend ist, der Transkription des ukrainischen kyrillischen Alphabets.
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaas-buchgestaltung.de
Coverabbildung: Foto: Mychajlo Palintschak © Abgebildete Streetart: Banksy / Thomas Baumgärtel
Fotos: Stephan Orth, außer anders angegeben
Karten: Birgit Kohlhaas, München, unter Verwendung von Illustrationen von Shutterstock und Adobe (Übersichtskarte); Angelika Tröger unter Verwendung einer Umrisskarte von Roman/Adobe Stock (Kapitelkarten)
Litho: Lorenz & Zeller, Inning am Ammersee
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44 b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Letztlich werden wir alle zu Geschichten.
Margaret Atwood
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Karte der Ukraine
Київ
Kriegsmüde
Nachtzug nach Kyjiw
Im alltäglichen Ausnahmezustand
Івано-Франківськ
Wandel durch Wandern
Дрогобич
Im Zimmer eines Superhelden
Ein historischer Knall
Харків
Leben und funktionieren
Полтава
Zwanzig Bilder pro Sekunde
Im Rittersaal des Präsidenten
Одеса
Visit Odesa today
Plus oder Minus
Дніпро
Kriegslieder und Friedenslieder
Запоріжжя
Hilfsmission mit Hindernissen
Gedankliche Ausflüge in eine andere Realität
TikTok-Tanz im Land der Träume
Чернівці
Die sicherste Stadt
Вінниця
Die Zukunft wird
Лукашівка
Gemeinsam reparieren
Чернігів
Schöner als sieben schöne Orte
Kaputte Panzer und ein sterbender Schwan
Дніпро
Rasten, essen, lachen
Das sagt Russland
Костянтинівка
Auf der Straße nach Bachmut
Донецька область
Alles wird gut werden
Ritter und Prinzessin
Dank
Bildteil
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Karte der Ukraine
Київ
Kyjiw
Oblast: Kyjiw
Kriegsmüde
Warum diese Reise?
Wurde nicht längst jeder Aspekt des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine beleuchtet, jeder Zeitzeuge befragt, jeder Leitartikel geschrieben, jedes Grauen dokumentiert, jede Kampftaktik analysiert, jede Hilfe diskutiert, jeder Kriegsfortgang prognostiziert, jeder Schrapnellsplitter dreimal umgedreht? Sind wir nicht alle ein bisschen kriegsmüde? Tatsache, ich kenne sogar eine Menge Ukrainer, die extrem kriegsmüde sind. Und heute, nach vielen Wochen unterwegs, heute an meinem Schreibtisch in der Olesia-Honchara-Straße in Kyjiw bin ich es auch. Die Sirenen um zwei Uhr morgens, kurz danach laute Explosionen, wieder kein Schlaf, wie schon in der Nacht davor und der Nacht davor. Der Horror der Kriegsnachrichten auf dem Handy, das Warten auf ein Lebenszeichen von Julijas Papa, der an der Front kämpft. Das ist alles ein bisschen viel, Julija und ich sollten Urlaub machen, irgendwo ins Warme, zehn Tage lang das Handy aus. Wir sollten hier raus, noch heute Abend in den nächsten Zug nach Polen steigen. Ich schäme mich für meine Schwäche, weil ich weniger Schlimmes hinter mir habe als fast jeder der Menschen, die ich getroffen habe. Doch nach allem, was ich gesehen habe, fällt mir das Schreiben schwer. Wie können Worte ausdrücken, was hier passiert? Wie soll man von einem Krieg dieses Ausmaßes erzählen? Vielleicht sollte ich die Arbeit an eine künstliche Intelligenz outsourcen.
Hallo, ChatGPT, bitte erste Seite für ein Buch verfassen, Stichwörter: Krieg, Ukraine, Raketen, Gefahr, Sirenen, Couch. Und natürlich: Liebesgeschichte zwischen dem deutschen Journalisten Stephan und der Ukrainerin Julija, die für eine internationale Organisation arbeitet.
Das war einfach. Buchstaben und Wörter formieren sich auf meinem Handybildschirm, nach zwanzig Sekunden ist der Text fertig:
Im Herzen des kriegsgeplagten Kyjiw, wo das Wehgeschrei der Sirenen die Nacht durchdrang und der Nachthimmel glühte von den feurigen Schweifen ankommender Raketen, stand eine Couch, zerfleddert und abgenutzt, als stille Zeugin für das Chaos draußen. Sie war ein Symbol der Zuflucht mitten im Sturm, ein zerbrechlicher Schutzort in einer Stadt am Rande der Verzweiflung.
Inmitten dieses Tumults ergab sich eine Liebesgeschichte, die jeglicher Unwahrscheinlichkeit trotzte und die Linien zwischen Nationalität und Gefahr verschwimmen ließ. Stephan, ein furchtloser deutscher Journalist mit einer Kamera, die den Horror des Krieges eingefangen hatte, suchte nach Wahrheit inmitten des Chaos.
Julija, eine resolute Ukrainerin, schuftete unermüdlich, um Hilfe zu ihren angeschlagenen Landsleuten zu bringen.
Ihre Pfade kreuzten sich in dieser schicksalhaften Nacht. Inmitten der Zerstörung fanden ihre Herzen Trost in ihrer Umarmung, einer Verbindung, geschmiedet im Schmelztiegel des Krieges.
Sie ahnten noch nicht, dass ihre Liebesgeschichte ein Fanal des Lichtes werden würde in der dunkelsten Stunde der Ukraine, ein Testament der Widerstandskraft des menschlichen Durchhaltevermögens im gnadenlosen Sturm des Krieges.
Nein, lieber Algorithmus. Das ist alles ziemlich dramatisch, herzlichen Dank für den »furchtlosen Journalisten« (haha) und das »Fanal des Lichtes«. Aber so war das nicht, das mit dem Krieg und Julija und der Couch. Und derzeit brauchen wir alle nicht noch mehr Fiktion, wir brauchen mehr Realität. Vielleicht bleibe ich doch noch ein bisschen, sortiere meine Notizen und schreibe alles auf.
Nachtzug nach Kyjiw
Ich könnte mit dem umgedrehten Peace-Zeichen in München anfangen. Oder mit dem goldenen Brot von Wiktor Janukowytsch. Oder mit Wolodymyr aus Dnipro und seinem Song, der den Frieden bringen soll. Aber eigentlich kann es nur mit einer Fahrt im Nachtzug beginnen. Nicht meiner ersten, sondern meiner dritten oder vierten, seit für die Ukraine eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes wegen des Krieges gilt. Für mich beginnt es immer mit einer Nachtzugfahrt. Es ist April 2023, kurz nach Ostern.
Ich habe schon viele Landesgrenzen überquert, aber diesmal ist etwas anders: Kurz hinter Przemyśl im östlichsten Osten Polens trage ich zum ersten Mal in meinem Leben nur Unterhose und T-Shirt bei der Passkontrolle. Eine Soldatin in Tarnuniform klopft an die Tür des Viererabteils, Waggon 9, Platz 22, als ich schon auf meiner blau-weiß bezogenen Pritsche liege. Die Frau trägt ein altertümlich aussehendes Maschinengewehr über der Schulter und eine Bodycam unter dem Hals. Die blauen Einheimischen-Reisepässe der anderen Passagiere nimmt sie wortlos entgegen.
Mich fragt sie: »From Germany? Why to Ukraine?«
»Ich bin auf der Suche nach Realität, Fiktion haben wir schon genug«, könnte ich antworten. Aber das würde komisch klingen und wäre nur ein Teil der Wahrheit. Außerdem lautet die wichtigste Regel bei Grenzübergängen: Verwirre niemals die Wachleute. Also sage ich: »Moja diwtschyna schywe w Kyjewi – meine Freundin lebt in Kyjiw.« Das ist einer von zwei Sätzen auf Ukrainisch, die ich unfallfrei hinbekomme (der andere lautet: »Meine Tante mag keine Mayonnaise.« Danke, Duolingo). Die Beamtin verschwindet mit den geöffneten Pässen in der Hand, und ich ziehe mir was an.
»Aus Deutschland?«, fragt der Mann auf der Pritsche gegenüber. »Hast du uns Leoparden mitgebracht?« »Klar, und Taurus. Zwei Stück liegen unter deinem Sitz«, antworte ich. Sein Händedruck ist robuster, als sein asketischer Körperbau vermuten lässt. Er stellt sich als Kyrylo vor, ist 46 und wohnt in Kyjiw. Leoparden sind Panzer, Taurus heißt eine Rakete. Das sind nun also die Small-Talk-Themen, die auf die Frage nach der Herkunft folgen. Schon sind wir mittendrin in einem Gespräch über aktuelle und erhoffte Waffenlieferungen. Wir fachsimpeln über schwedische Archer-Haubitzen (vier Ladungen pro Minute!) und britische Storm-Shadow-Raketen. Wie zwei Weinkenner, die über gute Jahrgänge diskutieren. Nur dass es halt um tödliche Waffen geht. Noch vor wenigen Monaten wäre ich nicht in der Lage gewesen, auch nur ein Fünkchen Expertise zu einem solchen Gespräch beizutragen. Aber ungewöhnliche Zeiten verlangen ungewöhnliches Fachwissen.
Unser Abteil wirkt eher funktional als schön, mit zwei harten Liegen pro Seite, einer quietschenden Metallschiebetür und einem Fenster, das mit durchsichtiger Folie beklebt ist. Wegen der Raketenangriffe, so entstehen bei einer Detonation weniger Splitter.
Zwei Stunden dauert der Zwischenstopp an der unbeleuchteten Haltestelle Mostyska II, ohne dass jemand aussteigen darf. Man will schon genau wissen, wer da aus Polen über die Grenze kommt. Zwei Stunden Halt, in öffentlichen Fahrplänen stehen die Zeiten. Bei meiner ersten Kriegsfahrt hatte ich große Angst vor einem Angriff auf den Zug. Aber wenn du viermal oder fünfmal fährst und viermal oder fünfmal nichts passiert, dann wird die Angst weniger. Die beste und schlimmste Eigenschaft des Menschen ist, dass er sich gewöhnt.
Kyrylo gratuliert mir zu meiner Reiserichtung, weil derzeit die meisten lieber aus der Ukraine raus- als in die Ukraine reinwollen. Auch er gehört zu den Reinwollern. Als der russische Großangriff begann, lebte er mit seiner Frau, zwei Söhnen und einer Tochter in Mexiko, auf der Yucatán-Halbinsel. Seit vier Jahren schon, das Leben war einfach, das Wetter angenehm, der Job lief gut. Er handelt mit Aktien und Kryptowährungen. Jeden Tag Wahrscheinlichkeiten einschätzen und Wetten eingehen, Gewinn oder Verlust. Je höher der Einsatz, desto größer die Chancen, aber auch die Gefahren. Im Sommer 2022 setzte er alles auf Risiko und entschied sich, mit der Familie zurückzukehren ins eigene Land. Seine Landsleute hätten ihn feiern können für diesen Entschluss, stattdessen wurde er zweimal für verrückt erklärt.
»Das erste Mal von den Grenzschützern, weil ich zurückkam. Und das zweite Mal beim Militär, als ich mich freiwillig zum Kriegsdienst meldete.«
Wer drei oder mehr Kinder hat, ist laut Gesetz von der Wehrpflicht befreit.
»Aber ich muss einfach helfen in diesem Moment«, sagt Kyrylo. »Sobald der Anruf kommt, fange ich mit der Ausbildung an.«
Er trägt Vollbart, eine schwarze Jacke mit Audi-Logo und eine Smartwatch. Immer wieder unterbricht ein jugendlich heiteres Lachen seine Worte. Er war in Krakau, um ein paar Banksachen zu regeln, dort hat er ein Konto.
Wie kommen seine Kinder zurecht in Kyjiw?
»Am Anfang hatten sie Angst. Vor allem, als sie zum ersten Mal Explosionen hörten, im Oktober 2022. Meine Tochter weinte, sie ist sieben. Aber wenn jetzt die Sirene losgeht, sagt sie nur: ›Kollegen, ab in den Korridor.‹ Ganz routiniert. Man muss von den Scheiben weg, weil die von der Druckwelle zersplittern könnten. Wir wohnen im vierzehnten Stock und haben große Fenster.«
Inzwischen könnten die Kids zwischen incoming und outgoing unterscheiden und wüssten, dass iranische Shahed-Drohnen wie Mopeds klängen und russische Raketen wie Düsenjets: ein lautes Pfeifen in der Luft, dann ein Donnern beim Einschlag. Outgoing, also die eigene Luftverteidigung, erzeugt dumpfe Detonationen, gewöhnlich mehrmals hintereinander in kurzer Abfolge. »Einmal habe ich vom Fenster unserer Wohnung beobachtet, wie unsere Luftverteidigung eine feindliche Iskander-Rakete abschoss. Ein unfassbarer Knall.« Er lacht, obwohl das Beschriebene nicht lustig ist.
Die Soldatin klopft wieder an die Schiebetür und gibt uns die gestempelten Pässe zurück. Ein aufgekratzter junger Schäferhund schnüffelt sich im Agility-Wettkampftempo durch die Abteile auf der Suche nach Drogen oder Sprengstoff. Er findet was Besseres: eine etwa fünfzigjährige Passagierin im Flur, die beginnt, ihn zu streicheln. Ein Grenzbeamter mit Vollbart und Glatze brüllt den Hund an, sofort wieder an die Arbeit zu gehen, wird aber ignoriert. Er blafft die Frau an, was sie im Gang zu suchen habe. Das sei die Grenzkontrolle, sie solle sofort in ihr Abteil gehen und die Töle in Ruhe lassen. Sie guckt dem Hund in die Augen, streichelt ihn noch ein bisschen weiter: Ja, wir zwei verstehen, was für ein Unsinn das ist mit den Menschen und ihrem Sprengstoff. Dann hebt sie resignierend die Schultern und gehorcht im Zeitlupentempo der Staatsgewalt.
Der Hundekommandeur fordert mich auf, meinen Rucksack zu öffnen. Er findet T-Shirts, Socken und Kamerazubehör. »Wie viel Bargeld?« – »Etwa 300 Euro.« Er nickt und stapft in schweren Stiefeln weiter zum nächsten Abteil, Einreise genehmigt. Nach einer Ewigkeit ächzen die Zugräder unter dem Beschleunigungsruck, und wir sind auf dem Weg nach Lwiw. Knapp vier Stunden braucht der Zug für die ersten 97 Kilometer.
Dunkle Ebenen, ein paar Bäume, kaum Straßenbeleuchtung. Schwere Trucks rollen parallel zur Schiene. Gleichmäßig rattern die Zugräder, zwei metallische Schläge, dann eine kurze Pause, dann wieder zwei Schläge. Ein Herzschlag. Das passt, denn wir befinden uns auf der Aorta der Ukraine, der wichtigsten Bahnstrecke der Welt.
Von Przemyśl in Polen nach Kyjiw in der Ukraine. Millionen Menschen gelangten über diese Gleise ins sichere Ausland, Dutzende Staatsgäste fuhren auf ihnen nach Kyjiw. Ob Macron, Biden, Scholz oder von der Leyen – alle ratterten auf diesen 663 Kilometern ihrem Ziel entgegen und wirkten auf den Fotos aus dem Zug wie von Midlife-Crisis geplagte Manager, die sich auf ihre alten Tage noch mal ein Interrailticket gekauft haben. Allerdings reisen die Staatsgäste – im Gegensatz zu mir – in Premiumwaggons. »Eiserne Diplomatie« nennt ein Poster im Gang die Bahnservices für wichtige Politiker. Dazu gehören Menüs vom Spitzenkoch und individuelle Geschenke: Steinmeier bekam einen Iris-Blumenstrauß und eine Postkarte, die das deutsche Iris-T-Flugabwehrsystem im Einsatz zeigte, darüber standen die Worte »Liebe in der Luft«. Boris Johnson erhielt eine für ihn persönlich gestaltete Loyalty Card des Zugunternehmens als Dank für seine Treue zur Ukraine. Doch bei seiner Delegation kam es zu einer logistischen Panne: Die Zugbegleiter hatten nicht bedacht, welche eigenartigen Bräuche bei Briten in Bezug auf Tee gelten, und nicht genug Milch dabei. Die musste bei einem Zwischenstopp um vier Uhr morgens ein Bahnhofswärter organisieren, um diplomatische Verstimmungen beim Frühstück zu verhindern. Alles ging gut, Johnson bekam seine Morgenmilch, blieb loyal und kam wieder.
Mein Tee kostet fünfzehn Hrywnja, umgerechnet 38 Cent, und was die blau uniformierte Prowidnyzja auftischt, ist kein trauriges Schullandheimschlabbersäckchen im Pappbecher, sondern ein Designerbeutel feinster Karpaten-Kräutertee-Mischung, serviert im Designerglas auf einem schmucken Metallsockel mit Gravur. Jeder Waggon hat eine eigene Prowidnyzja, eine Zugbegleiterin, die als Hotelmanagerin, Kellnerin, Kinderclown und manchmal Konfliktschlichterin fungiert. Vor der Abfahrt trägt sie per Hand die Ticketnummern aller Fahrgäste in eine Kladde ein. Am Morgen weckt sie jeden Passagier persönlich eine Stunde vor der Ankunft.
Jedes Abteil ist ein Mikrokosmos. Deutlich mehr Frauen als Männer. Mütter und Tanten mit aufgekratzten Kindern, am Ende des Ganges das Trinkerabteil, es riecht selbst bei geschlossener Tür nach Trockenfisch und Männerschweiß, auf dem Tisch stehen zwei leere Flaschen, die mit Samohon gefüllt waren, selbst gebranntem Wodka.
»Also, why to Ukraine?«, fragt Kyrylo, den Akzent der Grenzsoldatin imitierend.
»Aus zwei Gründen. Erstens wohnt Julija in Kyjiw, wir sind seit gut einem Jahr zusammen.«
»Da habt ihr euch ja einen tollen Zeitpunkt ausgesucht. Historisch«, spottet er.
»Kann man so sagen. Sie hatte ein Flugticket für den 25. Februar 2022, von Kyjiw nach Hamburg. Ich hatte uns Karten für die Elbphilharmonie gekauft. Liszt und Beethoven.«
Er versteht die Bedeutung des Datums sofort: Am 24. Februar begann Russlands große Invasion, seitdem flog in der Ukraine kein Passagierflugzeug mehr.
»Unglaublich, Putin hat euer Date verhindert«, sagt Kyrylo und beginnt, den Anfang von Beethovens Schicksalssinfonie zu summen. Da-da-da-daaaaa. Da-da-da-daaaa.
»Du wirst lachen«, sage ich unnötigerweise, denn der heiterste Mensch in diesem sonst so ernsten Zug lacht bereits, »das Stück stand tatsächlich auf dem Programm.«
»Mich wundert gar nichts mehr. Die Realität ist längst verrückter als jede Story, die sich jemand ausdenken könnte«, sagt er. »Was ist der zweite Grund für deine Reise?«
»Ich möchte durch die Ukraine reisen und couchsurfen.«
»Du möchtest was?«
»Menschen zu Hause besuchen. Mithilfe von couchsurfing.com. Einem Reisenetzwerk, auf dem die Leute kostenlose Unterkünfte anbieten. Und dann darüber ein Buch schreiben.«
»Funktioniert das? Während des Krieges?«
»Das frage ich mich auch. Aber eine Zusage habe ich schon.«
Kyrylo lacht.
Gute Plots für ein Ukraine-Buch:
Der Icherzähler ist Putinversteher, liebt Russland über alles und glaubt kein Wort von dem, was »westliche Medien« über die Ukraine berichten. Er fährt hin und hört sich selbst die Geschichten vor Ort an.
Eine russische Spionin reist unter dem Vorwand ein, ihren Lebenspartner zu besuchen. In Kyjiw und Odesa will sie Ziele für Raketenangriffe ausspionieren. Dann verliebt sie sich tatsächlich in einen Ukrainer.
Ein strammer deutscher Rechtsextremer hat in einem Video bei RT Deutsch gesehen, dass die Ukraine voller Nazis sein soll. Also reist er hin, um endlich unter seinesgleichen zu sein – doch als er ankommt, erlebt er eine Überraschung.
Die Icherzählerin reist mit ihrer besten Freundin auf die Krim, um russische Soldaten mit arsenhaltigem Wodka zu vergiften. Sie töten 46, verstecken sich in einem Haus in Jalta, werden entdeckt und erschießen drei Polizisten, bevor sie in einem geklauten Auto fliehen – ein unvergesslicher Roadtrip beginnt.
Ein abgehalfterter Physikprofessor, der gerade seinen Job an der Uni Greifswald verloren hat, besucht eine frühere Kollegin in Dnipro. Als sie dort die alte Raketenfabrik besichtigen, macht er eine Entdeckung, die den Krieg entscheiden könnte.
Der Icherzähler reist in die Ukraine und heuert als Soldat bei der Internationalen Freiwilligenlegion an. Er muss Abenteuer bestehen und Gefahren trotzen, um am Ende das Herz von Swetlana aus Swjatohirsk zu gewinnen.
Wir sind überflutet von Erzählungen, die gängigen Storytelling-Schablonen folgen. Fünf Akte, der Ruf zum Abenteuer und eine wichtige Mission, die es zu erfüllen gilt. Kurz vor dem Ende konfrontiert der Held den Bösewicht, alles scheint verloren, doch dann siegt doch noch das Gute und alle sind klüger als am Anfang. Diese Geschichten funktionieren, weil wir ihre Struktur verinnerlicht haben, von dem Moment an, in dem wir zum ersten Mal ein Märchen hören.
Die Dramaturgie meiner Reise kann damit nicht mithalten: Ich fahre durch die Ukraine, treffe ein paar Leute und hoffe, unversehrt zu bleiben und auch weiterhin mit Julija zusammen zu sein. Der Status quo als Ziel. In jedem Dramaturgieseminar würde eine solche Geschichte durchfallen. Aber dafür ist sie wahr. Das ist doch auch was wert.
A
Alles gut
Ukrainische Waschmittelmarke, die mit einem deutschen Namen Käufer anlocken will. Ähnliche Ansätze verfolgen die Hersteller »Frau Tau« (Haushaltswaren), »Grünhelm« (Elektrogeräte) und »Kumpel« (Bier). Doch »Alles gut« übertrifft alle anderen – ein Wunder, dass in Deutschland noch niemand auf diesen Produktnamen gekommen ist.
Eine Zusage habe ich schon. Doch leicht wird das nicht, viele ukrainische Couchsurfing-Profile sind derzeit inaktiv. Auf der Webseite kann ich sehen, wann sich jemand zuletzt eingeloggt hat. Vor sieben Jahren. Vor drei Jahren. Vor vierzehn Monaten. Das lese ich besonders häufig: Last login 14 months ago.
Es ist April 2023, vor vierzehn Monaten begann Russland seinen großen Überfall, seit vierzehn Monaten befindet sich Europa im Ausnahmezustand. Aufrüstung, Entrüstung, Zeitenwende, Luftalarm, nukleare Bedrohung, Kriegstreiber, Drohnenkrieg, Abnutzungskrieg, Eskalationsdominanz.
Das sind Schlagworte, die immer wieder fallen. Welche unbändige Lebensfreude, welche himmelschreiende Normalität sich im Kontrast dazu in den Selbstbeschreibungen der Mitglieder des Reisenetzwerks offenbart.
Wolodymyr aus Odesa, vierzig Jahre alt, mag Tai-Chi, Motorräder und Videospiele und wünscht sich, dass die Menschen wieder mehr voneinander lernen.
Diana aus Tscherniwzi liebt »The Great Gatsby« und guten Wein und hat einen verspielten Dobermann namens River.
Andrij aus Kamjanez-Podilskyj, 26, ist Arzt und will am liebsten die ganze Welt kennenlernen, alle Kulturen, alle Nationalitäten, alle Künste und alle Schönheit der Natur.
Wira aus Mariupol, 28, Kulturmanagerin und Aktivistin, will ihre Stadt »queer und weird« machen.
Anastasija aus Bachmut, 24, liebt Tanzen und Singen und Kino.
Lauter kleine Lebenswelten, dazu Selfies im Stadtpark, Selfies beim Skydiving, Scherzfotos mit dem Schiefen Turm von Pisa und stolze Posen vor Gebirgspanoramen. Menschen, die Kontakt suchen, Träume verwirklichen wollen und die unverschuldet in die größte Katastrophe ihres Lebens geschleudert wurden. Schicksale wie aus dem Werkzeugkasten von Drehbuchschreibern und Romanautoren: Normalmensch gerät in Ausnahmesituation und muss sich darin bewähren. Hier können vierzig Millionen diese Geschichte erzählen.
Es bricht einem das Herz, sich durch diese Profile zu klicken, es fühlt sich an wie eine Reise in eine digitale Alternativrealität, in der die Welt noch in Ordnung ist. Wie viele der Menschen, die ich hier quicklebendig sehe, sind in der Zwischenzeit auf dem Schlachtfeld oder im eigenen Wohnzimmer gestorben? Last login 10 months ago. Last login 7 months ago.
Manchmal stehen da ein paar Sätze zur aktuellen Situation, zum Beispiel bei Ihor aus Poltawa, 27: »Mein Land ist im Krieg. Orte, die ich besucht habe, sind besetzt, Häuser, in denen ich übernachtet habe, sind zerstört, Menschen, die ich traf, wurden getötet. Mein Leben voller Reisen ist nur noch eine Erinnerung: keine Berge mehr, keine Flüsse, kein Wandern oder Klettern, nur Angriffe, schlaflose Nächte und Nachrichten von mehr und mehr getöteten Freunden. Alles, was weiter unten steht, ist nicht mehr aktuell.«
Dann folgen Infos über sein früheres Leben. Er ist Fotograf und Journalist, reiste per Anhalter durch Europa, jobbte als Bergführer in Pakistan, lebte sechs Monate lang in Kanada in einem Auto. Er listet 37 Länder auf, die er bislang besucht hat, darunter Iran, Nepal, Tadschikistan, unter seinen Lieblingsbüchern sind »Der Meister und Margarita« und »Das Bildnis des Dorian Gray«. Manchmal hält er Vorträge über seine Reisen, sein Profilbild zeigt ihn neben einem Schild in Alaska, das den Polarkreis markiert.
Während ich das lese, habe ich das Gefühl, Ihor längst gut zu kennen. Seine Sätze über den Krieg treffen mich wie Schläge mit dem Vorschlaghammer. Nicht, weil es starke Sätze sind. Sondern weil er mir so ähnlich ist: Verdammt noch mal, das könnte ich sein. Wir halten Empathie für die Kardinaltugend des kultivierten Altruisten, doch in Wahrheit hängt unser Maß an Empathie stark davon ab, wie viel wir von uns selbst in denjenigen wiedererkennen, die in Not geraten sind. Das ist die schlechte Nachricht, Menschen sind so. Die gute Nachricht: Wir können daran arbeiten, mehr Gemeinsamkeiten zu entdecken. Reisen hilft.
Ich möchte Menschen wie Ihor, Diana und Wolodymyr besuchen.
Couchsurfing in einem Kriegsland, das klingt natürlich grundfalsch. Als hätten die leidgeprüften Menschen keine anderen Probleme, als einen ungekämmten Backpacker aus dem privilegierten Deutschland bei sich aufzunehmen, aus dem friedlichen, prosperierenden, sicheren, demokratischen, superreichen Deutschland.
Ist das in Ordnung, oder ist das pietätlos, unsensibel, eine Zumutung? Vor der Abreise war ich unschlüssig, also fragte ich ein paar ukrainische Couchsurfing-Mitglieder, was sie davon hielten.
Die schnellste Antwort kam von Iryna aus Kyjiw, die seit einem Jahr in Berlin wohnt: »Erst wollte ich sagen: Lass es sein. Aber das ist derzeit meine Antwort auf jede neue Idee, ich bin nihilistisch geworden. Meine Freunde dagegen meinen: Auf jeden Fall, mach das.«
Wolodymyr aus Odesa schrieb: »Die Deutschen haben eine Million Ukrainer aufgenommen, inklusive meiner Frau. Da können die Ukrainer doch auch mal einen Deutschen aufnehmen.«
Und Polina aus Iwano-Frankiwsk: »Ich finde nicht, dass du die Leute ausnutzt. Du zwingst ja niemanden, dich einzuladen. Vielleicht freuen sich manche über die Abwechslung. Bei meinem Mann und mir bist du herzlich willkommen, wann besuchst du uns?«
Da haben wir sie, die erste Einladung. Es könnte also gehen. Ich werde versuchen, ein guter Gast zu sein, und mit den Einheimischen einen Deal machen: Ihr nehmt mich auf, und dafür erzähle ich eure Geschichte.
Der Zug nähert sich dem Ziel, ich öffne meine Luftalarm-App und schalte »Region Kyjiw« scharf. Momentan steht dort »No worries« neben der Abbildung einer Friedenstaube und einem blau-gelben Herzen. Draußen Strommasten, Felder, Tankstellen namens Okko und SOCAR, Schiguli-Kleinwagen hinter Schranken. Am Straßenrand Rekrutierungsposter mit Fotos furchterregend ausgerüsteter Soldaten. »Lasst uns die Flagge über der Krim hissen«, steht auf einem, »Okkupanten, der Sturm wird kommen« auf einem anderen. Ein weiteres Plakat wirbt für eine Spendenaktion für Kriegsversehrte. »Superhumans«, lautet das Motto, zu sehen ist ein Soldat mit einer Armprothese, die eine gelbe Tulpe hält.
Ich bringe meine Bettwäsche zum Bettwäschestapel gegenüber dem Zugbegleiterinnenabteil, raffe meine Sachen zusammen und wünsche Kyrylo viel Glück für die nächsten Monate. »Das wird schon«, sagt er fröhlich. »In der Nacht haben unsere Leute 61 von 71 russischen Raketen abgeschossen. Wir werden gewinnen.«
Im alltäglichen Ausnahmezustand
Am Kyjiwer Hauptbahnhof sind die Lichter ausgeschaltet, Bahnhöfe sind strategische Ziele. Von den Gleisen kommend, drängeln sich die Passagiere auf den Treppen nach oben zum Hauptgang. Die Bahnhofsverwaltung hat auf Wänden aus Spanplatten eine Fotoausstellung angepinnt, die chronologisch die Erfolge der ukrainischen Armee zeigt. Die Befreiung von Kyjiw und Tschernihiw (2. April 2022), Sumy (4. April 2022), Charkiw (12. September 2022) und Cherson (11. November 2022). Bilder von schwerem Kriegsgerät, blau-gelbe Flaggen, Soldaten in Heldenposen.
So viele russische Misserfolge. Am Anfang erwarteten viele, Kyjiw werde innerhalb von drei Tagen fallen. Aber Prognosen für Kriege sind so eine Sache.
Auf dem Boden in der Bahnhofshalle lehnt seitlich an der Rolltreppe eine Anzeigetafel mit Strecken, die derzeit nicht befahren werden. Zugnummer 146 nach Simferopol auf Gleis 10, Zug 520 nach Luhansk, Zug 38 nach Donezk. Moskau steht nicht dabei. Noch vor Kurzem konnte man von Kyjiw per Nachtzug in die russische Hauptstadt fahren, in dreizehneinhalb Stunden. Ob es diese Verbindung je wieder geben wird?
Julija wohnt in einer Dreizimmerwohnung in der Nähe des Goldenen Tors. Ein Uklon-Taxi bringt mich hin, Uklon ist eine der lokalen Uber-Varianten. Die Stadt wacht gerade auf, die Straßen sind schon verstopft, graue Wolken hängen über den Hochhäusern. An vielen Wänden steht das Wort »Ukrittja« mit einem Pfeil zur nächsten Tür. Ukrittja bedeutet »Schutzraum«, für die Raketenangriffe.
Wir umarmen uns lange, und bei Frühstücksporridge und Fünfminutenei gibt Julija den Lagebericht ab: Heizung funktioniert, das Wasser ist warm, und Strom gibt es auch. Nur ein Luftalarm in der vergangenen Nacht, keine Detonationen. Mama ein bisschen erkältet, Papa hat sich gestern Abend aus der Nähe von Bachmut gemeldet, reichst du mir das Salz?
Sie hat ein Geschenk für mich, ein Armband mit einem Stück Stahl aus Mariupol, limitierte Edition. Das rechteckige Metallplättchen, das mit einem eingeritzten Dreizack-Emblem verziert wurde, stammt vom letzten Fertigungstag im dortigen Asow-Stahlwerk. Danach gab es dort heftige Kämpfe, wochenlang hielten die Verteidiger in der Riesenfabrik durch, bis sie die strategisch wichtige Hafenstadt aufgeben mussten. Jetzt tragen Julija und ich immer ein Stück Mariupol am Handgelenk, sie hat auch eins für sich selbst gekauft.
Sie muss ins Büro, ihr Arbeitgeber ist eine internationale Organisation, die beim Wiederaufbau hilft. Umspannwerke reparieren, Kriegsversehrte versorgen, Minen räumen. Julija macht viele Überstunden in letzter Zeit.
Ich gehe spazieren. Polierte Goldkuppeln glänzen auf der Sophienkathedrale und dem St.-Michaels-Kloster. Vor den Sakralbauten rosten zerstörte russische Panzer. Kinder klettern für Erinnerungsfotos auf Kanonenrohre, Männer in Militäruniform betrachten fachkundig Löcher in grünbraunen Karosserien. Einer der schönsten Plätze der Stadt ist nun Schrottplatz für Tötungswerkzeug. Von der Kirchenmauer blicken ukrainische Kriegstote herab, hundert Mauermeter mit Porträts, der Platz reicht bald nicht mehr aus.
Auf dem nahe gelegenen Unabhängigkeitsplatz, dem Majdan, wehen unter der Engelsstatue kleine Ukraineflaggen mit Namen von gefallenen Soldaten. Daneben steht in menschengroßen Buchstaben »Ich« und »Ukraine« mit einem roten Herzen dazwischen.
Ein Mann im braunen Bärenkostüm mit Stummelschwanz sucht nach Passanten, die gegen Cash ein Erinnerungsfoto mit ihm machen. Den Bärenkopf hat er über die Stirn hochgeklappt, darunter kommt ein Gesicht zum Vorschein, das zu mehr als der Hälfte von Tattoos bedeckt ist. Er fragt nach meiner Herkunft (»Ah, Deutschland, meine Ex-Freundin kommt aus Wuppertal!«) und nach einem Beitrag für seine angebliche Sammlung von Euromünzen verschiedener Herkunftsländer. Viel Kundschaft scheint er heute nicht anzulocken, vielleicht ist seine Verkleidung als russisches Nationalsymbol nicht mehr so angesagt.
Souvenirverkäufer bieten Kühlschrankmagneten an mit dem Soldaten und dem russischen Kriegsschiff. Der Soldat heißt Roman Hrybow, er war einer der ukrainischen Verteidiger auf der winzigen Schlangeninsel im Schwarzen Meer. Als sich ein russisches Schiff näherte, sagte er per Funk: »Russkyj Woennij Korabl, ydy na chuj!«, »Russisches Kriegsschiff, fick dich!« Der Feind hörte nicht auf ihn, das Schiff landete an, er und seine Mitstreiter wurden gefangen genommen. Hrybow wurde für seine sechs Wörter als Held gefeiert. Sie wurden zum tausendfach wiederholten und tausendfach variierten Motto der ukrainischen David-gegen-Goliath-Erzählung. Die ukrainische Post druckte eine Sonderbriefmarke, die Hrybow und seinen erhobenen Mittelfinger und die Moskwa zeigt, das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte. Und dann passierte etwas komplett Verrücktes: Zwei Tage nach Herausgabe der Briefmarke gelang es den Ukrainern tatsächlich, die Moskwa zu versenken. Wer im Krieg nicht abergläubisch wird, wird es nie.
Was hat diese Stadt, was hat dieser Platz durchgemacht in letzter Zeit … Vor zehn Jahren gingen hier Hunderttausende auf die Straße, am Ende jagten sie den prorussischen Präsidenten Janukowytsch aus dem Land. Für die »Himmlischen Hundert«, die bei den Euromajdan-Protesten ihr Leben verloren, wurde ebenfalls eine Reihe mit Erinnerungsschreinen eingerichtet. So viele Porträts von Toten, so viel nicht gelebtes Leben, so viel Heldenkult. Wie unmartialisch dagegen ein Banksy-Graffito auf einem Betonquader ein paar Meter weiter wirkt, das einen Jungen und ein Mädchen im Profil zeigt. Davor liegt eine rostige Panzersperre, die der Künstler zu einem Teil seines Werkes machte. Aus dem richtigen Blickwinkel sieht sie aus wie eine Wippe, auf der die Kinder sitzen.
B
Banksy
Britischer Street-Art-Künstler, der in der Ukraine einige seiner besten Werke schuf. Herausragend sind seine Arbeiten in Borodjanka, eineinhalb Stunden von Kyjiw entfernt. Eines zeigt ein Kind, das einen erwachsenen Judokämpfer zu Boden wirft (Putin ist begeisterter Judoka), ein anderes zeigt eine Turnerin im Handstand an der Mauer eines völlig zerstörten Gebäudes.
Über den spektakulär breiten Bürgersteig des Chreschtschatyk, der bekanntesten Straße der Stadt, wandere ich zurück. Zwei matt lackierte Audi-R8-Sportwagen knattern hochtourig vorbei, der Chreschtschatyk ist ihr Laufsteg. Ein riesiges Poster zeigt den Münchner Marienplatz voller Pro-Ukraine-Demonstranten, Unterstützung aus dem Ausland ist gut für die Moral. Gelenkige Breakdancer stehen kopf, stellen sich dem Wettstreit mit den Gesetzen der Physik. Monatelang tanzte niemand auf den Bürgersteigen, ihre Rückkehr ist ein Symbol für Normalität. Ich esse zu Mittag im Jewrasija, auf einem 42-Zoll-Bildschirm laufen Drohnenaufnahmen von Touristenattraktionen in Endlosschleife. Das Schloss von Chotyn, der Synewir-Gebirgssee in den Karpaten, die Verklärungskathedrale in Tschernihiw. Was für ein wunderschönes, unbekanntes Land.
Ein paar Meter weiter, vor dem Gebäude der Kyjiwer Stadtverwaltung, steht eine überdimensionale Briefmarke aus Kunststoff, darauf ist der Moskauer Kreml in Flammen zu sehen. Man kann diese Marke nirgendwo kaufen, eine Künstlergruppe hat sie entworfen. Es ist schon ihr zweites Motiv, vorher zeigten sie hier ein Feuer auf der Kertsch-Brücke, die Russland mit der illegal annektierten Krim-Halbinsel verbindet. Ein paar Wochen später beschädigten tatsächlich ukrainische Raketen die verhasste Brücke.
Am Abend gehen wir ins Nationale Opern- und Balletttheater. Ein weißer Palast, Ende des 19. Jahrhunderts erbaut, in der Galerie schwere Kronleuchter und Spiegel mit goldenen Rahmen. Nach dem russischen Angriff hat das Ensemble für zwei Monate pausiert, dann nahm es den Betrieb wieder auf. Aktuell läuft die 155. Saison, die zweite ohne russische Komponisten. Ohne Tschaikowsky, Mussorgski und Rachmaninow, ohne den »Nussknacker« oder »Bilder einer Ausstellung«. Die Ukrainer möchten auf ihren Bühnen keine Stücke aus dem Aggressorland sehen, obwohl diese jahrzehntelang als wesentlicher Teil der eigenen Kultur-DNA empfunden wurden. Ein harter Schnitt. Jede Tänzerin und jeder Musiker auf dieser Bühne ist mit diesen Werken aufgewachsen. Wer »Schwanensee« liebt, kann das Stück nicht plötzlich verabscheuen – was hat Putins Russland mit »Schwanensee« zu tun? Und doch erzeugt das Kriegstrauma im Kopf eine Abneigung nicht nur gegen Politik und Militär, sondern gegen alles Russische. Vielleicht lässt sich das neu verhandeln, wenn der Krieg irgendwann vorbei ist. Aber im Moment spüren viele nur Abscheu für das Nachbarland und für alles, was von dort kommt.
Heute spielen sie »Boléro« von Maurice Ravel als Ballett. Die Vorführung ist ausverkauft, dennoch bleiben viele Sitze leer. Für die oberen drei Ränge werden keine Tickets verkauft, weil nicht mehr Zuschauer kommen dürfen, als in den Schutzraum im Keller passen. Bei Luftalarm wird unterbrochen.
»Für mich sind die Besuche im Opernhaus eine der surrealsten Kriegserfahrungen«, sagt Julija. »Draußen ist Krieg, drinnen tauchen wir ab in eine andere Welt, als wäre alles wie immer. Das Saallicht geht aus, und für zwei Stunden ist alles okay.« Ich bin nicht so entspannt wie sie, ich denke an Fernsehbilder zerstörter Theater in Mariupol und Winnyzja. Und auch meine Wahrnehmung der Stücke ändert sich. Die Tänzerinnen und Tänzer tragen spanische Flamenco-Kostüme und spielen eine Liebesgeschichte nach, mit Leidenschaft und Temperament. Ich kenne die Musik gut, doch heute denke ich zum ersten Mal: Könnte das Stück nicht genauso gut vom Krieg handeln? Der durchlaufende Marschtrommelrhythmus, die ständige Wiederholung einer Melodie, die synchronen Bewegungen des Ensembles. Die Musik steigert sich ohne Verschnaufpause mit einem immer kräftigeren Crescendo hin zu heftigen Dissonanzen am Ende, dann folgt ein abrupter Schluss. Der Applaus ist ohrenbetäubend, dann leert sich der Saal schnell. Die Menschen strömen zu den Ausgängen, zurück in die Wirklichkeit.
Wir besuchen Julijas Mutter, die auf der linken Uferseite des Dnipro wohnt, im Hochhausstadtteil Trojeschina (die bei uns häufig verwendete Schreibweise »Dnjepr« ist aus dem Russischen transkribiert; hier heißt der Fluss wie bei den Ukrainern »Dnipro«). Ein ungut klingender Lastenaufzug, dessen Plastikknöpfe Julija aus Hygienegründen mit dem Schlüssel statt mit dem Finger bedient, bringt uns in den neunten Stock. Durch drei Türen müssen wir, bis wir aus einem Flur mit bröckelndem Putz in immer gepflegtere Areale bis zur geheizten Holzvitrinengemütlichkeit der Wohnung kommen.
Julijas Mutter Oksana tischt ein opulentes Abendessen auf, Borschtsch und gebackene Dorade. Sie fragt, ob sie zu wenig Salz benutzt habe. Das fragt sie immer, und immer verneinen wir wahrheitsgemäß. Oksanas Mann ist an der Front, Julijas siebzehnjähriger Bruder in der Schule. Oksana war früher Leistungsschwimmerin und trat bei nationalen Wettbewerben an, nun arbeitet sie als Lehrerin. Sie erzählt von Schulkindern, die sich über Luftalarm freuen – weil dann Pause ist und sie im Schutzkeller die Handys benutzen und Snacks essen dürfen. Letztens sagte ein Erstklässler zu ihr: »Wir brauchen keine Angst zu haben. Bevor der Russe bei uns ankommt, tritt er auf eine Mine und explodiert.«
Neben der Spüle steht ein Gaskocher mit einer einzelnen Platte, Marke »Eliocamp«, made in China. Der war im Winter wichtig wegen der Stromausfälle. Auf einem Aufkleber an seiner Seite steht der Slogan »Enjoy your free time«. So läuft das heute: China unterstützt Russland im Krieg, Russland greift die ukrainische Infrastruktur an, und dann verkauft China den Angriffsopfern Gaskocher und aufmunternde Worte. Ob auch die Qualität stimmt, ist eine andere Frage: Einige Kocher aus Fernost explodierten in ukrainischen Küchen, weil sie nichts taugten.
Ungefährlicher sind asiatische Kulturgüter: Oksana ist neuerdings Expertin für südkoreanische und chinesische Fernsehserien, weil sie keine russischen mehr anschaut. »Da haben Kinder wenigstens noch Respekt vor ihren Eltern«, sagt sie mit einem gespielt strengen Blick zu ihrer Tochter, beide lachen.
Julija deutet zum Küchenfenster. Plattenbauten, ein McDonald’s, ein Kebabladen namens Bayraktar Döner.
»Von diesem Fenster aus habe ich im Februar 2022 die Rauchwolke eines Raketeneinschlags gefilmt«, erinnert sie sich. Beim Frühstück wurden sie davon überrumpelt. Ein Zischen, ein Knall, die Wände wackelten. Die Rakete wurde abgefangen, die herabstürzenden Trümmer zerstörten sieben Autos. Sie schickte den zwanzigsekündigen Videoclip an einen befreundeten Journalisten, kurz darauf verbreitete ihn die Nachrichtenagentur Reuters auf der ganzen Welt.
In den folgenden Tagen rummste ständig ein Flugabwehrgeschütz, das ganz in der Nähe stand. Auf Kyjiw rollte aus dem Norden eine 64 Kilometer lange Panzerkolonne zu. Julija entschied sich abzuhauen. Mit Bruder und Mutter nach Lwiw im Westen, dort war es sicherer. »Der Abschied von Papa war das Schlimmste. Wir fuhren los, er stand auf dem Parkplatz und winkte. Er hätte niemals die Stadt verlassen, er war bereit zu kämpfen. Niemand wusste, was die nächsten Wochen bringen würden.« Zwei Monate blieben sie in Lwiw, dann kamen sie zurück in die Hauptstadt.
In Julijas Zimmer fallen mir im Regal zwei Bücher auf: »Das Ende der Geschichte« von Fukuyama und »Krieg der Welten« von Wells. In Vitrinen liegen Reisesouvenirs, an einem Regal lehnt unser selbst gemachtes Fotobuch mit dem Titel »J & S – a true fairytale«, auf einem Blechschild steht auf Deutsch »Faulheit ist die Quelle großen Geistes« (ein Souvenir aus ihrer Zeit in Hamburg).
Wie jemanden beschreiben, den man so gut kennt wie kaum einen anderen Menschen auf der Welt? Vielleicht mit einem Vergleich aus der Kinowelt, denn Julija liebt Filme und Serien. Einmal haben wir »Frühstück bei Tiffany« geguckt, darin geht es um einen Schriftsteller, der sich verliebt in eine lebensfrohe, unberechenbare und etwas sture Traumfrau namens Holly Golightly, gespielt von Audrey Hepburn. Wir entdeckten so viele Parallelen zu ihr und uns und unserer Geschichte, dass wir es kaum glauben konnten. War unsere Story gar nicht so einmalig, wie wir dachten? Ein Romanautor hatte umfangreiche Teile davon schon erfunden, als wir noch gar nicht auf der Welt waren, eine Unverschämtheit. Also, wenn Sie mehr über Julija wissen wollen, gucken Sie doch einfach den Film.
Івано-Франківськ
Iwano-Frankiwsk
Oblast: Iwano-Frankiwsk
Wandel durch Wandern
Kann ich Ihnen versprechen, dass Sie bei mir die ganze Wahrheit über die Ukraine lesen werden? Weil ich mehr als sieben Monate in der Ukraine verbringen werde, immer mit Einheimischen, nicht in einer Expat-Bubble, nicht mit anderen Journalisten? Nun, es ist so: Es gibt verschiedene Schätzungen zur Hirnkapazität, einer verbreiteten Theorie zufolge verarbeitet das Gehirn in jeder Sekunde elf Millionen Informationen, von denen uns maximal vierzig bewusst werden. Alles andere klammern wir aus. Was wir als irrelevant interpretieren, ignorieren wir.
Im Übrigen verlasse ich mich auf meine Sinne, hauptsächlich Augen und Ohren, auf zusätzliche Informationen, die ich medial mitbekommen habe, und auf meine Erfahrung. Wie jeder Mensch bin ich bei meiner Bewertung von Sachverhalten ständigen kognitiven Verzerrungen ausgesetzt.
Also nein, ich kann Ihnen nicht versprechen, nach sieben Monaten totaler Immersion in der Ukraine die Wahrheit über dieses Land berichten zu können. Aber vergleichen Sie mich mit jemandem, der während dieses Krieges nicht so lang in der Ukraine war, vielleicht nicht mal zwei Monate oder nicht mal eine Woche, vielleicht keinen einzigen Tag, und dennoch mit großem Selbstvertrauen versichert, die Wahrheit über die Ukraine zu verkünden. Ein wenig lächerlich, oder? Relativ betrachtet stehe ich mit meinem Augenzeugenbericht also gar nicht schlecht da.
Ich werde diesmal anders reisen als sonst, keine große ununterbrochene Tour durchs ganze Land machen, sondern sternförmig von Kyjiw in alle Himmelsrichtungen aufbrechen. Immer für ein paar Tage, dann wieder zurück zu meiner Lieblings-Couchbesitzerin in der Hauptstadt. »Bring viele gute Geschichten mit«, sagt Julija, bevor ich in den Zug nach Westen steige.
Meine ersten Gastgeber sind Polina und Roman in Iwano-Frankiwsk. Die beiden arbeiten als Trekking-Guides und haben angeboten, mich auf eine dreitägige Tour in die Karpaten mitzunehmen, Zelt und Schlafsack könnten sie mir leihen. Der Nachtzug braucht neuneinhalb Stunden. Von der Fahrt wird mir ein Witz in Erinnerung bleiben. Erzählt bekomme ich ihn von einem Mitreisenden namens Jewhenij, der seine Eltern in Lwiw besuchen will. Der Witz ist ein bisschen länger und geht so:
»Bei der ukrainischen Air Force ist eine Stelle ausgeschrieben. Ein Deutscher, ein Engländer und ein Ukrainer kommen zum Vorstellungsgespräch. Zunächst wird der Deutsche hereingebeten.
›Wie viel Erfahrung haben Sie als Pilot?‹
›Vier Jahre.‹
›Und im militärischen Bereich?‹
›Ich habe einige NATO-Übungen mitgemacht, kann Eurofighter und F-16 fliegen.‹
›Was wollen Sie verdienen?‹
›3000 Euro im Monat.‹
›Und was würden Sie mit dem Geld machen?‹
›Ich würde tausend für mich nehmen, tausend für meine Frau und tausend für Versicherungen und Rente und so was.‹
Als Nächstes spricht der Engländer vor.
›Berufserfahrung?‹
›Zehn Jahre.‹
›Auch beim Militär?‹
›Klar, in Afghanistan und im Irak. Hier, meine drei Tapferkeitsorden.‹
›Was wäre Ihr Monatsgehalt?‹
›6000 Euro – 2000 für mich, 2000 für meine Frau, 2000 für Versicherungen und Rente.‹
Zuletzt wird der Ukrainer hereingerufen.
›Erfahrung?‹
›Na ja, ehrlich gesagt wird mir beim Fliegen schlecht, ich muss in der Luft immer kotzen.‹
›Militärfliegerei?‹
›Da wird geschossen, oder? Nein, das mag ich nicht.‹
›Gehaltswunsch?‹
›9000 Euro im Monat.‹
›Wie bitte?‹
›Na klar. Wir teilen das auf: 3000 für mich und 3000 für dich.‹
›Und wer fliegt das Flugzeug?‹
›Der Deutsche für die restlichen 3000!‹«
Jewhenij lacht, klopft mir auf die Schulter und versichert, die Zeiten derartiger Korruption seien vorbei, vieles sei schon besser geworden. »Aber der Witz ist gut, oder?«
Der Name Iwano-Frankiwsk, das ist so, als würde man bei uns eine Stadt und die dazugehörige Region Friedrich-Schillerau oder Hermann-Hessingen nennen. Dafür, dass die Ukraine lange als ungehobelter Bauernstaat links neben der großen Kulturnation Russland galt, haben Schriftsteller hier einen verdammt hohen Stellenwert.
Iwan Franko ist die Nummer zwei im ukrainischen Nationaldichter-Ranking. An Nummer eins steht uneinholbar Taras Schewtschenko, in nahezu jeder Stadt des Landes gibt es einen Park mit seinem Namen und seiner schnurrbärtigen Skulptur. Insgesamt soll es 1068 Schewtschenko-Skulpturen geben in der Ukraine, weltweit wird nur Jesus häufiger in Stein gemeißelt.
Wie viele Iwan-Franko-Statuen aufgestellt wurden, weiß ich nicht. Auch er zeigte, wie kraftvoll und poetisch die ukrainische Sprache sein kann, übersetzte Cervantes, Dante und Goethe und schrieb pro Jahr fünf Bücher. Liest man seine Prosa heute, erscheint manches prophetisch. Schon damals ging es um den aufopferungsvollen Kampf gegen verbrecherische Unterdrücker. Zum Beispiel in »Die Steinbrecher«:
So schaffen wir vereint durch heiliges Bestreben,
Das hehre Ziel vor uns, gehorsam dem Gebot;
Und ob verflucht wir auch, vergessen hier im Leben,
Der Weg zur Wahrheit wird durch uns gebahnt und eben,
Und aller Menschen Glück kommt erst nach unsrem Tod.
»Es gibt ein Sprichwort hier«, sagt Polina, als sie mir die Wohnungstür in einem Innenhof in der Schewtschenkostraße öffnet. »Die Leute in Iwano-Frankiwsk lesen keine Bücher, sie schreiben sie.« Die Regale in ihrem Wohnzimmer sind dennoch gut gefüllt, mit Werken von Calvino, Remarque und Bradbury. Daneben stehen ukrainische Autoren, Andrij Kurkow, Oksana Sabuschko und Jurij Andruchowytsch. Bücher liegen im Trend, die hiesigen Verlage verzeichnen steigende Absatzzahlen, weil die Menschen Ablenkung brauchen.
»Andruchowytsch ist quasi unser Nachbar, der wohnt nur fünf Häuser weiter«, erzählt Polina. »Der ist einer der bekanntesten lebenden Autoren des Landes.« Seinen Durchbruch feierte er 1992 mit dem satirischen Roman »Moskowiada«. Darin stellt er Russland als imperialistischen Geheimdienststaat dar, der die ehemaligen Sowjetrepubliken erobern und deren Bürger versklaven will.
Polina hat ein rundes Gesicht, lange schwarze Haare und ernste Augen. Sie studierte Jura und arbeitete einige Jahre als Menschenrechtsanwältin. Ihr Thema: Dokumentation russischer Kriegsverbrechen in der Ostukraine. Seit Anfang 2022 hilft sie als Freiwillige bei medizinischen Evakuierungen in Saporischschja, dort wohnen ihre Eltern. Saporischschja liegt neunzehn Nachtzugstunden entfernt, manchmal vergisst man, wie riesig dieses Land ist. »Für mich ist wichtig, regelmäßig nach Iwano-Frankiwsk zu kommen und in den Karpaten wandern zu gehen, um nicht durchzudrehen«, sagt sie.