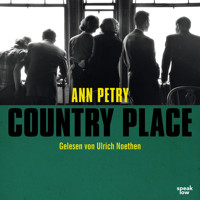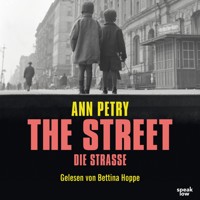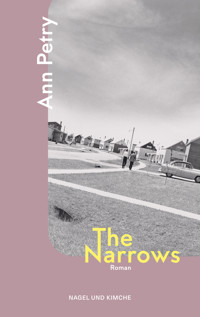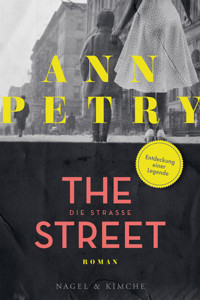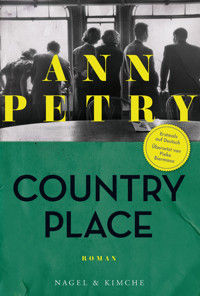
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Nagel & Kimche
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ebenso zeitlos wie »The Street«: Ann Petrys Roman über Idealisierung und Desillusionierung und über menschliche Abgründe.
Ein kleiner Ort in Connecticut: Johnnie kommt aus dem Zweiten Weltkrieg zurück. Die Kleinstadt ist nicht das Idyll, zu dem Johnnie sie in seiner Sehnsucht gemacht hat – ebenso wenig wie Glory die wunderbare Ehefrau ist, die Johnnie in ihr sehen wollte, wie er nach und nach erkennen muss. Johnnie empfindet sich nicht nur als Kriegsveteran, sondern auch als Veteran »des nicht enden wollenden Kampfes zwischen denen, die zu Hause blieben, und denen, die weggingen«.
Das Städtchen Lennox ist klatschsüchtig, böswillig und dünkelhaft. Es pflegt seine Verachtung für alles Fremde: das schwarze Dienstmädchen Neola, der portugiesische Gärtner, der jüdische Anwalt und die irischen Katholiken der Stadt gelten als »anders« und nicht dazugehörig.
Ann Petry zeigt, was passiert, wenn alle Fassaden bröckeln und ein großer Teil der Einwohner von Lennox sich als menschlich mies, intolerant, reaktionär oder gierig entpuppen. Bis auf wenige Ausnahmen: Johnnie und die alte Mrs. Gramby. Diese beiden ordnen ihr Leben oder das Leben ihrer Mitmenschen neu und besser...
»Berechnung, Untreue, Ehebruch, versuchter Mord, plötzlicher Tod und eine Reihe von überraschenden Erbschaften, die die Dinge mehr oder weniger in Ordnung bringen – das sind einige der vorherrschenden Themen, die in Country Place behandelt werden.« Richard Sullivan, New York Times, 1947
Erstmals auf Deutsch. Übersetzt von Pieke Biermann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Nagel & Kimche E-Book
Ann Petry
COUNTRY PLACE
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Pieke Biermann
Mit einem Nachwort von Farah Jasmine Griffin
I
Ich bin von jeher der Meinung, wenn jemand eine Chronik der gelaufenen Ereignisse schreibt, sollte er zuerst ein paar Auskünfte über sich selbst geben: Wie alt ist er, wo geboren, klein oder groß, dick oder dünn. All das sind Anhaltspunkte dafür, wie viel von dem Aufgeschriebenen als wahr gelten darf und wie viel eher verworfen gehört als Ergebnis persönlicher Voreingenommenheit dieses Jemands. Ein dicker Mann schreibt Bücher nämlich nicht auf dieselbe Art wie ein dünner, und ein großer Mann hat eine andere Perspektive als ein kleiner.
Deshalb erkläre ich hiermit ohne Umschweife: Ich bin Junggeselle und ein Durchschnittsmann – mittelgroß, mitteldick, mittelalt (fünfundsechzig Jahre) und mittelkahl. Ich bin weder Pessimist noch Optimist und vom Temperament her, glaube ich, durchschnittlich.
Es gehört sich auch, dass ich freimütig meine Vorurteile gegenüber Frauen einräume – vielleicht sollte ich sagen: Vorurteile gegenüber dem Weiblichen jeglicher Art und Gattung, menschlich wie tierisch. Allerdings bin ich, wie die meisten Leute, die zu ihren Vorurteilen stehen, nicht ganz konsequent, ich habe eine Katze. Sie heißt Banana, und ich bin ihr sehr zugetan, obwohl ich mir durchaus bewusst bin, dass sie entschieden dichter am Primitiven ist als ein Kater.
Sie kriegt zum Beispiel jedes Mal einen Wutanfall, wenn sie den Taxifahrer der Stadt, genannt das Wiesel, sieht. Sie plustert ihren Schwanz zur doppelten Größe auf, zieht die Krallen blank und schlägt nach ihm. Gut, er kann Katzen nicht leiden, aber das gibt ihr doch nicht das Recht, ihn jedes Mal anzufauchen, wenn er in den Laden kommt und etwas kaufen will. Aber sie, typisch weiblich, macht sich nicht die Mühe, ihre Gefühle zu zügeln.
Ach so, ich habe eine »Stadt« und einen »Laden« erwähnt, aber weder die eine noch den anderen erklärt. Ich bin Apotheker, der Laden ist natürlich ein Drugstore.
In Großstädten sind Drugstores ein Wirrwarr aus Neonlicht und Kosmetikständern und Aluminiumkochtöpfen – und über allem liegt der scharfe Qualm von Hamburgern und ranzigem Bratfett.
Mein Drugstore ist anders. Er hat schon meinem Vater gehört und davor meinem Großvater. Von ihnen stammt noch die Eisdiele, sie ist vom Rest des Ladens durch einen Bogendurchgang abgeteilt und fast ganz wie früher, also altmodisch. Es gibt einen Springbrunnen, aber keine Stühle mit Kunstlederpolster oder Kaffeeautomaten oder Elektrogrills, sondern sechs runde Tischchen mit schlanken schmiedeeisernen Beinen und passenden Stühlen.
Ich stelle meinen eigenen Sprudel her: in Zitronen-, Kirsch-, Orangen- und allen anderen Geschmacksvarianten. Wenn im Hinterzimmer auf dem Petroleumkocher der Schokoladensirup im offenen Kessel vor sich hin köchelt, läuft einem vom Duft im ganzen Laden das Wasser im Mund zusammen. So einen Duft findet man heutzutage in kaum noch einem Drugstore – auch keinen meiner anderen typischen Düfte. Ich habe nämlich auch frische Ingwerwurzeln und Kräuterhustenbonbons und diese runden Pfefferminzdragees, Canadian Mints, im Angebot.
Außerdem führe ich Penicillin und Sulfonamide. Ich erwähne das, damit Sie nicht denken, an meinem Laden sei die Zeit vorbeigezogen. Daneben verkaufe ich auch Nierenpflaster gegen Rückenschmerzen und erstaunliche Mengen Schwefelpuder. Viele Leute hier pusten ihren Kindern nämlich Schwefel in den Rachen, ein probates Mittel gegen Halsschmerzen – schnürt einem den Hals gleich ganz zu.
Die Stadt, von der ich spreche, heißt Lennox, Connecticut, und ist ein ruhiges Provinznest an der Mündung des Connecticut River, genau da, wo er sich in den Long Island Sound ergießt. Lennox ist fast vollständig von Wasser umgeben, überall riecht es nach Meersalz, überall hört man das Jammergekreisch der Möwen. In manchen Jahreszeiten schwirrt der Himmel vom Kommen und Gehen der Seevögel. Unser Städtchen hat einen gezackten Rahmen aus Buchten und Nischen und Bächen, lauter ideale Ruheplätze für Zugvögel.
In der Stadtmitte liegt eine Grünanlage, eine weite freie Rasenfläche, auf der einst Kühe und Schafe geweidet haben. Mein Drugstore schaut auf die Anlage. Direkt gegenüber, auf der anderen Seite, steht die Kongregationalistische Kirche.
Lennox ist leicht zu erkennen, und zwar am Gramby House. Falls Sie mal auf der Route 1 nach Boston fahren, sehen Sie ungefähr achtzehn Meilen vor New London direkt an der Post Road ein prächtiges Backsteinhaus. Für Autofahrer ist es das »Rosa Haus«, weil das Ziegelrot aussieht wie Zartrosa, wenn die Sonne darauf fällt. In Lennox heißt es nur Gramby House, egal ob jemand darüber redet oder schreibt, nie das Haus der Grambys. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht weil es das größte am Ort ist, oder weil es das einzige Backsteinhaus ist, oder vielleicht auch, weil die Bewohner, Mrs. Gramby und ihr Sohn, die reichsten Bürger von Lennox sind. Möglicherweise aus allen drei Gründen zusammen. Wegen seiner imposanten Fassade sticht unser Städtchen jedenfalls heraus unter allen Dörfern entlang der Boston Post Road.
Aber auch wir verzeichnen jeden Sommer den gleichen enormen Bevölkerungszuwachs wie die anderen kleinen Orte in New England. Viele Stadtflüchtlinge verbringen hier ihre Ferien. Um den ersten September herum reisen alle wieder ab, und kaum sind sie weg, wird Lennox allem Anschein nach zum stillen verschlafenen Dorf.
Ich sage »allem Anschein nach«, denn wo immer sich Menschen länger aufhalten, verläuft unter der ruhigen Oberfläche eine Spur der Gewalt.
Letztes Jahr zum Beispiel, in einer Phase heftiger »Wettererregung« (wie meine Freundin Mrs. Gramby gesagt hätte), wäre Lennox kaum als ruhiges, verschlafenes Dorf durchgegangen. Während der Stürme und danach haben sich etliche bedauerliche Dinge ereignet. Ich denke, das Meiste davon wären ohnehin passiert, aber wegen des Unwetters geschah alles früher, als es normalerweise geschehen wäre.
Ich bin der einzige Apotheker in Lennox und von daher, aus meiner Sicht, besser als fast jeder andere in der Lage aufzuzeichnen, was sich hier zugetragen hat.
Alle betroffenen Personen waren Kunden von mir. Ich kenne sie so gut und so lange, dass ich genau weiß, was sie liebten und was sie hassten, auf was sie hofften und was sie fürchteten.
Ich bin hier geboren, wie viele derjenigen, über die ich schreibe. Über alle habe ich in langen Jahren intime, detaillierte Kenntnisse sammeln können: Johnnie Roane und seine Frau Glory, seine Eltern Mr. und Mrs. Roane, Mrs. Gramby und ihren Sohn Mearns, Ed Barrell, das Wiesel, Neola, den Portigies, David Rosenberg und natürlich Mearns Grambys Frau Lil.
Auf den folgenden Seiten werde ich berichten, was mit ihnen passiert ist und wie es passiert ist. Ich halte mich dabei exakt an die chronologischen Abläufe und füge an der passenden Stelle auch meine eigene Reaktion auf die verschiedenen Ereignisse ein. Nach meiner Überzeugung ist dies eine wahre Darstellung, aber die Wahrheit hat viele Seiten, und ich bin, wie gesagt, nicht ganz unvoreingenommen, was Frauen betrifft.
Diese Chronik der Ereignisse enthält natürlich manches über das Leben und manches über den Tod, denn beides kommt vor in einem Provinznest.
2
Ich habe Johnnie Roane weder selbst aus dem Zug steigen sehen, noch mit eigenen Augen beobachtet, wie es danach weiterging.
Aber das Wiesel hat mir Johnnies Rückkehr nach Lennox so detailliert geschildert, dass ich ebenso gut persönlich auf dem Bahnsteig stehen und Johnnies Gedanken hätte lesen können.
Vieles von dem im folgenden Berichteten weiß ich von Johnnies Mutter, einer alten Freundin von mir. Überdies habe ich lange genug mit angesehen, was Johnnies Frau Glory so treibt, um ziemlich treffsicher sagen zu können, was sie so denkt, wenn sie morgens aufwacht.
Und so war es:
Ende September ist der Bahnhof von Lennox ruhig und menschenleer. Die Sommerleute haben längst die langen und kurzen Hosen und die Badeanzüge eingepackt und sind zurück in den großen Städten, aus denen sie gekommen waren. Die Stadt ist wieder erlöst von ihrer Anwesenheit und richtet sich allmählich auf den langen friedlichen Winter ein.
Das Wiesel, der hiesige Taxifahrer, blieb im Wagen sitzen, als er den langen Pfiff hörte, mit dem sich der Morgenzug aus New York ankündigt. Er hielt nur die Zeitung, die er gerade las, etwas tiefer und sah zu, wie die Lok in die Gleiskurve glitt. Dann warf er einen Blick zum katholischen Friedhof, aber ohne ihn wirklich wahrzunehmen, der Friedhof war schon so lange da, dass er ihn nur gesehen hätte, wenn er aus irgendeinem Grund nicht da gewesen wäre.
Als der Zug gehalten hatte, hing er wieder hinter der Zeitung. Er war ziemlich kurzsichtig, deshalb hielt er sie dicht vor der Nase. Er war in einen Artikel über einen Axtmord in New York vertieft.
Infolgedessen verpasste er die Chance zu sehen, wie sich Jung-Johnnie Roane schon, bevor der Zug richtig stillstand, hinausschwang und wie Jung-Johnnie Roane dann den Bahnsteig entlangging, groß und breitschultrig, den Armeesack schräg über dem Rücken. Johnnie konnte es kaum glauben, dass er in Lennox war, heil und vollständig. Er rechnete fest damit, gleich wieder zu sich zu kommen oder aufzuwachen und ganz woanders zu sein, und das stand ihm ins Gesicht geschrieben.
Also blieb Jung-Johnnie Roane, frisch zurück aus dem Krieg, einen Augenblick lang auf dem Bahnsteig stehen, sah sich um und sog begierig alles haarklein ein, die Holzdielen unter seinen Füßen, die Umrisse der Güterwaggons, die auf dem Rangiergleis am Ende des Bahnhofs standen. Er hatte nur einen Gedanken: Glory, Glory, Glory. Es ist wahr geworden, ich bin wieder hier, in dieser Stadt, und heute Nacht halte ich sie in meinen Armen.
Dann ging er zum Taxi. Vom Wiesel waren nur die – für einen Mann sehr kleinen – Hände zu sehen, als Umrisse vor den fettgedruckten Schlagzeilen der Zeitung. Johnnie zögerte, eigentlich hätte der Mann seine Anwesenheit doch spüren und die Zeitung sinken lassen müssen. Als er das nicht tat, klopfte Johnnie an die Scheibe.
Jetzt ließ das Wiesel die Zeitung sinken, und Johnnie sah in ein spitzes Frettchengesicht mit eng stehenden Augen. Eine verbeulte Kappe saß falsch herum auf dem Kopf und war eigentlich hellgrau, aber stellenweise nachgedunkelt von Fett und Schweiß. Hinter einem Ohr klemmte eine Zigarette. Der Mann musterte Johnnie eingehend, bevor er das Fenster herunterkurbelte.
»Wo wollen Sie hin?« Er beugte sich hinaus.
»Zum Haus von Mrs. Roane, River Road.«
»Okay.« Er legte seufzend die Zeitung beiseite. »Packen Sie Ihr Zeug hinten rein.«
Johnnie hievte seinen Armeesack auf den Boden im Fond und setzte sich nach vorn neben den Fahrer. Er konnte sich nicht an ihn erinnern. Als er vor vier Jahren aus Lennox weggegangen war, hatte Old Man Crandall das hiesige Taxi gefahren.
Ein Gütereilzug rumpelte durch den Bahnhof und machte Gespräche unmöglich. Johnnie sah ihm nach und las die Beschriftung auf den Waggons: Lackawanna, B&O, Chesapeake und Ohio, New York Central …
Als der letzte Waggon aus dem Blick verschwunden war, ließ das Wiesel den Wagen an. »Sie sind bestimmt Johnnie, Mrs. Roanes Junge. Sie wartet schon auf Sie.«
»Ja«, sagte Johnnie. Hoffentlich wollte der Knirps nicht anfangen zu plaudern. Vier Jahre hatte er sich auf diesen Augenblick gefreut, jetzt wollte er ihn fest an die Brust drücken, damit ihm nichts, auch nicht das kleinste Detail, entging. Es war eine längere Strecke bis zum Haus seiner Mutter, und wenn der Kerl ein Gespräch vom Zaun brach, würde die Fahrt sehr anders verlaufen, als er wollte. Sein Plan war, sich alles haargenau anzusehen, die Bäume, die Häuser, die Straßen, er müsste den Kopf andauernd drehen und wenden und auch in die kleinen Nebenstraßen gucken, um sich den ganzen Ort einzuverleiben.
Wenn der Fahrer quasselte wie ein Wasserfall, würde er die Hälfte verpassen. Er wäre abgelenkt, könnte sich nicht darauf konzentrieren, aus was für holprigen Holzdielen der Bahnsteig zusammengezimmert war und wie beinah lachhaft das Brettergebäude mit dem langen Dach und mit diesen Trägerstützen war, die aussahen wie Spinnenbeine, und dass die ganze Anlage unter Schichten aus Dreck und Ruß lag.
Er kniff ein Auge zusammen und blinzelte. Doch, so betrachtet hatte das Bahnhofsgebäude noch immer große Ähnlichkeit mit dem Lebkuchenhaus aus Hänsel und Gretel. Er atmete aus, langsam, sachte, denn alles war noch genauso, wie er es in Erinnerung hatte. Es hatte sich gar nichts verändert.
Jetzt, wo der Güterzug durch war, konnte er hinter den Gleisen den katholischen Friedhof sehen. Der war auch noch genauso. Nein, nicht ganz. Er war weißer gewesen. Der Eisenbahnruß hatte ihn so grau gemacht wie den Bahnhof.
Beim Anblick der Kirche musste er fast lächeln, weil ihm wieder einfiel, wie die Kinder aus der Nachbarschaft sogar am helllichten Tag nur auf Zehenspitzen über den Friedhof gegangen waren. Für sie war er der irische Friedhof, und sie schworen, dass immer, wenn sie vorbeigingen, die Grabsteine schwankten und sich bewegten. Aber natürlich gab es auch einen Schnellzug namens Ostwind, der immer ungefähr zur Schulschlusszeit durch den Bahnhof ratterte, und die Schwingungen konnten die Steine ebenso gut ins Wanken gebracht haben.
Abends oder nachts gingen jedenfalls weder Kinder noch Erwachsene am Friedhof vorbei, wenn es sich vermeiden ließ. Angeblich stiegen in dunklen Nächten ruhelose irische Geister aus den Gräbern und wanderten umher. Bei Vollmond, hieß es, würden sie so unruhig, dass man ihre Spitzhacken auf den Gleisen hören könne, mitsamt leisem, vom Wind weitergetragenem Stimmengemurmel.
Ein reichlich schräger Ort, um eine Kirche zu bauen, fiel ihm jetzt auf.
»Sagen Sie«, fragte er den Fahrer, »war die Kirche immer hier?«
»Meines Wissens«, antwortete das Wiesel gleichgültig.
»Ich meine, waren die Gleise schon vorher verlegt?«
»Klar.«
»Wie kann man denn eine Kirche neben eine Bahnstrecke bauen?«
Das Wiesel schoss ihm einen Blick von der Seite zu. »Sind doch hier geboren, oder?«
»Ja, klar.«
»Und war die Kirche nich immer hier?«
»Doch. Aber ich war ziemlich lange weg.« Der Fahrer ließ ihn nicht aus den Knopfaugen, so dass Johnnie das Gefühl hatte, er müsse sich genauer erklären. »Ich hab nur nie darüber nachgedacht. Die Kirche stand da, solange ich denken kann, ich nehme an, ich hab sie für selbstverständlich gehalten. Nicht wahr. Sie war eben da, und ich hab über sowas nie nachgedacht. Aber wenn ich sie jetzt so sehe, also ich fand einfach, ist doch ein seltsamer Ort für eine Kirche.«
Das Wiesel nickte. »Weiß, was Sie mein’. Wenn man was ne Weile nich gesehn hat, sieht man da Sachen drin, die man gar nicht wusste. Geht allen so.«
Er setzte zurück und fuhr auf die Straße nach Lennox hinein. Dann sah er Johnnie an: »Sie ha’m wohl vergessen, dass Lennox Katholiken nich so mag. War das einzige Stück Land, dass die kaufen durften. Als die Eisenbahn hierher sollte, sind ne Menge Iren gekommen, Schienen legen und sowas. Die wollten dann auch ne Kirche haben, und das hier war das einzige verkäufliche Grundstück in der ganzen Stadt. Deshalb haben die die hier gebaut.«
»Dürfen die denn immer noch kein Land kaufen?«
»Och, kann man so nicht sagen.« Das Wiesel grinste. »Aber irgendwie stand immer nie was zum Verkauf auf der Hauptstraße, da wo die Episkopalen und die Kongregationalisten ihre Kirchen haben.«
Es war, als läge eine matte Wolke vor der Sonne und rückte Häuser und Bäume in die Ferne, sie waren nicht klar zu sehen, sondern leicht verschwommen, und was einst weiß gewesen war, sah dunkler aus; wie ein Nebel über einer Kurve, in der man eigentlich die ganze Straße im Blick haben müsste, aber nicht hatte. Johnnie kam zum ersten Mal der Gedanke, dass vielleicht nichts je so blieb, wie es gewesen war, ganz bestimmt nicht genauso, wie man es in Erinnerung hatte. Nicht dass sich die Dinge verändert hätten, sondern man selbst hatte sich verändert, und so fand man Dinge, von denen man glaubte, sie seien da, nicht wieder.
Jahrelang hatte er die Kirche neben den Bahngleisen stehen sehen und es so hingenommen, er hatte nie gefragt, warum sie da stand, er hatte sie eben mit Jungsaugen gesehen. Und Jungsaugen sahen etwas anderes als Männeraugen. Also gab es in Lennox wohl noch andere Dinge, die er entweder vergessen oder nie wirklich gesehen hatte.
Ihm fiel alles Mögliche ein, was er an Lennox nie hatte leiden können. Es lag nicht an dem, was der Fahrer gesagt hatte, er hatte die Lage der bescheidenen kleinen Kirche mit den drumherum gescharten Grabsteinen weder billigend noch missbilligend kommentiert. Die Erinnerungen kamen zurück wegen dieses ständigen verschlagen-zufriedenen Lächelns. Das war wie ein Wink, ein Knuff in die Rippen.
Jetzt fiel ihm wieder ein, dass überall geklatscht und getratscht wurde – im Postamt, im Gemischtwarenladen, im Drugstore und sonntags nach dem Gottesdienst vor den Kirchen. Diese Sorte Grinsen im Gesicht des kleinen Mannes hinterm Lenkrad stand für die ganze Selbstgefälligkeit und Selbstzufriedenheit der Stadt, für ihr hinterhältiges Gespött über andere.
Er verlagerte die Füße, als das Taxi auf die Hauptstraße einbog. So hatte er sie sich nicht ansehen wollen, so vor Verärgerung und Beklommenheit nur halb aufmerksam. Und statt der Freude, die vertraute Straße wiederzusehen, fiel ihm nur wieder ein, dass er schon im ersten Ehejahr aus Lennox weggewollt hatte. Aber Glory war dagegen gewesen.
Jetzt wollte er wieder weg. Diese Stadt – der kleine Mann da war ihr Ebenbild, und was aus seinem Mund kam, war ihr Denken –, diese Stadt war nicht groß genug, um ihn zu halten. Er wollte an einem Ort leben, wo man aus einem Zug stieg, einem Taxifahrer eine Adresse nannte, und der nuschelte sie aus dem Mundwinkel nach und wusste weder, wer man war, noch gar, dass man von seiner Mutter erwartet wurde; dem war alles wurscht, außer ob man genug Geld dabeihatte.
Sein ganzer Plan war schiefgegangen. Vor nicht mal fünf Minuten hatte er in der Zugtür gestanden, sich an die Ungeduld geklammert, die sich während der langen Fahrt nach Osten in ihm aufgebaut hatte, und sie im Zaum gehalten. Und trotzdem hatte er sich, als der Zug endlich langsam in die Gleiskurve ging und er den schmuddeligen kleinen Bahnhof schon sehen konnte, größte Mühe gegeben, nicht abzuspringen, bevor der Zug stand. Er hatte nur Glory im Sinn gehabt, nicht die gottverdammte Stadt, denn das war zweierlei. Sicher, die Stadt wollte er auch wiedersehen, aber vor allem wollte er unbedingt wieder bei Glory sein. Er hatte sich gezwungen, dicht an der Tür stillzustehen, er hatte hinausgeschaut und zugesehen, wie die Landschaft immer langsamer wurde und die Häuser bald nicht mehr irgendwelche Häuser waren, sondern individuelle Gebäude, die er kannte und wiedererkannte.
Die Stadt stinkt, dachte er. Das wenigstens hat sie in deiner Erinnerung nicht. Nein, das stimmt nicht ganz. Du hast bloß die Dinge vergessen, die du nicht mochtest. Du hast diese Stadt vier Jahre lang verbrämt und aufgehübscht und verzärtelt, bis etwas herauskam, was sie gar nicht war.
Hatte er das mit Glory etwa auch gemacht? Nein. Unmöglich, sie hatte ihm doch so oft Schnappschüsse geschickt, sie war immer noch dieselbe – schlank, leuchtend blond, lächelnd. Nein. Mit Glory hatte er das nicht gemacht. Natürlich, das eine oder andere hatte er womöglich vergessen, sie waren ja erst ein Jahr verheiratet, als er zur Armee ging – aber das war Kleinkram, unbedeutend.
Beruhigt über Glory wandte er sich wieder der Straße zu. Er drehte das Fenster herunter und schnupperte. Ja, irgendwer verbrannte Laub. Wo genau wusste er nicht, aber er hatte den altvertrauten beißenden Qualm in der Nase, der seinen Widerwillen gegen den Ort weit nach hinten in seinem Kopf drängte. Wär ich ein Hund, dachte er, dann würde mir jetzt vor Vergnügen über den Geruch das Fell jucken.
Denn ich bin zu Hause, und um diese Jahreszeit ist der Duft dieser Luft wie die Schlückchen eines alten Weins – sanft und samtig. Schon nach ein paarmal Nippen spürt man, wie einem das Blut ein bisschen schneller durch die Adern rauscht, und es wird einem warm. Er vergaß die Stadt und den kleinen Mann am Steuer.
Zwischen den Zaunlatten vor den alten Häusern entlang der Straße blieben Blätter hängen. Er sah zu, wie der Wind sie über den Boden fegte. Er bildete sich ein, er könnte über den schnaufenden Taximotor hinweg das matte, trockene Rauschen hören. Und dachte, du lieber Gott, dann stinkt die Stadt eben, ich bin so froh, zu Hause zu sein, dass es wehtut!
»Stadt is ganz die alte, was?«, sagte der Fahrer.
»Ja, ist sie.« Er wand sich bei der Antwort, denn anscheinend hatte der Kerl seine überbordenden Gefühle irgendwie mitgekriegt. Wer zum Teufel ist der Mann, überlegte er und verspürte heftigen Widerwillen, dieses spitze Rattengesicht, und wie der über dem Steuer hängt, vornübergebeugt, als hätte er einen Buckel. »Ich kann mich gar nicht an Sie erinnern«, sagte er, »hat Crandall sein Taxi nicht mehr?«
»Klar doch. Aber die Geschäfte sind so gut gelaufen, wegen Benzin rationiert und keine Reifen zu kriegen und so, da hat er expandiert und mich angestellt.«
»Wohnen Sie in Lennox?« Sie fuhren am Postamt vorbei, Johnnie drehte den Kopf und sah noch einmal hin. Er war samstags immer vom Point hergeradelt, die Post holen.
Miss Blandess hatte ihn über den Brillenrand angeguckt, sich umgedreht, akribisch die Kiste mit »R« durchsucht und entweder: »Keine Post für Roane«, oder: »Post für Roane. Zwei Briefe«, gemeldet.
Der Fahrer sagte: »Ja. Bin aber geboren in Westville. Hab hier überall in der Gegend gewohnt. Kenn die Orte auswendig. Sie würden sich wundern, wie viel man von’ner Stadt mitkriegt, wo man Taxi fährt.«
»Kann ich mir denken«, sagte Johnnie. Hoffentlich ging der Kerl nicht ins Detail mit seinem Wissen über Lennox. Er bereute, ihn zum Reden animiert zu haben, aber er konnte es nicht leiden, dass der in seinen Gedanken herumschnüffelte, was er ja offenbar getan hatte. »Und wie heißen Sie?«, fragte er.
»Tom Walker. Gibt aber keine drei Leute hier, wo sich den Namen merken könn. Für die meisten bin ich das Wiesel.«
Johnnie musterte sein Profil und fand, die Frage nach dem Grund erübrigte sich, die Antwort war dieses spitze Gesicht, die engstehenden Knopfäugelchen und die hinterhältige Art, einen anzusehen, so dass man es nicht gleich merkte, aber ehe man’s wusste, war der Blick tief eingedrungen und grabbelte in einem herum.
Kurz vor dem Rathaus stieg das Wiesel auf die Bremse und fuhr im Kriechgang. Er kurbelte sein Fenster herunter und spuckte nach draußen.
»Äh!«, sagte er angewidert. »Verpasst! Da ist ne Bodendelle, da ziel ich immer rein, wenn ich vorbeikomme. Mach ich, seit ich mal zwei Nächte im Stadtgefängnis gesessen hab. Die haben behauptet, ich wär betrunken, war ich aber nicht.« Dann sah er zum Rathaus hinüber und winkte einem Mann zu, der gerade heraustrat. Johnnie folgte seinem Blick, oben auf dem Absatz einer langen Treppe zur Straße stand eine dunkle männliche Gestalt.
Die breiten Säulen am Gebäude reichten bis unters Dach, und auf der weißen Fassade tanzten Muster von Ästen im Sonnenlicht. Der Umriss des Mannes davor sah aus, als ob er vor einer Theaterkulisse posierte.
Trotz der hellen Sonne verspürte Johnnie etwas Dunkles, denn der Mann war dunkel gekleidet, eine wuchtige Gestalt mit mächtigen Schultern und leichten O-Beinen.
»Der olle Ed.«, sagte das Wiesel und winkte noch einmal. »Kenn’ Sie den noch?«
»Klar. Wir haben bei ihm mal ein Auto gekauft.« Johnnie sah, wie Ed die Hand zum Gruß hob, und die Geste, die ganze Gestalt erinnerten ihn an etwas. Es war nur ein kurzer, flüchtiger Eindruck, den er nicht zuordnen konnte.
Er kramte in seinen Erinnerungen an Ed Barrell – aber so etwas gab’s da nicht. Es gab Bilder von Ed beim Autoverkauf, mit Melone und Anzug und rasiermesserscharfen Bügelfalten in der Hose, und von Ed., der auf langen Probefahrten über Land seinen Kunden in spe vorführte, wie sanft die neuen Sechszylinder sogar über Holperstraßen glitten.
Von Ed, der plötzlich im Auto um eine Kurve geschossen kam, halb verdeckt von einem Gebüsch, weshalb Johnnie seine kräftigen Schultern und die Fedora, die Ed an freien Tagen aufsetzte, nur noch von hinten sah. Und von Ed, der gerade die Frau von jemand Anderem küsste, irgendwie mächtig männlich, mit genau dem Schwung und dem Drang, die Johnnie selbst jetzt beim flüchtigen Blick auf die vorwärtsdrängenden, hochgezogenen Schultern sehen und spüren und begreifen konnte. Angesichts dieser Schultern hatte er damals zum ersten Mal geahnt, wie es sein würde, eine Frau fest in den Armen zu halten, war er sich seiner eigenen Männlichkeit bewusst geworden, denn Ed hatte dabei ausgesehen wie ein Kater, der mit steifen Beinen auf ein Weibchen zugeht – startklar, lauernd, hungrig.
Nein, die Handbewegung eben fand Johnnie nirgendwo in seinen Erinnerungen an Ed. Sie hatte nichts mit Ed zu tun. Aber es gab irgendwen, irgendwo, irgendein Zeitungsfoto, eine Geste, die er in irgendeiner Wochenschau gesehen hatte – er versuchte, ihr in Gedanken auf die Spur zu kommen. Natürlich, jetzt hatte er es – die Wochenschau mit Mussolini auf dem Balkon, in Italien irgendwo. Daran hatte der Ed auf der Rathaustreppe ihn erinnert – genau der bullige Brustkorb, der runde Kopf, die Handbewegung. Dass Ed hoch oben stand und dunkel gekleidet war, verstärkte den Eindruck.
»Der olle Ed«, sagte das Wiesel noch einmal und gab wieder Gas. »Bumst noch immer jede Frau am Ort.«
Das war eine schlichte Feststellung, die keiner Antwort bedurfte. Also ließ Johnnie die Sache auf sich beruhen. Aber sofort verspürte er wieder ein hauchfeines stechendes Unbehagen, als ihm das Wiesel einen seiner scharfen verschlagenen Blicke zuwarf und sich zu ihm wandte.
Kaum drehte sich der kurze Hals zwischen den vorgesackten Schultern, war Johnnie überzeugt, dass das Wiesel ihn nur ansah um herauszufinden, was er, Johnnie, wusste und ob er auf die Feststellung reagieren würde. Denn es gab nur einen Grund für einen Mann, auf so eine Feststellung zu reagieren – er wusste, dass seine Frau eine von Eds Frauen war.
Er spielte den Gedanken unwillkürlich durch und verwarf ihn als ausgesprochen lächerlich. Andererseits, warum sonst hatte das Wiesel eben zu ihm statt auf die Straße geguckt?
Anscheinend erwartet der, dass ich etwas sage oder einen anderen Gesichtsausdruck kriege. Aber wieso denn? Was geht mich das an, dass Ed immer noch der Hengst der Stadt ist? Mich betrifft das in keinster Weise. Ed war klein und hatte O-Beine. Jeder wusste, dass er eine Schwäche für Frauen hatte. Das war eine stadtbekannte Lachnummer. Das hatte nichts mit ihm zu tun.
Trotzdem setzte er sich hoch und sagte: »Ach, ja?« Und warf, als das Wiesel nicht antwortete, einen Köder hinterher: »Sieht ja nicht besonders aus. Was die Frauen an dem wohl finden?«
Das Wiesel lächelte. »Bei Frauen weiß man nie. Ich hab keine Ahnung, bin ja keine. Werden wohl unruhig, wenn die ne Weile verheiratet sind. Hatten sich das anders vorgestellt. Nicht so eintönig, und heute können die ja im Kino sehen, was alles so sein könnte. V’leicht zeigt Ed denen, wie’s anders sein könnte. Sorgt für’n bisschen was Aufregendes.«
Eintönig, unruhig, anders vorgestellt – die Wörter echoten in seinem Kopf. Woher wusste er, dass es Glory nicht auch so ergangen war? Ihre Briefe taugten weiß Gott nicht wirklich als Gegenbeweis. Genau betrachtet und analysiert besagten die gar nichts. Es stand nie etwas wirklich Persönliches drin.
Glory schrieb, dass er ihr fehlte und dass es kalt oder heiß war oder dass es gerade regnete oder schneite. Und dass sie gern bei seiner Mutter wohnte oder dass das junge Paar, das jetzt das Häuschen bewohnte, in dem sie und Johnnie am Anfang ihrer Ehe gelebt hatten, die Fliegengitter abgenommen oder Fliegengitter angebracht hatte oder die Chrysanthemen gepflückt oder nicht gepflückt hatte oder dass die Verandamöbel noch draußen auf dem Rasen standen und sie fürchtete, die könnten im Regen verrosten.
»Wollen Sie bei Perkins vorbei?« fragte das Wiesel unschuldsvoll und ging vom Gas.
»Nein«, sagte Johnnie barsch. Er kam sich vor wie ein Herdentier, das mit einem spitzen Stock in eine nicht von ihm gewollte Richtung getrieben wird. Vielleicht gab es keinen Zusammenhang zwischen dem Gerede des kleinen Mannes über Eds Umgang mit Frauen und deren Langeweile und seiner Frage gleich danach, ob er am Lebensmittelladen halten und Glory sehen wollte. Aber genau so fühlte es sich an.
Er hatte ohnehin nicht vorgehabt, Glory im Laden wiederzusehen, wo halb Lennox feixend und grinsend zusah, wenn er sie an sich drückte. So sehr er sie wiedersehen wollte, so heftig er sich danach sehnte, er hatte schon vor Wochen beschlossen zu warten, bis sie von der Arbeit kam. Er hatte nicht die Absicht, seine Gefühle vor der Stadt auszubreiten. Nein, er würde warten, bis sie heute Abend nach Hause kam, genauso, wie er es geplant hatte. Er wartete jetzt schon so lange, da spielten ein paar Stunden mehr keine Rolle.
Er starrte aus dem Fenster und versuchte, zwischen sich und dem Wiesel eine Schweigemauer hochzuziehen. Auf diese Weise konnte er den Blick lange über den Stadtpark schweifen lassen: auf die Kongregationalistenkirche zur einen Seite, den Drugstore gegenüber und die ausgedehnte Rasenfläche dazwischen. In der Mitte stand noch immer der weiße Blumenkübel, in dem zerzauste Geranien wuchsen, jedenfalls hielt er sie für Geranien. An Halloween hatten er und fünf, sechs andere Jungen den immer umgekippt, nur so aus Jux. Und hinter den Ulmen hatten immer die Gemeindeältesten gelauert – fette Männer in schweren Gewändern –, versessen darauf, sie zu schnappen. Die Kirchenmänner auszutricksen, war natürlich der eigentliche Jux gewesen.
Eine voluminöse Gestalt im schwarzen Umhang schlurfte langsam auf die Kirche zu und blieb stehen. Er erkannte Mrs. Gramby und freute sich, denn sie wiederzusehen, wenn auch nur durchs Autofenster, war, wie ein fast vergessenes Wahrzeichen wiederzuentdecken. Sie sah fast genauso aus wie damals, als er fortgegangen war, nur dass sie sich jetzt noch langsamer bewegte und noch schwerer auf den Stock stützte.
»Gibt Wetten, dass die noch neunzig wird.« Das Wiesel nahm einen neuen Anlauf. »Na, ich weiß nich. Die Blase is ziemlich für’n Arsch und die falschen Zähne rutschen und im Mund kann die auch nichts mehr behalten.«
Das Gerede des Wiesels fühlte sich an wie eine dreckige Hand, die einem in den persönlichen Dingen herumgrabbelte, und danach war alles durcheinander und so besudelt, dass man sich ekelte und die Sachen am liebsten weggeschmissen hätte, weil sie nicht mehr dieselben waren. Mit diesem trostlosen Porträt, in dem Mrs. Gramby nach Urin roch und ihre falschen Zähne beim Sprechen klapperten, hatte er Johnnie soeben alle Freude über ihren Anblick vergällt.
Aus dem Wiesel spricht Lennox, dachte er. Und sein Kommentar steht für ganz Lennox, selbst wenn er nur aus dem schiefen Schandmaul eines Schrumpelmännchens kommt. Er verfluchte die Stadt, diesen Ort, wo der Zustand der Nieren einer alten Frau als beliebter Diskussionsstoff galt, in Küchen und Schlafzimmern wie auf dem Postamt und im Drugstore.
Er musste nicht hier leben. Er und Glory konnten jederzeit wegziehen und in einer richtigen Stadt leben – einer Großstadt. Hoffentlich, dachte er, hält der kleine Drecksack in seiner Rumpelkiste ab sofort den Mund. Ich möchte nachdenken. Ich möchte nicht, dass der seinen Schnabel in meinen Kopf steckt.
Das Wiesel warf ihm weiter hinterhältige Blicke zu. Als die Wieselaugen wieder mal sekundenlang auf Johnnie statt auf der Straße ruhten, schoss plötzlich eine schwarze Katze aus dem Unterholz am Fluss und lief direkt auf den Wagen zu.
Auf den ersten Blick sah Johnnie nur einen Streifen Schwärze, dann erst erkannte er eine Katze, geduckt, den Bauch fast auf dem Boden. Der Wagen geriet heftig ins Schwanken und Schlingern, und Johnnie wusste, dass Wiesel einen Schreck gekriegt und das Lenkrad scharf nach links statt nach rechts gerissen hatte. Dann fuhr der Wagen über ein flaches weiches Hindernis.
»Gottverdammt!« sagte das Wiesel. »Hab das Viech erwischt.«
Die Wieselaugen suchten im Rückspiegel herum. Johnnie erkannte am Blinzeln, dass er die Katze geortet hatte. Er fuhr unwillkürlich herum und sah nach hinten.
Die Katze lag platt auf der Fahrbahn, ein Matsch aus schwarzem Fell und dunkelrotem Blut. Die Blutlache wurde zusehends grö-ßer.
Das Wiesel warf ihm einen finsteren Blick zu, und Johnnie sah weg. Das hier war ein böses Omen. Schlimm genug, wenn einem eine Katze über den Weg läuft, aber sie musste die auch noch schwarz sein und just im Moment seiner Ankunft unbedingt von einer Straßenseite zur anderen laufen. Und sie mussten die verdammte Katze auch noch totfahren.
»Nennt man wohl Pech«, sagte das Wiesel leise. »Tut mir leid. Wo Sie grad nach Hause komm’ und so.«
»Schon in Ordnung. Hat nichts zu bedeuten«, sagte Johnnie schnell. Wohl wissend, dass es sehr wohl etwas zu bedeuten hatte, wohl wissend, dass er bei Gott lieber nie in dieses Taxi mit diesem Schrumpelmännchen gestiegen wäre. Dass er unbedingt ohne Ankündigung hatte ins Haus treten und plötzlich vor seiner Mutter stehen wollen, wenn sie nicht mit ihm rechnete, war kindisch gewesen. Hätte er vorher angerufen, wäre sie zum Bahnhof gekommen. Aber nein, er musste es ja partout so haben.
Das Wiesel hielt vor dem Haus, Johnnie bezahlte und zerrte den Armeesack aus dem Taxi. Er sah ihm nach, bis es hinter der Kurve verschwunden war. Was für ein verdammtes Zeichen. Plötzlich packte ihn Angst. Dieses rattengesichtige Männchen hatte ihm klargemacht, dass nichts je dasselbe war, nichts je dasselbe bleiben konnte – weder an der Oberfläche noch tief darunter.
3
Der beißende hartnäckige Wind wehte von Nordosten herein und mit ihm die feuchte Kälte des Meeres. Johnnie Roane war plötzlich kalt, er zog sich den Kragen der Feldjacke um den Hals. Er betrachtete das Haus, in dem er geboren war, das Haus, in dem er die meiste Zeit seines Lebens verbracht hatte, mit einem Schauder, weil ihn eine Angst umgab, die er nicht loswurde.
Er starrte es an, suchte nach bekannten, vertrauten Einzelheiten. Es schien unverändert. Die Holzverkleidung war noch immer weiß, die Fensterläden dunkelgrün gestrichen. Er wusste auch noch genau, wie die modernen großen Scheiben eingebaut worden waren, weil seiner Mutter das Putzen von alten Fenstern mit vielen kleinen Scheiben zu lästig wurde.
Der Anblick des Hauses hatte etwas Beruhigendes. Nirgendwo eine unangenehme Überraschung. Er war erleichtert, etwas von der Furcht verzog sich.
Er sah zur Garage. Sie stand offen, und er konnte die Rückseite des Autos sehen – dasselbe Nummernschild wie damals, als er fortgegangen war: RR15. Nur der Jahresstempel war bestimmt nicht mehr von 1942, sondern von 1946, aber lesen konnte er die kleinen Ziffern aus der Entfernung nicht.
Vier Jahre waren eine lange Zeit im Leben eines Mannes. Er hatte plötzlich das seltsame Gefühl, abgeschnitten gewesen zu sein, in der Mitte abgeklemmt wie ein Gummischlauch, wodurch sein Lebensfluss jäh und brutal zum Stillstand gekommen war. Jetzt war die Klemme entfernt, und ihm wurde schwummerig. Dieses Haus hatte hier gestanden, während er weg war, und darin hatten Leute gewohnt, Leute, die seine Familie waren, die völlig andere Erfahrungen gemacht hatten als er, und auch sie hatten sich verändert, kaum merklich, auf vielerlei Weise, so wie er.
Dann schob er seine Zweifel und Befürchtungen beiseite und stellte sich dem Wind – spürte ihn im Gesicht, scharf und kalt.
Er lud den Armeesack auf die Schulter und ging locker, mit großen Schritten den Weg hoch. Kurz vor der Haustür änderte er seinen Plan und bog auf den schmalen Weg nach hinten zur Küchentür.
Als er um die Hausecke kam, ermahnte er sich: Du denkst zu viel, Kumpel. Hast du schon immer, und das ist nicht gesund. Denn er ertappte sich bei der Vorstellung, dass er gerade irgendwie mit tausend anderen Männern ums Haus herumging – und alle waren nicht die ersten Kriegsheimkehrer und mit Sicherheit nicht die letzten. Auch vor ihm waren Soldaten nach Hause gekommen – und andere würden nach ihm kommen, in sechs Monaten oder einem Jahr. Er überlegte, ob auch sie, wenn sie um andere kleine Häuser in anderen kleinen Städten herum gingen oder in Mietshäusern in großen Städten den Schlüssel ins Schloss steckten, einen Augenblick innehielten, weil ihnen plötzlich wegen grässlicher kleiner Ängste kalt und bange war.
Dann hörte er Besteck klimpern und Geschirr klappern. Als er näher an die Küchentür kam, wusste er, was die Geräusche bedeuteten: Seine Mutter war fertig mit dem Mittagessen, es war heiß in der Küche, und sie hatte die Küchentür aufgemacht. Innen waren schnelle Schritte zu hören. Er setzte den Armeesack ab, stieg die Stufen hoch und klopfte an die Tür.
»Wer ist da?« Die Stimme seiner Mutter.
Er antwortete nicht. Er pochte noch einmal, und wieder fragte seine Mutter: »Wer ist da?«
Er trat zur Seite und drückte sich flach an die Wand. Ein Kinderstreich. Aber er konnte nicht anders. Er wollte sehen, wie sie guckte, genau so, kalt erwischt.
Die schnellen Schritte kamen auf die Fliegengittertür zu. »Wer ist da?«
»Lebensmittellieferung«, sagte er mürrisch.
»Was?« Sie zog die Tür auf, entdeckte ihn und blieb einen Augenblick reglos stehen. Dann sagte sie: »Oh!«, mit einem tiefen Seufzer. Und dann: »Johnnie! Oh, Johnnie!«
Aus ihrem Gesicht wich alle Farbe. Sie griff nach einem Schürzenzipfel und nestelte daran herum, als wäre das Befühlen des Stoffs der überzeugende Beweis, dass das hier wirklich war, als müsste sie sich vergewissern, dass die Küchenschürze von derselben Welt ist wie der Moment, in dem man eine Fliegengittertür aufzieht, hinausschaut und seinen einzigen Sohn erblickt. Sie sah an der Schürze hinunter – hastig –, als brauchte sie weitere Beweise und fände sie sie in dem blauweißen Perkalmuster und der roten Zackenlitze.
Sie ließ den Zipfel los und trat auf die Veranda. »Johnnie«, sagte sie noch einmal und betastete seinen Ärmel. »Oh, Johnnie, du bist wieder zu Hause.«
Er nahm sie in die Arme, schob sie aber gleich wieder von sich, um sie anzusehen. Sie war dicker geworden, die Haare deutlicher grau, aber ihre Augen waren noch genauso, wie er sie in Erinnerung hatte – dunkelbraun mit einem tiefinneren Glanz –, und ihr Mund wohlwollend und irgendwie so freundlich wie die Augen. Die Furchen zwischen Mund und Nase waren jetzt tiefer, aber um die Mundwinkel lag noch immer dieser komische Zug – eine Einladung zum Lachen.
»Die haben euch Zivilisten ja richtig gut gefüttert.« Er grinste.
»Liegt bloß an meinem alten Korsett«, sagte sie, »wenn ich gewusst hätte, wann du genau kommst, dann hätte ich natürlich …«
»Das neue angezogen? Dein bestes?«
»Natürlich.« Sie übersah das Lachen in seinen Augen.
Sie ging zurück zur Küche und hielt die Fliegengittertür weit auf. Er beobachtete sie und dachte: Sie hält sie für dich auf, Kumpel, denn für sie verkörperst du all des Königs Rösser und all des Königs Mannen.
Sie sagte nur: »Komm mit rein. Ich mache dir was zu essen.«
Während sie Speck ausließ und Eier quirlte, sah er sich in der Küche um. Alles war genauso, wie er es in Erinnerung hatte: Der große schwarze Gusseisenherd biss sich noch immer mit der modernen weißen Emaillespüle, der runde Eichentisch in der Küchenmitte war viel zu ausladend.
Sein Widerwille gegen Lennox verlor die scharfen Kanten und weichte auf. Hier hatte sich gar nichts verändert – nicht die Küche, nicht die Garage, nicht der Fluss hinter dem Haus und der Ligusterhecke, nicht die Augen und der Mund seiner Mutter.
Sie sagte: »Du bist richtig groß geworden.« Er meinte, ein leises erschrockenes Flackern in ihren Augen zu sehen, war aber nicht sicher.
»Ja?«
Jetzt drehte sie sich zu ihm. »Du bist jetzt ein Mann. Dass jemand so wachsen kann, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit.«
»Als ich wegging, war ich auch schon ein Mann.«
»Oh nein«, sagte sie. »Du warst noch ein Junge. Zweiundzwanzig. Du warst ja noch in dem Alter nicht mal ausgewachsen. Du warst bloß Arme und Beine.«
»Ich war verheiratet. Also muss ich ja wohl ein Mann gewesen sein.«
Die Gabel sauste zu Boden, weil sie vor Schreck die Hand hochgerissen hatte. »Du warst gar nicht im Laden bei Glory?«, fragte sie. »Sie weiß nicht, dass du hier bist?«
»Ich dachte, ich warte, bis sie nach Hause kommt. Als kleine Überraschung.« Das Warten würde hart werden, härter, als ihm klar gewesen war. Aber er würde schon schaffen, die nächsten Stunden durchzuhalten.
»Vielleicht möchte sie gar nicht überrascht werden«, sagte Mrs. Roane. »Du weißt doch, Frauen werfen sich gern in Schale für ihre Mannsbilder. Nicht nur, was die Kleider angeht, auch im Kopf. Willst du nicht lieber im Laden anrufen, damit sie weiß, dass du hier bist?«
»Nein«, sagte er stur. »Ich will es so haben. Ich will sehen, wie sie durch die Tür spaziert und ins Haus kommt, ohne zu wissen, dass ich hier bin.«
Endlich waren sie allein im Zimmer. In seinem alten Jungsschlafzimmer – seltsam vertraut und fremd zugleich.
Er blieb mit der Hand an der Türklinke stehen und lauschte auf das leise Stimmengemurmel seiner Mutter und seines Vaters, das den Flur entlang schwirrte. Ganz bald würde seine Mutter ruhig und gleichmäßig atmen und nur noch das Schnarchen seines Vaters zu hören sein – ein gleichbleibendes, aber nicht unangenehmes Geräusch. Sein Vater würde im Schlaf aufstöhnen und einmal laut schnauben und sich dann umdrehen. Die Bettfedern würden quietschen, und seine Mutter würde sagen: »Jonathan. Alles gut mit dir? Jonathan … Jonathan …«
Er zog leise die Tür zu, ließ die Klinke los, drehte sich zu Glory und starrte sie an. Er konnte nicht anders, er musste sie einfach anstarren, schon seit sie von der Arbeit gekommen war. Sie hatte die Küchentreppe mit leichten schnellen Schritten genommen. Mit ihr war ein Schwall süßer kalter Luft hereingeweht, sie schien wie eingehüllt in die Frühherbstdämmerung und von einem geheimnisvollen sanften Glanz umgeben, der tief in ihren Augen schimmerte und in ihren Haarspitzen hing.
Die meiste Zeit hatten seine Mutter und Glory geredet, er fand einfach keine Worte für das, was er sagen wollte. Dann war sein Vater nach Hause gekommen, sie hatten sie zu Abend gegessen und danach Radio gehört. Sein Vater hatte Pfeife geraucht und ihn endlos ausgefragt.
Er hatte alles beantwortet, hoffentlich vernünftig. Aber hatte auch dabei die Augen nicht von Glory lassen können, sie war noch zarter und schöner als in seiner Erinnerung. Er hatte nur eins gewollt: Mit ihr allein sein, hier in diesem Zimmer.
Jetzt waren sie beide allein und hier, und er fühlte sich unbeholfen, befangen.
»Glory«, sagte er leise.
Sie zog die Tagesdecke vom Bett, faltete sie zusammen und drehte sich mit dem krisseligen Baumwollballen überm Arm zu ihm. »Ja?«
»Ich liebe dich.« Er ging zu ihr. Er zog sie in die Arme, presste sie fest an sich.
»Du verknautschst die Decke«, protestierte sie.
»Zum Teufel mit der Decke.« Er nahm sie ihr ab und hängte sie über den Windsorstuhl neben dem Bett.
Er drehte sich wieder zu ihr, zögerte aber einen Moment, unsicher. Sie sah ihn an, als wäre sie vor irgendetwas auf der Hut, ängstlich, und hätte gleichzeitig Angst, dass es ihr anzusehen war. Dann zog er sie wieder in die Arme, vergrub sein Gesicht in ihren Haaren, schob sie sachte in Richtung Bett.
»Oh, Liebling«, sagte er, »ich liebe dich, liebe dich, liebe dich.« Er zog sie noch enger an sich und küsste sie.
»Du verknitterst mir das Kleid«, sagte sie.
»Na, zieh’s einfach aus.« Er machte eine Handbewegung, als ob er ihr helfen wollte, aber sie wich zurück. »Na komm, zieh’s aus«, sagte er noch einmal.
Sie löste den Gürtel vom Kleid und fing an, ihn fest und akkurat zu einer Rolle zu wickeln. Er sah auf ihre Finger. Irgendetwas stimmte nicht. Wie konnte sie dort stehen und sich auf einen Gürtel konzentrieren?
Er setzte sich auf den Stuhl neben dem Bett und fummelte an seinen Schnürsenkeln, aber statt aufzugehen, verknoteten sie sich erst recht. Er fluchte leise. Dann verhedderten sich seine Finger in den Hemdknopflöchern. Er brach die hektische Entkleiderei ab und grübelte, warum sie da immer noch herumstand – so ungerührt, so überhaupt nicht aufgeregt, beschäftigt mit Gürtelaufrollen, fein säuberlich, handfertig.
Vielleicht war sie verlegen, aber das konnte doch nicht sein. Sie waren kein unbeholfenes Paar in den Flitterwochen, frisch verheiratet, noch bange voreinander. Vielleicht verlor sie ja ihre Befangenheit oder was immer sie am Ausziehen hinderte, wenn er sie nicht mehr anstarrte. Er sah erst wieder in ihre Richtung, als er die Bettdecke aufschlug.
Sie stand weiter vor der Kommode und nestelte an dem Gürtel herum, rollte ihn noch kleiner, noch fester zusammen. Der Anblick machte ihn zornig.
»Willst du die ganze Nacht dastehen und mit dem verdammten Gürtel rumkaspern?«, fragte er.
»Natürlich nicht«, sagte sie ruhig.
Mehr sagte sie nicht. Sie machte auch keine Anstalten sich auszuziehen. Schließlich nahm er ihr den Gürtel aus der Hand. »Soll ich dir helfen?« fragte er.
»Nein.« Sie sah ihn nicht an. Sie ließ ihn einfach stehen, zog die Schranktür auf, nahm einen seidenen Hausmantel vom Bügel und ein Paar Hausschuhe von einem Regal oben. Dann ging sie quer durchs Zimmer zurück zur Kommode und zog ein hauchdünnes Nachthemd aus einer Schublade.
»Heh«, sagte er, »du brauchst doch kein Nachthemd.«
Sie ging zur Tür und öffnete sie.
»Wo gehst du hin?«, fragte er verdutzt.
»Ins Bad.«
Er legte sich in das Bett aus Schwarznussbaum und drehte den Kopf hoch zu dem Kopfteil mit den geschnitzten Weintrauben. Er wusste noch ganz genau, wie seine Mutter ihm das Bett gekauft hatte. Er war fünfzehn und schoss in die Länge, und seine Mutter fand, es sei Zeit für ein Bett in Männergröße. Sie hatte das Riesending bei einer Versteigerung entdeckt und war wütend geworden, als sein Vater gesagt hatte: »Davon kriegt der Junge ja Alpträume. Möchte wetten, da drin sind ganze Generationen gestorben.«
Es war irgendwie komisch, wieder in diesem Bett zu liegen. Aber jetzt natürlich nicht mehr allein. Diesmal würde Glory bei ihm liegen. Er hatte vergessen, wie schwarz und düster das Holz war. Das Kopfteil war so dunkel und ragte so hoch, dass es einem von unten vorkam wie eine Mauer, die man erklimmen musste – eine schwarze Mauer, unüberwindbar steil, weil einem die dunkle Oberfläche allen Mut nahm und alles Selbstvertrauen zersetzte, noch bevor man anfing.
Was zum Teufel trieb Glory im Bad? Er horchte auf den Wasserhahn. Da lief nichts. Er starrte auf das Tapetenmuster. Lauter schmucke goldene Blumen, in endloser Wiederholung. Wenn man lange genug hinsah, wurde einem schwindelig.
Falls er wieder in diesem Zimmer wohnen müsste, würde er die Tapete wechseln. Komisch, dass Glory das nicht getan hatte. Überhaupt, es gab im ganzen Zimmer keinen Hinweis, dass Glory es bewohnte. Keine Bücher. Keine Zeitungen. Keine Illustrierten. An den Wänden auch nur die Bilder, die er selbst vor Jahren aufgehängt hatte.
Ach doch, der Spiegel über der Kommode war neu hier. Er hatte früher in ihrem Wohnzimmer gehangen. Ihm fiel wieder ein, wie sie ihn bei Malley’s in New Haven gekauft und im Bus nach Hause geschleppt hatten, weil Glory nicht auf den Lieferdienst warten wollte.
Wenn er jetzt überlegte – sie hatte nie abwarten können, wenn sie etwas unbedingt wollte. Sie musste immer alles sofort in Besitz nehmen, hier und jetzt, in derselben Sekunde, in der sie den Wunsch danach verspürt hatte. Aber warum zögerte sie dann den Moment ihrer Wiedervereinigung hinaus, schob ihn auf –
Die Tür ging auf, und Glory kam herein. In diesem Hausmantel. Er war aus Taft, blass blau-grün. Wie das Meer, dachte er, und ihre langen Haare fallen bis auf die Schultern und strahlen hell wie die Sonne auf dem bläulich-grünen Stoff.