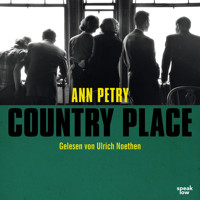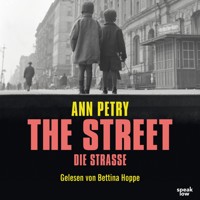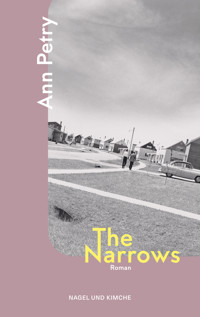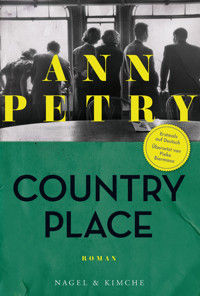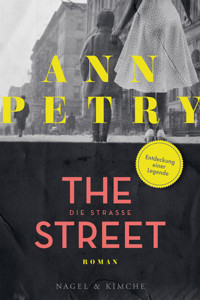16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Nagel & Kimche
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Protagonisten in Ann Petrys Geschichten mit Titeln wie Mutter Afrika oder Der neue Spiegel kommen aus fast allen Schichten – Mittelschicht, Unterschicht, Arbeiterklasse – und Lebensbereichen. Mal handeln sie von einer Apothekerfamilie, eine biografische Gemeinsamkeit mit der Autorin, mal von einem Kleinkind, einem Künstler, einem College-Professor. Sie alle schaffen etwas, was viele Geschichten dieser Zeitnicht geschafft haben: einen facettenreichen Blick auf das Leben der schwarzen Bevölkerung in Amerika zu werfen. Ann Petry hat diese und andere unvergessliche Erzählungen in dem Band vor mehr als siebzig Jahren verfasst, doch kaum etwas hat sich seither geändert: ungerechtes Vorgehen der Polizei und Brutalität gegen Afroamerikaner gibt es immer noch, genau wie innere und vererbte Ängste und Kämpfe, die einen Großteil der schwarzen Bevölkerung unterschwellig beschäftigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ann Petry
Miss Muriel
Erzählungen
Aus dem amerikanischen Englisch von Pieke Biermann
Die Originalausgabe erschien 1971 unter dem Titel Miss Muriel and Other Stories bei Houghton Mifflin, Boston.
Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber an den
aufgeführten Zitaten ausfindig zu machen,
verlagsüblich zu nennen und zu honorieren.
Sollte uns dies im Einzelfall nicht möglich gewesen sein,
bitten wir um Nachricht durch den Rechteinhaber.
Der Abdruck der Zitate auf den Seiten 44, 100 und 252 aus RICHARD III / MACBETH von William Shakespeare in der Übersetzung von Frank Günther erfolgt mit der freundlichen Genehmigung des Hartmann & Stauffacher Verlag, Köln.
© 1971 by Ann Petry
Deutsche Erstausgabe
© 2024 für die deutschsprachige Ausgabe
NAGEL UND KIMCHE
in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg
Covergestaltung von wilhelm typo grafisch
Coverabbildung von Granger / Bridgeman Images
E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 9783312012985
www.nagel-kimche.ch
Jegliche nicht autorisierte Verwendung dieser Publikation zum Training generativer Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) ist ausdrücklich verboten. Die Rechte der Autorin und des Verlags bleiben davon unberührt.
Dieses Buch ist für Walter J. Perry
Miss Muriel
Ruth Davis und ich gehen nach der Schule fast jeden Tag zusammen nach Hause. Wir gehen sehr langsam, wir reden nämlich gern miteinander, aber in der Schule kommen wir kaum dazu und nachmittags auch nicht. Wir sind uns sehr ähnlich. Wir sind beide zwölf und im ersten Highschooljahr und machen keine Hausaufgaben – also, nur selten, wir lernen nämlich schneller als der Rest der Klasse. Wir lachen über dieselben Sachen und sind neugierig auf dieselben Sachen. Wir haben sogar dieselbe Frisur – dicke Zöpfe den halben Rücken runter. Nur in einem sind wir uns nicht ähnlich. Sie ist weiß und ich bin schwarz.
Als wir gestern vor dem Haus ankamen, in dem mein Vater seine Apotheke hat, haben wir uns erst mal auf die Stufen gesetzt – die langen Holzstufen entlang der gesamten Front. Ruth hat gesagt: »Hier würd ich auch gern leben«, und die Stufen getätschelt, obwohl die ziemlich splitterig sind.
Aunt Sophronia hat uns wohl reden gehört, denn sie kam zur Tür. Sie sagte: »Ich habe heute Morgen meine Schuhe zum Schuster gebracht. Bitte geh sie für mich abholen«, und gab mir ein Pappkärtchen mit einer Nummer drauf.
»Kommst du mit, Ruth?«
»Ich muss nach Hause. Meine Tante hat ganz bestimmt auch was zu tun für mich. Genau wie deine.« Sie lächelte Aunt Sophronia an.
Ich bin den halben Weg bis zu ihr nach Hause mitgegangen und dann wieder zurück und die Petticoat Lane hoch zur Schusterwerkstatt. Mr. Bemish, der Schuster, ist ein kleiner weißer Mann mit grauen Haaren. Er hat ein Glasauge. Das hat nicht dieselbe Farbe wie sein eigenes. Es ist ein dunkleres Grau. Wenn ich zu dicht neben ihm stehe, wird mir immer etwas mulmig, weil sich das eine Auge in seiner Höhle bewegt und das andere nicht.
Mr. Bemish und ich sind Freunde. Ich bringe ihm immer Schuhe zum Reparieren. Wir besitzen kein Gespann, deshalb gehen wir viel zu Fuß. Wir haben sogar eine Familienregel, dass wir unter fünf Kilometern Entfernung immer zu Fuß gehen müssen. Und deshalb müssen unsere Schuhe ständig zur Reparatur, sie brauchen neue Sohlen und Absätze, und wir brauchen anscheinend andauernd neue Schnürsenkel. Im Wald bleibe ich ziemlich oft mit den Oberteilen in den Stechwinden hängen, und dann müssen die Risse wieder geflickt werden.
Als ich Aunt Sophronias Schuhe abholen kam, saß Mr. Bemish beim Fenster. Das Fenster ist groß, er hat von da einen schönen Blick auf die Straße. Er hatte seine Lederschürze um und die Brille auf. Die Brille ist klein mit einem Stahlgestell. Er nähte gerade einen Schuh, in der Nadel steckte ein langer gewachster Leinenfaden. Den Faden wachst er immer selbst.
Ich gab ihm das Kärtchen, und er stand auf und holte die Schuhe. Ich sah, dass er sie getrennt von den anderen Schuhen gestellt hatte. Es sind Aunt Sophronias Ladenschuhe. Sie glänzten wie Lackleder, so blank hatte er sie poliert. Sie standen ganz allein vorn auf dem Tisch, auf den er die Schuhe stellt, die er fertig hat. Er beugte sich zu mir, und ich wich etwas zurück. Ich mochte dem Glasauge nicht so nahe kommen.
»Die Dame, die die Schuhe gebracht hat. Wer ist denn das?«
Ich sah ihn an und zog eine Augenbraue hoch. Die Kunst, eine Braue zu heben, hatte ich zwei Monate lang ständig vor dem Spiegel einstudiert.
Mr. Bemish sagte: »Was ist los mit dir? Hast du meine Frage nicht gehört? Wer ist die Dame, die mir diese Schuhe gebracht hat?«
Ich trat noch einen Schritt zurück. Er wusste es nicht, aber ich kopierte gerade Dottle Smith, meinen absoluten Lieblingsmenschen auf der ganzen Welt. Dottle erzählt die wunderbarsten Geschichten und kann schauspielern und Gedichte rezitieren. Er kommt jeden Sommer zu Besuch. Also, ich verneigte mich erst vor Mr. Bemish und verneigte mich danach vor einer imaginären Gruppe von Leuten irgendwo rechts von mir und sagte: »Meine Herren, nehmen Sie Platz. Mr. Bones, wer war die Dame, mit der ich Sie gestern Abend sah?« Dann senkte ich die Stimme und sagte: »Das war keine Dame. Das war meine Frau.«
»Mädelchen –«
»Warum sagen Sie immer Mädelchen zu mir? Ich hab einen Namen.«
»Ich kann mir nicht merken, wie Leute heißen. Ich bin zu alt dafür. Das hab ich dir schon mal erklärt.«
»Wie alt sind Sie, Mr. Bemish?«
»Geht dich nichts an«, sagte er griesgrämig. »Wer –«
»Nun, ich frage nur, um zu entscheiden, ob ich auch denke, dass Sie alt genug für Vergesslichkeit sind. Halten Sie die Vergangenheit für wirklicher als die Gegenwart?«
Mr. Bemish drückte seinen Verdruss mit einem finsteren Blick aus. »Die Stadt ist voll von Kindern«, fing er an. »Kinder bringen mir die Schuhe und holen sie wieder ab, wenn ich sie repariert habe. Die Kinder erledigen das. Und für mich sehen die alle gleich aus. Ich kann mir nicht merken, wie die heißen. Ich versuche es auch gar nicht erst. Ich gedenke nicht, mir das Hirn mit einem Haufen Kindernamen zu verstopfen. Ich sehe auch nicht so oft dieselben Kinder. Also sage ich Junge zu den Jungs und Mädelchen zu den Mädchen. Das habe ich dir schon mal erklärt. Was ist denn heute los mit dir?«
»Es ist Frühling, auf der Kirchenwiese sind lauter Rotkehlchen auf der Suche nach Würmern. Wären Sie nicht manchmal lieber ein Rotkehlchen auf der Suche nach einem Wurm?«
Er seufzte. »Jetzt sag schon, wer war die Dame, die diese Schuhe gebracht hat?«
»Aunt Sophronia.«
»Sophronia?«, fragte er. »Ein komischer Name. Das ist deine Tante?«
»Ja.«
»Lebt sie bei euch?«
Vor der Tür maunzte Mr. Bemishs Katze, ich ließ sie herein. Sie ist ein sehr hübsches Geschöpf, grau mit weißen Pfoten und einem wirklich tollen Fell. »May-a-ling, May-a-ling«, ich tätschelte sie, »wo warst du denn?« Ich habe immer das Gefühl, wenn ich warte, wenn ich einfach weitermache, dann antwortet sie. Sie ist eine sehr intelligente Katze und sehr zugänglich.
»Lebt deine Tante bei euch?«
»Ja.«
»Lebt sie schon lange bei euch?«
»So sechs Monate, glaub ich. Sie ist Apothekerin.«
»Du meinst, sie versteht was von Medizin?«
»Ja, wie mein Vater. Sie betreiben den Drugstore gemeinsam.«
Mr. Bemish schob die Hände in Aunt Sophronias Schuhe, hielt sie hoch und betrachtete sie eingehend. Dann führte er sie an der Tischkante entlang, so in Tippelschritten, als Karikatur der Art, wie Frauen gehen.
»Sie hat kleine Füße, nicht?«
»Nein.« Ich versuchte zu klingen wie meine Mutter, wenn sie etwas missbilligt.
Er wurde rot und wickelte die Schuhe zu einem akkuraten Bündel in Zeitungspapier.
»Ist sie verheiratet?«
»Wer? Aunt Sophronia? Nein. Sie ist nicht verheiratet.«
Er holte seinen Kekstopf vom Regal. Mr. Bemish lebt in der Werkstatt. Er hat einen Herd an einer Wand, einen großen schwarzen Herd aus Gusseisen mit Nickelrosten und einem Teekessel drauf, und neben dem Herd ist ein schwarzer Ausguss, auch aus Gusseisen, mit einer Pumpe. Er kocht sein Essen selbst, er backt Brot, und meistens blubbert irgendein Eintopf auf dem Herd. Im Winter frieren in der kleinen Werkstatt die Fenster so zu, dass ich nicht hinein- und er nicht hinaussehen kann. Sobald es dämmert, zieht er die roten Vorhänge zu und schaltet die Lampen an, dann schimmern die Fenster von außen rosarot, von der Frostschicht und den roten Vorhängen und dem Licht dahinter.
Manchmal vergisst er, den Vorhang zwischen seiner Schlafnische und der Werkstatt zuzuziehen, dann kann ich sein Bett sehen. Es ist ein Messingbett. Offensichtlich poliert er es, es glänzt nämlich wie Gold. Kopfteil und Fußteil sind verschlungen geformt. Vor dem Bett liegt ein kleiner Teppich mit Blumenmuster. Unter dem Bett steht sein weißer Porzellannachttopf. An der Wand hängen ein dunkler Anzug und ein paar Hemden an Haken. Es gibt eine Kommode mit Schubladen, darüber einen kleinen goldgerahmten Spiegel und daneben ein Waschgestell mit einer Waschschüssel und einer Kanne. Waschschüssel und Kanne sind weiß mit aufgemalten rosaroten Rosenknospen.
Mr. Bemish hielt mir den großen Steinguttopf hin.
»Nimm einen Keks, Mädelchen.«
Er macht große, dicke Sirupkekse. Ich aß gleich drei auf einmal. Ich hatte gar nicht mitgekriegt, dass ich Hunger hatte. Den vierten Keks aß ich ganz langsam und unterhielt mich mit Mr. Bemish.
»Ich glaube nicht, dass meine Aunt Sophronia je heiratet.«
»Warum nicht?«
»Na, ich hab noch nie von einer Apothekerin gehört, ich wüsste auch gar nicht, wen eine Apothekerin heiraten würde. Vielleicht einen anderen Apotheker? Hier gibt‘s nirgends welche außer meinem Vater, und den kann sie ja nun nicht heiraten. Er ist schon verheiratet, mit meiner Mutter.«
»Sie sieht aus wie eine Zigeunerin«, sagte Mr. Bemish verträumt.
»Aunt Sophronia, meinen Sie?«
Mr. Bemish nickte.
»Tut sie nicht. Sie sieht aus wie meine Mutter und Aunt Ellen. Und die, sagen mein Vater und Uncle Johno, sehen aus wie ägyptische Königinnen.«
Sie sind beide nicht sehr groß und haben flinke Bewegungen und sehr glatte braune Haut und große schwarze Augen und eine sehr aufrechte Haltung. Aber sie sind sich nicht ähnlich. Meine Mutter hat viel Geschäftssinn. Sie kauft und verkauft gern Sachen. Sie ist Fußpflegerin und Friseurin. Manchmal scheint das Leben nur aus anderer Leute Haaren und Zehennägeln zu bestehen. Sie stellt selbst Haarwasser her und verkauft es an ihre Kundinnen. Sie entwirft Essgeschirr und Tischdecken und Gästehandtücher und verkauft sie. Aunt Ellen und Uncle Johno sind eher für Kultur zuständig. Aunt Ellen hält Vorträge in Schulen und Colleges. Sie spielt Bach und Beethoven auf Klavier und Orgel. Sie schreibt Artikel für Zeitungen und Illustrierte.
Über Aunt Sophronia weiß ich nicht sehr viel. Sie arbeitet im Laden. Sie bereitet die verschriebenen Rezepturen zu. Sie stickt. Sie liest viel. Klavier spielt sie nicht. Sie ist sehr gepflegt. Die Männer, die in den Drugstore kommen, beobachten sie aus den Augenwinkeln. Sie trägt die Haare straff aus der Stirn gekämmt und ist immer schlicht gekleidet, hochgeschlossene Kleider mit langen Ärmeln, und trotzdem sieht sie aus wie – na ja, wie eine ägyptische Königin. Sie ist jung, aber sie wirkt sehr ruhig und vernünftig.
Mr. Bemish bot mir noch einen Keks an. Ich sagte artig: »Den esse ich auf dem Nachhauseweg, damit ich bei Kräften bleibe. Vielen, vielen Dank.«
Als ich Aunt Sophronia die Schuhe gab, erzählte ich ihr: »Mr. Bemish findet, du siehst aus wie eine Zigeunerin.«
Meine Mutter sah mich ärgerlich an. »Hat er gesagt, du sollst das weitererzählen?«
»Nein, hat er nicht. Aber ich fand es eine interessante Aussage.«
»Ich möchte nicht, dass du weitererzählst, was du so hörst. So was macht nur Ärger. Jetzt werde ich jedes Mal, wenn ich Mr. Bemish sehe, überlegen, ob –«
»Was denn – ich meine –«
Sie sagte, ich soll jetzt gehen und mich ums Klavierlernen kümmern machen, und überging meine Frage. Ich möchte mal wissen, wie alt ich werden muss, bevor ich erwachsene Fragen stellen darf und ehrliche Antworten bekomme. Die Erwachsenen finden immer etwas, das ich stattdessen machen soll. Ist das etwa keine Machtausübung, wenn sie mir irgendwas befehlen, bloß um Fragen auszuweichen?
An dem Abend, so gegen fünf, kam Mr. Bemish in die Apotheke. Ich saß auf der Bank am Fenster. Die Bank ist sehr alt. Auf die setzen sich die Kunden, wenn sie darauf warten, dass ihre Medikamente fertig werden. Das Holz hat eine wunderschöne Farbe. So ein rötliches Tiefbraun.
Mr. Bemish setzte sich neben mich. Ich fand seine Anwesenheit unangenehm. Er fuhr andauernd mit der Hand auf der Lehne herum, mit hastigen, nervösen Bewegungen. So, als ob er glaubt, er hat eine Ahle in der Hand und bohrt Löcher ins Leder, immer rein und raus, und näht dann, lässt die Nadel rein- und rausgleiten, wie wenn er Sättel oder Stiefel flickt.
Mein Vater hat ihn über den Brillenrand hinweg angesehen und gesagt: »Und, Bemish, was darf ich für Sie tun?«
»Nichts. Gar nichts. Ich komme nur mal vorbei und vertreibe mir die Zeit, wollte mal sehen, wie‘s euch so geht –« Ganz sachte verstummend.
Er kommt jeden Abend. Ich finde das sehr lästig. Ich muss mich ganz oft auf die Bank quetschen. Pritchett, der Küster der kongregationalistischen Kirche – beleibt, rotgesichtig, nach Whiskey riechend –, läutet um sieben zum Gottesdienst, und dann setzt er sich auch vorn in den Laden und sieht bis zum Geschäftsschluss der Kundschaft beim Kommen und Gehen zu. Anfangs hat er Mr. Bemish argwöhnisch beäugt und danach ignoriert. Wenn der Küster und Mr. Bemish auf der Bank saßen, blieb gerade noch so viel Platz, dass ich mich dazwischenquetschen konnte. Der Küster störte mich nicht besonders, der schlief meistens ein und döste bis Ladenschluss vor sich hin. Aber Mr. Bemish kann nicht stillsitzen – und seine Handbewegerei stört mich.
Irgendwann hat meine Mutter meinen Vater darauf angesprochen. Sie standen im hinteren Raum. »Warum sitzt Mr. Bemish eigentlich so oft im Laden?«, fragte sie.
»Hat sonst nichts zu tun.«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich glaube, er hat Interesse an Sophronia. Er hält immer Ausschau nach jemandem.«
Mein Vater lachte laut auf. »Der vertrocknete alte Weiße?«
Sein Lachen klingt wunderbar – wenn man ein bisschen was von Musik versteht, weiß man sofort, dass mein Vater Tenor singt, und zwar auf italienische Art, aus offener Kehle, und man fängt an zu lächeln, und wenn er lange genug lacht, lacht man mit, man kann einfach nicht anders.
»Bemish?«, sagte er. Und lachte so heftig, dass er sich gegen den Türrahmen lehnen musste, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren.
Jeden Abend sitzt Mr. Bemish gleich nach dem Essen im Laden und bearbeitet die Armlehne mit diesen raschen, ruckenden Handbewegungen, nickt Leuten zu, die hereinkommen, und spricht sie manchmal auch an, aber meistens sitzt er nur da.
Zwei Wochen später ging ich an seiner Werkstatt vorbei. Er kam zur Tür und rief mich: »Mädelchen.« Winkend.
»Ja, Mr. Bemish?«
»Ist deine Tante mit dem eigenartigen Namen noch da – also in der Stadt, bei euch?«
»Ja, Mr. Bemish, ist sie.«
»Kommt sie denn nie in die Apotheke?«
»Nach fünf nicht, Mr. Bemish. Mein Vater schätzt abends arbeitende Damen nicht. Abends tun wir, was andere Familien auch tun. Wir sitzen am Esszimmertisch und unterhalten uns und spielen Schach und lesen und –«
»Ja, ja«, sagte er ungeduldig. »Aber geht deine Tante denn abends nie irgendwohin?«
»Das glaub ich nicht. Ich gehe früh ins Bett.«
»Und glaubst du –« Er schüttelte den Kopf. »Ach, egal, Mädelchen, ist egal.« Er seufzte. »Hier – ich habe gerade ein Blech mit den großen Keksen gebacken, die du so gern magst.«
Auf dem Weg die Petticoat Lane entlang zur Apotheke aß ich einen von Mr. Bemishs dicken Sirupkeksen. Eigentlich hätte ich ihm gern noch erzählt, wie gemütlich unser Wohnzimmer im Winter ist. Wir haben auch truthahnrote Vorhänge an den Fenstern, und wir lassen die Jalousien herunter und ziehen die Vorhänge zu, und auf dem Boden liegt ein richtig dicker Teppich, und weil das Zimmer klein ist, bedeckt er den ganzen Boden. Hier steht auch das Klavier, und es gibt ein altmodisches Sofa mit einem geschnitzten Mahagoni-Rahmen und einen sehr hübschen runden Ofen, und im Winter ist es warm; im Sommer, wenn die Fenster offen sind, kann man direkt nach hinten in den Garten sehen und die Blumen riechen und die kühle Luft spüren, die vom Garten hereinkommt.
Am nächsten Tag kam Mr. Bemish schon um Viertel nach drei in die Apotheke. Es war ein kalter, windiger Nachmittag. Ich war gerade aus der Schule zurück, und auf mich wartete ein großer Becher Kakao im Hinterzimmer. Aunt Sophronia hatte ihn gemacht. Ich hatte gerade einen Löffel Kakao geschlürft. Er war noch viel zu heiß für große Schlucke, ich beugte mich über den Becher und pustete sanft hinein und sog den vollen Schokoladenduft ein. Da hörte ich meine Tante: »Oh, Mr. Bemish, was machen Sie um diese Zeit draußen?«
»Ich dachte, ich hätte gern ein Ice Cream Soda.« Mr. Bemish klang atemlos, seine Stimme war dünner und tiefer als gewöhnlich.
Ich spähte in den Laden. Er saß neben dem Limonadenspender auf einem der Eisdielenstühle. Er sah sehr steif und förmlich aus und gepflegter als üblich. Er hatte sich die Haare anscheinend extra flach nach hinten gestriegelt. Der ganze Kopf wirkte kleiner dadurch. Er hielt ihn leicht zu einer Seite geneigt. Er sah aus wie ein Vogel, aber ich weiß nicht genau, was für einer – eine Meise vielleicht. Er trank fein und zierlich seine Limonade. Er sah unentwegt zu Aunt Sophronia.
Jetzt kommt er immer mitten am Nachmittag. Eigentlich müsste er in seiner Werkstatt sein und eifrig Schuhe reparieren und Stiefel machen, oder Eintopf kochen und Kekse backen. Stattdessen sitzt er bei uns im Laden, und sein hellgraues Auge, das gesunde, wandert eifrig an Aunt Sophronia hoch und runter. Wenn er ihre Stimme hört, scheint er mit den Ohren zu wackeln, und neuerdings kichert er auf eine sehr alberne Art.
Er kommt jeden Tag ungefähr um dieselbe Zeit. Manchmal setze ich mich auch auf einen Eisdielenstuhl und unterhalte mich mit ihm. Er riecht ganz schwach nach Leder und nach Schuhcreme und nach Wachs und nach toten Blumen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich diesen anderen Geruch einordnen konnte – tote Blumen. Er bleibt jeden Tag ein bisschen länger als am Tag davor.
Mir ist aufgefallen, dass mein Vater Mr. Bemish immer mit leicht zusammengekniffenen Augen ansieht. Ich habe gehört, wie er zu meiner Mutter gesagt hat: »Mir gefällt das nicht. Ich möchte ihm nicht sagen, er soll nicht mehr herkommen. Aber mir gefällt das nicht – jeden Nachmittag sitzt hier, ein alter weißer Mann, und starrt Sophronia an und leckt sich die Lippen – also, das gefällt mir einfach nicht.«
Aunt Sophronia zeigte plötzlich großes Interesse am Garten. Ich half ihr nachmittags nach der Schule beim Pflanzensetzen und Aussäen. Im Sommer ist unser Garten voller Blumen; wir haben auch einen Gemüsegarten, der irgendwie genauso schön ist wie die Blumenbeete – sehr gepflegt und akkurat. Wir halten Hühner, damit wir frische Eier haben. Und wir mästen ein Schwein und lassen es im Herbst schlachten.
Bei schlechtem Wetter, wenn wir nicht im Garten arbeiten können, machen Aunt Sophronia und ich Hausputz. Ich putze nicht gern, aber ich sortiere gern, was andere Leute in ihren Schreibtischschubladen haben. Wir fingen mit Aunt Sophronias Schreibtisch an. Sie zeigte mir ein Foto von ihrer Abschlussklasse im Pharmazie-College. Sie war das einzige Mädchen unter lauter Jungs. Sie war schwarz, die Jungs waren weiß. Zum Farbunterschied habe ich nichts gesagt, und sie auch nicht. Aber ich habe versucht rauszukriegen, wie das war, so als einzige Vertreterin des weiblichen Geschlechts in einer sonst rein männlichen Klasse.
»Hast du dich nicht komisch gefühlt mit den ganzen Jungs?«
»Das waren sehr nette Jungs.«
»Ja, klar, ganz bestimmt. Aber hast du dich nicht komisch gefühlt als einziges Mädchen unter so vielen jungen Männern?«
»Nein. Ich habe nie allzu viel Vertrautheit zugelassen, und wir sind sehr gut miteinander ausgekommen.«
Ich habe das Foto angesehen und dann sie und gesagt: »Du bist wunderschön.«
Aunt Sophronia hat das Foto zurück in die oberste Schublade gelegt. Darin bewahrt sie ihre Schätze auf. Sie besitzt einen Kragen aus echter Spitze und ein Paar ganz lange, weiße Glacéhandschuhe und eine Kette mit Goldklümpchen aus Colorado, die ihr eine Freundin meiner Mutter vererbt hat. Die Handschuhe und der Kragen duften wie unser Garten im August, wenn die Blumen in voller Blüte stehen und die Sonne draufscheint.
Ich vergesse manchmal, dass Aunt Sophronia erwachsen ist und damit zum feindlichen Lager gehört, und sage aus Versehen laut, was ich gerade gedacht habe.
Ich lehnte mich an den Schreibtisch und sah in die Schublade, auf das Foto, und sagte: »Du, das Bild erinnert mich an einen Abend im letzten Sommer, da war so ein weiblicher Falter, so ein riesiger Nachtfalter, innen an der Fliegengittertür, und draußen kamen die männlichen Falter von kilometerweit her und klammerten sich ans Fliegengitter und flatterten mit den Flügeln und, du, die haben überhaupt kein Geräusch gemacht, und das war irgendwie gruselig. Warst du nicht –«
Aunt Sophronia schob die Schublade mit Wucht zu. »Du holst dir jetzt Besen und Kehrblech und fegst den Flur.«
Samstagmorgen, als ich das Frühstücksgeschirr gespült und den Küchenboden gewischt hatte, ging ich Mr. Bemish einen Besuch abstatten. Er war auch gerade beim Hausputz. Er hatte die roten Vorhänge, die den Winter über vor den Fenstern hängen, und den roten Vorhang vor seinem Bett, der seine Schlafnische von der Werkstatt trennt, abgenommen und wusch sie in einem großen Zuber neben dem Haus. Er planschte fürchterlich herum, und die Waschlauge war blassrosa. Er hatte die Ärmel hochgekrempelt. Seine Unterarme sind sehr weiß und sehen aus wie zähes Fleisch.
»Zu rot für die Sommerzeit, Mädelchen. Ich muss die grünen Sommervorhänge rausholen.«
Er hängte sie auf die Wäscheleine und schüttete das Waschwasser über den Boden. Es war rosarot.
»Ihre Vorhänge sind ausgelaufen, nicht?« Ich betrachtete eine kleine rosarote Pfütze auf einem Stein. »Wenn Sie die weiter waschen, sind sie bald rosa statt rot.«
Sein eigenes Auge, das echte, wanderte von mir weg, und in sein Gesicht trat ein heimlicher oder vielmehr hinterlistiger Ausdruck. Er sagte: »Ich habe deine Tante lange nicht mehr in der Apotheke gesehen. Wo ist sie?«
»Sie hat mit dem Garten und dem Hausputz zu tun. Hausputz machen anscheinend gerade alle.«
»Wenn ich meine grünen Vorhänge aufgehängt habe, lade ich deine Tante zum Tee ein.«
»Wo soll sie denn mit Ihnen Tee trinken?«
»In meiner Werkstatt.«
Ich schüttelte den Kopf. »Aunt Sophronia trinkt keinen Tee bei anderen Leuten im Schlafzimmer, und Ihre Werkstatt hat nur den einen Raum, und da steht ein Bett drin, und das wäre ja wohl –«
»Ich habe ein bisschen alten Schmuck, den ich ihr gern zeigen möchte, und ich dachte, sie kommt vielleicht mal zum Tee.«
»Mr. Bemish«, sagte ich, »mögen Sie Aunt Sophronia?«
»Also, Mädelchen«, er kicherte in sich hinein, »na ja, also, glaubst du, deine Tante mag mich?«
»Nicht besonders. Nicht mehr als sonst jemanden. Ich glaube, Sie sind zu alt für sie, und außerdem, na ja, Sie sind weiß, an einem alten weißen Mann hätte sie wohl kein großes Interesse, oder?«
Er runzelte die Stirn. »Geh nach Hause. Du bist ein sehr ungezogenes Mädchen.«
»Sie wollten doch wissen, was ich glaube, Mr. Bemish. Ich verstehe nicht, wieso Sie böse werden, wenn ich Ihnen sage, was ich glaube. Sie haben mich ja selbst gefragt, Mr. Bemish.«
Ich folgte ihm in die Werkstatt. Er setzte sich ans Fenster und machte sich an die Arbeit. Ein Männerstiefel musste neu besohlt werden, und er schnitt eine Ledersohle zurecht. Ich sah aus dem Fenster auf die Straße. Hier geht immer ein leichter Wind und bewegt das Ladenschild hin und her, es klingt wie Seufzen. Im Winter, wenn es richtig weht, klingt es, als würde das Schild ächzen, so schnell schlenkert es hin und her. Es hat einen aufgemalten Schnürstiefel. Der war bestimmt mal tief dunkelrot, inzwischen ist er verwittert und zartrosa.
Mr. Bemish ist mein Freund, und ich wollte ihm zu verstehen geben, dass ich ihn trotzdem gern mag, auch wenn ich sein Interesse an Aunt Sophronia missbillige. Ich suchte nach einem Thema, das ihm beweist, wie gern ich mich mit ihm unterhalte.
»Warum haben Sie keinen Männerstiefel auf Ihrem Schild?«
»Ich mag lieber Damenschuhe. Die sind zierlicher, anmutiger –«, er wedelte mit der Ahle und lächelte gekünstelt.
Ich ging nach Hause und erzählte Aunt Sophronia, dass Mr. Bemish sie zum Tee einladen will.
»Gehst du hin?«
»Natürlich nicht«, antwortete sie gereizt.
Aunt Sophronia ging nicht zum Tee zu Mr. Bemish. Und er sah sie so selten in der Apotheke, dass er sie schließlich suchen kam.
Jetzt ist Sommer, und das Wheeling Inn öffnet für die Saison. In die prächtigen Häuser am Wasser ziehen wieder die reichen Besitzer. Wir haben alle viel zu tun. Abends nach Ladenschluss sitzen wir hinten im Garten. An warmen Juniabenden schwärmen die Glühwürmchen aus, und über allem liegt so ein weiches Sommerlicht aus Mondschein und Sternen. Das Gras unter den Füßen ist dicht und die Luft ist lieblich. Fast jeden Abend sitzen meine Mutter und mein Vater und Aunt Sophronia und ich und manchmal auch Aunt Ellen und Uncle Johno in dieser Ruhe und dieser Lieblichkeit und diesem seltsamen weichen Licht.
Als wir gestern Abend dasaßen, kam Mr. Bemish ums Haus herum. Die Art, wie er sich näherte, hatte etwas Zaghaftes. Ich lag gerade im Gras und schoss hoch, gespannt, was die anderen wohl machen und was sie wohl sagen.
Er schlich über den Rasen. Er sagte kein Wort, bis er praktisch über uns stolperte. Meine Mutter schwang sachte in der Hängematte unterm Kirschbaum hin und her und bemerkte ihn erst, als er »Guten Abend« sagte. Es klang eher wie eine Frage.
Wir sahen ihn alle an. Ich hoffte, dass gleich jemand sagt: »Was machen Sie in unserem Garten, in unserem privaten Bereich, unserem besonders privaten Bereich? Sie sind ein Eindringling, gehen Sie wieder zu Ihren Wachsfäden und Ihrer Ahle, gehen Sie in Ihr Haus und zu Ihrer Katze.« Aber niemand sagte etwas.
Er stand eine Weile da, wartend, zögerlich, dann verbeugte er sich und setzte sich im Schneidersitz neben Aunt Sophronia ins Gras. Sie saß auf einer Bank. Und er setzte sich so dicht neben sie, dass sich ihr Rockzipfel auf sein eines Hosenbein legte. Ich behielt ihn im Auge. Er langte mit einer Hand nach dem Zipfel und befühlte zart den Stoff. Und entweder spürte sie das, oder die Handbewegung erregte ihre Aufmerksamkeit, jedenfalls rückte sie weg, raffte ihren Rock zusammen und stand auf: »Ich bin schläfrig von der Luft. Gute Nacht.«
Am nächsten Nachmittag brachte ich Mr. Bemish ein Paar Schuhe meines Vaters, sie brauchten neue Absätze. Mein Vater trägt immer knöchelhohe schwarze Schnürschuhe. Ich stellte sie auf Mr. Bemishs Arbeitstisch.
»Kannst sie morgen abholen.«
Ich sah ihn nicht an. Ich beugte mich vor und tätschelte May-a-ling. »Sie hat so einen hübschen Namen, Mr. Bemish. Der Name scheint mir ausgesprochen passend für eine Katze.«
Mr. Bemish sah mich über den Rand der kleinen Brille mit der Stahlfassung an. »Ihr habt einen schönen Garten«, sagte er.
»Ich glaube, Sie hätten nicht reinkommen sollen.«
»Warum nicht?«, fragte er barsch. »Hat jemand gesagt, ich darf da nicht rein?«
»Nein. Aber für alle ist nur der vordere Teil vom Haus da, der Teil mit der Apotheke. Der hintere Teil und die obere Etage und der Garten sind für uns. Der Garten ist ein Privatbereich in unserem Leben. Da gehören Sie nicht rein. Sie sind nicht Teil unserer Familie.«
»Ich wäre aber gern Teil eurer Familie.«
»Man kann nicht einfach Teil von anderen Familien werden. In eine Familie muss man hineingeboren sein. Unser Familienbereich ist nur für uns. Sie scheinen auch überhaupt nicht zu verstehen, dass Sie die falsche Farbe haben, Mr. Bemish.«
Darauf gab er keine Antwort. Er stand auf, holte den Kekstopf und bot mir schweigend einen Keks an.
Als ich vom Schuhladen zurückkam, setzte ich mich auf die Holzstufen, die sich die ganze Vorderseite des Drugstores entlangziehen. Ich wollte mir darüber klarwerden, was ich wirklich von Mr. Bemish halte. Ich sitze immer ganz am Rand der Stufen und lehne mich an den festen Bretterzaun. Der Platz ist sehr gut, von da aus habe ich die Straße, die Ladenfront und die Kirchenwiese im Blick. Die Leute gehen vorbei, ohne mich zu bemerken. Manchmal führen sie sehr seltsame Gespräche. Ich kann den Weg, der quer durch die Wiese führt, ziemlich weit einsehen. Er ist nicht gepflastert und nicht sehr gerade. Die einzigen geraden Wege in der Stadt sind die vor den Häusern von Leuten, die Gärtner haben.
Ich sah einen Mann von meinem Platz aus. Er kam den Weg durch die Kirchenwiese entlanggeschlendert. Dass in Wheeling im Sommer ein Mann so gemächlich geht, ist äußerst unüblich. Im Sommer müssen alle, die das ganze Jahr über hier wohnen, ihren Lebensunterhalt verdienen. Sie mähen Rasen und schneiden Hecken und jäten Unkraut und besorgen alles Mögliche für die Sommerleute. In Wheeling gehen im Sommer alle Männer schnell, die körperlich fit sind.
Dieser große breitschultrige Mann schlenderte den Weg entlang. Er trug einen weißen Anzug mit ziemlich engen Hosenbeinen und hatte die Hände in den Gesäßtaschen und einen steifen Strohhut hinten auf dem Kopf, eine Kreissäge.
Ich setzte mich aufrecht hin, als ich erkannte, dass dieser Mann sehr dunkelhäutig war. Ich hatte keine Ahnung, wo er hergekommen war. Butler oder Kellner konnte er auf keinen Fall sein, selbst wenn er gewollt und es sein Leben lang versucht hätte. Er würde nie einen anständigen Gang hinkriegen – er würde immer rumstolzieren. Und hat schon mal jemand von herumstolzierenden Butlern oder um Tische herumscharwenzelnden Kellnern gehört?
Als er näher kam, sah ich, dass er einen Bart hatte, einen ungepflegten, struppig wie ein Ziegenbart. Auch seine Haare waren lang und struppig und sahen wüst aus. Er war zwar hochgewachsen und hatte breite Schultern, aber durch die wüste Mähne und den Ziegenbart wirkten Kopf und Gesicht viel zu groß für den Körper.
Als er mich sah, kam er direkt auf mich zu. Er beugte sich über mich, lächelnd, und ich rückte weg und drückte mich gegen den Bretterzaun. Seine Augen machten mir Angst. Wenn mir seine Augen einfallen, mache ich meine immer zu und versuche, seine auszusperren. Sie sind rötlich braun und sehen heiß aus, und wenn ich da erst mal reinschaue, kann ich irgendwie nicht mehr wegschauen. Ich habe noch nie Augen in so einer Farbe gesehen oder mit so einem komischen Ausdruck, was immer das heißt. Ich hab sie »heiß« genannt, aber das geht ja nicht. Es muss daran liegen, dass sie dieselbe Farbe haben wie etwas, bei dem ich an Feuer oder Hitze denke. Was das ist, weiß ich nicht.
»Verloren gegangen?«, fragte er.
»Nein. Und Sie?«
»Klar. Wir Schwarzen sind alle verloren.« Seine Stimme klang heiser, unmusikalisch, und er drehte sich um und ging in den Laden.
Ich ging auch in den Laden. Ich wollte unbedingt hören, ob dieser auffällige Mann mit dem Ziegenbart und mein Vater in eine Diskussion über »Wir Schwarzen sind alle verloren« gerieten.
Mein Vater sagte: »Wie gehts, wie stehts?« Als ob ihn das wirklich interessierte.
Der bärtige Mann nickte und sagte: »Der Apotheker da?«
»Ich bin der Apotheker.«
»Is dein Laden hier?«
»Ganz recht.«
»Hübsches Plätzchen haste. Schon lange hier?«
Mein Vater brummte. Ich wartete darauf, dass er den nächsten Zug macht. Wir haben nämlich ein Familienspiel, wir nennen es Stanley und Livingstone. Livingstones sind alle fremden Schwarzen, die in den Laden kommen – und wir müssen herausfinden, welcher verloren gegangene Mr. Livingstone oder welche verloren gegangene Mrs. Livingstone sich in die durch und durch weiße Wildnis namens Wheeling verirrt hat. Wenn man in einer Stadt lebt, in der es keine anderen Schwarzen gibt, ist man natürlich neugierig, wenn andere Schwarze auftauchen.
Ich setzte mich vorn in den Laden und wartete ab, ob mein Vater herausfand, mit welchem Mr. David Livingstone er redete und was der in unserer Stadt machte. Aber mein Vater sah ihn nur an, ohne eine Miene zu verziehen, und sagte: »Und was hätten Sie gern?«
Der Mann mit dem Ziegenbart angelte in der Tasche seiner engen weißen Hose herum. Er musste extra ein Bein nach vorn schieben, damit der Stoff nicht so spannte, und das sah aus, als ob er am Boden scharrte. Er gab meinem Vater einen Zettel.
»Ich hab n Rezept für Lotion –«
»Das dauert ein paar Minuten«, sagte mein Vater und ging ins Hinterzimmer.
Der bärtige Mann setzte sich neben mich.
»Wohnen Sie hier in Wheeling?«, fragte ich.
»Ich arbeite im Inn. Ich bin der Klavierspieler.«
»Sie spielen Klavier?«
»Und singe. Ich bin das ganze Orchester. Ich spiele zum Dinner. Ich spiele, damit die ganzen netten reichen Leute abends tanzen können. Ich bleib den ganzen Sommer.«
»Tatsächlich?«
»Ganz recht. Und ich hab noch nie so ne tote Stadt gesehen.«
»Wie heißen Sie?«
»Chink.«
»Mr. Chink –«
»Nein«, er stand auf, »Chink ist der Vorname. Chink Johnson.«
Mr. Johnson ist ein rastloser Typ. Selbst wenn er nur dasitzt, ist ständig etwas an ihm in Bewegung, die Füße, die Hände, der Kopf. Er schlägt die Beine übereinander und wieder auseinander, faltet die Hände und nimmt sie wieder auseinander.
»Wofür brauchen Sie ein Rezept?«
»Handlotion. Brauch ich für meine Hände.«
Mein Vater kam aus dem Rezepturenzimmer, wickelte ein Fläschchen ein und sagte: »Fertig.«
Chink Johnson bezahlte, sagte mir Auf Wiedersehen, und ich sagte: »Auf Wiedersehen, Chink.«
»Wie heißt der?«
»Chink Johnson. Er spielt Klavier im Inn.«
Chink Johnson scheint ein sehr interessanter, ungewöhnlicher Mann zu sein. Mein Vater erwähnte unseren neuesten Mr. Livingstone erstaunlicherweise nicht gegenüber der Familie. Er verlor kein Wort über ihn. Und ich auch nicht.
Dabei kommt er ziemlich oft in den Laden. Er kauft Zigaretten und Halspastillen. Manchmal kommt er mit einer geliehenen Pferdekutsche vom Inn. Manchmal kommt er zu Fuß. Mein Vater wechselt kaum ein Wort mit ihm.
Er bleibt nie lange da, das Benehmen meines Vaters soll ihn davon abhalten, lange im Laden rumzuhängen. Aber er scheint nach irgendwas zu suchen. Er guckt durch die Tür ins Rezepturenzimmer hinten, da steht an heißen Sommertagen auch die Tür zum Garten offen und man hat einen Blick auf die schönen kleinen Blumenbeete, dann guckt er in den Garten, scheint ihn zu durchsuchen. Wenn er geht, guckt er prüfend das Haus an. Als ob er um die Ecke gucken will, durch die Wände gucken will, weil ihm sein sechster Sinn eingeflüstert hat, dass auf dem Grundstück irgendetwas ist, das ihn interessieren könnte, und er nur scharf genug hingucken muss, um es zu finden.
Meine Mutter sah ihn irgendwann kurz, als er aus dem Laden ging. Sie sah dasselbe wie ich – eine Silhouette aus Ziegenbart, vorgerecktem Kopf, dicken, struppigen Haaren –, denn wir standen beide im Rezepturenzimmer und schauten nach vorn zur Tür.
»Wer war das denn?«, fragte sie streng.
»Das ist der Klavierspieler aus dem Inn«, sagte mein Vater.
»Du hast ihn nie erwähnt. Wie heißt er?«
»Jones«, sagte mein Vater.
Ich wollte ihn schon verbessern, aber ich traute mich nicht, ihm ins Wort zu fallen, denn er redete plötzlich schnell und sehr laut. »Lightfoot Jones«, sagte er, »Shake Jones. Barrelhouse Jones.« Er fing an, auf der Vitrine herumzuklopfen. So was habe ich noch nie von ihm gehört. Er singt im kongregationalistischen Kirchenchor. Er hat einen reinen lyrischen Tenor und singt alle Tenorsoli – das »Sanctus«, »The Heavens Are Telling«. Man hört auch seiner Sprechstimme an, dass er singt. Er ist ständig am Summen oder Singen oder Pfeifen. Und jetzt stand er mit dem Stift in der Hand vor einer Vitrine und klopfte in einem höchst eigenartigen Rhythmus auf dem Glas herum.
»Shake Jones«, sagte er noch einmal. »Rhythmus im Fuß. Rhythmus im Blut. Rhythmus im Fuß. Rhythmus im Blut. Haut sich das Leben raus, haut sich die Lunge raus, haut sich die Leber raus, am Klavier.« Und fiel in einen anderen, lauteren Rhythmus mit dem Fuß. »Am Kla-vi-ier. Am Kla-vi-ier. Am Kla–«
»Samuel, was ist denn mit dir los? Wovon redest du?«
»Ich rede von Tremblin‘ Shakefoot Jones. Dem Klavierspieler. Dem Klavierspieler, der nicht stillsitzen kann und hier reinkommt und rumgafft und rumgafft und mit den Hufen tänzelt und rumschwarwenzelt und rumschnüffelt. Wie ein Hengst, der eine Stute wittert – ein Hengst, der –«
»Samuel! Wie kannst du so vor dem Kind reden?«
Mein Vater schwieg.
Ich sagte: »Er heißt Chink Johnson.«
Mein Vater brüllte schnaubend vor Zorn. »Der heißt Duke. Der heißt Bubber. Der heißt Count, Maharadscha, König der Löwen. Ist mir verdammt egal, wie der sich selber nennt. Ich will den und seine rastlosen Füße hier nicht haben. Der soll mit seinen langen Füßen auf dem Boden von andern Leuten rumsteppen. Nicht auf meinem. Nicht hier –«
Er starrte mich an, starrte meine Mutter an, zornig. Seine Wut machte uns stumm. In diesem Moment waren seine Augen rotbraun, genau wie bei Chink Jones, nein, Johnson. Er ist kleiner, er hat keinen Bart, aber in diesem Moment sah er Chink sehr, sehr ähnlich.
Und ich machte ihn noch wütender. »Du siehst genauso aus wie Chink Johnson.«
Er sagte: »Ah!!! …« Er war so zornig, dass ich kein Wort mehr verstand. Ich ging nach draußen und über die Straße und setzte mich auf die Kirchenstufen und sah zu, wie die Welt vorbeizog, und lauschte dem schwachen Summen, mit dem sie sich drehte und drehte.
Mr. Bemish ging in die Apotheke. Er blieb lange drin. Ich sah es mit einem gewissen Vergnügen, ich wusste ja, er war gekommen, um sich mit einem unserer langen Ice-Cream-Soda-Löffel sein Ice Cream Soda in den Mund zu schaufeln und um Aunt Sophronia zu mustern, während er am Eis herumlutschte. Er musterte sie immer aus den Augenwinkeln, mit raschen verstohlenen Blicken. Ich wusste ja, er vergeudete seine Zeit, denn Aunt Sophronia kam erst viel später in den Laden. Mein Vater hatte Geburtstag, und Aunt Sophronia war in der Küche, einen großen Kuchen für ihn backen.
Wenn Mr. Bemish das auch gewusst hätte, wäre er womöglich in die Geburtstagsfeier geplatzt, obwohl er gar nicht eingeladen war. Er hatte sich schließlich auch ohne Einladung in unseren Garten geschlichen, und unser Garten ist komplett von einem festen Bretterzaun umgeben und hat ein Tor, das man erst aufmachen muss, wenn man reinwill, also, in unseren Garten zu kommen, das ist, wie wenn man in unser Wohnzimmer geht. Der Ort ist sehr privat. Mr. Bemish ist der einzige Mensch, den ich kenne, der ohne Einladung in unseren Garten gekommen ist, und er kommt auch weiterhin.
Als Mr. Bemish wieder weg war, ging ich über die Straße und setzte mich auf die Stufen vor dem Laden. Es war heiß. Es war sehr still. Die alte Lady Chimble ging mit einem schwarzen Seidenschirm über die Kirchenwiese, spannte ihn auf und nutzte ihn als Sonnenschirm. Ein Junge fuhr auf einem Fahrrad vorbei. Frances Jackins (wir nennen sie Aunt Frank), die schwarze Köchin aus der Pension gegenüber, kam mit einem Korb voll Irgendwas. Sie ist immer knurrig und meistens betrunken. Sie trinkt Gin. Mutter sagt, deshalb sehen Aunt Franks Lippen aus, als wären sie von innen nach außen gestülpt, und das nennt man »gin lips«, sagt sie. Sie sind grellrot, fast wie eine rote Scharte quer über ihr dunkles Gesicht. Ich möchte Aunt Frank so gern danach fragen – wie sich das anfühlt, wie das passiert ist und so weiter –, und das mach ich irgendwann auch, ich hab nur noch nicht die passende Gelegenheit gefunden. Wenn sie betrunken ist, gibt sie nur unvernünftige Antworten auf vernünftige Fragen, und wenn sie nüchtern ist, oder teilweise nüchtern, regt sie sich schnell auf und meckert dauernd an mir rum. Sie ist überhaupt nicht mit uns verwandt; meine Mutter hat sich bloß vor vielen Jahren angewöhnt, sie Aunt Frank zu nennen, und deshalb nennen wir sie alle so. Sie will mich immer rumkommandieren und rumscheuchen, weil ich noch klein bin, und sagt immer Miss zu mir, auf so eine gemeine, sarkastische Art.
Sie kann sehr gut kochen, wenn sie nüchtern ist. Wenn sie betrunken ist, lässt sie alles anbrennen, sie kommt auch immer über die Straße getorkelt und unsere Hintertreppe hochgestolpert, mit Schüsseln voll Sauerteig, der nicht aufgeht, weil sie die Hefe vergessen hat, und mit verbrannten Kuchen und Pasteten und verbrannten Schinken und Rinderbraten. Und wenn sie was anbrennen lässt, ist das nicht bloß angebrannt, das ist schwarz und hart wie Holzkohle.
Sie kratzt fast jeden Abend an unserer Hintertür. Ich habe ein schärferes Gehör als alle anderen, ich höre Leute schon ums Haus kommen, bevor die irgendjemand sonst hört – jedenfalls höre ich Aunt Frank immer als Erste. Dann reiße ich ganz schnell und abrupt die Tür auf, und sie stürzt fast in die Küche und steht schwankend da und verpestet unsere Küche mit ihrer süßlichen Ginfahne und ihrem klammen, modrigen Kleidergeruch.
Sie hat immer ein Klümpchen Kautabak unter der Oberlippe, es klingt eigenartig, wenn sie um dieses Hindernis herum spricht. Sie redet schnell, damit der Priem nicht rausrutscht, und manchmal macht sie eine Pause und fuhrwerkt an der Oberlippe rum, wahrscheinlich um den Priem an eine bestimmte Stelle zu schieben. Wenn sie abends durch die Küchentür kommt, stellt sie den Korb mit dem missratenen Essen einfach hinter der Tür auf den Fußboden und sagt zu meiner Mutter: »Hier, Mar-tha, schmeiß das weg. Schmeiß das weg für mich. Gibs den Hüh-nern. Kipps vor die Schwei-ne –«
Sie verwandelt alle Wörter mit zwei Silben in Einsilber. Sie sagt nicht in einem Rutsch »Martha«. Sie zerhackt es zu »Mar-tha«; sie sagt nicht »Hühner«, sondern »Hüh-ner«. Eine sehr ruckartige Art zu reden.
Das Zeug im Garten zu beerdigen, ist dann immer meine Aufgabe. Ich grabe ein Loch und werfe den kohlschwarzen Mist rein und schütte Kalk drüber, damit er sich schneller zersetzt und um Hunde und Stinktiere zu vergraulen.
Manchmal verstecke ich mich hinterm Zaun, wenn sie wieder über die Straße geht, und schreie ihr nach:
Die olle Aunt Frankie
Schwarz wie Teer
Wollte in Himmel
Im ’lektrogefährt.
Gefährt verhakt sich innem Gleis
Schmeißt Aunt Frankie aufn Steiß
Wenn ich so hinter ihr her reime, will sie sofort über den Zaun klettern, eine wütende betrunkene Alte, die mir mit dem Herrenschirm in der Hand droht. Ich denke immer, sie müsste doch von ihren früheren Einlagen noch wissen, dass sie nicht an mich drankommt. Aber sie versucht es immer wieder. Nach ein paar vergeblichen Versuchen gibt sie auf und geht in die Pension auf der anderen Straßenseite. Da wohnen jede Menge alte Jungfern und Witwen. Keine Herren. Nur Damen. Die verbringen ihre Freizeit auf der Veranda schaukelnd und Whist spielend, den Drugstore gegenüber im Blick. Aunt Frank verbringt ihre Freizeit in der Küche der Pension, auch schaukelnd und eine Ginflasche nach der anderen leerend.
Am Geburtstag meines Vaters war sie allerdings nüchtern, jedenfalls ihrem Gang nach. Sie hatte einen Korb am Arm, den Inhalt mit einer weißen Serviette abgedeckt. Ich dachte, sie hat bestimmt meinem Vater etwas Besonderes zum Abendessen gemacht. Sie ging in den Laden, und als sie wieder rauskam, hatte sie den Korb nicht mehr dabei. Sie sah mich auf den Stufen sitzen, beachtete mich aber nicht.
Aunt Sophronia kam zum Schaufenster. Sie hatte die Glaskugeln gespült, die wir immer mit blauer, roter und gelber Flüssigkeit füllen. Sie trug einen dunklen Rock und eine weiße Bluse. Ihre Haare waren nicht mehr straff aus der Stirn gekämmt, sondern ringelten sich um die Stirn; vielleicht hatte sie im Garten gearbeitet und sich gebückt, und dabei hatten sich die Haarnadeln gelockert, mit denen sie sie sonst auf dem Kopf bändigte. Sie sah unwirklich aus. Die Sonne schien ins Fenster und warf den Schein der bunten Wassergläser über ihr Gesicht und ihre Gestalt, und sie selbst schien gülden und rosenrot und lavendelblau, es war, als ob sich im Schaufenster ein Regenbogen bewegte.
Chink Johnson kam in seiner Leihkutsche die Straße hoch. Er unterhielt sich kurz mit mir und wollte weiter in den Laden, als er Aunt Sophronia sah und stehen blieb. Er holte tief Luft. Ich konnte es hören. Er zog den steifen Strohhut vom Hinterkopf und verneigte sich vor ihr. Sie nickte, eigentlich ohne es zu wollen, dann wandte sie sich ab und tat, als hätte sie viel zu tun.
Er packte mich am Arm, das heißt, er kniff mich.
»Was machen Sie denn da?«, sagte ich zornig. »Was ist denn los mit Ihnen? Lassen Sie meinen Arm los.«
»Klappe«, sagte er ungehalten und kniff noch fester. Seine Finger fühlten sich an, als wären sie aus Eisen. »Wer ist das?«
Ich riss seine Finger weg und rieb mir den Arm. »Wo?«
»Im Fenster. Wer ist das Mädchen im Fenster?«
»Das ist meine Tante Sophronia.«
»Deine Tante? Deine Tante?«
»Ja.«
Er ging hinein. Gerade hatte er noch neben mir gestanden, im nächsten Moment war er mit einem Satz im Laden verschwunden.
Ich ging auch hinein. Er beugte sich ins Fenster und sagte: »Möchten Sie vielleicht Sonntag mit mir spazieren gehen?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Na ja, könnten Sie nicht mit mir ausfahren? Ich hol Sie ab –«
Aunt Sophronia sagte: »Ich arbeite jeden Tag.«
»Jeden Tag?«, sagte er. »Geht doch gar nicht. Niemand arbeitet jeden Tag. Ich bin morgen wieder da –«
Und weg war er. Aunt Sophronia sah entgeistert drein. Nicht ärgerlich, nur irgendwie verblüfft.
Ich sagte: »Morgen und morgen und morgen –« Und dachte, tja, jetzt hat sie schon zwei Verehrer. Einmal diesen Shake Jones Livingstone, sonst bekannt als Chink Johnson, und dann Mr. Bemish. Ich würde, glaube ich, keinen von beiden nehmen. Mr. Bemish ist zwar mein Freund, aber zu alt. Chink Johnson halte ich auch für meinen Freund, aber der würde, glaube ich, keinen guten Ehemann abgeben. Ich überlegte, warum ich ihn als Ehemann für Aunt Sophronia ablehnte. Ich glaube, es liegt daran, dass Aunt Sophronia eine Lady ist, und Chink Johnson – na ja – er ist kein Gentleman.
Beim Abendessen feierten wir den Geburtstag meines Vaters. Um die Zeit kam kaum noch Kundschaft. Pritchett, der Küster, saß auf der Bank vor dem Laden; falls jemand nach meinem Vater verlangte, würde er hintenrum kommen und ihn rufen.
Eine weiße Tischdecke lag auf dem großen Eichentisch im Esszimmer, gedeckt war mit dem feinen Haviland-Porzellan meiner Mutter und dem Besteck aus Sterlingsilber mit dem Rosendekor, und neben dem Teller meines Vaters lag ein Stapel Päckchen, und auf der Torte steckten Kerzen und zum Nachtisch gab es Eis. Meine alte Feindin Aunt Frank hatte ihm zum Geburtstag Parker House Rolls gebracht und einen ganzen Topf Milchreis für ihn gekocht, mein Vater sagt nämlich immer, er hofft, wenn er mal stirbt, dann, weil er in ein Milchreismeer gefallen ist, denn Milchreis kann er morgens, mittags, abends essen. Offenbar war Aunt Frank beim Kochen nüchtern gewesen, denn der Milchreis war sahnig und köstlich, ich hab zwei Portionen gegessen, zusätzlich zum Eis.
Ich wartete darauf, dass Aunt Sophronia etwas über Chink Johnson sagt. Er fällt ja sehr auf, einen Kunden mit so einem Bart hatten wir noch nie, weder schwarz noch weiß. Aber sie hat ihn nicht erwähnt. Ich auch nicht. Mein Vater erwähnte ihn auch nie wieder – zumindest nicht bei Tisch. Ob mein Vater wohl hofft, dass er verschwindet? Vielleicht haben sie ja Angst, dass er irgendwann zur Familie gehört, wenn sie ihn erwähnen.
Inzwischen gehört Chink Johnson zum Kreis der Familie, er hat dieselbe Methode angewendet wie Mr. Bemish. Er ist einfach in den Garten und ins Haus spaziert. Ich war oben und sah zufällig aus dem Fenster, und Chink Johnson kam die Straße hoch spaziert. Er zog das Tor auf und ging ums Haus herum in unseren Garten. Ich lief nach hinten und sah da aus dem Fenster, und er zog einfach die Fliegengittertür auf und ging in die Küche. Er hat nicht mal angeklopft, er ist einfach reingegangen.
Endlos lange war kein Ton zu hören. Ich horchte und horchte. Ich habe mich bestimmt fünfzehn Minuten lang nicht gerührt. Dann hörte ich jemanden auf unserem Klavier spielen. Ich wusste, das musste Chink Johnson sein, denn so eine Musik würde bei uns zu Hause niemand spielen. Ich lief nach unten. Meine Mutter war im Keller gewesen und kam die Kellertreppe hoch, und mein Vater kam aus dem Laden angerannt. Wir standen alle da und guckten und guckten.
Chink saß an unserem Klavier. Von seiner Unterlippe baumelte eine Zigarette, der Rauch hing ihm wie eine Wolke – eine dunstige blaugraue Wolke – um Gesicht und Augen und Bart, man konnte sie nur ab und zu ganz kurz erkennen. Er spielte, schnell, disharmonisch, mit einem seiner langen Füße tappte er auf den Boden, mit seinen langen Fingern tappte er auf die Tasten.
Aunt Sophronia lehnte am Klavier und sah zu ihm runter. Er spielte ohne Noten, er sah kein einziges Mal auf die Tasten, er sah nur Aunt Sophronia in die Augen. Ich dachte, gleich sagt mein Vater, Chink soll mit seinen langen Füßen auf dem Boden von anderen Leuten rumsteppen, aber meine Mutter warf ihm so einen »Sag jetzt bloß nichts«-Blick zu, und er starrte Chink nur böse an und ging wieder in den Laden.
Chink blieb lange; er spielte Klavier, er sang, das heißt, man könnte eher sagen, er redete zur Musik. Er hat eine ganz eigene Art, Musik zu machen. Er spielt ein paar Akkorde, reihenweise Akkorde, aber die spielt er in eigenartigen Variationen, und dazu spricht er einen Liedtext – das ist nicht wirklich Singen, aber seine Stimme variiert, passt sich sozusagen den Akkorden an, die er spielt, und er redet in einer Art Rhythmus, der auch zu den Akkorden passt. Ich habe mich neben ihn gesetzt und mir angesehen, was er macht, und mir angehört, was er sagt, und fand es sehr interessant, obwohl es überhaupt nicht die Musik war, die ich gewöhnt bin. Er hat mir erzählt, was er mit den Stücken macht, heißt »talkin‘ blues«. Er betonte »talkin‘« auf der ersten Silbe, und »blues« klang bei ihm, als wären es zwei Wörter, zwei einzelne Wörter, nicht einfach eins mit zwei Silben.
Ich hab versucht, so Klavier zu spielen wie er, aber bei mir kommt nur furchtbarer Krach raus. Ich tue, als wär ich blind, ich versuche, Akkorde zu erspüren, und hab die ganze Zeit die Augen zu. Er muss eine besondere Begabung dafür haben, was er da macht, ist nämlich extrem schwierig, ich weiß gar nicht, ob ich das je hinkriege. Er hat ein viel besseres musikalisches Gehör als ich.
Chink Johnson kommt Aunt Sophronia fast jeden Tag besuchen. Manchmal sehe ich auch Mr. Bemish im Garten. Er sitzt immer auf dem Boden, dabei könnte er sich doch Rheuma holen in seinem Alter. Er muss ein sehr tapferer kleiner Mann sein, oder seine Liebe zu Aunt Sophronia macht ihn sehr, sehr mutig. Ich sage das, weil Chink Johnson Mr. Bemish sehr rüde behandelt, er starrt ihn immer furchtbar gemein an. Wenn ich so klein und schmächtig und alt wie Mr. Bemish wäre, würde ich mich nicht zu einem viel größeren, viel jüngeren Mann in den Garten setzen, der mich offensichtlich nicht hier haben will.
Ich habe viel über Mr. Bemish nachgedacht. Ich mag ihn. Er ist ein echter Freund. Aber ich finde, er sollte sich nicht für Aunt Sophronia interessieren – jedenfalls nicht im Sinn von Liebe. Und eins treibt mich um, und zwar, dass mir ehrlich nicht klar ist, ob ich ihn als Verehrer ablehne, weil er weiß ist oder weil er alt ist. Manchmal glaube ich, wegen beidem. Ich bin ziemlich sicher, dass es nicht nur am Alter liegt. Das treibt mich um. Wenn meine Ablehnung nämlich daher kommt, dass er weiß ist (was ich ihm ja gesagt hatte, aber ich sage oft Dinge, die die Leute eigentlich nicht hören wollen, und schon gar nicht wollen sie die von jemand viel Jüngerem hören), dann bin ich in Sachen race genauso »trainiert« worden, wie ich »trainiert« worden bin, Christin zu sein. Wie ich als Christin trainiert worden bin, das weiß ich – Sonntagsschule, Beten und so weiter. Ich weiß bloß nicht genau, wie ich in Sachen race trainiert worden bin. Aber woher kommen dann meine Gefühle gegenüber Mr. Bemish?
Kurz nachdem ich das geschrieben hatte, ließ ich das Rätselraten über Mr. Bemish erst mal sein, denn jetzt war offiziell Sommer – zumindest für mich. Wir hatten zwar schon lange Schulferien und trugen unsere Sommersachen und im Garten blühten überall die Blumen – aber für mich geht der Sommer erst wirklich los, wenn Dottle Smith zu seinem alljährlichen Besuch kommt.
Dottle und Uncle Johno sind zusammen zur Schule gegangen. Sie sehen sich irgendwie ähnlich. Zwei große Männer mit so heller Haut, dass sie aussehen wie Weiße. Aber irgendwas an ihnen (Dottle sagt, es ist ein »kultivierter und ausgeprägter und sorgfältig gepflegter Hass auf weiße Männer«) verhindert, dass sie als weiß durchgehen. Dottle ist Lehrer für Englisch, Rhetorik und Theater an einer Schule für Schwarze in Georgia und hält in den Sommerferien Vorträge und Lesungen, um sein Einkommen aufzubessern. Uncle Johno ist Chef-Spendensammler für eine schwarze Schule in Louisiana.