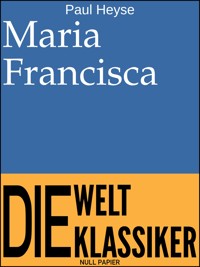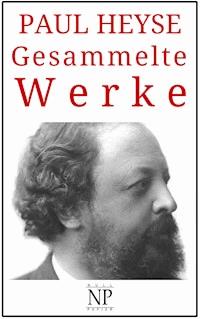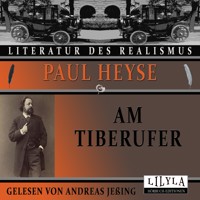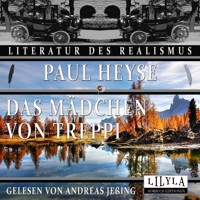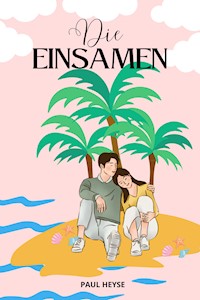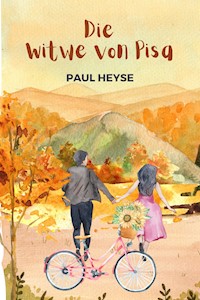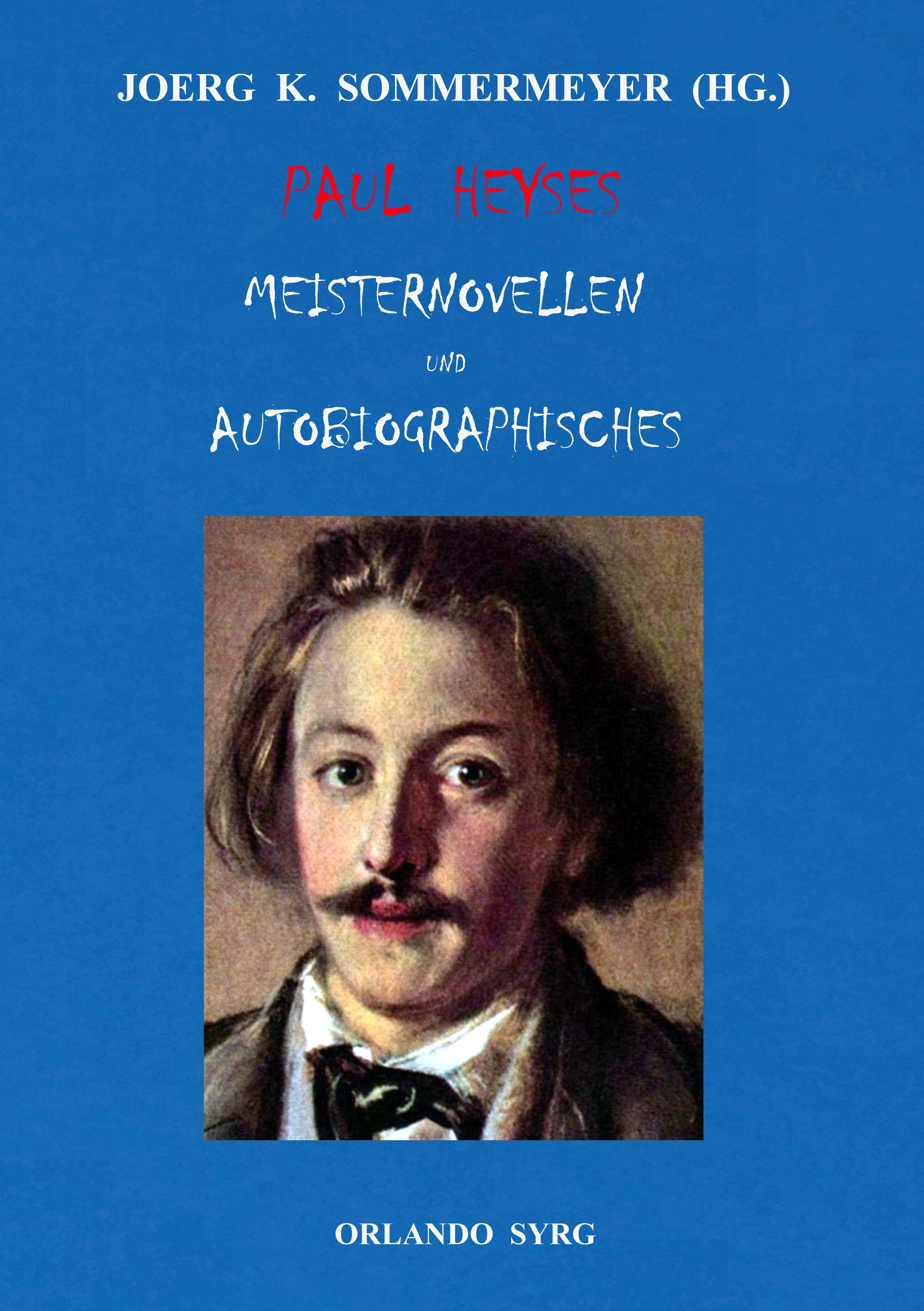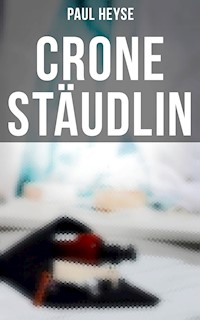
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In "Crone Stäudlin" von Paul Heyse taucht der Leser ein in die Welt des 19. Jahrhunderts in Deutschland, wo die Figuren mit den drängenden Fragen ihrer Zeit konfrontiert sind. Heyse nutzt einen eleganten literarischen Stil, der sowohl anspruchsvoll als auch zugänglich ist. Das Werk spiegelt die sozialen und kulturellen Normen dieser Ära wider und thematisiert Konflikte zwischen traditionellen Werten und modernem Denken. Heyse's Fähigkeit, komplexe Charaktere zu entwerfen und deren innere Konflikte aufzuzeigen, macht "Crone Stäudlin" zu einem fesselnden literarischen Meisterwerk. Paul Heyse, als renommierter deutscher Schriftsteller und Nobelpreisträger für Literatur, schöpfte möglicherweise aus seiner eigenen Erfahrung und kulturellen Kenntnis, um dieses Buch zu verfassen. Sein tiefes Verständnis der menschlichen Natur und sein feines Gespür für die Interaktion zwischen Charakteren spiegeln sich in seinem Werk wider. Für Leser, die historische Romane mit tiefgreifender Charakterentwicklung und literarischer Raffinesse schätzen, ist "Crone Stäudlin" von Paul Heyse ein absolutes Muss. Dieses Buch wird Sie auf eine fesselnde Reise durch die gesellschaftlichen Konventionen und persönlichen Kämpfe des 19. Jahrhunderts mitnehmen und Ihnen unvergessliche Einblicke in die menschliche Natur bieten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Crone Stäudlin
Books
Inhaltsverzeichnis
Im waldigsten Teile eines mitteldeutschen Berglandes einige hundert Meter über dem offenen Talgrunde erhöht, breitet sich eine große ebene Grashalde aus, wie eine freie Stufe, auf der der Berg vor seinem weiteren Anstieg sich ausgeruht hat.
Hier hatten vor langen Jahren die Ackerbürger, die das unten gelegene alte Städtchen bewohnten, ihr Vieh übersommert, bis der Reichste unter ihnen, der Wirt und Posthalter, den ganzen Wiesengrund, den zu umwandern man fast eine halbe Stunde brauchte, zu seinem alleinigen Eigentum erworben und an der Stelle der ehemaligen Hirtenhütte ein großes Haus hatte aufführen lassen, zwar außer dem Erdgeschoß nur ein Stockwerk hoch, doch geräumig genug, um Sommergäste zu beherbergen, die hier die heißen Monate überdauern oder Ausflüge zu den höheren Punkten des Waldgebirges machen wollten. Die langgestreckte freie Hochebene, auf der jetzt nur noch die Kühe und Pferde des Eigentümers weideten, war so ausgedehnt, daß noch zwei andere Häuser von zugewanderten Fremden in ziemlichen Abständen darauf Platz gefunden hatten. Wer aus ihren Fenstern über die Wipfel des Buchenwaldes, der von unten bis zum Rande des Plateaus hinaufreichte, nach Süden schaute, konnte seine Augen an dem hellen Talgrunde weiden, wo grüne Wiesen mit buntfarbigen Kornfeldern abwechselten. Fern am Horizont streckten sich niedrige Höhenzüge, mit dunklen Fichten bestanden, wie auch das höhere Gebirge fast nur Nadelholzwälder trug. Diese hielten die rauhen Winde von Mitternacht und die scharfe Ostluft ab, so daß auf der Hochfläche beständig eine nur mäßig bewegte Luft wehte, kühler als drunten im Tal, doch wohltätig temperiert durch die von Süden breit hereinflutende Sonne.
Von dieser günstigen Lage hatte man, wie gesagt, schon in der vorigen Generation, der der erste Bergwirt angehörte, Vorteil gezogen, und das Haus war besonders von Gästen aus Norddeutschland nie leer gewesen. Als der Sohn es dann übernommen und es nach Osten hin durch einen stattlichen Anbau erweitert hatte, wozu vorn zur Rechten noch ein freistehender geräumiger Gartensaal hinzukam, nahm sich das Ganze reich und behaglich genug aus. Über der Eingangstür hing eine schwarze Tafel, auf der mit großen Goldbuchstaben zu lesen stand:
Gasthof zum Seehof von Wenzel Harlander.
Darunter hatte man erst vor sechs Jahren mit kleinerer Schrift hinzugefügt:
Kurhaus zur Höhenluft.
Der Name Wenzel aber war mit schwarzer Farbe überstrichen und statt dessen der Name Maria eingesetzt worden.
Denn so hieß die jetzige Wirtin, die nach dem vor sieben Jahren erfolgten Tode ihres Mannes das einträgliche Geschäft rüstig fortsetzte. »Zum Seehof« aber war das Gasthaus geheißen, da etwa fünfzig Schritt hinter den Gebäuden, hart an dem steil ansteigenden Föhrenwalde, ein kleiner Bergsee lag, auch vorn an der Südseite von einem dichten Kranz niedriger Nadelholzstämmchen eingesäumt, so daß nur am Nachmittag, wo die Sonne vom Westen Zutritt hatte, die schwarze Flut von einem hellen Schimmer überglänzt wurde. Trotzdem hauchte sie keine eisige Kälte aus. Denn warme Quellen drangen aus dem tiefen Seegrunde durch eine morastige Erdschicht herauf, und die Glieder der Badenden wurden von weichen, bräunlichen Wellen umspült, die selbst an Herbst- und Frühlingstagen keine frostigen Schauer erregten.
Um diese, wie es schien, von der Natur eigens zum Luftkurort bestimmte Gegend vollends als Naturheilanstalt zu beglaubigen, hatte ein kluger Arzt der Wirtin geraten, vor dem kleinen Fichtenkranz am See eine Anzahl schmaler, offener, nur oben mit einem Dächlein versehener Hütten zu errichten, mit einer nicht gar weichen Matratze, Kopfkissen und wollener Decke für solche, die im Freien übernachten wollten. Auf einer Lichtung etwas höher im Walde waren zwei länglich runde Umzäunungen abgesteckt, die, für die Geschlechter getrennt, zu Sonnenbädern dienen sollten. Das Baden im See war Männern und Frauen im züchtigen Schutz langer Badekostüme zu gleicher Zeit freigestellt, und auf dem schmalen Uferweg längs des schilfigen Wassers stand eine Anzahl kleiner Kabinen zum Umkleiden bereit.
Erstes Kapitel
Am Nachmittag eines heißen Hochsommertages saß die Wirtin des Seehofs, Frau Maria Harlander, auf einer der Bänke vor ihrem Hause, im Schatten eines der Ebereschen- und Akazienbäumchen, mit denen der Platz bepflanzt war. In diesem Wirtsgarten pflegte sich an warmen Abenden an kleinen grüngestrichenen Tischen die Honoratiorenschaft des Städtchens drunten niederzulassen und mit Frauen und Kindern sich an der kühlen Bergluft und der guten Küche der Wirtin zu erquicken.
Heute hatte sich außer dieser selbst kein lebendes Wesen hier herausgewagt. Die fremden Gäste hielten in ihren mit Läden verdunkelten Zimmern Mittagsruhe, oder hatten sich höher in den Bergwald hinaufgeflüchtet, wenn sie nicht ihrer Kurpflicht in den Sonnenbädern oblagen. Nur in dem großen Gartensaal, der sogenannten »Halle«, saß hinter herabgelassenen Jalousien ein ältliches Ehepaar, ein grauhaariger, seine Hundstagsferien genießender Gymnasialdirektor, der noch eine und die andere Partie Schach mit seiner dicken kleinen Frau spielte, wobei man es dieser ansah, daß sie einen Schlummerwinkel auf ihrem Sofa vorgezogen hätte.
Frau Maria Harlander aber schlief nicht, wenn sie auch die Augen auf das große Wirtschaftsbuch, das vor ihr lag, nur träumend gesenkt hatte und an andere Dinge als die Zahlen darin zu denken schien.
Sie war eine stattliche Frau, mit ihren Vierundvierzig an jener Altersgrenze angelangt, wo die weibliche Blüte ihre Höhe erreicht und gewöhnlich schon überschritten hat. Letzteres war auch bei der Wirtin vom Seehof der Fall. Zwar zeigten sich in dem runden Gesicht, das noch immer, wenn sie lächelte, reizend erscheinen konnte, nur erst wenige Falten, die starken weißen Zähne hatten kaum eine Lücke, und nur das schlicht gescheitelte braune Haar begann sich ein wenig zu lichten. Doch mit der zunehmenden Fülle hatten die Züge einen derberen Ausdruck bekommen und alles jugendlich Feine verloren. Man erkannte, daß ihr Sommer sich seinem Ende zuneigte.
In ihrer Kleidung aber hielt sie sich noch zierlich, ohne sonderliche Künste. Sie hatte ein schwarzseidenes Tüchlein über den Kopf geschlungen, dessen dicke Fransen einen Teil des sorgfältig geflochtenen Knotens am Hinterhaupt bedeckten und nach vorn über den oberen Rand der etwas zu hohen Stirn hereinfielen. Das dunkle Kattunkleid mit roten Tupfen, das sie trug, ließ den kräftigen, sehr weißen Hals unter dem Doppelkinn ganz frei, und eine schwarzseidene Schürze, bis an die Mitte der vollen Brust hinaufreichend, war mit zwei kleinen silbernen Spangen befestigt, die ihrer Kleidung einen Anstrich von eigenem Geschmack gaben, wie er in dieser Gegend sonst nicht herkömmlich war.
So saß sie nun schon eine halbe Stunde, vor sich hinstarrend und ins Tal hinunterhorchend, von wo der Signalpfiff einer Lokomotive heraufgedrungen war. Doch der Gast, den sie zu erwarten schien, wollte immer noch nicht kommen. In nervöser Unruhe hatte sie die Feder eingetaucht und es nicht geachtet, daß ein schwerer Tintentropfen auf das Blatt gefallen war, das sie sonst peinlich sauber hielt. Von Zeit zu Zeit nippte sie an dem Glase Wasser, das vor ihr stand, aber ihre Lippen wurden sofort wieder heiß und trocken, und ihre Brust atmete immer schwerer, während ihr seine Schweißtropfen auf die Stirn traten.
Plötzlich aber fuhr sie von der Bank in die Höhe und stand aufrecht, die Hände gegen die Tischplatte gestützt, als suche sie einen Halt, da ihr ein Zittern durch die Glieder lief. Im Schatten der Bäume hinter der Gittertür, die sich in dem Zaun am Rande des Wirtsgartens öffnete, war eine Männergestalt aufgetaucht, das Pförtchen wurde aufgestoßen, und mit dem lauten, freudigen Ausruf »Guten Tag, Maria!« trat der Ankömmling rasch ein und wand sich zwischen den Tischen und Bänken durch bis zu dem Platz, wo die Seehoferin stand, regungslos immer noch sich am Tisch haltend, als wäre ihr der Mann, der ihr die Hand entgegenstreckte, ein Fremder und sie stände im Zweifel, wie sie seinen Gruß erwidern solle.
Sie nickte nur leise, sah ihm aber jetzt voll ins Gesicht. Er hatte den breiten Strohhut abgenommen und trocknete sich jetzt mit dem Taschentuch, daß er zum Gruß geschwenkt hatte, die hohe weiße Stirn, deren Farbe sich von der sonnegebräunten Haut des übrigen Gesichtes abhob. Ein sehr ausdrucksvolles, aber unregelmäßig gebildetes Gesicht, mit einem ins rötliche spielenden braunen Vollbart umrahmt, während das kurzgeschnittene starke Haar dunkler um die Schläfen stand. Die mittelgroße, gedrungene Figur mit breiten Schultern steckte in einem nachlässigen grauen Sommeranzug, statt der Weste hatte er einen leichten schwarzseidenen Schal umgegürtet, und die Zipfel eines dunklen Halstuchs hingen über die schneeweiße Hemdbrust herab. Wie er sich rasch und elastisch bewegte, traute man ihm die fünfunddreißig Jahre seines Alters nicht zu, sondern nahm ihn für einen Studenten in höheren Semestern, bis man dem scharfen, durchdringenden Blick seiner schwarzen Augen begegnete, oder die Falte zwischen den Brauen bemerkte, die bei jedem ernsten Wort sich vertiefte.
Ein paar Sekunden lang hatten die beiden sich stumm gegenübergestanden. Von dem Gesicht des Mannes war der freudige Ausdruck gewichen, und der energische Mund hatte sich zusammengepreßt. Als die Frau jetzt ihre Hand in die seine legte, die er über die Tischplatte weg immer noch ihr entgegenhielt, hörte er sie leise sagen: Willkommen, Johannes! Du kommst spät.
Er hielt ihre kräftige weiße Hand noch eine Weile fest, ehe er sie frei gab.
Bist du krank, Maria? sagte er dann. Deine Hand ist kalt und feucht. Und auch sonst – du bist wie verwandelt zu mir. Ist das dein Empfang, nachdem wir seit Ostern getrennt waren?
Sie machte eine halbe Wendung mit dem Kopf nach der Halle hin.
Sprich leise! Wir sind nicht allein. Da drüben hören sie jedes Wort. Laß uns Sie zueinander sagen. Die Rektorsleute sitzen beim Schach in der Halle.
So laß uns ins Haus gehn, wo wir unter vier Augen sprechen können. Mein Zimmer ist doch bereit? Wenn du wüßtest, wie ich mich nach diesem Augenblick gesehnt habe, wo ich meine Arme wieder um dich schlingen und dein liebes Gesicht küssen könnte! Und jetzt dieser Zwang! Du hast es doch sonst so traulich einrichten können, daß unser erstes Wiedersehen von niemand gestört wurde.
Sie atmete schwer und suchte seinem forschenden Blick auszuweichen.
Dein Zimmer, flüsterte sie endlich mühsam – es tut mir leid, Johannes, aber diesmal kannst du nicht darin wohnen.
Das Fältchen zwischen seinen Brauen vertiefte sich. Die Stimme, obwohl er sich Mühe gab, sie zu dämpfen, klang rauh und fast drohend.
Wer hat mich daraus zu verdrängen gewagt? Und wie hast du's leiden können?
Zürne mir nicht, Johannes, erwiderte sie stockend. Die Kinder wohnen jetzt darin – ich hab' es ihnen geben müssen – wie schwer mir's wurde, weiß Gott im Himmel, aber – es mußte sein!
Sie sank auf die Bank zurück und bedeckte die Augen mit der Hand, als könne sie's nicht ertragen, zu sehn, welchen Eindruck ihre Worte auf ihn gemacht hätten.
Eine Weile blieb es still zwischen ihnen. Man hörte von der Halle herüber das Klappern der Schachfiguren, die in das Brett zurückgelegt wurden.
Dann sagte der Mann: Wenn mir das ein andrer gesagt hätte, würde ich ihn ausgelacht und einen Narren genannt haben. Erkläre mir –
Sie nahm die Hand von den Augen und sah ihm mit einem rührenden Ausdruck des Flehens ins Gesicht.
Ja, seufzte sie, ich muß es dir erklären, aber ich beschwöre dich, hör' mich ruhig an, ohne in Wut zu geraten. Bin ich doch ganz so unglücklich wie du, oder noch mehr, denn du weißt nicht, wie einsam ich hier oben bin, trotz der Kinder, wie ich keinen anderen Trost habe, zumal in dem langen Winter, als zu denken, noch so und so viel Monate, dann kommst du, und ich erlebe wieder ein kurzes Glück.
Aber es gibt Menschen, die so neidisch sind, daß sie einem armen durstigen Herzen auch den Tropfen Erquickung nicht gönnen, den das Schicksal ihm zuweilen spendet.
Zu Pfingsten, als unser alter Pfarrer gestorben war, ist unten ein neuer gekommen, ein junger, sehr hitziger Seelsorger, der kein Erbarmen kennt mit menschlicher Schwachheit. Dem hat irgendein hämischer Zuträger erzählt, was ja für die Leute unten kein Geheimnis ist, wie wir zwei zueinander stehen. Alle andern haben's so angesehn, wie wir selbst, daß es Gottes Wille war, der uns zusammengeführt hat, und sind auch gescheit genug, um zu begreifen, daß es so bleiben muß, daß wir uns vor Gott und Menschen nicht anders angehören können, weil ich hier oben mein Geschäft hab' und du das deine in der Stadt. Und nachdem sie erst, als sie dich noch nicht kannten und achten gelernt hatten, über uns gelästert hatten, ist es ja nach und nach still davon geworden, und jetzt red't mir keiner mehr was Übles nach, da ich mich immer ehrbar und anständig gehalten, die Kinder gut erzogen hab' und auch sonst kein Ärgernis gegeben. Für den neuen Pfarrer aber hat das all nicht gegolten. Wie ich zum erstenmal zur Beicht' bei ihm gegangen bin, hat er mir die Hölle heiß gemacht und mir alles als wie eine Todsünde vorgehalten, daß ich die Eh' gebrochen, jahrelang ohne den Segen der Kirche mit meinem Mitschuldigen gelebt hätt', der noch dazu ein Protestant sei. Ich will dich mit den schimpflichen Ausdrücken verschonen, mit denen er mein Betragen verdammt hat. Genug, als er mich fragte, ob ich Reue empfände und Abstellung des sündhaften Wandels gelobte, – das Herz im Leibe wollte mir zerspringen, aber ein Ja konnt' ich nicht über die Lippen bringen. Da hat er mich fortgehen heißen, ohne mir die Absolution zu geben, und mir mit den ewigen Höllenstrafen gedroht, so laut, daß ich gemeint hab', ich müss' vor Scham auf der Stelle des Todes sein, wie ich an den Frauen vorbeigewankt bin, die hinter mir vor dem Beichtstuhl knieten, bis die Reih' an sie käme.
Die Stimme versagte ihr, und die Augen wurden ihr feucht. Als sie sich mit ihrem Tuch getrocknet hatte, sah sie, daß er ohne jede sonderliche Erregung ruhig ihr gegenüberstand.
Ist das alles? fragte er endlich. Ich habe dir versprochen, in deine religiösen Ansichten dir nie hineinzureden. Sie haben dich bis jetzt weder glücklich noch unglücklich gemacht, weil du trotz all dieser kindlichen Vorurteile in allen wichtigen Dingen deinen klaren Verstand hast reden lassen. Wenn dich aber jetzt eine abergläubische Furcht vor den Höllenstrafen dazu bringt, dich von mir scheiden zu wollen, so muß ich dir sagen –
O Johannes, fiel sie ihm ins Wort und sah ihn mit einem Blick schwermütiger Liebe an – sag mir nichts! Das Härteste, was du mich hören lassen könntest, hab' ich mir selbst gesagt. Aber glaub mir: nicht vor der Hölle fürcht' ich mich. Der würd' ich tausendmal trotzen, wenn ich deine Liebe damit erkaufen könnte. 's ist etwas anderes, ganz Irdisches, was mir das Herz schwer macht und mich nach der Absolution verlangen läßt: die Sorge, was meine großen Kinder von mir denken möchten, wenn wir fortleben, wie all die Jahre bisher, wenn Gunled, die schon vom Leben Bescheid zu wissen anfängt, des Nachts aufwacht und die Türe gehen hört, die zum Zimmer ihrer Mutter führt. Sie haben dich beide lieb, mehr als sie ihren leiblichen Vater gern gehabt haben. Und doch – mit welchen Augen müssen sie mich ansehen, wenn sie die Entdeckung machen, daß der Onkel Hans, den sie immer für den bravsten aller Menschen geachtet haben, und ihre Mutter, die ihnen gute und strenge Lehren gegeben, daß diese beiden – o Johannes, wenn du es recht bedenkst – auch ohne daß der Priester dazwischengekommen wär' – es hätt' doch ein Ende nehmen müssen. Überdies – in ein paar Jahren werd' ich eine alte Frau sein, und du bist dann noch ein junger Mann und kannst eine andere finden – und ich, so hart mich's ankommen wird – glaub nur, Johannes, ich werde mir Mühe geben, sie lieb zu haben und sie dir zu gönnen, dir aber werd' ich bis zu meinem letzten Atemzug dankbar sein, daß ich durch dich das einzige Glück meines Lebens –
Die Erschütterung übermannte sie. Sie legte das Gesicht gegen die Tischplatte und schluchzte herzbrechend in ihr Tuch hinein.
Da hörte sie ihn sagen: Beruhige dich. Du hast recht. Ich werde deinen Kindern kein Ärgernis geben. Aber Halbheiten gehn mir wider die Natur. Wenn geschieden sein muß, sei es gleich und für immer. Ich werde meine Ferien wo anders zubringen und dir den Ort melden, wohin du mir meinen Koffer nachschicken sollst. Nur daß ich den Jungen nicht mehr haben soll, ist mir ein bittrer Kummer. Über alles andere muß ich eben sehn wie ich hinwegkomme. Also lebwohl!
Er wandte sich, setzte den Hut mit einer hastigen Gebärde auf und tat ein paar Schritte von ihr weg. Im nächsten Augenblick war sie aufgesprungen und hatte, ihm nachstürzend, ihn am Arm gefaßt.
Du wirst mir das nicht antun, raunte sie, so von mir zu gehn, und wie du sagst, auf immer! Oder ich müßte glauben, alles, was du mir je von Liebe gesagt hast, wär' eine Lüge gewesen. Auch wenn zwei sich in bitterer Feindschaft voneinander scheiden, haben sie doch das Einsehn, daß noch manches sie aneinander knüpft, wären's auch nur die äußerlichsten Dinge. Du aber hast das Wort bereits ausgesprochen: was soll mit Hänsel geschehen? Und du wirst auch außerdem nicht deine Schöpfung, die Kuranstalt, so jählings im Stich lassen, von mir ganz zu schweigen, die zeitlebens dir nur Liebes angetan hat und nun zurückbleiben würde, als wäre sie nicht einmal deine Freundschaft mehr wert. Nein, Johannes, dieser ersten heftigen Regung darfst du nicht folgen. Wenigstens bis morgen mußt du bleiben. Ich hab' dir zwei Zimmer reserviert im Anbau – und sieh, eben kommen die Kinder, dich zu begrüßen, die sollen dich hinführen. Sieh nur, wie sie sich freuen, daß du endlich gekommen bist! Was sollt' ich ihnen sagen, wenn du wie ein schwer beleidigter Mensch plötzlich davonstürztest und es nicht einmal eine Nacht hier oben aushalten könntest?
Zweites Kapitel
Ums Haus herum, auf dessen Rückseite die Küche und andere Wirtschaftsräume lagen, kamen zwei Mädchen herbeigelaufen, die Töchter der Frau Maria, die sie ihrem Manne in den ersten Jahren ihrer Ehe geboren hatte. Sie mäßigten aber sogleich ihren Schritt, als sie in den Gesichtskreis der Mutter kamen, die ihnen ein wildes, hastiges Wesen nicht durchgehen ließ, und näherten sich mit der etwas unbeholfenen Haltung junger Backfische, dem Doktor ihre Hände entgegenstreckend.
Die ältere, Gundel, war mit ihren siebzehn Jahren über das Backfischalter schon hinaus, hatte aber in dieser Weltabgeschiedenheit noch nicht die Manieren eines erwachsenen Jungfräuleins angenommen, obwohl sie unter den Töchtern der Sommergäste die Vorbilder dazu vor Augen hatte. Sie war ein bescheidenes Mutterkind geblieben, mit keinem höheren Ehrgeiz, als sich im Hause nützlich zu machen, und nur stolz darauf, daß ihr schon die Sorge für die Wäschekammer, das Silberzeug und die Einrichtung der Zimmer anvertraut war. Auch im Äußeren erinnerte sie an den Vater, dessen blondes Haar und blaue Augen zugleich mit einer gewissen Schüchternheit im Betragen sie geerbt hatte.
Hiervon hatte die jüngere und kleinere, Trinchen, nichts, als die etwas eckigen Bewegungen des Papas. Im übrigen war sie mehr der Mutter nachgeartet, ohne deren schönen ebenmäßigen Wuchs, da ihr hübscher kleiner Kopf auf einem zu kurzen Halse saß. Aus ihren stillen, beobachtenden Augen aber sah ein kluger Geist in die Welt hinein, und im Gegensatz zu der Schwester liebte sie nicht, sich viel zu rühren, sondern saß stundenlang über den Büchern, deren Inhalt ihr sechzehnjähriges Gehirnchen oft nur unvollständig zu verarbeiten vermochte.
Sie wollte sich nach dem Beispiel der Mutter zur Lehrerin ausbilden, nahm allerlei Privatstunden bei dem Rektor der Stadtschule und Klavierunterricht bei der Lehrerin der Töchterschule. Das hatte, sehr gegen den Wunsch der Mutter, ihre körperliche Entwicklung zurückgehalten, der Doktor aber hatte geraten, sie gewähren zu lassen; man müsse es jedem Kinde gönnen, sich seinen Weg zu suchen, und es gebe kein anderes Glück, als nach eigenem inneren Gesetz seiner Kräfte froh zu werden.
Wie die beiden guten Geschöpfe nun vor ihm standen und mit sichtbarer Freude ihm treuherzig in die Augen sahen, suchte er vergebens nach einem Wort, sie in alter Weise zu begrüßen. Das Fältchen zwischen seinen Brauen war noch nicht wieder geglättet, sein finsterer Blick noch nicht sanfter geworden. Er strich den Kindern, ihnen stumm zunickend, langsam über das Haar und brachte endlich mühsam hervor: Ihr seid noch gewachsen seit dem Frühjahr. Trinchen hat es auch nötig.
Dann trat eine verlegene Pause ein.
Zeigt dem Onkel Hans seine Zimmer, brachte Frau Maria endlich mühsam hervor. – Sie ergriff begierig den Vorwand, das peinliche erste Wiedersehn abzubrechen.
Der Doktor schien es zu überhören.
Wo ist Hänsel? fragte er. Hat er nicht erfahren, daß ich heut kommen würde?
Er ist in der Turnschule unten, versetzte die Frau. Jeden Mittwoch und Sonnabend Nachmittag turnen jetzt die Schüler, am Montag die Mädchen. Es schlägt ihm gut an. Sie werden sich freuen, wie Ihr Patenkind sich herausgemacht hat. Aber nun begleitet den Onkel, Kinder. Ich habe im Hause zu tun. Beim Abendessen sehn wir uns wieder.
Sie grüßte Helmbrecht mit einem etwas leidmütigen Neigen des Kopfes, nahm das Buch vom Tische und ging langsam ins Haus zurück.
Kaum hatte sie den Rücken gedreht, so wurden die Gesichter der beiden Mädchen heller und unbefangener. Trinchen ergriff ohne Umstände den Arm des Onkels und zog ihn mit fort, Gundel bemächtigte sich seines Huts und Stocks und ging neben ihnen her. Er ließ willenlos mit sich machen. Das muntere Geplauder der Kinder hörte er nur wie im Traum, die Eröffnung, die die Frau ihm gemacht, lag schwer über seinem Gemüt und ließ keinen anderen Gedanken in ihm aufkommen, als daß nun zu Ende sein sollte, was seine Lebensfreude gewesen war.
So schritten sie langsam nach rechts, dem Anbau zu, der durch einen langen, auf schlanken Pfosten ruhenden Wandelgang, die Zuflucht der Kurgäste in Regenzeiten, mit dem alten Hause verbunden war. Der schmucklose Wirtsgarten mit den Tischen und Bänken reichte nicht weit, auf dem offenen Platz vor dem langgestreckten Nebenhause war ein Ziergärtchen angelegt mit einem Springbrunnen in der Mitte, in dessen unterem Becken ein paar Goldfische schwammen. Gundel erzählte, welche Not sie mit den Rosenstöcken habe, die von den Mühlenknechten und anderen leichtsinnigen Burschen geplündert würden. Sie brach eine große dunkle Blüte und steckte sie Helmbrecht ins Knopfloch. Er ließ es geschehn, ohne anders als mit einem zerstreuten Kopfnicken zu danken.
Dann traten sie ins Haus, und die Mädchen führten ihn ans äußerste Ende des Korridors, der zwischen den beiden Zimmerreihen hinlief. Die letzte Tür zur Rechten öffnete sich in ein großes schönes Gemach, das sein Licht durch zwei Fenster von Osten und Süden erhielt. Nebenan war ein kleineres Kabinett zum Schlafen eingerichtet, dieser »Salon« aber, wie er im Hause genannt wurde, galt für das vornehmste Zimmer im ganzen Seehof und war mit den elegantesten Möbeln ausgestattet, die aus der nächsten größeren Stadt bezogen werden mußten. Auch hingen zwei nicht üble Öldruckbilder an den Wanden, den Montblanc und die Jungfrau vorstellend, deren ewiger Schnee an eine »Höhenluft« erinnerte, mit der die des Seehofs sich nicht messen konnte.
Auf dem Tisch vorm Sofa aber stand in einer blauen Vase ein Strauß von Reseden. Trinchen hatte ihn hingestellt. Sie wußte, daß es die Lieblingsblumen des Onkels waren.
Dafür war er nun doch erkenntlich. Er zog die beiden guten Kinder an sich und küßte sie auf die Stirn, schob sie aber gleich wieder mit einem Seufzer von sich weg und ließ sich, wie tief erschöpft, auf das Sofa sinken.
Die Mädchen blieben verlegen vor ihm stehen. Der Onkel war so anders als sonst. Was mochte ihm begegnet sein?
Gundel brach wieder die peinliche Stille. Die beiden Zimmer – Onkel Hans werde sich erinnern – habe im vorigen Sommer »die Gräfin« bewohnt. Auch in diesem Jahr hätte sie sie gern wieder gehabt, aber die Mutter habe sie nicht hergegeben, sie habe gewollt, der Onkel sollte sie haben, da sie die stillsten seien und im alten Hause das ewige Laufen und Lärmen ihm die Ruhe störe, die er zum Arbeiten brauche. Sie habe dann der Gräfin zwei andere angeboten, auch nach vorn und frisch tapeziert. Die aber habe gesagt, sie wolle lieber hinten hinaus wohnen, sie sehe gern in den Wald hinauf, und so hätte sie das letzte noch freie Zimmer hier im Anbau bekommen, gerade deinem gegenüber, Onkel Hans.
Er fuhr unmutig in die Höhe.
Diese fatale Person – so in meiner nächsten Nähe? Nun, ein paar Tage werd' ich's ja aushalten. Dann aber –
Er sagte den Mädchen, daß er diesmal nicht lange bleiben könne, seine Geschäfte in der Stadt erlaubten ihm keine gründliche Sommererfrischung. Das machte die guten Kinder traurig, sie baten und bettelten, wenigstens vierzehn Tage, oder zwölf, oder zehn müsse er bleiben, er schüttelte düster den Kopf, und da jetzt sein Gepäck gebracht wurde, das ein Wagen auf dem breiten, sacht ansteigenden Fahrweg heraufbefördert hatte, brach er das Gespräch ab und fing an, seinen Koffer auszupacken.
Er holte allerlei hübsche Sachen heraus, die er ihnen mitgebracht hatte, ein paar elegante Blusen, bei deren Auswahl ihn die Frau eines Kollegen beraten hatte, schöne Schildpattnadeln fürs Haar und zwei einfache goldene Broschen von seiner Arbeit. Die Mädchen wurden dunkelrot vor Freude, fielen dem gütigen Geber um den Hals und liefen dann mit ihren Schätzen davon.
Als er sich allein sah, stand er wohl eine halbe Stunde mitten im Zimmer und starrte vor sich hin. Es war ihm wunderlich zumut. Noch wirkte die erste bittere Empfindung in ihm nach, daß diese Frau, die er wahrhaft geliebt hatte, sich von ihm lossagen konnte, einem fremden Gebot gehorchend, das ihr heiliger war als die Stimme ihres Herzens. War's nur die Macht des Glaubens, in dem sie aufgezogen war, daß die von der Kirche geheiligten Satzungen höher seien als alles, was Menschennatur als ihr Eigenrecht in Anspruch nehmen mochte? Oder war das Gefühl der Lieb' und Treue, das sie mit ihm verbunden, mit den Jahren schwächer geworden, so daß es sie kein großes Opfer kostete, sich dem Machtspruch des Priesters zu fügen?
Sie war das Kind einer kleinen bürgerlichen Familie aus dem Städtchen unten, und da sie in der Schule sich früh auszeichnete, hatten die Eltern sie in die nächste größere Stadt geschickt, dort ihr Lehrerinnenexamen zu machen. Als sie dann zurückgekehrt war, fand sie bald eine Anstellung in der Töchterschule drunten, wo sie Unterricht im Singen, Deutsch und ein wenig Französisch gab. Ihre Lehrzeit draußen hatte aber ihre religiösen Anschauungen nicht zu erschüttern vermocht, obwohl sie sie nicht zur Schau trug. Doch war sie bei den Eltern ihrer Zöglinge dadurch nur um so besser angeschrieben, und als ihre Gesundheit ins Wanken kam, so daß man der Fünfundzwanzigjährigen kein langes Leben mehr gab, hatte man ihr gern einen schulfreien Sommer bewilligt, um dem Verderben vielleicht noch Einhalt zu tun.
Das war auch über Erwarten gelungen. Doch obwohl das schlanke Fräulein mit dem zarten blassen Gesicht in der kräftigen Höhenluft rasch wieder aufblühte, kehrte sie doch nicht in ihre Schule zurück. Denn der Wirt des Seehofs, Herr Wenzel Harlander, der großen Respekt vor ihrem Wissen und gewandteren Betragen empfand, erklärte ihr nach vier Monaten, er lasse sie nicht fort und frage sie, ob sie seine Wirtin werden wolle.
Sie hatte, ob auch ohne sonderliche Neigung, eingewilligt, da er ein ehrenwerter, auch sonst nicht übler Mann war, nur zwölf Jahre älter als sie, und die bequeme Lage, in die sie durch ihn versetzt wurde, nach der Dürftigkeit ihrer Schulmeisterei auch für ihr körperliches Wohlsein zuträglich zu sein versprach.
Hierin hatte sie sich auch nicht getäuscht. Bald nachdem sie ihrem Manne zwei Töchter geboren, hatte ihre schmächtige Figur angefangen sich zu einer anmutigen Fülle zu entwickeln, durch das rührige Schaffen in Haus und Hof in richtigen Grenzen gehalten. Auch ihr Gesicht zeigte nicht mehr den schmalen Umriß der früheren Zeit, und der Blick der besonnenen grauen Augen, vor allem die Linien des Mundes hatten einen charaktervollen Ausdruck von festem Willen und Selbstbewußtsein gewonnen, da sie nun nicht mehr kleinen Schulmädeln, sondern einer zahlreichen Dienerschaft zu gebieten hatte.
Auch ihr Mann war diesem Willen bald völlig untertan geworden. Er erkannte dankbar all ihre Gaben und Tugenden an, ihre feinere Bildung, die ihr im Verkehr mit den Sommergästen zustatten kam, ihr rasches Erfassen alles dessen, was für den mannigfachen Betrieb einer großen Wirtschaft vonnöten war, dazu ihre Güte und Gelindigkeit gegen alle Untergebenen und Sorge für die Tiere, wobei sie doch in ihrem gleichmütig gerechten Sinn auf keinen Herrscherlaunen sich betreffen ließ. So galt sie in der ganzen Gegend als ein musterhaftes Weib, zumal sie auch jeder Versuchung widerstand, durch die Huldigungen irgendeines fremden jungen Verehrers, der schmeichelnd um die schöne Seehoferin herumstrich, sich auch nur auf eine kurze Sommerzeit betören zu lassen.
Dann, nachdem dieser erfreuliche Zustand etwa zehn Jahre gedauert hatte, war plötzlich alles verwandelt worden. Der Hausherr hatte auf einem auf abschüssiger Straße hinuntersausenden Wagen einen Sturz getan, der ihm einen Rückenwirbel beschädigt und den wackeren Mann so weit gelähmt hatte, daß er seinem Geschäft nicht mehr wie früher in Haus und Stall und Weideplätzen vorstehen konnte. Er saß die meiste Zeit in einem Zimmer, das ihm den Ausblick auf das Gehöft verstattete, und verfolgte mit trübsinnigem Gesicht das Hin und Her seiner Dienstleute und mit dankbarem Kopfnicken die Schritte seiner Frau, auf der nun die ganze Last des Haushaltes lag. Auch seine beiden Töchterchen saßen wohl, wenn sie ihre Schulaufgaben gemacht hatten, ein Stündchen bei dem kranken Vater, lasen ihm das Lokalblättchen vor oder eine Kalendergeschichte, doch ohne daß er sonderlich zuzuhören schien.
Seine beste Unterhaltung hatte er mit einem jungen Arzt aus der nahe gelegenen Universitätsstadt, einem Doktor Johannes Helmbrecht, der bald nach jenem unglücklichen Sturz zum Seehof hinaufgekommen war und besser als der alte Bezirksarzt unten um die Sache Bescheid wußte. Er hatte nach Möglichkeit Linderung für die Schmerzen geschafft und durch zweckmäßige Verordnungen die Kräfte zu heben und im ganzen einen leidlichen Zustand herzustellen gewußt. Dazu war sein frisches, warmblütiges Temperament eine Wohltat für den schwermütig grübelnden Patienten, dem er wieder Hoffnung und Lebensmut einzuflößen verstand und mit Erzählungen aus der Welt draußen, die der Ärmste so gut wie nicht kannte, die Weile kürzte, besser als es Gundel und Trinchen mit ihren Kindergeschichten imstande waren.
Leider konnte er nur in den Ferien zu einem längeren Besuch auf dem Seehof die Zeit erschwingen, da er außer seiner ärztlichen Praxis auch Vorlesungen an der Universität zu halten begonnen hatte; dann aber erschien er allen im Hause wie ein rettender Engel oder Zauberer, der die schwüle, dumpfe Stimmung auf einen Schlag verwandelte. Die Kinder hingen an dem munteren Onkel mit aller Zärtlichkeit, deren ihre etwas engen kleinen Herzen fähig waren, die Dienstleute, denen er hin und wieder auch als Arzt allerlei Gutes erwies, wären für ihn durchs Feuer gegangen, und auf Frau Marias Gesicht erschien wieder zuweilen ein Lächeln, das seit jenem Schicksalstage ein Fremdling darauf gewesen war.
Auch schien der Kranke in der Tat das Leiden noch einmal überwinden zu sollen. Er wagte wieder, an zwei Stöcken im Hause umherzuschleichen, ja sein junger Freund brachte ihn dazu, an die Luft zu gehen und eine neue Scheune, die inzwischen gebaut worden war, zu inspizieren. Was aber vollends ein Wunder schien: fünfzehn Monate nach dem Sturz kam noch ein Söhnchen zur Welt, ein so lebfrischer kleiner Bursch, wie man ihn einem invaliden Vater nimmermehr zugetraut hätte.
Die Taufe wurde denn auch mit besonderer Feierlichkeit begangen, und jedermann fand es natürlich, daß Doktor Helmbrecht, obwohl er Protestant war, das Kind aus der Taufe hob und ihm seinen Namen Johannes gab. Bei dem Taufschmause freilich hatte der glückliche Vater, der sich am Anblick des rosigen Knäbchens nicht satt sehen konnte und die Wiege durchaus neben seinem Stuhl haben wollte, nicht bis zu Ende ausdauern können. Die Schmerzen waren so stark geworden, daß man ihn zu Bett bringen mußte, das er nicht mehr verließ. Drei Wochen darauf trug man ihn auf dem Friedhof unten zu Grabe.
Da die Herbstferien noch dauerten, war der Pate imstande, seiner Frau Gevatterin in der ersten Trauerzeit zur Seite zu bleiben und ihr in der Ordnung ihrer Angelegenheiten beizustehen. Den Winter verbrachte sie, wie sich's für eine Witwe geziemt, in großer Stille und Zurückgezogenheit. Um Ostern aber erschien der Doktor wieder, und um sie durch neue Tätigkeit aus ihrer gedrückten Stimmung herauszureißen, schlug er ihr die Umwandlung der simplen Sommerfrische in eine förmliche Luftkuranstalt vor und traf auch dazu die nötigen ersten Einrichtungen.
Daß er selbst sich als Kurarzt droben ansiedelte, war ihm versagt, da er seit einem Jahr eine eigene Klinik für Wöchnerinnen und Kinder gegründet hatte, wozu ihm durch eine milde Stiftung die Mittel zugeflossen waren. Doch gelang es ihm, den neuen Arzt im Städtchen unten, einen Anfänger, der noch wenig Praxis hatte, für seine hygienischen Grundsätze zu gewinnen, so daß dieser als sein Assistent sich gern verpflichten ließ, täglich zum Seehof hinaufzusteigen und die Patienten zu überwachen. Wenn er selbst, Hans Helmbrecht, in seinen Ferienwochen hier oben wohnte, trat er nur in schwierigeren Fällen hinzu und überließ, nachdem er sich mit dem Kollegen verständigt hatte, diesem die weitere Behandlung.
So hatten die Dinge acht Jahre gestanden bis zu dem Tage, wo Frau Maria Harlander vor ihrem Hause ihn erwartete, um ihm mitzuteilen, daß geschieden sein müsse, um ihres Seelenheils willen, an das sie so lange Jahre nicht gedacht hatte.
Es hatte ihn schwer getroffen.
Diese Frau war in der Tat seine erste und einzige Liebe gewesen. Niemals hatte er den Weibern Macht über sich eingeräumt, bei keinem flüchtigen Abenteuer die Illusion eines Herzensverhältnisses empfunden, sondern alle Leidenschaft seiner starken Natur auf seine Wissenschaft und ihre menschenfreundliche Anwendung gerichtet. Zum erstenmal in der Abgeschiedenheit dieser Berghöhe, als er die blühende junge Frau neben ihrem dem Tode entgegenwelkenden Manne gesehen, wie sie ihr Los mit klagloser Ergebung trug, hatte er anfangs menschliche Teilnahme und bewundernde Verehrung empfunden, dann nach und nach ein sehnsüchtiges Verlangen, das ihm endlich über den Kopf gewachsen war.
Nach seiner redlichen und gewissenhaften Natur hatte er es mit dieser heimlichen Verbindung so ernst genommen, daß er sie als fürs Leben geschlossen ansah und an die Möglichkeit eines Bruchs von seiner Seite nie gedacht hatte. Dazu kam, daß eben durch die äußere Getrenntheit ihrer Lebenskreise das Verhältnis stets den vollen Reiz eines Ferienglücks behielt, das nur kurze Wochen dauerte und um so dankbarer genossen werden mußte. Daß es dabei freilich auch zu einer tieferen Gemeinschaft nicht kommen konnte, zu dem Besten, was ein richtiges Ehepaar in langen Jahren miteinander zu teilen und auszutauschen hat, kam ihm nicht zum Bewußtsein. Auf einmal war's ihm jetzt, als zerrisse ein Schleier, der seinem Blick bisher die nüchterne Wahrheit verhüllt habe, daß diese Liebe für sein Leben doch keine tiefere Bedeutung habe, daß der Verzicht auf sie keine so unheilbare Wunde schlagen könne, wie er in der ersten Aufwallung zu empfinden geglaubt.
Dann wieder machte er sich einen Vorwurf daraus, einer fremden Macht so ohne Widerstand das Feld geräumt zu haben. Diese Wochen hier oben waren ja die einzige Zeit gewesen, in der die Last seines schweren Berufs von ihm abfiel, er nach der Atmosphäre der Krankenzimmer und des Hörsaals reine Höhenluft atmen konnte. Das sollte nun aufhören. Denn in der alten Umgebung mit einem so ganz anderen Herzen herumzugehen, gleichsam als ein abgeschiedener Gatte, der gespenstig zu seiner Witwe zurückkehrt, war ein unmöglicher Gedanke.
So wogte es in seinem Inneren unselig hin und her.
Auf einmal wie er eben in seinem unmutigen Grübeln auf einen Stuhl gesunken war und die Augen zugedrückt hatte, um sich zu irgendeiner Entscheidung zu sammeln, hörte er hinter sich ein Geräusch, ein fröhliches Lachen und den Ausruf: Guten Tag, Onkel Hans! und fühlte sich von zwei kleinen Armen umfaßt. Sein Knabe, eben vom Turnen zurückgekehrt, war zu dem niedrigen offenen Fenster hereingesprungen, sehr vergnügt, den Paten unversehens überfallen zu haben.
Dem schoß eine warme Blutwelle gegen das Herz, als er den geliebten kleinen Kerl, nachdem er ihn wieder und wieder auf das frische Mündchen geküßt hatte, nun von seinem Halse löste und vor sich hin auf seine Füße stellte.
Ja, das war sein Fleisch und Blut, in jedem Zuge des noch zarten Gesichts die Frische und der frische Eigenwille, die seine eigene Knabenseele erfüllt hatten. Nur die schönen grauen Augen hatte er von der Mutter, die auch schon Neigung zeigten, sich halb zuzudrücken, wenn sie scharf in die Ferne sehen wollten. Dann aber sein schwarzes Haar und das feine, schmale Naschen und die etwas zu kurze Oberlippe – auf und nieder sein verjüngtes, verschönertes Ebenbild.
Er setzte sich mit dem Knaben auf das Sofa und hielt ein langes Gespräch mit ihm, ihn nach all seinen kleinen Interessen, Aufgaben und Vergnügungen befragend, und Hänsel gab auf alles mit der treuherzigsten Offenheit Antwort. Er sitze in der zweituntersten Klasse der Stadtschule, aber das Latein, das er nebenher beim Stadtpfarrer lerne, mache ihm weit mehr Spaß, er könne schon drei Deklinationen und werde über acht Tage amo anfangen. Auch zum Zeichnen finde er Zeit neben der Schule, dem Onkel werde er seine Häuser und Bäume zeigen, und besonders Tiere zeichne er gern, die seien aber furchtbar schwer. Er habe die scheckige Kuh gezeichnet, aber Trinchen habe ihn ausgelacht, das sei ja gar keine Kuh, sondern ein Mühlstein mit vier krummen Holzstöcken.
Johannes Helmbrecht hörte ihm zu, ohne viel hineinzureden. Die helle junge Stimme war ihm wie Balsam auf seine frische Wunde. Er fühlte plötzlich, daß er es nicht übers Herz bringen könne, sich so rasch von diesem seinem besten Besitz zu trennen; jedenfalls, wenn er auf die Mutter verzichten müsse, das Kind werde er nicht zurücklassen.
In solchen Gedanken ging er nach seinem Koffer und nahm ein paar Bücher heraus, die er dem Knaben reichte, eins für Käfersammler und ein Schmetterlingsbuch mit vielen bunten Abbildungen.
Du sollst mir zeigen, was du inzwischen gesammelt hast, Hänsel, sagte er, da der Knabe, vor Freude rot geworden, kein Wort des Dankes fand. In der kleinen Kiste dort habe ich dir zwei Kasten mit Glasdeckeln mitgebracht, da wollen wir die Käfer und Falter ordentlich hineinstecken, und ich zeige dir auch, wie man sie tötet, ohne sie zu quälen. Wenn die Kasten voll sind, bring' ich dir neue, du mußt nicht ruhen, bis du alle Arten, die hier im Gebirge zu finden sind, beisammen hast und die Namen weißt, die in den Büchern stehn.
Der Knabe war ihm in großer Aufregung beim Öffnen der Kiste behilflich, als es klopfte und ein Besucher sie unterbrach, der Assistent Helmbrechts und wohlbestallte Kurarzt der Heilanstalt zur Höhenluft. Hänsel nahm seine Bücher unter den Arm und lief überglücklich hinaus, allen im Hause zu zeigen, was sein guter Pate ihm mitgebracht hatte.
Der aber begrüßte den Kollegen herzlich, bot ihm eine Zigarre an und ließ sich von ihm über den Fortgang der Anstalt ausführlich Bericht erstatten. Der um vieles jüngere Arzt sah zu dem älteren sehr respektvoll hinauf. Er verehrte sein überlegenes Wissen und war ihm überdies Dank schuldig. Hatte er doch durch Helmbrechts Empfehlung die Stelle unten im Städtchen erhalten und war bald darauf auch zum Kurarzt oben im Seehof von ihm bestellt worden. Es gehe trefflich mit der Heilanstalt. Die dreißig Zimmer im Hause seien besetzt, täglich kämen neue Anmeldungen, die nicht mehr berücksichtigt werden könnten. Frau Harlander habe davon gesprochen, noch eine Dependance zu bauen. Jedenfalls werde es notwendig werden, die Hütten zum Übernachten im Freien zu vermehren.
Davon ließe sich reden, versetzte Helmbrecht. Einer Vergrößerung des Hauses aber könne er nicht zustimmen. Für den Heilzweck sei es nachteilig, wenn die Leute, die hier Genesung suchten, sich in einem großen Menschengewimmel sähen, das selbst die entlegenen Waldwinkel unsicher mache. Überreizte Nerven brauchten Ruhe und Einsamkeit, und die finanzielle Ausbeutung der günstigen Lage könne gegen den hygienischen Hauptzweck nicht in Betracht kommen. Die Wirtin habe das wohl nicht bedacht, werde sich aber seinen Gründen gewiß fügen.
Indem erklang von einem Türmchen auf dem Haupthause der helle Schall einer Glocke.
Wir werden zu Tisch gerufen, sagte Helmbrecht. Sie speisen doch heute mit uns?
Er bedaure, die freundliche Einladung nicht annehmen zu können. Er habe unten noch einen Krankenbesuch zu machen, und dann – er lächelte vergnügt – ich bin seit dem Mai ein Ehemann, und meine junge Frau erwartet mich. Ich habe sie aus Liebe geheiratet, große Schätze hat sie mir nicht zugebracht, überdies – Sie wissen, verehrter Herr Kollege, ein unverheirateter Doktor hat nicht das rechte Vertrauen in kleinbürgerlichen Häusern. Aber Sie werden uns hoffentlich die Ehre erweisen, morgen am Sonntag eine Suppe bei uns zu essen. Meine Frau würde sich so sehr freuen.
Helmbrecht dankte, erklärte aber, es sei noch ungewiß, ob er nicht morgen schon wieder abreisen müsse. Auf das bestürzte Bedauern des anderen sprach er von allerlei Umständen, die heute noch nicht zu berechnen seien. Übrigens werde er jedenfalls unten in seiner Wohnung vorsprechen, die Frau Kollegin zu begrüßen.
So trennten sie sich.
Drittes Kapitel
Das Tischglöckchen hatte langst ausgeklungen, und immer noch stand Helmbrecht in seinem Zimmer, unschlüssig, ob er dem Rufe folgen solle.
Es widerstrebte ihm, die Frau, mit der er noch kaum sich ausgesprochen hatte, unter fremden Menschen wiederzusehn und eine unbefangene Miene zu heucheln. Dann aber bedachte er, daß wohl, wenn er ausbliebe, der Knabe nach ihm geschickt werden würde, oder eines der Mädchen, vor denen er um eine Ausflucht verlegen gewesen wäre. So spülte er nur den Reisestaub von Gesicht und Händen, vervollständigte seinen Touristenanzug durch eine Weste und verließ das Zimmer.
Es war sieben Uhr und die Dämmerung schon hereingebrochen, da die Sonne früh hinter der Waldhöhe im Westen hinabging. Nur im Tal unten, auf den Dächern des Städtchens und den fernen Hügeln lag noch ein goldener Schein, und der Rauch aus vielen Schornsteinen stieg in die windstille Abendluft hinauf.
Schon von weitem sah Helmbrecht die Lichter in der Halle und die Köpfe der dort bereits vollzählig um den langen Tisch Sitzenden. Die Fenster nach der Ostseite waren der Abendkühle geöffnet, er hörte das Summen und Raunen der verworrenen Tischgespräche und das Klappern der Schüsseln und Teller. Von der Decke herab hingen zwei große Lampen, sechs kleinere waren an den Holzwänden zwischen den Glasfenstern befestigt. Als er hereintrat, blendeten ihn im ersten Augenblick die sich kreuzenden Strahlen, so daß er keines der Gesichter deutlich sah. Er selbst aber wurde sogleich von einigen am Tisch erkannt und teils mit freundlichem Zuruf und Händewinken begrüßt, teils noch herzlicher von besonders dankbaren Patienten, die sich's nicht nehmen ließen, aufzustehen und zu ihm zu eilen, um ihm einen Händedruck zu bieten und nach seinem Ergehen zu fragen.
Als er sich an das helle Licht gewöhnt hatte und die Gesichter unterscheiden konnte, erkannte er unter den drei Dutzend Tischgenossen etwa die Hälfte als alte Stammgäste wieder. Sie saßen an der langen, sauber gedeckten Tafel in zwanglosen Kostümen und sichtbarem Behagen beisammen und sprachen den einfachen Gerichten mit frischer Eßlust zu, da sie meistens einen weiten Gang oder Kletterweg durch den Wald hinter sich hatten. Beim Nachtessen wurden keine Fleischspeisen aufgetragen, nur eine leichte vegetarische Kost, wie auch der Wein verpönt und nur ein dünnes Bier erlaubt war, das unten im Städtchen gebraut wurde. Gundel und Trinchen bedienten die Gäste mit Hilfe einer Kellnerin, die die Schüsseln auf einem großen Brett aus der Küche hereintrug. Seitwärts aber, an einem Kredenztischchen, an dem einen Ende der weiten Halle stand die Wirtin des Seehofs und überwachte alles. Mit am Tisch zu sitzen, wie es zu den Zeiten ihres Mannes Brauch gewesen war, hatte sie sich längst versagt.
Sie hatte nur einen flüchtigen Blick auf Helmbrecht geworfen, als er eintrat. Ihre Haltung war wie sonst, nur daß sie zerstreut und blasser als sonst erschien, was aber niemand beachtete. Auch er hatte sie mit dem ersten Blick an ihrem gewohnten Platz gesucht und rasch sich abgewendet. Während er dann die Augen herumgehen ließ, um noch einen freien Sitz zu finden, kam Gundel auf ihn zu, nahm ihn bei der Hand und führte ihn die lange Reihe hinunter zum anderen Ende der Tafel, wo noch zwei leere Stühle standen. Hier, Onkel Hans, sagte sie. Ich habe dir schon deinen Serviettenring neben das Kuvert gelegt und auch die Flasche mit Bier hingestellt, und gleich werde ich dir den ersten Gang nachservieren. Die Frau Gräfin hat dich schon erwartet.