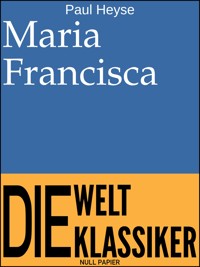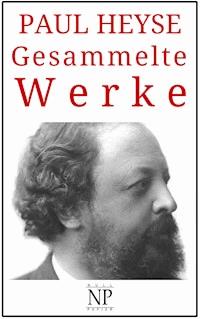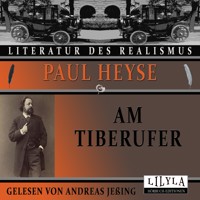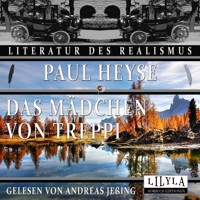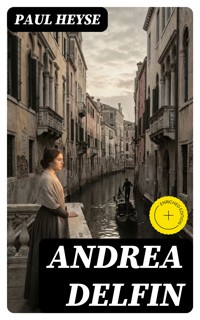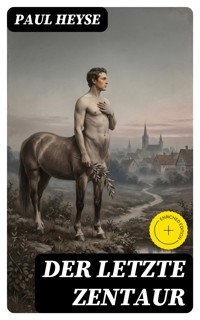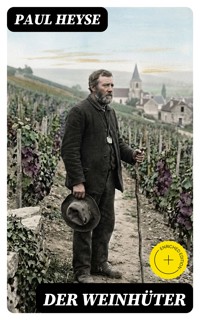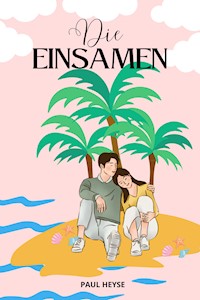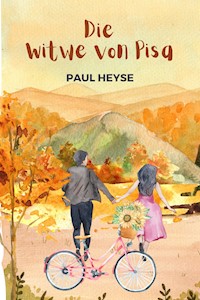Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 99 Welt-Klassiker
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung Paul Johann Ludwig von Heyse (15.03.1830–02.04.1914) war ein deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Übersetzer. Neben vielen Gedichten schuf er rund 180 Novellen, acht Romane und 68 Dramen. Heyse ist bekannt für die "Breite seiner Produktion". Der einflussreiche Münchner "Dichterfürst" unterhielt zahlreiche – nicht nur literarische – Freundschaften und war auch als Gastgeber über die Grenzen seiner Münchner Heimat hinaus berühmt. 1890 glaubte Theodor Fontane, dass Heyse seiner Ära den Namen "geben würde und ein Heysesches Zeitalter" dem Goethes folgen würde. Als erster deutscher Belletristikautor erhielt Heyse 1910 den Nobelpreis für Literatur. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Heyse
Neue Moralische Novellen
Paul Heyse
Neue Moralische Novellen
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962811-82-2
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Jorinde
Getreu bis in den Tod
Die Kaiserin von Spinetta
Das Seeweib
Die Frau Marchesa
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
99 Welt-Klassiker
Der Tee der drei alten Damen
Arme Leute und Der Doppelgänger
Der Vampir
Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde
Der Idiot
Jane Eyre
Effi Briest
Madame Bovary
Ilias & Odyssee
Geschichte des Gil Blas von Santillana
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Widmung
Meinen lieben Freunde Theodor Storm zugeeignet.
Jorinde
(1878)
Vor einem der alten Festungstore der Stadt Augsburg stand noch in den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts ein Häuschen mitten in einem großen, verwilderten Garten, den schon seit Menschengedenken Niemand mehr betreten hatte. Eine hohe Mauer, deren Bewurf von Regen und Schnee zernagt kaum noch hie und da an den Steinen hing, lief in weitem Viereck um das öde Grundstück herum, und nur durch das schwere eiserne Gittertor zwischen den beiden mit Wappenlöwen gekrönten Mittelpfeilern konnte man einen verstohlenen Blick in das Innere werfen. Man sah von dem Häuschen, das nur Ein Stockwerk hatte, nichts als ein Stück des verwitterten Schindeldaches über die Taxushecke hervorragen, die gleich hinter dem Eingang gepflanzt dazu bestimmt schien, neugierige Blicke abzuwehren. Jahr um Jahr wuchs diese Hecke, an der so lange schon keine Gärtnerschere gestutzt hatte, und Jahr um Jahr schien die schwarze Dachlinie des Gartenhäuschens tiefer hinabzusinken, sodass man den Tag kommen sah, wo hinter den rostigen Schnörkeln des alten Tores nur noch eine dunkelgrüne Wildnis zu schauen sein würde.
Eine halb verschollene unheimliche Geschichte knüpfte sich an diesen Garten. Ein vornehmer Herr – nach Anderer Meinung gar ein hoher Kirchenfürst – hatte das Häuschen für eine Dame, die er liebte, bauen und mit allem üppigen Hausrat, wie er in den Lustschlössern der Rokokozeit zu finden war, ausstatten lassen. Die Herrlichkeit sollte nicht lange währen. Der Gemahl – oder war es ein Bruder – der unglücklichen Schönheit, die hier von der Welt vergessen zu werden hoffte, hatte ihren Versteck ausfindig gemacht und mit einem Pistolenschuss seine besudelte Ehre reingewaschen. Seitdem war das Haus unbewohnt geblieben. Es gehe darin um, raunten sich die Leute zu. Einem kleinen Bürger der Stadt hatte der Besitzer die Schlüssel anvertraut, unter der Bedingung, dass er Niemand den Eintritt gestatte. Darüber waren viele Jahre vergangen. Über den Gespenstern der französischen Schreckenszeit hatte man den Spuk in der Nähe vergessen. Doch wirkte das Unheimliche, das jeder Verödung anhaftet, noch immer so stark, dass selbst unter dem Empire, als die Blutscheu auf den großen Schlachtfeldern gründlich erstickt wurde, Niemand sich fand, der Lust gehabt hätte, das so schön gelegene Gartengrundstück zu erwerben und den Motten und Mäusen die Herrschaft in dem verfallenen Häuschen streitig zu machen.
Um so größer war das Erstaunen der gesamten Augsburger Bürgerschaft, als plötzlich die Neuigkeit durch die Stadt lief, das verwunschene Haus sei wieder bewohnt, und zwar von zwei einzelnen Frauenzimmern, einer jungen wunderschönen Person und einer ältlichen, welche die Kammerfrau, Haushälterin, Köchin und Gärtnerin der Jungen vorstelle. Denn außer einem in Augsburg gemieteten Laufmädchen, das die nötigen Einkäufe in der Stadt besorgen und täglich mit einem Körbchen zum Bäcker und Metzger wandern müsse, zeige sich keine menschliche, geschweige männliche Seele im Bereich der gemiedenen Mauern. Der alte Schlüsselbewahrer, den man um Auskunft bestürmte, konnte nichts weiter berichten, als dass vor etlichen Wochen die alte Person ihn mit der Frage angegangen, ob das Häuschen samt dem Garten vermietet werde. Er hatte sich um Instruction für diesen bisher undenkbaren Fall an die Erben des früheren Besitzers gewendet, die gern gegen einen mäßigen Zins ihre Einwilligung gegeben. Dann seien eines Morgens die beiden Frauenzimmer in einem kleinen Wagen vor dem Gittertor erschienen, hätten ein Köfferchen und einige Schachteln vom Kutscher abladen lassen und sofort von dem Hause Besitz ergriffen, das wundersamerweise trotz der langen Vernachlässigung sich noch in ziemlich wohnbarem Zustande gezeigt habe.
Auf seine Frage, wen er denn der Herrschaft als Mieterin zu nennen habe, sei ihm von der Jungen, die dabei ein Paar unglaublich schöner schwarzer Augen so fest auf ihn geheftet, dass er den Blick kaum habe ertragen können, in gutem, nur etwas fremdartigem Deutsch die Antwort geworden, sie heiße Mademoiselle Jorinde La Haine und gedenke jedenfalls Jahr und Tag hier wohnen zu bleiben.
Nach diesen Mitteilungen konnte es nicht fehlen, dass die Neugier, zumal der jungen Welt, zu einem wahren Fieber gesteigert wurde und diese sonst so einsame Gegend des alten Stadtwalles zu allen Stunden des Tages von Spaziergängern zu wimmeln anfing. Ja selbst in der Nacht konnte man junge Bürger aus den anständigsten Familien, die sonst keine Nachtschwärmer waren, das Gittertor hier außen umschleichen und wohl gar, wenn sie sich unbemerkt glaubten, an der bröckligen Mauer hinaufklettern sehen, um in die Taxuswege und zu dem Häuschen hinüberzuspähen. Auch schienen sich alle Dilettanten auf der Guitarre und im Gesang plötzlich verschworen zu haben, ihre Künste vor dem geheimnisvollen Garten zu üben. Es war gerade Sommer und die Nächte warm und duftig, da der Jasmin eben zu blühen begonnen. Wer die Worte, die da gesungen wurden, nicht verstand, konnte sich nach Italien versetzt glauben.
Alles aber blieb verlorene Mühe, und schon begann die Neugier zu erkalten und selbst in den abenteuerlichsten Köpfen die Ahnung zu dämmern, dass es eine große Torheit sei, um eine ewig Unsichtbare sich den Schlaf abzubrechen, als eines schönen Sonntagmorgens, da gerade der Wall von geputzten Kirchgängerinnen und spazierenden jungen Bürgern schwärmte, das eiserne Parktor sich öffnete und die rätselhafte Fremde, begleitet von ihrer Dienerin, heraustrat. Ihre Erscheinung, wie sie die sonnige Straße zwischen ihrem Garten und dem von hohen Bäumen überschatteten Wall mit ruhigen Schritten kreuzte, war so wundersam und wie aus einer fremden Welt, dass das gesamte lustwandelnde Publikum auf Einen Schlag betroffen stillstand, nicht die Jugend allein, sondern auch bejahrte Matronen und ehrwürdige Grauköpfe, die bisher zu allen Erzählungen von der seltsamen Fremden die Achseln gezuckt und gemurmelt hatten: es werde auch an Dieser nicht viel Sauberes sein, gleichwie an ihrer Vorgängerin in dem spukhaften Häuschen. Jetzt standen sie alle mit offenen Augen und Mäulern und starrten der schlanken Gestalt entgegen, wie man Spalier bildet, um irgend eine fürstliche Person ehrerbietig vorbeizulassen. Das Fräulein war in ein schwarzes, sommerliches Gewand gekleidet, das, nach der Mode der Zeit hoch unter der Brust gegürtet, den schönsten jugendlichen Wuchs erkennen ließ, während ein feiner roter Shawl die bloßen Schultern und Arme nur wie ein schmaler Streifen umschlang. Ihr reiches, ganz eigen aufgestecktes Haar war unter einen hohen Strohhut nur notdürftig gebändigt, und eine lose schwarze Locke fiel ihr auf den Busen, den sie, gleichfalls der herrschenden Sitte gemäß, ziemlich frei der Sommerluft preisgab. Statt der Schuhe – und dies war das Einzige, worin sie völlig von der Mode abwich, – trug sie kleine hochrote Saffianpantöffelchen, ohne hohe Hacken, in denen sich ihre schmalen Füße aufs Zierlichste bewegten. Sie schritt, als ob das Gaffen der Menge sie nicht das Mindeste anginge, den Weg zum Wall hinan in einer Haltung, die nicht züchtiger und harmloser hätte sein können, ihre Dienerin in einem ehrbaren grauen Kleide mit großer Haube dicht an ihrer Seite, von Zeit zu Zeit ein Wort an ihr Fräulein richtend, das immer freundlich erwidert wurde. Während sie nun rasch durch die stehen gebliebenen Gruppen hinschritt, konnte die Neugier, die so lange hatte fasten müssen, sich recht an ihrem Anblick sättigen, und man hörte von allen Seiten die bewundernden Ausrufe und geflüsterten Bekenntnisse, dass sie noch weit schöner sei, als man sie sich vorgestellt, ja dass man überhaupt nie und nirgend, außer in Bildern, etwas Ähnliches gesehen habe. Selbst den alten Leuten, deren Blut zahm und schläfrig in den Adern floss, schien sie es wie durch einen Zauber angetan zu haben; sie rühmten in die Wette ihren Anstand, ihre grazienhafte Art, das Haupt auf den schönen Schultern zu tragen, die schlichte Hoheit, womit sie etwa einen Gruß erwiderte, ohne dass je ein Lächeln über ihr Gesicht ging, auch den Geschmack in ihrer wunderlich gewählten Kleidung. Dass die Jugend vollends, die weibliche wie die männliche, von der Fremden ganz erfüllt war und in leidenschaftlichem Eifer, freilich in sehr verschiedenem Sinne, ihr plötzliches Erscheinen besprach, wird Niemand Wunder nehmen.
Sie aber, die Anstifterin dieses Volksaufruhrs, schien von der Wirkung ihrer jungen Reize nicht die geringste Notiz zu nehmen. Sie war an eine Stelle gelangt, wo sie unten in dem breiten Wassergraben, der träge zwischen Wall und Stadtmauer hinschleicht, die Entenhäuschen sehen konnte und die zahlreiche junge Brut, die sich dazwischen auf der schlammigen Welle hin- und hertrieb. Da blieb sie stehen, zog ein Brötchen aus der Tasche und fing an einzelne Brocken den gierigen Vögeln hinunterzuwerfen, die sich sofort nach der Stelle hindrängten, um das seltene Futter sich streitig zu machen. Dies dauerte eine Weile, zu sichtbarer Belustigung der Spenderin. Als aber der Vorrat erschöpft war, winkte sie ihnen nur noch mit ihrer kleinen Hand, die zur Hälfte in einem schwarzseidenen Filethandschuh steckte, gleichsam einen Abschiedsgruß hinunter, zog den roten Shawl, der tief herabgefallen war, wieder um ihre Schultern und trat den Heimweg nach ihrem Garten an, die dichte Zuschauermenge furchtlos durchwandelnd, als wären es eben so viel Sträucher und Bäume.
So verschwand sie hinter ihrem eisernen Parkgitter, das die alte Dienerin sorgfältig mit einem großen rostigen Schlüssel hinter ihnen verschloss.
Von diesem Tage an war die ausländische Demoiselle, wie die älteren Leute sie nannten, oder die schöne Jorinde, wie sie bei der Jugend hieß, durch viele Wochen das Hauptgespräch der guten Stadt, in welcher vor einem halben Jahrhundert noch sehr kleinstädtischer Brauch herrschte. Die jungen und alternden Töchter der guten Bürgershäuser führten dies Gespräch mit verhaltener Gereiztheit, die mehr und mehr in offene Erbitterung ausartete. Väter und Mütter, die anfangs nur daran ein Ärgernis genommen hatten, dass die Fremde nie eine Kirche besuchte, überhaupt die Straßen der Stadt niemals betrat, als ob eine ansteckende Seuche darin umgehe, wurden von diesen feindseligen Gefühlen mit der Zeit ebenfalls ergriffen und fingen ihrerseits an, das schöne Wesen als eine gemeinschädliche Person zu betrachten, ja auch im Stillen auf Mittel zu sinnen, wie man sie aus ihrem stillen Garten vertreiben könnte. Das Alles einzig und allein, weil die gesamte männliche Jugend je länger je unentrinnbarer dem Zauber verfiel, den die Bewohnerin des verwunschenen Häuschens um sich her verbreitete.
Sie erschien, nachdem sie einmal die Schwelle ihrer Gartenpforte überschritten hatte, alltäglich zu der nämlichen Stunde auf dem Wall, um ihren Spaziergang zu machen, meist mit der Alten, zuweilen auch allein. Immer trug sie dasselbe Kleid, den roten Shawl und Strohhut und die Saffianpantöffelchen, und nie wurde an ihr das geringste Schmuckstück bemerkt, außer einem kleinen Kreuz von roten Korallen an einem schwarzen Sammetbande, das die Weiße ihres Halses und Busens nur noch leuchtender hervorhob. In einem Körbchen trug sie regelmäßig das Futter für ihre Pfleglinge unten im Wallgraben und gab sich dieser Beschäftigung so ernsthaft und eifrig hin, als vollbrächte sie damit ein wichtiges Tagewerk. In der Tat sah man sie auch in ihrem Garten, als man später sie dort aufsuchen durfte, nie mit irgend einer weiblichen Arbeit beschäftigt, noch schien sie je ein Buch zu lesen. Gleichwohl konnte man in dem schönen Gesicht nie einen Zug von Langerweile entdecken, wenn auch freilich noch weniger von Munterkeit, wie man bei einem so jungen Wesen, das alle Welt bewunderte, wohl hätte erwarten dürfen. Es war etwas Kaltes, Stilles und doch wieder Kühnes und Trotziges in den kindlich weichen Zügen, und gerade dieser rätselhafte Widerspruch reizte die jungen Leute mehr als das süßeste Lächeln und die zierlichste Gefallsucht anderer glatter Lärvchen. Schon am folgenden Tage fasste sich der reichste und auf seine schöne Figur eitelste junge Herr, der Sohn des Bürgermeisters, ein Herz, die Fremde auf dem Walle anzureden. Sie antwortete ohne jede Verlegenheit, vermied aber auf eine feine Weise, über ihre persönlichen Verhältnisse irgend nähere Auskunft zu geben; nur soviel ließ sie durchblicken, dass sie, von deutschen Eltern geboren, längere Zeit in Frankreich gelebt habe und jetzt ganz allein in der Welt stehe. Auf die Frage, warum sie ein schwarzes Kleid trage, erwiderte sie unverlegen, es sei dies ihr einziger guter Anzug, sie habe eben kein großes Vermögen und müsse an ihrer Garderobe sparen, um sich ohne Schulden durchzubringen.
Als dieses offene Bekenntnis unter den jungen Bürgerssöhnen herumkam, bestärkten sie sich daran in der frechen Hoffnung, an diesem fremden Meerwunder, das sie nun für nicht viel Besseres als eine Abenteurerin hielten, einen bequemen Fang zu machen. Sie sollten aber unsanft enttäuscht werden. Denn so freien Zutritt die Schöne Jedem verstattete, der auf dem Wall sich ihr vorstellte, oder gar die Klingel an dem Parktor zog, um ihr auf ihrem eigenen Grund und Boden eine Visite zu machen, so wenig konnte sich irgend Einer rühmen, auch nur die Spitze ihres kleinen Fingers geküsst zu haben, oder auf eine verwegene Rede ohne die gebührende Abfertigung geblieben zu sein. Jenen Haupthahn im Korbe der jungen Augsburgerinnen, den Sohn des Bürgermeisters, hatte sie sogar ein für allemal von ihrem Antlitz verbannt, weil er in einer vom Wein befeuerten übermütigen Stunde sich unterstanden hatte, den Arm um ihre Hüfte zu legen. Er wagte es, obwohl seine Leidenschaft bis zu völliger Verzweiflung emporloderte, nicht mehr, die Schwelle ihres Gartens zu betreten, während er so viel andere, bescheidnere Bewerber den halben Tag dort aus- und eingehen sah.
Denn es war bald Sitte geworden, gleich nach Mittag der schönen Jorinde seine Cour zu machen, die es auch nicht ungnädig aufzunehmen schien, und deren ernste schwarze Augen immer seltsamer zu blitzen anfingen, je größer der Schwarm verliebter junger Toren ward, der durch die verschlungenen Kieswege um das Häuschen herum, bei der alten, längst verlechzten Fontäne, unter der Trauerweide und bei dem Tempelchen hinten im dichteren Teil des Parks der angebeteten Grausamen nachzog.
In das Innere ihres Hauses ließ sie Niemand. Und jeden Tag, sobald die Sonne hinter den Rand der Fichtenreihe, die das Grundstück nach Westen abgrenzte, zu versinken Miene machte, verabschiedete sie ihren ganzen Hofstaat, und die alte Dienerin musste warten, bis der Letzte hinaus war, um das Parktor hinter ihm wieder zu verschließen. Dass Keiner aus der Schar sich heimlich in einem Schlupfwinkel verbarg, um, wenn die Andern gegangen, die Früchte seiner Kriegslist zu ernten, dafür sorgte die Eifersucht Aller, die eine genaue Liste über jeden Mitbewerber führte.
Auch die Hoffnung, vielleicht durch die Alte etwas zu erreichen, und wär’ es zunächst nur eine genauere Kunde über das frühere Leben des Fräuleins, ihr Herkommen und warum sie sich gerade Augsburg zum Aufenthalt erwählt, auch diese Hoffnung erwies sich als eitel. Geld, das man der Alten geboten, hatte diese mürrisch und verächtlich zurückgewiesen. Dagegen war es um so sonderbarer, dass Jorinde selbst Geschenke, die man ihr zuerst nur höchst schüchterner Weise darzubringen gewagt, durchaus nicht abgelehnt, freilich auch kaum mit mehr als einem trocknen Wort gedankt hatte. Sie sagte, als dies zum ersten Male geschah, sie selbst habe keine Freude am Besitz, doch wisse sie arme Leute genug, denen es zu Gute kommen würde, wenn sie die Augsburger Goldfasanen ein wenig rupfte. Möglich auch, dass sie, wenn sie einen rechten Schatz beisammen hätte, eine Kirche oder Kapelle davon gründen würde. Nur kein Kloster, dessen Äbtissin sie selbst werden möchte! riefen einige der Jünglinge scherzend. O nein, sagte sie ganz ruhig, zum Klosterleben fühle sie einstweilen nicht den geringsten Beruf. Sie habe fürs Erste eine andere Mission zu erfüllen. Gefragt, worin diese bestehe, verstummte sie, und ihr Gesicht verfinsterte sich fast unheimlich. Dann aber fing sie gleich wieder an zu singen, eine leichtmütige französische Chanson oder ein trübsinniges deutsches Volkslied, und ihre Stimme, obwohl weder stark noch geübt, vollendete den märchenhaften Zauber, den ihr fremdes und widerspruchsvolles Wesen auf jedes Mannsbild auszuüben wusste.
Jene Äußerung nun war das Signal zu einer wetteifernden Bemühung um ihre Gunst durch kostbare Geschenke. Jeder wollte, wie er sagte, zur Gründung ihrer Kapelle seinen Baustein herbeitragen. Alles aber, Juwelen, kostbare Stoffe und Geräte, seltene Schaumünzen und was die Söhne der reichen Handelsherren irgend Ausgesuchtes aus der Ferne verschreiben mochten, häufte die Herrin des Häuschens in einem eigenen Zimmer zusammen und führte zuweilen ihren jungen Hofstaat an das Fenster, um den milden Stiftern zu zeigen, dass Alles wohl aufgehoben sei. Sie selbst trug nie weder eins der teuren Geschmeide, noch kleidete sie sich in den Sammet und die golddurchwirkte Seide, schien vielmehr diese ihre Schatzkammer nicht höher zu achten, als ob darin ein Haufen dürren Laubes aufgeschichtet läge. Eine besondere Freude schien ihr überhaupt Nichts auf der Welt zu machen, und selbst wenn sie einmal lachte, klang es unfroh und verstimmt, wie ein Instrument, das lange nicht gespielt seinen harmonischen Klang verloren hat.
Es konnte nicht fehlen, dass die Erbitterung gegen ein so gefährliches Wesen bei Allen, die nicht von Leidenschaft zu ihr verblendet waren, immer drohender heranwuchs. Mehr als Ein Brautstand war durch die fremde Hexe, wie sie nun hieß, zerrüttet, mehr als Ein wackerer Muttersohn seinem Geschäft und rührigen Erwerb abtrünnig gemacht worden, Dieser in Schulden gestürzt, Jener mit Vater und Mutter entzweit, und wenn noch kein Blut geflossen war unter den Rivalen selbst, da sie alle in gleicher Hoffnungslosigkeit hinschmachteten, so fingen doch einige Brüder von Patrizierbräuten an, Händel mit ihren künftigen Schwägern zu suchen, die gleichfalls sich dem verzauberten Schwarm zugesellt hatten, und ein Ehrsamer Rat der Stadt hielt allen Ernstes im Stillen eine Sitzung, ob nicht Mittel zu finden seien, dieser Stadtplage auf gute und gesetzliche Manier loszuwerden. Es kam aber zu Nichts, weil einige der jüngeren Ratsherren selbst von der Schlange gebissen waren und mit allem juristischen Scharfsinn nachwiesen, dass sich kein Paragraf ihres Stadtrechtes auf diesen unerhörten Fall anwenden lasse. So gärte die leidenschaftlichste Aufregung, Hass, Liebe, Furcht und Neid in dunklem Gemisch Woche um Woche fort, nicht anders als ob man in die fabelhaften Zeiten zurückgekehrt wäre, wo hie und da ein Lindwurm, eine böse Schlange oder sonst ein reißendes Ungeheuer eine Stadt oder Insel in Kontribution gesetzt hatte.
Da geschah Etwas, das der ganzen Welt die Augen darüber öffnen musste, wie groß die Gefahr und wie dringend geboten eine rasche Abwehr sei.
Unter Denen, die wie verblendete Motten um das Licht der fremden Schönheit schwirrten, befand sich Einer, dem Niemand je zugetraut hatte, dass er einer leidenschaftlichen Torheit fähig wäre: ein junger Kaufmann, der die Dreißig schon erreicht, steif und nüchtern, ganz nur auf sein Geschäft bedacht, das er in großen Flor gebracht hatte, allen jugendlichen Lüsten und Liebhabereien abgekehrt und in der Stadt für einen ausgemachten Weiberfeind geltend. Sein Name war Georg Haslach, und er führte das Geschäft unter der Firma und mit dem Gelde eines früh verstorbenen Oheims, der in jungen Jahren sich durch die leichtsinnige Verbindung mit einer schönen Magd einen üblen Ruf gemacht hatte, dann aber, nachdem er diese ungleiche Ehe gelöst und eine der reichsten Patriziertöchter heimgeführt hatte, bei der gestrengen reichsbürgerlichen Gesellschaft wieder zu Gnaden aufgenommen worden war. Seinen Neffen Georg und dessen Bruder Walter hatte er zu Erben eingesetzt. Der Letztere, der zugleich mit dem noch lebenden alten Vater in der österreichischen Armee diente, war dem älteren Bruder durchaus unähnlich, ein ungebunden schwärmendes und schweifendes Reiterblut, übrigens bei Jung und Alt trotz seiner wilden Sitten besser gelitten als der rechtfertige, trockene Georg, der doch den Kredit und Wohlstand des Hauses Haslach mit rastloser Arbeit aufrecht erhielt. Auch dankte der Biedermann im Stillen Gott, dass sein Bruder fern bei der Armee war, als das erste Gerücht von der gefährlichen Sirene durch die Stadt lief. Aber sein tugendstolzer Hochmut sollte desto schmählicher zu Falle kommen. Er war der Fremden kaum einmal auf dem Walle begegnet, wohin er mit dem Vorsatz gegangen war, sie durch einen verachtungsvollen Blick zu beleidigen, als er selber, nur gestreift von ihrem gleichgültigen schwarzen Auge, rettungslos sich in ihrem Netz gefangen fühlte.
Statt sie zu demütigen, musste er nun selbst die nicht geringe Schmach erleiden, als er das erste Mal sich ihrem Hofstaat beigesellte, von den übrigen Schicksalsgenossen, die sonst alle Ursache hatten, sich unter einander zu schonen, mit grausamer Schadenfreude begrüßt und der jungen Dame unter anzüglichen Stichelreden als das interessanteste ihrer Opfer vorgestellt zu werden. Jorinde empfing ihn nicht anders wie jeden Andern. Nur als sie seinen Namen hörte, blitzte etwas wie eine stolze Genugtuung über ihre Lippen, und sie schien ihm in so fern einen Vorzug vor den Anderen zu gönnen, dass sie ihn mit noch schneidenderer Kälte behandelte, als alle seine Rivalen.
Er selbst nahm ihre Geringschätzung hin wie ein Schicksal und machte, seiner steifen und unweltmännischen Natur gemäß, keinerlei Anstrengung, unter den glänzenderen Bewerbern sich vorzudrängen. Im Stillen aber hoffte er dennoch, durch unsinnige Kostbarkeiten, die er ihr schickte, und durch wiederholte Briefe, in denen er ihr seine Hand anbot und sich und sein ganzes Vermögen ihr zu Füßen legte, mit der Zeit allen Andern den Rang abzulaufen.
Sie nahm sich kaum die Mühe, wenn er wieder vor ihr erschien, nur mit einem flüchtigen Wort den Empfang der Briefe und Geschenke zu bescheinigen, sodass sich ihm der Stachel immer tiefer ins Herz wühlte. Und einmal, da er es durchgesetzt hatte, sie allein zu treffen, übermannte ihn seine jammervolle Leidenschaft dergestalt, dass er sie in heftiger Rede um eine Antwort bestürmte, ob sie ihm Hoffnung machen könne oder nicht, jemals die Seine zu werden. Tod oder Leben hänge an ihrer Entscheidung.
Sie erwiderte mit ihrer gelassensten Miene, während doch ihre Stimme von verhaltener Erregung bebte: sein Tod oder sein Leben habe nicht den geringsten Wert für sie. Sie sei noch überhaupt nicht Willens, ihre Freiheit aufzugeben. Wenn es aber geschehe, werde sie lieber dem lahmen Bettler, der täglich an ihrem Gittertor seinen Kreuzer hole, ihre Hand reichen, als Herrn Georg Haslach.
Und als er darauf mit mühsamer Stimme, bleich wie die getünchte Wand ihres Häuschens, die Drohung hinwarf, sie werde dies Wort bereuen, wenn er um ihretwillen das Leben hingeworfen wie einen Beutel, aus dem ein Bankerottierer1 den letzten Gulden ausgezahlt, lachte sie kalt: ihr sei nicht bange, dass ein Haslach aus Liebe sterben könne, es sei denn aus hoffnungsloser Sehnsucht nach einer Million, die er nicht zu erlangen vermöge.
Am folgenden Morgen, als die alte Dienerin die vordere Tür des Häuschens, die auf einen kleinen Portikus zwischen zwei verschnörkelten Säulen hinausging, ihrer Gewohnheit nach öffnen wollte, konnte sie nicht damit zu Stande kommen, da etwas Schweres sich dagegen stemmte. Verwundert musste sie zur Hintertür hinaus und um das Haus herumgehen. Da sah sie eine Mannesgestalt in der kleinen Vorhalle sitzen, am Boden hingekauert und gegen die Tür gelehnt, und glaubte, da trotz der Sommerzeit ein grauer Mantel mit kurzem Krügelchen und der tief über die Augen gedrückte Hut das Gesicht verbarg, irgend ein Anbeter habe zu Nacht im Rausch der Hoffnungslosigkeit oder des Weines die Gartenmauer überstiegen, um vor der Schwelle seiner harten Herrin den Tag zu erwarten. Wie sie aber hinzueilte, den Schläfer wachzurütteln, erkannte sie mit Entsetzen Herrn Georg Haslach’s entfärbtes und vom Tode verzerrtes Gesicht. In der starren Hand hielt er ein leeres Fläschchen, darin noch einige Tropfen einer braunen Flüssigkeit, die deutlich verrieten, was hier geschehen war.
Wenn der eherne Herkules von seinem Brunnen in der Hauptstraße herabgestiegen wäre und die Treppen des Rathauses hinanschreitend die Tür zum goldnen Saal mit seiner Keule gesprengt hätte, – es hätte die Stadt kaum in helleren Aufruhr und tieferes Grauen versetzen können, als die Nachricht von diesem schauderhaften Ende eines so stillen und achtbaren Mitbürgers. Noch lange, nachdem der Leichnam hinweg und in das Haslach-Haus auf einer eilig errichteten Tragbahre geschafft, die herzudrängende Menge des geringeren Volkes wieder hinausgewiesen und das eiserne Gittertor fest verschlossen war, stand die Straße, die an Jorindens Garten vorbeilief, Kopf an Kopf gefüllt von einem unheimlich gärenden Gewühl, aus dem sich dann und wann Arme und Hände deutend und drohend gegen das Innere des verschlossenen Bezirkes reckten und Stimmen laut wurden, die nur durch den Machtspruch einiger bewaffneter Polizeidiener sich wieder beschwichtigen ließen. Wären die Zeiten der Hexenprozesse nicht vorbei gewesen, so hätte sich das grauenvoll aufgereizte Volksgemüt unzweifelhaft zu den wildesten Gewalttaten fortreißen lassen.
Gegen Mittag erschienen Abgesandte vom Justizamt, die mit der Bewohnerin des Gartenhauses ein Verhör anstellten und ein weitläufiges Protokoll aufnahmen. Sie berichteten hernach, dass sie das Fräulein in ganz unerschütterter Fassung, von dem furchtbaren Vorfall scheinbar unberührt gefunden hätten, und da ihre völlige Schuldlosigkeit aus allen Zeugnissen hervorging, fehlte auch fürs Erste den Vätern der Stadt jede Handhabe, um gegen sie einzuschreiten und ihre Verweisung aus dem Stadtgebiet anzuordnen.
Auch war zunächst dasjenige von selbst erreicht, was die besorgten Mütter und die schwer gekränkten Töchter der Stadt aufs Dringendste gewünscht hatten: auf Einen Schlag war das Gefolge der unheimlichen Fremden zersprengt und zerstoben. Von all den jungen Toren, die sich jeden Nachmittag in dem Zaubergarten dieser Circe eingefunden, wagte sich keiner mehr über die Schwelle des Parkgitters, die Einen von dem Grauen, das hier seinen Einzug gehalten, zurückgebannt, die Anderen nur aus Furcht, von dem Volk, das sich draußen wie zu einer freiwilligen Wache hin und her trieb, geschmäht oder gar handgreiflich fortgewiesen zu werden.
Man hatte Vater und Bruder des Unglücklichen sofort benachrichtigt, konnte aber die Bestattung, die ohnehin bei der frevelhaften Art dieses Todes ohne jede Feier bleiben musste, nicht so lange hinausschieben, bis die beiden nächsten und einzigen Verwandten in der Stadt eingetroffen wären. Sie hatten eine Reise von mehreren Tagen zu machen, und obwohl sie unterwegs täglich die Pferde wechselten, langten sie doch erst in ihrem Hause zu Augsburg an, als das Grab an der Kirchhofsmauer schon eine Woche lang mit flachem Rasen zugedeckt war. Nichts fanden sie von dem kläglich verlorenen Sohn und Bruder, als den Anzug, den er in jener Todesnacht getragen, seinen grauen Mantel und Hut und einen kurzen Brief, worin er ihnen ein verzweifeltes Lebewohl sagte.
Der alte Oberst, ein weißhaariger, harter Soldat, den Niemand je hatte weinen sehen, brach beim Anblick dieser Überbleibsel wie ein geknicktes Rohr zusammen und verschloss sich, als er seine Mannheit wiedergefunden, in seinem Schlafzimmer, wo die ganze Nacht das Licht brannte und der sporenklirrende Schritt des Alten ruhelos über die Dielen klang. Dem jungen Sohn leistete einer seiner früheren Kameraden und Schulgenossen eine tröstliche Gesellschaft, wobei ihm Alles mitgeteilt wurde, was die Stadtchronik über das Unglück und seine Urheberin bisher verzeichnet hatte. Die Brüder hatten sich nie sehr nahe gestanden. Gemütsart und Beruf hielten sie in einer kühlen, wenn auch nicht unfreundlichen Entfernung von einander. Jetzt aber schien es dem Überlebenden, als hätte ihn kein größerer Verlust treffen können, als müsse er alle versäumte brüderliche Liebe und Zärtlichkeit gegen den Toten mit doppelter Innigkeit nachholen. Doch als der Freund um Mitternacht den jungen Kapitän verließ, fielen diesem vor Erschöpfung durch den hastigen Ritt und die bittere Trauer alsbald die Augen zu, und er erwachte spät aus sonderbaren Träumen, in denen ihm die Gestalt seines Bruders und einer teuflischen Schönheit, die ihm nach dem Leben stand, in den mannigfachsten Bildern und Szenen vorübergegangen war.
Gegen Mittag, als eine stechende Gewittersonne die Straße vor Jorindens Garten öde machte, sahen die wenigen Menschen, die im Schutz der Wallbäume vorbeischlenderten, mit großem Erstaunen einen jungen Mann in österreichischer Uniform sich nähern und mit aufgeregten Schritten auf das eiserne Gitter zueilen. Er riss so heftig an dem Glockenzug, dass die lange stumm gebliebene Klingel gellend durch die stille Luft tönte. Als nicht sogleich Jemand kam, um das Tor zu öffnen, läutete er von Neuem, indem er den Hut abnahm und sich den Schweiß von der Stirn trocknete, die Augen finster und scheu zu Boden geheftet, als fürchte er irgend Wem ins Gesicht zu sehen, der ihn fragen könnte, wie er es übers Herz brächte, dieser Schwelle zu nahen.
Endlich erschien die alte Dienerin, den Schlüssel in der Hand, und als sie den Unbekannten draußen stehen sah und seine wunderlich verstörte Miene gewahrte, fragte sie durch die Eisenstäbe hindurch, was er wünsche. – Mit ihrer Herrin zu sprechen. – Das Fräulein habe noch nicht Toilette gemacht, er möge sich nach Tisch wieder herbemühen. – Er sei nicht gekommen, die Reize ihres Fräuleins zu bewundern, gab der junge Mann barsch zur Antwort, sondern um über ein Geschäft mit ihr zu verhandeln. – Wen sie zu melden habe? fragte die Alte wieder nach einigem Zögern. – Der Name tue nichts zur Sache; er werde sich dem Fräulein selbst vorstellen.
Die Alte schloss nach einigem Besinnen kopfschüttelnd das Gitter auf und führte den düster blickenden Besucher durch die sonneglitzernden Kieswege des Gartens dem Hause zu. Als er die kleine Vorhalle mit den geschnörkelten Säulen erblickte, wo sein Bruder vor wenigen Tagen seine letzte Nachtruhe gehalten, überlief ihn ein Schauder, er wandte sich ab und presste die Lippen zusammen, wie um einen Seufzer oder eine Verwünschung zu ersticken. Während die Dienerin ins Haus ging, ihn zu melden, warf er sich in tiefer Erschöpfung auf ein Bänkchen neben einer hohen Taxuswand und fuhr sich mit der Hand über die Augen, aus denen schwere Tropfen rollten. Er biss die Zähne in sein Schnupftuch, und seine schwer arbeitende Brust verriet, dass ein schluchzender Krampf ihn erschütterte. Plötzlich hörte er leichte Schritte vom Hause her, kämpfte seine Bewegung gewaltsam nieder und erhob sich, um mit dem Aufgebot all seines Muts der verhassten Erscheinung die Stirn zu bieten.
Was er aber sah, widersprach so völlig Dem, was er zu sehen erwartet hatte, dass das Erstaunen zunächst alle anderen Empfindungen seines Innern niederschlug.
Statt einer kaltsinnigen Verführerin, die mit aller Schlangenkunst der Gefallsucht jedem neuen Besucher entgegentritt, stand eine bescheidene junge Gestalt vor ihm, in ein schlichtes, fast ärmliches Morgengewand gekleidet, die Arme nur bis zu den Ellenbogen entblößt, die reichen Haare kunstlos aufgesteckt, das ernste, blasse Gesicht durch einen kleinen leinenen Sonnenschirm gegen die Mittagsglut geschützt. Als sie die großen schwarzen Augen unter breiten Lidern müde und teilnahmslos auf ihn heftete und mit einer sanften Stimme nach seinem Begehren fragte, war plötzlich jedes Wort der heftigen Rede aus seinem Gedächtnis; verlöscht, mit der er sich der Mörderin seines Bruders vorzustellen gedacht hatte.
Doch besann er sich endlich, ließ die Augen, gleichsam um sich gegen diese stille Gewalt zu waffnen, wieder nach dem Portikus schweifen und sagte dann mit dem schärfsten Ton, dessen er fähig war:
Sie sind die Herrin dieses unglücklichen Hauses, Mademoiselle?
Ein leichtes Kopfnicken war die ganze Antwort.
Ich bin gekommen, fuhr er fort, Ihnen ein Handelsgeschäft zu proponieren. Es ist dazu nötig, dass Sie meinen Namen kennen. Ich bin der Kapitän Walter Haslach, Bruder jenes Unglücklichen –
Sie trat einen Schritt zurück, ihre ohnehin bleiche Wange war totenfahl geworden, einen Augenblick schien sie zu wanken oder hinwegflüchten zu wollen, fasste sich aber sogleich und sagte, während ein tiefer Seufzer ihren jungen Busen hob:
O wie beklage ich Sie – und ihn – und mich!
Dann verstummte sie wieder. Er hatte schon ein schneidendes Wort verächtlichen Hohns auf der Lippe, um sich jedes geheuchelte Beileid zu verbitten. Aber das Wort versagte ihm. Ein Ausdruck wahren Schmerzes lag in Ton und Blick und Gebärde des schönen Wesens, dem er sich nicht entziehen konnte.
Ich weiß nicht, was man Ihnen von mir gesagt haben mag, fing sie endlich mit einer seltsamen Hast wieder zu reden an. Man wird mich als ein fluchwürdiges Ungeheuer dargestellt haben, und in Ihren Augen werde ich es wohl immer bleiben, obwohl ich, so wahr mir Gott helfe! an diesem Unglück keinen Teil habe. Nie habe ich Ihrem Bruder die geringste Hoffnung gemacht, nie seine Bewerbung um mich begünstigt. Weshalb ich überhaupt – aber wozu verschwende ich meine Worte? Sie hören mich nicht, am wenigsten, wenn ich mein Betragen zu rechtfertigen versuchte. Wohl ist es wahr – und auch das mögen Sie erfahren: ich habe dem Toten nie etwas Gutes gewünscht. Warum? Das ist ein Geheimnis; zwischen meinem Schöpfer und mir. Sein klägliches Ende aber war nicht mein Wunsch, so wenig wie mein Werk. Ich dachte, ein Haslach sei ewig schon durch den Geist seiner edlen Familie vor einem so raschen, unseligen Schritt geschützt. Es ist nun geschehen, wie überhaupt Unglück in der Welt geschieht Ich kann es beklagen, aber wenn Sie gekommen sind, es mir ins Gewissen zu schieben, so erkläre ich Ihnen offen und ehrlich, dass ich keinerlei Reue zu empfinden vermag. Und somit –
Sie trat wieder einen Schritt zurück, als ob sie das Gespräch zu enden wünsche. Er hatte, während sie sprach, den Blick nicht von ihr verwandt, aber seine düster gespannte Miene ließ es ungewiss, ob er ihren Worten gefolgt war.
Mademoiselle, sagte er jetzt und senkte die Augen in plötzlicher Verwirrung, ich bin nicht gekommen – seien Sie überzeugt, dass ich bis auf einen gewissen Grad meinem armen Bruder nachfühlen kann, – ich gestehe, dass die Vorstellung, die ich mir von Ihnen gemacht hatte –
Er stockte. Das Blut schoss ihm in die schönen, wettergebräunten Wangen. Er ballte die Faust krampfhaft um seinen Degengriff, als ob er sich seiner Mannes- und Bruderpflicht erinnern wollte, hier nur das zu sprechen, was streng mit seinem Geschäft zu vereinigen war, und sich schämte, dass er sich von dieser sanften Stimme halb und halb hatte entwaffnen lassen.
Ich komme nicht aus eigenem Antrieb, brach es endlich rau und kalt von seinen Lippen. Mein Vater hat mich geschickt –
Ihr Vater! Ah! er ist hier? –
Ihr Gesicht, während sie dies sagte, nahm wieder seinen herben, unguten Ausdruck an.
Mein Vater – hat unter dem Nachlass des Toten etwas vermisst, was ihm sehr wert ist, einen Ring, der in der Familie seit mehr als hundert Jahren immer auf den ältesten Sohn fortgeerbt hat, einen Rubin in Diamanten gefasst. Da es bekannt ist, Mademoiselle, – dass Sie Liebhaberin von Juwelen sind – dass Sie eine Sammlung von Kostbarkeiten angelegt haben – (er betonte das Wort mit neu aufwallender Feindseligkeit) – so glaubt mein Vater nicht fehl zu gehen – auch diesen Ring jetzt in Ihrem Besitz vermuten zu dürfen. Ich weiß nicht, Mademoiselle, –
Jetzt erst heftete er die Augen wieder auf ihr Gesicht und begegnete einem kalten, stolzen Blick, den er mit Mühe ertrug.
Es kann sein. Ich glaube sogar mich bestimmt zu erinnern, dass auf diesen Ring einmal die Rede kam; die andern Herren fragten ihn darnach, er sagte, dass es ein Familienstück sei, und zog ihn vom Finger, mich ihn betrachten zu lassen. Ich gab ihn zurück ohne jede Bemerkung. Desselben Tages sandte er mir ein elfenbeinernes Kästchen mit verschiedenem Geschmeide, darunter auch diesen Ring, den ich eben so wie alles Übrige bei Seite tat. Er steht Ihnen jeden Augenblick wieder zu Dienst.
Mein Vater wird sich beeilen, Ihnen den dreifachen Wert in Gold dagegen zu senden! warf der Jüngling trotzig hin, indem er sich verneigte.
Sagen Sie Ihrem Vater, dass ich keinen Handel mit Juwelen treibe. Ihr Vater ist zwar Offizier, aber da er einem alten Kaufmannshause entstammt, ist er gewiss nicht gleichgültig gegen Gold und Gut, und dieser Ring wird darum nichts in seiner Schätzung verlieren, wenn ich mir jeden Preis dafür verbitte. Folgen Sie mir. Sie können ihn sofort in Empfang nehmen.
Sie wandte sich mit der kältesten Gebärde dem Hause zu und ging ihm rasch voran. Im höchsten Erstaunen hatte er sie reden hören, selbst das Beleidigende in ihren Worten erfüllte ihn mehr mit geheimer Achtung und Bewunderung, als mit Unmut. Keines Wortes mächtig, gesenkten Hauptes, wie in einer traumhaften Betäubung schritt er hinter ihr her.
Als sie das Haus erreicht hatte, blieb sie stehen und wandte sich nach ihm um.
Sie sind der erste Mann, der diese Schwelle überschreitet, sagte sie. Ich weiß nicht, wie ich dazu komme, mit Ihnen eine Ausnahme zu machen, die mich vielleicht in Ihren Augen herabsetzt. Aber es ist nun Alles gleich. Treten Sie ein.
Er betrat das kleine Gemach, in welchem der viel berufene »Schatz« Jorindens aufgespeichert lag. Es war ein zierlicher Raum mit verblichener mattblauer Seidentapete und schmalen Spiegeln rings an den Wänden. Auf einem Rokokotisch in der Mitte standen schöne Geräte, Uhren, Vasen, Kandelaber, wie in einem Basar; ein großer Schrank mit halb offenen Türen enthielt Stoffe und Stickereien, Spitzen und kostbare Fächer. Ein kleineres Möbel mit eingelegter Holzarbeit und vergoldeten Rokokogriffen schien bloß für die Aufbewahrung von Schmucksachen bestimmt. Zu diesem ging das Fräulein und zog ein Schubfach nach dem andern heraus. Er beobachtete sie dabei. Keine Miene verriet irgend eine Freude an diesem Besitz. Mit einer Art verächtlicher Unordnung waren Kästchen, Etuis und lose Ketten und Spangen über einander gehäuft. Sie wühlte darin herum, ihre Wangen röteten sich, da sie immer noch das Gesuchte nicht fand. Endlich schob sie das letzte Fach wieder hinein und sagte:
Ich bin zu aufgeregt, um jetzt ordentlich zu suchen. Der Ring ist sicher vorhanden, beruhigen Sie sich darüber. Ich will Sie nicht länger aufhalten, ich begreife, dass Ihnen hier der Boden unter den Füßen brennt. Aber mein Wort darauf, heut Abend haben Sie den Ring. Ich sende ihn durch eine zuverlässige Person in Ihr Haus.
Er sah, dass sie ihn verabschiedete. Dennoch zögerte er noch einen Augenblick.
Erlauben Sie mir, heute Abend noch einmal selbst vorzusprechen und den Ring aus Ihrer Hand in Empfang zu nehmen?
Wie Sie wollen. Ich dachte Ihnen ein peinliches Wiedersehen zu ersparen. Aber wie es Ihnen lieber ist.
Sie neigte den Kopf unmerklich gegen ihn, er machte eine linkische Verbeugung und verließ das Haus.
Als die alte Dienerin, die ihm das Parktor wieder geöffnet hatte, zu ihrem Fräulein zurückkehrte, stand diese noch unbeweglich auf derselben Stelle, wo der junge Kapitän sie verlassen.
Du bist es, Anne! sagte sie mit einem Seufzer. Ist er fort?
Die Alte nickte. Wer war der Herr?
Sein Bruder! Walter Haslach! Sollte man’s für möglich halten? – Ach, Anne, ich gäbe alles Gold der Welt darum, wenn er dem Toten ähnlich sähe!
In tiefster Verworrenheit war der Jüngling fortgestürmt. Stundenlang rannte er durch die einsamsten Feldwege rings um die Stadt und wich allen Menschengesichtern aus. Als er sich endlich besann, dass der Vater auf ihn warte, erschrak er. Aber als Soldat an Gehorsam und Selbstverleugnung gewöhnt, schlug er, ermattet wie von einem langen, blutigen Kampf, den Weg nach der Stadt wieder ein und schlich, die Augen zu Boden gesenkt, die Glieder mühsam regierend, durch die abgelegensten Gassen seinem väterlichen Hause zu.