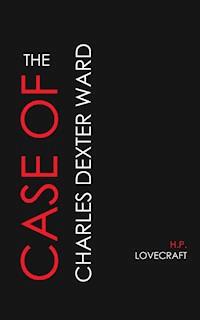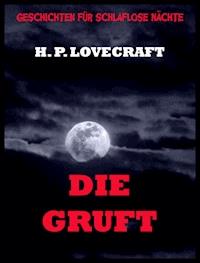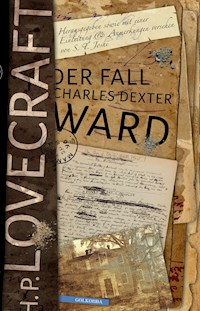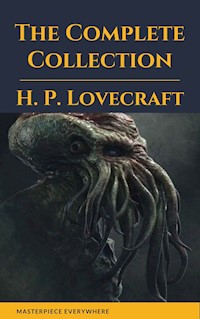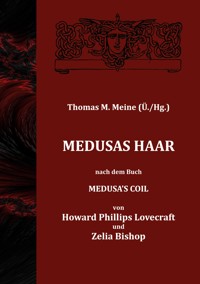Cthulhus Ruf. Die besten Horrorgeschichten (u.a. mit »Cthulhus Ruf«, »Ding auf der Schwelle«, »Pickmans Modell«) E-Book
H. P. Lovecraft
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Cabra-Leder-Reihe
- Sprache: Deutsch
Lemurische Wesen der Unterwelt mit blutigen Riten, leichenverzehrende Dämonen, Monstren, die »in unbestimmten Bereichen und Dimensionen außerhalb unseres stofflichen Universums leben« – sie bevölkern die so verstiegene wie faszinierende Welt des H. P. Lovecraft. Unaufhaltsam schürt der frühe Meister der Horrorliteratur die Angst vor dem Unbekannten und Bedrohlichen und löst bei seinen Lesern blankes Entsetzen und wohlige Schauer aus. In dieser Sammlung sind einige seiner berühmtesten Erzählungen versammelt: »Cthulhus Ruf«, »Das Grauen von Dunwich«, »Die Farbe aus dem All«, »Das Ding auf der Schwelle« und viele mehr.
- »Der größte Horror-Autor des 20. Jahrhunderts ist H. P. Lovecraft, daran gibt es keinen Zweifel.« Stephen King
- Neuübersetzung und Vorwort von Dr. Florian F. Marzin
- Prägend für Film, Kunst und Literatur: »Alien«, John Carpenters »Das Ding aus einer anderen Welt«. Autor*innen Neil Gaiman, Wolfgang Hohlbein, Stephen King, Clive Barker und sogar ein Arno Schmidt
- Lovecraft ist überall: Ob im Computerspiel oder bei Brett- und Escape-Spielen, der Mythos Lovecraft lebt!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
H. P. Lovecraft
Cthulhus Ruf
Die besten Horrorgeschichten
Aus dem Englischen übersetzt undmit einem Vorwort von Florian F. Marzin
Anaconda
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und
enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte
Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung
durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung
oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in
elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und
zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Diese Publikation enthält Links auf Webseiten Dritter,für deren Inhalt wir keine Haftung übernehmen, da wir unsdiese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Standzum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlichgeschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- undData-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jeglicheunbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sindim Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2024 by Anaconda Verlag, einem Unternehmender Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagmotive: Adobe Stock, Christos Georghiou (Cthulhu);Maryam Hamila (Rahmen)
Umschlaggestaltung: Druckfrei. Dagmar Herrmann, Bad Honnef
Satz und Layout: InterMedia – Lemke e. K., Heiligenhaus
ISBN 978-3-641-32439-1V001
www.anacondaverlag.de
Inhalt
Vorwort: Der große Träumer aus Providence
Die Aussage des Randolph Carter
Die Musik des Erich Zann
Die Ratten im Gemäuer
In der Gruft
Pickmans Modell
Cthulhus Ruf
Die Farbe aus dem All
Das Grauen von Dunwich
Der Schatten über Innsmouth
Das Ding auf der Schwelle
Quellenverzeichnis
Vorwort: Der große Träumer aus Providence
Als Howard Phillips Lovecraft am 15. März 1937 starb, kannten nur wenige sein Werk. Die meisten von Lovecrafts Erzählungen erschienen als Heftpublikationen in den oft genannten Pulp-Magazinen wie z. B. Weird Tales. Einzig seine Geschichte Schatten über Innsmouth ist zu seinen Lebzeiten (1936) als Buch veröffentlicht worden. Beachtet wurden die Werke von Lovecraft erst, als seine Erzählungen, in Sammelbänden zusammengefasst, zu Beginn der Vierzigerjahre des letzten Jahrhunderts auf das nimmermüde Betreiben von Arthur Derleth und Donald Wandrei hin vom eigens dafür gegründeten Verlag Arkham House herausgegeben wurden. Dabei ist besonders Derleths Rolle nicht unumstritten, denn er hat sich aus Lovecrafts Nachlass bedient, um nach dessen Ideen eigene Erzählungen in Lovecrafts Manier zu schreiben. Besonders in dem Band Auf Cthulhus Spur spinnt er ein wesentliches Element aus Lovecrafts Schaffen weiter.
Über das schriftstellerische Werk, seine Verbreitung, die Reaktionen, die von höchstem Lob bis zu grimmiger Ablehnung reichen, und seine immense Renaissance – besonders in Deutschland – ein Wort zu verlieren, hieße »Verfall nach Arkham tragen«.
H. P. Lovecraft, geboren am 20. August 1890 in Providence, Rhode Island, erhielt, bedingt durch seine angeschlagene Gesundheit, nie eine ordentliche Schulbildung. Als Erwachsener führte er ein zurückgezogenes Leben, begab sich selten in die Öffentlichkeit, hielt seine literarischen Ergüsse stets für zu schlecht, um veröffentlicht zu werden, pflegte aber umfangreiche Briefkontakte und war als Ghostwriter und Lektor/Bearbeiter für andere Autoren tätig. Zum Beispiel hat er die Erzählung Gefangen bei den Pharaonen für Harry Houdini geschrieben.
Lovecrafts eigenes schriftstellerisches Werk ist in sich stark zerrissen und beschränkt sich bei Weitem nicht auf das, was man oberflächlich damit verbindet. Es gibt darin philosophische Traktate, Beschreibungen eines antik-griechisch anmutenden Arkadien und Traumstücke. Sein verwirrendstes und längstes Werk allerdings ist Die Traumsuche nach dem unbekannten Kadath, in dem Randolph Carter, das Alter Ego des Autors, durch eine mystische Welt des Traums irrt, ohne jemals sein Ziel zu erreichen. Diese Welt hat Lovecraft dann in einigen weiteren, kürzeren Erzählungen (Die Katzen von Ulthar, Der silberne Schlüssel) wieder aufleben lassen.
Am Anfang seiner schriftstellerischen Tätigkeit schrieb Lovecraft klassische Horrorgeschichten, die sehr stark an denen des von ihm verehrten Edgar Allan Poe orientiert waren. Er griff dabei auf das typische Setting zurück: Friedhöfe, unheimliche Orte, verwunschene Häuser und beängstigende Visionen, die den Helden quälen. 1923 wurden seine ersten beiden Stories, Das Grab und Dagon, in Weird Tales, einem Magazin für Fantasy und Horror, veröffentlicht.
Als zwei der besten Erzählungen dieser Phase können Die Ratten im Gemäuer und Pickmans Modell gelten. In der Zusammenarbeit mit Kenneth Sterling entstand die einzige Science-Fiction-Erzählung In den Mauern von Eryx, die in einer nie wieder erreichten Dichte das Grauen und das Ausgeliefertsein des Helden zwischen Hoffen und Verzweiflung nahezu physisch greifbar werden lässt.
Lovecrafts eigentlicher Ruhm und seine Bedeutung für die Horror-Literatur aber begründet sich auf die Erzählungen, die dem Cthulhu-Zyklus, auch Arkham- oder Yog-Sothoth-Zyklus genannt, zugehören. In diesen Erzählungen formuliert er den Cosmic-Horror, der seinen Ursprung weit jenseits des bekannten Universums hat und in Gestalt der Großen Alten vor undenkbar langer Zeit die Erde heimgesucht hat und nun, in der Gegenwart des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, durch das Einwirken menschlicher Adepten wiedererweckt wird.
Die erste Erzählung des Zyklus ist Cthulhus Ruf, entstanden 1926. Im Mittelpunkt steht die fiktive Stadt Arkham, in der unschwer Lovecrafts Heimatstadt Providence wiederzuerkennen ist. Aber die Handlung führt auch in abgelegene Bereiche der Erde, so spielt Cthulhus Ruf zum großen Teil in der Südsee oder Berge des Wahnsinns (1931) in der Antarktis.
Lovecraft verlegt dabei den Ursprung des Schreckens in die Weiten des Weltalls oder in Äonen vor der Menschwerdung, wobei aber nie richtig klar wird, warum diese »unbeschreiblichen Wesen« eigentlich hier sind. Die naheliegendste Vermutung ist: aus purem Zerstörungswillen.
Weitere wichtige Elemente sind das »Necronomicon des wahnsinnigen Arabers Abdul Alhazred«, ein Buch, in dem die Beschwörungsformeln für die Großen Alten verzeichnet sind und das jeden normalen Menschen in den Wahnsinn treiben soll. Ein weiteres fiktives Buch, das sich durch Lovecrafts Werk zieht, ist »Unaussprechliche Kulte« von einem ebenso fiktiven Autor »Juntz«.
Bücher mit geheimnisvollem Inhalt, die zudem noch unter einem Bann liegen, sind ein ständig wiederkehrender Topos in Lovecrafts Schaffen, ebenso wie einsam zurückgezogen lebende Gelehrte, die sich ein Wissen angeeignet haben, von dem die Menschheit nie erfahren darf. Unschwer ist in diesen Charakteren eine Selbststilisierung des Autors zu erkennen.
Lovecraft ist es mit dem Cthulhu-Zyklus, so inkohärent er auch erscheinen mag, gelungen, eine neue Dimension in die bis dahin stark kodifizierte Schauer- oder Horrorliteratur einzuführen. Vergessen waren auf einmal die Bettlaken-Gespenster, lebenden Toten und klappernden Gerippe, die in den gängigen Erzählungen fröhliche Urständ feierten.
Hier hatte ein Autor die Bühne betreten, der – ähnlich wie 80 Jahre zuvor Edgar Allan Poe – dem Schrecken ein neues Gesicht gab – und dieses noch hinter dem häufig benutzten Unsagbarkeitstopos versteckte. Seine einsamen Helden führen einen Kampf, den sie von der ersten Minute an verloren haben. Hier gilt nicht das strebende Bemühen, das zur Erlösung führt, sondern bestenfalls gelingt ein Aufschub der endgültigen Vernichtung. Lovecrafts Protagonisten sind nicht Mächten unterworfen, denen mit irdischen Mitteln beizukommen wäre. Nein, das Ende ist klar und kann nur im Untergang der gesamten Menschheit bestehen.
Lovecraft hat in seinen Horror-Erzählungen das wohlige Gruseln in das allumfassende Grauen verwandelt. Er hat damit den Boden bereitet, auf dem Autoren wie Stephen King, Dean R. Koontz, Clive Barker, Clark Ashton Smith und viele andere seitdem die Horrorliteratur kultiviert haben.
Florian F. Marzin
Die Aussage des Randolph Carter
Ich wiederhole es noch einmal, meine Herren, Ihre Untersuchung ist nutzlos. Sperren Sie mich hier auf ewig ein, wenn Sie möchten, legen Sie mich in Ketten oder erschießen Sie mich, wenn Sie ein Opfer brauchen, um die Illusion dessen aufrechtzuerhalten, was Sie Gerechtigkeit nennen. Ich kann nicht mehr sagen, als ich schon gesagt habe. Ich habe Ihnen vorbehaltlos alles mitgeteilt, an was ich mich erinnern kann. Ich habe nichts verschwiegen und nichts verändert, und wenn etwas unklar blieb, dann liegt das an der dunklen Wolke, die sich über meinen Geist gelegt hat – diese Wolke und die unklare Natur der Schrecken, die für sie verantwortlich ist.
Nochmals erkläre ich, dass ich nicht weiß, was aus Harley Warren geworden ist, doch ich denke – hoffe fast –, dass ihm ein friedliches Vergessen zuteilgeworden ist, wenn es so eine Gnade überhaupt gibt. Es stimmt, ich bin fünf Jahre lang sein engster Freund gewesen und habe teilweise seine schreckliche Erforschung des Unbekannten unterstützt. Ich stelle nicht in Abrede, wenn meine Erinnerung auch ungenau und verschwommen ist, dass Ihr Zeuge, wie er behauptet, uns vielleicht um halb zwölf in jener grässlichen Nacht zusammen gesehen hat, wie wir auf dem Berg Gainsville in Richtung des Großen Zypressensumpfs gegangen sind. Und dass wir Taschenlampen, Spaten und eine merkwürdige Kabeltrommel mit daran befestigten Instrumenten bei uns hatten, will ich auch bestätigen, denn diese Dinge spielen eine Rolle in der fürchterlichen Szene, die in meinem verwirrten Gedächtnis eingebrannt ist. Doch was dann folgte, und warum ich am nächsten Morgen alleine und benommen am Rand des Sumpfs gefunden wurde, darüber weiß ich nichts Genaues, was ich Ihnen aber schon immer und immer wieder gesagt habe. Sie behaupten, in dem Sumpf oder in der Nähe gäbe es nichts, was Ursache der schrecklichen Ereignisse hätte sein können. Ich wiederhole: Ich weiß nichts über das hinaus, was ich gesehen habe. Vielleicht eine Vision oder ein Albtraum – ich hoffe inbrünstig, dass es eine Vision oder ein Albtraum war. Dies ist meine ganze Erinnerung an die Geschehnisse in den grauenhaften Stunden, nachdem wir aus dem Blickfeld der Menschen verschwunden waren. Und warum Harley Warren nicht zurückkehrte, wissen nur er oder sein Schatten – oder irgendein namenloses Ding, das ich nicht beschreiben kann.
Ich habe schon gesagt, dass ich mit den abseitigen Studien des Harley Warren gut vertraut bin und sie bis zu einem gewissen Grad auch unterstützt habe. Aus seiner großen Sammlung von fremden, seltenen Büchern über verbotene Dinge, habe ich all die gelesen, deren Sprache ich verstand, doch das waren nur sehr wenige, verglichen mit denen, deren Sprache in nicht kannte. Ich glaube, die meisten waren in Arabisch abgefasst und das Buch von üblem Geist, das zum Untergang führte – das Buch, das er beim Verlassen dieser Welt in seiner Tasche hatte –, war in Schriftzeichen verfasst, die ich nirgendwo sonst gesehen habe. Warren hätte mir nie gesagt, was in diesem Buch steht. Nun, bezüglich unserer Studien muss ich noch einmal wiederholen, dass ich mich kaum noch daran erinnern kann. Mir erscheint es eine Gnade, dass ich es nicht kann, denn es waren schreckliche Studien, die ich mehr aus widerstrebender Faszination als aus wirklicher Neigung durchführte. Warren war immer der Beherrschende, und manchmal fürchtete ich ihn. Ich erinnere mich noch, wie sein Gesichtsausdruck in der Nacht vor den schrecklichen Ereignissen mich erschaudern ließ, als er unentwegt von seiner Theorie sprach, warum bestimmte Leichen nie verrotten, sondern unverändert fest und fett tausend Jahre lang in ihren Gräbern liegen. Jetzt aber fürchte ich ihn nicht mehr, denn ich glaube, dass er ein Grauen weit jenseits meines Vorstellungsvermögens erfahren hat. Jetzt fürchte ich um ihn.
Noch einmal erkläre ich, dass ich keine genaue Vorstellung von dem habe, was wir in dieser Nacht vorhatten. Ganz sicher hatte es eine Menge mit dem Inhalt des Buches zu tun, das Warren bei sich trug – das uralte Buch mit den unentzifferbaren Zeichen, das er einen Monat zuvor aus Indien erhalten hatte –, doch ich schwöre, dass ich keine Ahnung hatte, was wir suchten. Ihr Zeuge sagt, dass er uns um halb zwölf am Gainsville in Richtung des Großen Zypressensumpfs hat laufen gesehen. Das ist wahrscheinlich richtig, aber ich kann mich nicht erinnern. In meinem Bewusstsein ist nur eine Szene eingebrannt, und es muss lange nach Mitternacht gewesen sein, denn der schwindende Halbmond stand hoch am trüben Himmel.
Wir befanden uns auf einem uralten Friedhof, so alt, dass mich die vielen Anzeichen unendlicher Jahre erschaudern ließen. Ich befand mich in einer tiefen feuchten Kuhle, die von hohen Gräsern, Moos und merkwürdigen Ranken überwachsen war, und es herrschte ein schwacher Geruch, den meine eingeschränkte Fantasie absonderlicherweise mit verwesendem Stein in Verbindung brachte. Rings um uns waren die Anzeichen von Verwahrlosung und Niedergang, und ich schien erschreckt von der Vorstellung, dass Warren und ich die ersten lebenden Wesen waren, die seit Jahrhunderten diese Totenstille störten. Über dem Rand des Tals lugte verschwommen die bleiche Sichel des Mondes durch ekelerregende Dämpfe, die aus unbekannten Katakomben zu kommen schienen. In dem schwachen, zitternden Mondlicht konnte ich eine Reihe abstoßender Grabsteine, Urnen, Ehrenmäler und die Fassaden von Mausoleen erkennen, die sämtlich verfallen, moosbewachsen, von der Feuchtigkeit verschmutzt und teilweise unter der fetten Üppigkeit der unheilvollen Vegetation verborgen waren.
Meine erste klare Erinnerung an meine Anwesenheit auf diesem schrecklichen Gräberfeld zeigt mir, wie ich mit Warren vor einer bestimmten, halbverfallenen Gruft stehen blieb und wie wir einiges Gepäck ablegten, das wir wohl mit uns getragen hatten. Jetzt fiel mir auf, dass ich eine Taschenlampe und zwei Spaten bei mir hatte, während mein Gefährte eine ebensolche Taschenlampe und einen tragbaren Telefonapparat mitführte. Es fiel kein Wort, denn der Ort und die Aufgabe schienen uns bekannt zu sein, und ohne zu zögern ergriffen wir die Spaten und befreiten die flache, vorzeitliche Grabstätte von Gras, Gestrüpp und darüber gefallener Erde. Nachdem wir die Oberfläche, die aus drei immensen Granitplatten bestand, gereinigt hatten, traten wir einige Schritte zurück, um die gesamte Grabstätte überblicken zu können, und Warren schien im Kopf einige Berechnungen anzustellen. Dann ging er zu der Grabstätte zurück und setzte seinen Spaten als Hebel ein, um die Platte anzuheben, die am nächsten bei den Ruinen lag, die vor langer Zeit einmal ein Denkmal gewesen waren. Es gelang ihm nicht, und er gab mir ein Zeichen, dass ich ihm helfen sollte. Zu guter Letzt lockerten unsere gemeinsamen Anstrengungen die Steinplatte, wir hoben sie an und kippten sie zur Seite.
Das Entfernen der Platte legte eine schwarze Öffnung frei, aus der übel riechende Gase entströmten, die so ekelerregend waren, dass wir vor Grauen zurückwichen. Trotzdem näherten wir uns nach einem kurzen Moment wieder der Grube und stellten fest, dass die Ausdünstungen jetzt besser zu ertragen waren. Im Licht unserer Taschenlampen sahen wir das obere Ende einer Steintreppe, auf der irgendwelche ekelhafte Feuchtigkeit des Erdinneren stand und die von feuchten, mit Salpeter überzogenen Mauern eingefasst wurde. An dieser Stelle erinnere ich mich zum ersten Mal, dass gesprochen wurde. Warren sprach mit seiner weichen Tenorstimme lange auf mich ein. Er zeigte keinerlei Verunsicherung durch unsere furchteinflößende Umgebung.
»Es tut mir leid, aber ich muss Sie bitten, hier oben zu bleiben«, sagte er, »aber es wäre unverantwortlich, jemanden mit so schwachen Nerven wie Sie dort hinunterzulassen. Sie können sich nicht vorstellen, selbst nicht auf Grundlage von dem, was Sie gelesen und ich Ihnen erzählt habe, was ich dort unten sehen und tun werde. Das ist Teufelswerk, Carter, und ich bezweifle, dass jemand ohne eiserne Nerven das je durchstehen und gesund wieder hier heraufkommen könnte. Ich möchte Sie nicht beleidigen, und der Himmel weiß, dass ich froh bin, Sie bei mir zu haben, doch die Verantwortung liegt ohne Zweifel bei mir, und ich kann kein Nervenbündel wie Sie dort unten gebrauchen, wo möglicherweise Tod und Wahnsinn warten. Ich sage Ihnen, Sie können sich nicht vorstellen, was dieses Ding wirklich ist! Doch ich verspreche Ihnen, Sie über jeden meiner Schritte über das Telefon zu informieren – sehen Sie, das Kabel hier reicht einmal bis zum Mittelpunkt der Erde und zurück.«
Ich kann in meinem Kopf immer noch diese kaltblütig gesprochenen Worte hören und erinnere mich noch an meine Einwände. Ich schien verzweifelt darauf aus zu sein, meinen Freund in diese unheimlichen Tiefen zu begleiten, doch er war nicht umzustimmen. Er drohte sogar, das Unternehmen abzubrechen, wenn ich nicht einlenken würde. Eine Drohung, die ihren Zweck nicht verfehlte, denn nur er allein hatte den Schlüssel zu diesem Ding. An all das kann ich mich noch erinnern, obwohl ich nicht mehr weiß, was für ein Ding das war. Nachdem ich widerstrebend seinem Plan zugestimmt hatte, nahm Warren die Kabeltrommel und richtete die Instrumente ein. Auf sein Nicken hin nahm ich einen der Apparate und setzte mich auf einen alten, verblichenen Grabstein direkt neben dem frisch geöffneten Grab. Dann schüttelte er mir die Hand, schulterte die Kabeltrommel und verschwand in dem unbeschreiblichen Beinhaus.
Eine Minute lang sah ich noch das Licht seiner Taschenlampe und hörte das Klappern des Drahts, der hinter ihm auf den Boden sank, doch das Licht war schon bald verschwunden, so als ob er um eine Biegung der Steintreppe gegangen wäre, und die Geräusche erstarben ebenfalls. Ich war allein, aber durch die magischen Schnüre, deren isolierte Oberfläche im verschwommenen Licht der Mondsichel grün glänzte, an die unbekannten Tiefen gefesselt.
Ich kontrollierte im Licht der Taschenlampe unentwegt meine Uhr und lauschte mit fiebernder Ungeduld am Telefonhörer, doch über eine Viertelstunde lang hörte ich nichts. Dann vernahm ich ein schwaches Klicken aus dem Apparat und rief meinen Freund mit angespannter Stimme. Obwohl ich mit allem rechnete, war ich doch nicht auf die Worte vorbereitet, die beunruhigt und zitternd, wie ich es bei Harley Warren noch nie erlebt hatte, aus der schrecklichen Gruft zu mir heraufdrangen. Er, der mich vor kurzer Zeit so selbstsicher verlassen hatte, sprach nun von dort unten zu mir mit einem zitternden Flüstern, das bedrohlicher klang als der lauteste Schrei.
»Mein Gott! Wenn Sie sehen könnten, was ich sehe!«
Ich konnte nicht antworten. Ich konnte nur stumm abwarten. Dann erklangen wieder fast wahnsinnige Worte.
»Carter, es ist schrecklich, monströs, unbeschreiblich!«
Diesmal setzte meine Stimme nicht aus, und ich stieß eine Flut von aufgeregten Fragen in das Telefon. Von Grauen gepackt wiederholte ich immer wieder: »Warren, was ist es? Was ist es?«
Einmal mehr erklang die von Angst raue Stimme meines Freundes, doch nun schwang auch Verzweiflung mit.
»Das kann ich Ihnen nicht beschreiben, Carter! Es ist weit jenseits des Vorstellbaren – ich wage nicht, es Ihnen zu beschreiben – kein Mensch kann weiterleben, wenn er es gesehen hat. Großer Gott, davon habe ich nie geträumt.«
Wieder kehrte Stille ein, nur unterbrochen vom Strom meiner unzusammenhängenden, ängstlichen Fragen. Dann erklang Warrens Stimme schrill vor tiefster Bestürzung.
»Carter, um Gottes willen, schließen Sie die Gruft mit der Granitplatte und sehen Sie, dass Sie wegkommen, wenn Sie können! Schnell! Lassen Sie alles stehen und liegen und versuchen Sie wegzukommen … das ist Ihre einzige Chance! Machen Sie, was ich gesagt habe, und stellen Sie keine Fragen!«
Ich hatte es gehört, war aber nur in der Lage, meine dummen Fragen zu wiederholen. Um mich herum waren die Gräber, die Dunkelheit und die Schatten, unter mir eine Bedrohung, die außerhalb des menschlichen Vorstellungsvermögens lag. Mein Freund befand sich allerdings in größerer Gefahr als ich, und trotz meiner Angst hatte ich das vage Gefühl, er würde mich dafür verfluchen, wenn ich ihn unter solchen Umständen allein ließe.
»Hau ab, Carter! Um Gottes willen, schieb die Platte wieder drauf und hau ab, Carter!«
Etwas in der knabenhaften Ausdrucksweise meines offensichtlich hilflosen Gefährten gab mir meine Handlungsfähigkeit zurück. Ich traf eine Entscheidung und schrie sie zu ihm hinunter. »Warren, fass dich! Ich komme runter!« Doch bei dieser Ankündigung verwandelte sich der Tonfall meines Gefährten in einen Schrei der Verzweiflung.
»Nein! Du verstehst das nicht! Es ist zu spät und mein eigener Fehler. Schieb die Platte darüber und lauf weg – es gibt nichts, was du oder sonst jemand jetzt noch tun könnte!«
Der Klang der Stimme veränderte sich erneut und wurde jetzt weicher, so als ob Warren hoffnungslose Verzweiflung ergriffen hätte, dennoch schien er weiterhin von Angst geschüttelt.
»Schnell, bevor es zu spät ist!«
Ich versuchte, nicht darauf zu achten, versuchte die Lähmung, die mich gepackt hatte, abzustreifen und mein Vorhaben, ihm zu Hilfe zu kommen, auszuführen. Doch seine nächsten Worte erreichten mich noch in den Klauen unsäglichen Grauens.
»Carter, beeil dich! Es hat keinen Sinn, du musst fliehen. Besser nur einer als alle zwei … die Platte …«
Eine Pause, dann ein Klicken und die schwache Stimme von Warren.
»Es ist fast vorbei … mach es nicht noch schlimmer … verschließe diese verdammte Treppe und lauf um dein Leben … du verlierst Zeit … mach’s gut, Carter … wir werden uns nicht wiedersehen.«
An dieser Stelle wurde Warrens Flüstern zu einem Schrei, ein Schrei, der sich in ein Kreischen verwandelte, in dem das Grauen aller Zeitalter lag.
»Verflucht seien diese Ausgeburten der Hölle, es sind unzählige. Mein Gott! Hau ab! Hau ab! HAUAB!«
Danach herrschte Stille. Ich weiß nicht, wie viele unendliche Äonen ich wie betäubt dasaß und in dieses Telefon flüsterte, murmelte, rief und schrie. Immer und immer wieder äonenlang flüsterte, murmelte, rief und schrie ich: »Warren! Warren! Antworte … bist du noch da?«
Und dann kam das Grauen über mich, das alles übertraf – das unglaubliche, undenkbare und fast unbeschreibbare Ding. Ich habe gesagt, dass Äonen vergangen zu sein schienen, seit Warren seine letzte, verzweifelte Warnung herausgeschrien hatte, und dass nun meine eigenen grässlichen Schreie die Stille zerrissen. Doch nach einer Weile klickte der Telefonapparat wieder, und ich bemühte mich, etwas zu hören. Wieder rief ich hinunter: »Warren, bist du da?«, und dann antwortete das Ding, das meinen Geist umwölkt hat. Meine Herren, ich werde nicht versuchen, dieses Ding zu erklären, diese Stimme, noch kann ich es im Einzelnen beschreiben, denn die ersten Worte schon raubten mir das Bewusstsein und ließen meinen Geist zu einem unbeschriebenen Blatt werden, bis zu dem Zeitpunkt als ich im Krankenhaus erwachte. Sollte ich sagen, dass die Stimme tief war, hohl, gallertartig, weit entfernt, unirdisch, nicht menschlich, körperlos? Was soll ich sagen? Das ist das Ende meines Erlebnisses und das Ende meiner Geschichte. Ich hörte diese Stimme und weiß nichts darüber hinaus – hörte sie, als ich versteinert auf diesem unbekannten Friedhof saß, in der Kuhle zwischen verwitterten Steinen und den verfallenen Gräbern, der wuchernden Vegetation und dem Verwesungsgeruch – habe sie deutlich aus den innersten Tiefen dieses verfluchten Grabes vernommen, als ich die amorphen, aasfressenden Schatten im untergehenden Mond tanzen sah. Und das hat sie gesagt:
»Du Narr, Warren ist TOT!«
Die Musik des Erich Zann
Obwohl ich mit größter Sorgfalt die Stadtpläne studiert habe, gelang es mir nicht, die Rue d’Auseil wiederzufinden. Es waren nicht nur moderne Stadtpläne, denn mir ist bewusst, dass sich Straßennamen ändern. Ganz im Gegenteil, ich habe mich tief in sämtliche Antiquariate vergraben und persönlich jeden Bezirk dieser Stadt nach jedem Namen durchforscht, der auch nur irgendwie an die Straße erinnerte, die ich als Rue d’Auseil kannte. Doch trotz all meiner Bemühungen bleibt es eine verstörende Tatsache, dass ich weder das Haus noch die Straße noch nicht einmal das Viertel finden konnte, wo ich während der letzten Monate meines ärmlichen Lebens als Student der Metaphysik an der Universität die Musik des Erich Zann gehört habe.
Mich wundert nicht, dass meine Erinnerung Lücken aufweist, denn meine geistige und körperliche Gesundheit wurde während der Zeit, als ich in der Rue d’Auseil wohnte, stark beeinträchtigt, aber ich erinnere mich, dass ich keinen meiner wenigen Bekannten mit dorthin nahm. Doch dass ich den Ort nicht mehr finden kann, ist zugleich einzigartig und verstörend, denn es war nur eine halbe Stunde Fußweg zur Universität und er wurde gesäumt von auffälligen Besonderheiten, die jemand, der dort war, wohl kaum vergisst. Ich habe nie jemanden getroffen, der in der Rue d’Auseil war.
Die Rue d’Auseil lag jenseits eines dunklen Flusses, an dessen Ufer steil aufragende Lagerhäuser aus Ziegeln mit blinden Fensterscheiben standen und über den sich eine massige, dunkle Steinbrücke wölbte. Am Fluss war es immer schattig, so als ob der Rauch der anliegenden Fabriken die Sonne permanent ausschließen würde. Der Fluss selbst verbreitete üble Gerüche, die ich nirgendwo sonst gerochen habe und die mir vielleicht eines Tages den Weg weisen werden, denn diesen Geruch werde ich sofort wiedererkennen. Auf der anderen Seite der Brücke gab es schmale Kopfsteinpflasterstraßen mit Geländern und danach der Anstieg, erst nur wenig, doch dann, wenn man die Rue d’Auseil erreichte, ziemlich steil.
Nie habe ich eine Straße gesehen, die so steil und schmal war wie die Rue d’Auseil. Sie war fast wie eine Klippe und für alle Fahrzeuge gesperrt, hatte eine Reihe von Treppenfluchten und endete oben an einer efeubewachsenen Mauer. Das Pflaster war unregelmäßig und bestand teilweise aus Steinplatten, teilweise aus Pflastersteinen und manchmal auch dem blanken Boden mit einem grünlichen Bewuchs. Die Häuser waren hoch und hatten spitze Dächer, waren unglaublich alt und neigten sich wild nach vorne, hinten oder zur Seite. Manchmal berührten sich zwei vorwärts geneigte gegenüberstehende Häuser fast über der Straße wie zu einem Bogengang, und ganz gewiss hielten sie den größten Teil des Lichts vom Boden ab. Es gab einige Brücken über der Straße, die zwei Häuser verbanden.
Die Bewohner dieser Straße beeindruckten mich auf eigentümliche Weise. Zuerst dachte ich, es läge daran, dass sie alle verschwiegen und zurückhaltend waren, doch später dann merkte ich, dass es an ihrem hohen Alter lag. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, dass ich mir in einer solchen Straße eine Wohnung nahm, doch ich war nicht ganz ich selbst, als ich dorthin zog. Ich hatte an vielen ärmlichen Orten gelebt, immer knapp bei Kasse, bis ich schließlich in dieses verfallene Haus in der Rue d’Auseil kam, das von dem gelähmten Blandot geführt wurde. Es war das dritte von oben und bei Weitem das höchste von allen.
Mein Zimmer befand sich im vierten Stock, das einzig bewohnte auf dieser Etage, denn das Haus stand fast leer. Am Abend, als ich einzog, hörte ich aus der Mansarde über mir seltsame Musik und am nächsten Tag fragte ich Blandot danach. Er sagte, dass es ein alter deutscher Geigenspieler sei, ein merkwürdiger stummer Mann, der sich als Erich Zann eingeschrieben hätte und abends in einem billigen Theaterorchester spielte, und er fügte hinzu, dass es Zanns Verlangen, abends, nach seiner Rückkehr von dem Orchester, noch zu spielen, gewesen sein, warum er die hohe Mansarde mit dem einzigen Fenster in der Giebelwand genommen hätte, von dem aus er über die Grenzmauer auf das ansprechende Panorama dahinter blicken konnte.
Danach hörte ich Zann jede Nacht spielen und obwohl mich sein Spiel nicht schlafen ließ, war ich von seiner absonderlichen Musik gefangen. Ich hatte nicht viel Ahnung von Kunst, doch ich war mir sicher, dass keine seiner Melodien irgendeinen Bezug zu einer Musik hatte, die ich schon einmal gehört hatte, und schloss daraus, dass er ein Komponist von großer Originalität sein musste. Je länger ich zuhörte, desto mehr faszinierte sie mich, bis ich nach einer Woche beschloss, die Bekanntschaft des alten Mannes zu suchen.
Eines Abends, als er von seiner Arbeit kam, trat ich ihm im Korridor entgegen und erklärte, dass ich ihn kennenlernen und bei ihm sein wollte, wenn er spielte. Er war eine kleine, schmale, gebeugte Person mit schäbiger Kleidung, blauen Augen, einem merkwürdig satyrgleichen Gesicht und einem fast kahlen Kopf, und nach meinen ersten Worten schien er zugleich verschreckt und wütend. Meine offene Freundlichkeit erweichte ihn schließlich, und grummelnd wies er mich an, ihm die quietschenden und wackligen Stufen hinauf in die Dunkelheit zu folgen. Seine Mansarde war eine der beiden einzigen unter dem steilen Dach und lag nach Westen, in Richtung der hohen Mauer, die das Ende der Straße bildete. Die Mansarde war sehr geräumig und erschien durch die karge Ausstattung noch größer. Die einzigen Möbel waren ein schmales eisernes Bett, ein Waschgestell, ein kleiner Tisch, ein großes Bücherregal, ein eiserner Notenständer und drei altertümliche Stühle. Auf dem Boden verstreut lagen Notenblätter herum. Die Wände waren blankes Holz und wahrscheinlich nie verputzt gewesen, während das Übermaß an Staub und Spinnweben den Ort eher verlassen denn bewohnt wirken ließ. Offensichtlich lag Erich Zanns erstrebenswerte Welt der Schönheit in einem weit entfernten Kosmos der Fantasie.
Nachdem er mich genötigt hatte, Platz zu nehmen, schloss der stumme Mann die Tür, legte den hölzernen Riegel vor und entzündete eine Kerze, um seinen Gast in Augenschein zu nehmen. Nun holte er seine Fiedel aus der von Motten zerfressenen Hülle und setzte sich auf den am wenigsten unbequemen Stuhl. Er benötigte den Notenständer nicht, fragte mich auch nicht, was ich hören wolle, sondern spielte aus dem Gedächtnis und verzauberte mich über eine Stunde lang mit Melodien, die ich nie zuvor gehört hatte, Melodien, die er selbst ersonnen haben musste. Sie zu beschreiben ist für jemanden, der keine Ahnung von Musik hat, unmöglich. Sie waren eine Art Fuge mit Wiederholungen absolut unglaublicher Kunstfertigkeit, doch mir fiel auf, dass keine der absonderlichen Töne darunter waren, die ich bei anderer Gelegenheit in meinem Zimmer vernommen hatte.
Jene Töne, die mich gefangen und die ich häufig mehr schlecht als recht vor mich hin gesummt oder gepfiffen hatte. Als der Geigenspieler schließlich den Bogen weglegte, fragte ich ihn, ob er ein paar davon spielen könnte. Kaum hatte ich meine Bitte ausgesprochen, verschwand aus dem faltigen, satyrgleichen Gesicht die gelangweilte Gleichgültigkeit, die er während seines Spiels gezeigt hatte, und es erschien der gleiche seltsame Ausdruck von Schrecken und Wut, den ich schon festgestellt hatte, als ich den alten Mann ansprach. Einen Moment lag versuchte ich ihn zu überreden, denn ich konnte sehr leicht die Schrullen des Alters erkennen, und versuchte sogar die Laune meines Gastgebers zu beeinflussen, indem ich einige der Melodien pfiff, die ich in der Nacht zuvor gehört hatte. Doch diese Absicht verfolgte ich nur einen Augenblick, denn als der stumme Musiker das Pfeifen vernahm, verzog sich plötzlich sein Gesicht auf unbeschreiblich abscheuliche Weise und er streckte seine knochige rechte Hand aus, um meinen Mund zum Schweigen zu bringen und so die grässliche Nachahmung zu unterbinden. Während er dies tat, stellte er seine Exzentrik noch dadurch unter Beweis, dass er einen erschrockenen Blick zu dem einsamen Fenster warf, als ob er Angst vor einem Eindringling hätte, ein Blick, der doppelt unsinnig war, befand sich die Mansarde doch hoch und unerreichbar über sämtlichen benachbarten Dächern und war das Fenster der einzige Punkt, wie mir der Hausverwalter gesagt hatte, von dem man aus über die Mauer auf der Hügelkuppe blicken konnte.
Der Blick des alten Mannes brachte mir wieder Blandots Bemerkung in Erinnerung, und mit einer Anwandlung von Eskapismus fühlte ich den Wunsch, einen Blick über das weite, Schwindel erregende Panorama von im Mondlicht daliegenden Dächern und den Lichtern der Stadt hinter dem Hügelkamm werfen zu wollen, das sich von allen Bewohnern der Rue d’Auseil nur diesem griesgrämigen Musiker darbot. Ich bewegte mich auf das Fenster zu und hätte die unbeschreiblichen Vorhänge zur Seite gezogen, wenn der stumme Mieter nicht mit einer ängstlichen Wut, die noch größer war als zuvor, über mich hergefallen wäre. Diesmal deutete er mit seinem Kopf zur Tür und zog mich unruhig mit beiden Händen dorthin. Nun war ich ernsthaft über meinen Gastgeber verärgert, wies ihn an, mich loszulassen, und sagte ihm, dass ich sofort gehen würde. Sein Griff lockerte sich, und als er meine Verärgerung und Erregung bemerkte, milderte sich sein eigener Zorn. Sein Griff wurde wieder fester, doch diesmal als freundliche Geste, und er nötigte mich auf einen Stuhl, dann begab er sich nachdenklich zu dem überhäuften Tisch, wo er viele Worte mit einem Bleistift im schwerfälligen Französisch eines Ausländers niederschrieb.
Was er mir schließlich zu lesen gab, war eine Bitte um Toleranz und Vergebung. Zann schrieb, dass er alt, einsam und von seltsamen Ängsten geplagt war und unter nervösen Anfällen litt, die mit seiner Musik und anderen Dingen zusammenhingen. Ihm hätte gefallen, dass ich seiner Musik zugehört hatte, und er wollte, dass ich wiederkäme und mich nicht an seinem außergewöhnlichen Verhalten störte. Er könne aber seine absonderlichen Melodien niemandem vorspielen und ertrage es auch nicht, sie von anderen zu hören, und könne auch nicht ertragen, wenn irgendein anderer etwas in seinem Zimmer anfasste. Er hatte bis zu unserer Unterhaltung im Korridor nicht gewusst, dass ich sein Spiel in meinem Zimmer hören konnte, und bat mich, Blandot um einen tiefer gelegenen Raum zu bitten, wo ich ihn nachts nicht hören konnte. Er würde, so schrieb er, die Mehrkosten in der Miete übernehmen.
Während ich das scheußliche Französisch entzifferte, wurde ich nachsichtiger gegenüber dem alten Mann. Wie ich war er ein Opfer von körperlichem und geistigem Leiden und meine metaphysischen Studien hatten mich Milde gelehrt. In der Stille ertönte ein leises Geräusch vom Fenster her, der Fensterladen musste wohl im Nachtwind geklappert haben, und aus irgendwelchen Gründen fuhr ich genauso erschrocken auf wie Erich Zann. Als ich mit dem Lesen fertig war, schüttelte ich meinem Gastgeber die Hand und verließ ihn als Freund.
Am nächsten Tag erhielt ich von Blandot ein teureres Zimmer im zweiten Stock, zwischen der Wohnung eines alten Geldverleihers und dem Zimmer eines ehrenhaften Sattlers. Im dritten Stock wohnte niemand.
Es dauerte nicht lang, dann bemerkte ich, dass Zanns Sehnsucht nach meiner Gesellschaft nicht so groß war, wie es schien, als er mich aus dem vierten Stock heraushaben wollte. Er forderte mich nicht auf, ihn zu besuchen, und wenn ich von selbst kam, dann schien er nervös und spielte lustlos. Das geschah immer bei Nacht, denn am Tage schlief er und empfing niemanden. Meine Gefühle für ihn wurden nicht größer, dennoch hielten mich der Mansardenraum und die absonderliche Musik in ihrem Bann. Ich hatte den eigentümlichen Wunsch, aus dem Fenster zu sehen über die Mauer und den unbekannten Abhang, wo die glitzernden Dächer und Türme sich ausbreiten mussten. Einmal ging ich während der Theatervorstellung, als Zann weg war, nach oben zur Mansarde, aber die Tür war verschlossen.
Doch ich schaffte es, das nächtliche Spiel des stummen alten Mannes zu belauschen. Zuerst schlich ich auf Zehenspitzen in mein altes Zimmer im vierten Stock, dann wurde ich kühn und erklomm die knarrende Treppe in den spitzen Giebel. Dort, in dem engen Vorraum, vor der verriegelten Tür mit dem zugehängten Schlüsselloch, hörte ich oft Töne, die mich mit nicht zu beschreibender Ehrfurcht erfüllten, eine Ehrfurcht vor unbestimmten Wundern und brütenden Geheimnissen. Es war nicht so, dass die Töne schrecklich gewesen wären, das waren sie nicht, doch sie trugen Schwingungen, die an nichts auf dieser Erde erinnerten, und in bestimmten Passagen erreichten sie eine symphonische Qualität, die man nur sehr schwer einem einzigen Musiker zuschreiben konnte. Zweifellos war Erich Zann ein Genie mit überschäumender Kraft. Die Wochen vergingen, und sein Spiel wurde immer ungestümer, während der alte Musiker immer hagerer und eigenbrötlerischer wurde. Er weigerte sich jetzt, mich überhaupt noch zu empfangen, und übersah mich, wann immer wir uns auf der Treppe begegneten.
Als ich dann eines Nachts an der Tür lauschte, hörte ich die kreischende Geige sich in ein chaotisches Babel von Tönen steigern, ein Inferno, das mich an meiner geistigen Gesundheit hätte zweifeln lassen, wäre nicht hinter der verriegelten Tür der mitleiderregende Beweis erfolgt, dass dieses Grauen real war, ein schrecklicher, unartikulierter Schrei, den nur ein Stummer zustande bringt und der nur in Augenblicken außergewöhnlicher Furcht oder Bedrohung ausgestoßen wird. Ich klopfte mehrmals an die Tür, erhielt aber keine Antwort. Danach verharrte ich vor Kälte und Angst zitternd in dem dunklen Vorraum, bis ich hörte, wie der arme Musiker versuchte, sich mithilfe eines Stuhles vom Boden zu erheben. Da ich annahm, er wäre nach einer Ohnmacht gerade wieder zu Bewusstsein gekommen, klopfte ich erneut und rief laut meinen Namen, um ihn zu beruhigen. Ich hörte, wie Zann zum Fenster stolperte und sowohl die Scheiben als auch die Fensterläden schloss, dann stolperte er zur Tür, entriegelte sie unbeholfen und ließ mich ein. Diesmal war er wirklich froh, mich zu sehen, denn sein verzerrtes Gesicht glänzte erleichtert, während er sich an meine Jacke klammerte wie ein kleines Kind an den Rockzipfel seiner Mutter.
Am ganzen Körper zitternd, nötigte mich der alte Mann auf einen Stuhl, während er auf einen zweiten sank, neben dem seine Geige und der Bogen achtlos auf dem Boden lagen. Eine Zeit lang saß er apathisch da, nickte merkwürdig, erweckte aber den Anschein, als ob er angestrengt und ängstlich auf etwas lauschte. Schließlich schien er zufrieden, ging hinüber zum Tisch und schrieb ein paar Zeilen, gab sie mir und ging wieder zu dem Tisch, wo er schnell und ausgiebig weiterschrieb. In den wenigen Zeilen bat er mich, im Namen des Mitleids und zur Befriedigung meiner eigenen Neugierde auf meinem Platz zu verharren, während er auf Deutsch einen vollständigen Bericht über die Wunder und Schrecken abfasste, die ihn verfolgten. Ich wartete, und der Stift des stummen Mannes flog über das Papier.
Etwa eine Stunde später wartete ich immer noch, während der Stapel der von dem Musiker fieberhaft beschriebenen Blätter beständig anwuchs, als ich bemerkte, wie Zann plötzlich erschrocken auffuhr. Er blickte eindeutig auf die Vorhänge am Fenster und lauschte zitternd. Dann hatte ich den unbestimmten Eindruck, Musik zu hören. Es waren keine schrecklichen Töne, sondern eher eine außergewöhnlich tiefe und unendlich weit entfernte Melodie, die daraufhin deutete, dass sich der Musiker in einem der Nachbarhäuser oder jenseits der hohen Mauer befand, über die zu blicken mir nie gelungen war. Die Wirkung auf Zann war grässlich, denn er ließ den Stift fallen, stand unvermittelt auf, nahm seine Geige und begann, die Nacht mit seinem wildesten Spiel zu durchdringen, das ich nur von meinem Lauschen vor der verschlossenen Tür kannte.
Es ist zwecklos, Erich Zanns Spiel in dieser schrecklichen Nacht beschreiben zu wollen. Es war grauenvoller als alles, was ich jemals gehört hatte, denn jetzt sah ich auch seinen Gesichtsausdruck und erkannte, dass sein Antrieb extreme Furcht war. Er versuchte, Geräusche zu produzieren, um etwas abzuschrecken oder hinauszuwerfen, doch was, konnte ich mir nicht vorstellen, aber es musste grässlich sein. Sein Spiel wurde fantastisch, wahnsinnig und hysterisch, behielt aber bis zuletzt die Qualität seines außergewöhnlichen Genies, das der alte Mann ganz sicher besaß. Ich erkannte die Melodie, es war ein wilder ungarischer Tanz von der Art, wie sie in den Theatern beliebt waren, und mir kam zu Bewusstsein, dass ich zum ersten Mal hörte, dass Zann die Musik eines anderen Komponisten spielte.
Das Kreischen und Wimmern der verzweifelten Geige wurde immer lauter und wilder. Der Musiker war schweißgebadet und verrenkte sich wie ein Affe, wobei er immer gehetzt zum Fenster blickte. In seinen aufgewühlten Melodien konnte ich fast die Satyre und Bacchanale sehen, wie sie durch die Abgründe von Wolken, Rauch und Blitzen tanzten. Dann glaubte ich einen schrilleren, lang anhaltenden Ton zu vernehmen, der nicht von der Geige stammte, einen leisen, außergewöhnlichen, verheißungsvollen und höhnischen Ton, der weit aus dem Westen kam.
In diesem Augenblick begann der Fensterladen im heulenden Nachtwind zu klappern, der sich, wie als Antwort auf das wahnsinnige Geigenspiel in der Mansarde, draußen erhoben hatte. Zanns kreischende Geige brachte nun wie von selbst Töne hervor, von denen ich nicht geglaubt hatte, eine Geige könnte sie produzieren. Die Läden klapperten noch lauter, rissen sich los und schlugen gegen das Fenster. Dann zersplitterten unter den dauernden Schlägen die Scheiben und der kalte Wind fuhr ins Zimmer, ließ die Kerzen flackern und die Blätter auf dem Tisch auffliegen, auf denen Zann begonnen hatte, sein schreckliches Geheimnis niederzuschreiben. Ich schaute auf Zann und bemerkte, dass er nicht mehr bei Sinnen war. Seine blauen Augen traten glasig und gebrochen hervor, und sein wildes Spiel war zu einer blindwütigen, mechanischen, unbewussten Orgie geworden, die unmöglich zu beschreiben ist.
Ein plötzlicher Windstoß, heftiger als alle zuvor, packte das Manuskript und trug es Richtung Fenster. Ich stürzte den Blättern hinterher, doch sie waren verschwunden, bevor ich das geborstene Fenster erreichte. Da erinnerte ich mich an meinen lang gehegten Wunsch, aus dem Fenster zu blicken, dem einzigen in der Rue d’Auseil, von dem aus man wahrscheinlich den Abhang hinter der Mauer und die sich dort ausbreitende Stadt sehen konnte. Es war sehr dunkel, doch die Lichter der Stadt leuchteten immer, und ich erwartete, sie dort im Regen und Wind zu sehen. Doch als ich aus dem höchsten aller Giebelfenster hinausblickte, während die Kerzen flackerten und die verrückte Geige mit dem Nachtwind heulte, sah ich unter mir keine Stadt, keine freundlichen Lichter von erahnbaren Straßen, sondern nur die Schwärze eines endlosen Raumes, ein unvorstellbarer Raum, erfüllt von Bewegung und Musik, der an nichts Irdisches erinnerte. Als ich da, von Grauen gepackt, hinabblickte, blies der Wind in der alten Mansarde beide Kerzen aus und ich war in grimmige und undurchdringliche Dunkelheit gehüllt, erfüllt vom Chaos und der Hölle vor mir und hinter mir der dämonische Wahnsinn dieser albtraumhaften Geige.
Ich schwankte zurück in die Dunkelheit, ohne auf den Gedanken zu kommen, ein Streichholz anzuzünden, stieß gegen den Tisch, warf einen Stuhl um und tastete mir den Weg zu dem Punkt, von dem aus in der Dunkelheit die schreckliche Musik erklang. Ich konnte zumindest versuchen, mich und Erich Zann vor den Kräften zu retten, die gegen uns standen. Einmal glaubte ich zu spüren, wie etwas Kaltes mich berührte, und ich schrie auf, doch mein Schrei wurde übertönt von der abscheulichen Geige. Plötzlich traf mich der verrückt sägende Geigenbogen, und ich wusste, dass ich mich in der Nähe des Musikers befand. Ich tastete mich vor, berührte die Lehne von Zanns Stuhl, fand dann seine Schulter und rüttelte sie in dem Versuch, ihn zur Vernunft zu bringen.
Er reagierte nicht, und die Geige kreischte ohne Unterlass. Ich griff nach seinem Kopf, und es gelang mir, sein mechanisches Nicken zu unterbinden. Ich schrie ihm ins Ohr, dass wir beide vor den unbekannten Dingen der Nacht fliehen müssten. Doch weder antwortete er mir noch hielt er in seinem wilden Spiel inne, während die gesamte Mansarde von seltsamen Windstößen erfüllt war, die darin zu tanzen schienen. Als meine Hand sein Ohr berührte, erschauderte ich, obwohl ich nicht wusste, warum, bis ich sein unbewegliches Gesicht fühlte, das eiskalte, steife Gesicht, dessen glasige Augen tief in die Höhlen gesunken waren. Dann fand ich auf wundersame Weise die Tür und den hölzernen Riegel und floh panisch vor dem Ding mit den glasigen Augen in die Dunkelheit, weg von dem ghoulischen Heulen der verfluchten Geige, das sich noch steigerte, während ich davonlief.
Ich stürzte, sprang und flog die endlosen Treppen in dem dunklen Haus hinunter, rannte, ohne zu denken, die schmale, steile und alte Straße mit den Stufen und verfallenen Häusern entlang, stürzte über Stufen und das Kopfsteinpflaster der tiefer gelegenen Straßen und das schluchtartige Ufer des stinkenden Flusses entlang, über die große, dunkle Brücke hinweg zu den breiteren, gesünderen Straßen und Boulevards, die wir alle kennen. All diese schrecklichen Eindrücke sind in mir eingebrannt. Ich erinnere mich, dass es windstill war, der Mond am Himmel stand und überall die Lichter der Stadt glitzerten.
Trotz meiner sorgfältigen Suche und Nachforschungen ist es mir nie gelungen, die Rue d’Auseil wiederzufinden. Aber ich bin nicht wirklich traurig darüber, nicht darüber und auch nicht über den Verlust der eng beschriebenen Seiten, die allein die Musik des Erich Zann hätten erklären können.
Die Ratten im Gemäuer
Nachdem alle Arbeiten beendet waren, zog ich am 16. Juli 1923 in die Burg von Exham. Die Restauration war eine enorme Aufgabe gewesen, denn von dem verlassenen Gebäude war wenig mehr als Ruinen übrig gewesen, doch es war der Sitz meiner Vorfahren, sodass mich keine Kosten abschreckten. Seit der Zeit James I. war das Gebäude nicht mehr bewohnt, als eine abscheuliche, doch weitgehend ungeklärte Tragödie den Hausherrn, fünf seiner Kinder und einige Bedienstete dahingerafft und den dritten, einzig überlebenden Sohn unter dem Schatten von Aberglaube und Grauen vertrieben hatte, der mein direkter Vorfahr und einziger Überlebender dieses verabscheuungswürdigen Geschlechts war.
Da der einzige Erbe des Mordes bezichtigt wurde, fiel der Besitz an die Krone zurück. Der Beschuldigte hatte keinen Versuch unternommen, sich zu entlasten oder seinen Besitz zurückzuerlangen. Von einem Grauen gepackt, das größer war als Gewissensqualen oder die Angst vor dem Gesetz, hatte er nur den einzigen Wunsch, das alte Gebäude aus seinem Blickfeld und seiner Erinnerung zu verbannen. Aus diesem Grund floh Walter de la Poer, elfter Baron von Exham, nach Virginia und gründete die Familie, die im nächsten Jahrhundert als Delapore bekannt wurde.
Die Burg von Exham blieb unbewohnt, obwohl sie später den Ländereien der Norry zugeschlagen wurde und sie aufgrund ihrer besonderen Architektur häufig als Studienobjekt diente. Die Bauweise beinhaltete gotische Türme, die sich auf angelsächsischen oder romanischen Mauern erhoben, deren Fundamente wiederum noch älter waren und, wenn man den Legenden glauben will, auf römische, druidische oder walisische Ursprünge zurückgehen. Die Fundamente waren etwas Einzigartiges, denn sie waren auf der einen Seite Teil des Kalksteinfelsens, von dessen Kamm die Burg ein ödes Tal drei Meilen westlich von dem Dorf Anchester überblickte.
Architekten und Altertumsforscher untersuchten gerne dieses absonderliche Relikt aus vergessenen Jahrhunderten, doch die Landbevölkerung hasste es. Sie hassten es schon seit Jahrhunderten, als meine Vorfahren noch dort lebten, und sie hassten es jetzt, mit dem Moos und dem Schlamm des Verfalls daran. Es hatte keinen Tag gedauert, dann hatte ich in Anchester schon erfahren, dass es sich um ein verfluchtes Anwesen handelte. Und in dieser Woche haben die Arbeiter die Burg von Exham gesprengt und sind dabei, die letzten Spuren ihrer Fundamente zu zerstören. Die nackten Fakten meiner Abstammung habe ich immer gekannt, auch dass mein erster amerikanischer Vorfahr unter merkwürdigen Umständen in die Kolonien gekommen war. Was die Einzelheiten betrifft, hatte ich nicht die leiseste Ahnung, denn die Delapores waren immer sehr verschwiegen. Ganz anders als unsere benachbarten Plantagenbesitzer brüsteten wir uns nicht mit Kreuzrittern als Vorfahren oder anderen Helden des Mittelalters und der Renaissance, und auch wurde in der Familie kein großes Aufhebens über unsere Abstammung gemacht, außer was in einem versiegelten Umschlag stand, der vor dem Bürgerkrieg von jedem Familienoberhaupt dem ältesten Sohn übergeben wurde und nach seinem Tod zu öffnen war. Unser Ruhm beschränkte sich auf das, was wir uns nach der Einwanderung erarbeitet hatten, der Ruhm einer stolzen und ehrwürdigen, doch reservierten und zurückgezogenen Familie in Virginia.
Während des Bürgerkrieges verloren wir unser Vermögen, und unser Leben änderte sich völlig, als Carfax, unser Anwesen am Ufer des Flusses James, niedergebrannt wurde. Mein betagter Großvater war in dem fürchterlichen Flammenmeer umgekommen und mit ihm der Umschlag, der uns mit unserer Vergangenheit verband. Ich erinnere mich noch heute daran, wie ich im Alter von sieben Jahren das Feuer erlebte, die Rufe der Konföderierten Soldaten, die Schreie der Frauen und das Heulen und Beten der Neger. Mein Vater war bei der Armee, die Richmond verteidigte, und nach vielen Formalitäten wurden meine Mutter und ich durch die Linien gelassen, um sich ihm anzuschließen.
Am Ende des Krieges gingen wir alle in den Norden, von wo meine Mutter stammte, und ich wurde erwachsen, erreichte die mittleren Jahre und wurde als abgestumpfter Yankee reich. Weder mein Vater noch ich erfuhren je, was sich in dem Umschlag unserer Abstammung befunden hatte, und als ich mich dem grauen Geschäftsleben in Massachusetts widmete, verlor ich jegliches Interesse an den Geheimnissen, die offensichtlich weit unten in unserem Stammbaum lauerten. Wenn ich geahnt hätte, welcher Art sie waren, hätte ich freudig die Burg von Exham dem Moos, den Fledermäusen und den Spinnweben überlassen.
Als mein Vater 1904 starb, gab es keine Botschaft mehr, die er mir oder meinem einzigen Kind, Alfred, einem zehnjährigen Jungen ohne Mutter, hätte hinterlassen können. Dieser Junge war es, der die Familientradition wieder aufleben ließ, obwohl ich ihm nur ein paar Bruchstücke über unsere Vergangenheit mitteilen konnte, schrieb er mir von einigen interessanten alten Legenden, als er im Ersten Weltkrieg 1917 als Pilot nach England kam. Augenscheinlich hatten die Delapores eine abwechslungsreiche und auch dunkle Geschichte, denn ein Freund meines Sohns, Hauptmann Edward Norrys vom Royal Flying Corps, der in der Nähe unseres Familiensitzes in Anchester beheimatet war, berichtete vom Aberglauben der Landbevölkerung, den nur wenige Schriftsteller an Wildheit und Unglaublichem in der Lage wären, zu überbieten. Norry selbst nahm die Sache natürlich nicht ernst, doch mein Sohn fand Gefallen daran und füllte damit seine Briefe an mich. Zweifellos haben die Legenden meine Aufmerksamkeit auf unser überseeisches Erbe gelenkt und mich dazu gebracht, unseren Familiensitz zu erwerben und zu restaurieren, den Edward Norrys Alfred in seiner bildschönen Abgeschiedenheit gezeigt und angeboten hatte, einen sehr guten Preis dafür herauszuschlagen, da sein Onkel der momentane Besitzer wäre.
Ich kaufte die Burg 1918, wurde aber kurz darauf von meinem Plan, sie zu restaurieren, abgebracht, da mein Sohn als Kriegsinvalide heimkehrte. Während der zwei Jahre, die er noch lebte, kümmerte ich mich ausschließlich um seine Pflege und hatte sogar mein Geschäft meinen Partnern überlassen.
Im Jahr 1921 fühlte ich mich einsam und ohne Ziel, war ein Unternehmer im Ruhestand, nicht mehr jung, und beschloss, meine verbleibenden Jahre meinem neuen Besitz zu widmen. Als ich Anchester im Dezember besuchte, kümmerte sich Hauptmann Norrys, ein fülliger, liebenswerter junger Mann, um mich, der häufig an meinen Sohn gedacht hatte und mir seine Hilfe bei der bevorstehenden Restauration zusicherte, indem er Pläne und Berichte über die Burg zusammensuchte. Die Burg von Exham selbst begutachtete ich ohne besondere Gefühle, ein Haufen zusammengefallener, mittelalterlicher Ruinen, von Flechten überwachsen und überzogen mit Krähennestern. Die Mauerreste ragten gefährlich über einen Abhang, ohne Fußböden oder Innenkonstruktionen, lediglich die Steinmauern der frei stehenden Türme waren vorhanden.
Nachdem ich mir langsam eine Vorstellung verschafft hatte, wie das Gebäude vor dreihundert Jahren, als meine Vorfahren es verlassen hatten, ausgesehen hatte, begann ich, Arbeiter für den Wiederaufbau anzustellen. Dazu musste ich außerhalb der näheren Umgebung nach Leuten suchen, denn die Menschen aus dem Dorf Anchester hatten eine fast unglaubliche Furcht vor dem Ort und einen ebenso großen Hass darauf. Diese Vorurteile waren so mächtig, dass sie manchmal ihren Weg zu den Arbeitern von außerhalb fanden und viele von ihnen einfach wegliefen. Dieser Aberglaube schien sowohl das Gebäude als auch unsere Familie zu betreffen.
Mein Sohn hatte mir erzählt, dass man ihn während seines Besuches gemieden hatte, weil er ein de la Poer war, und mir ging es jetzt ähnlich, bis ich die Dorfbewohner davon überzeugte, wie wenig ich von meiner Abstammung wusste. Selbst dann brachten sie mir noch Abneigung entgegen, sodass ich meine Kenntnisse über die Geschichte des Dorfes durch Edward Norrys erhielt. Was mir die Leute nicht verziehen, war, dass ich das Symbol des Abscheus wieder aufbauen wollte, denn, ob nun vernünftig oder nicht, für sie war die Burg von Exham nichts weniger als ein Hort des Satans und der Werwölfe.
Als ich die Erzählungen, die Norrys für mich zusammentrug, in Verbindung brachte und sie mit den Berichten verschiedener Gelehrter, die die Ruinen untersucht hatten, ergänzte, fand ich heraus, dass das Gebäude auf einem Platz stand, wo sich ein prähistorischer Tempel befunden hatte, ein Druidentempel oder etwas noch Älteres, das aus der Zeit von Stonehenge stammte. Dass dort unbeschreibliche Riten durchgeführt wurden, bezweifelten nur wenige, und es gab beunruhigende Berichte, nach denen diese Rituale vom Zybelekult, den die Römer einführten, übernommen worden seien.
Inschriften, die in den unterirdischen Fundamenten noch erkennbar waren, trugen solch eindeutige Buchstaben wie: »DIV …OPS …MAGNA.MAT …«, Zeichen der Magna Mater, deren dunkler Kult einstmals vergeblich den römischen Bürgern verboten wurde. Anchester war das Lager der dritten Augustinischen Legion gewesen, wie man an vielen Überbleibseln noch sehen konnte, und man sagte, dass der Tempel der Kybele prächtig und von Gläubigen überlaufen war, die namenlose Rituale unter Anleitung eines phrygischen Priesters durchführten. Die Berichte besagten zudem, dass mit dem Niedergang der alten Religion die Orgien in dem Tempel nicht aufhörten, sondern die Priester im Gewand des neuen Glaubens ihre alten Riten vollzogen. Außerdem, so hieß es, seien die Rituale nicht mit dem Abzug der Römer verschwunden und dass bestimmte Anglosachsen die Überreste des Tempels wieder in alter Form instand setzten und daraus eine Kultstätte entstand, die in der Hälfte des Siebenkönigreichs gefürchtet wurde. Um 1000 n. Chr. wurde dieser Ort in einer Chronik erwähnt als ein bedeutendes Kloster, in dem ein seltsamer und mächtiger Mönchsorden residierte und das von weitläufigen Gärten umgeben ist, die keine Mauern brauchten, um die eingeschüchterte Bevölkerung davon fernzuhalten. Es wurde nie von den Dänen zerstört, doch nach der Normanneninvasion musste ein dramatischer Niedergang stattgefunden haben, denn als Heinrich III. 1261 die Ländereien meinem Vorfahren Gilbert de la Poer, erster Baron von Exham, übereignete, gab es keinen Einspruch.
Vor diesem Zeitpunkt gibt es über meine Familie keine schlechten Zeugnisse, also musste sich danach etwas Merkwürdiges ereignet haben. In einer Chronik findet sich im Jahre 1307 ein Hinweis auf die de la Poer als »von Gott verflucht«, während die Dorflegenden nichts außer Bösem und einer schrecklichen Furcht vor der Burg berichten, die auf den Grundmauern des Tempels und des Klosters errichtet wurde. Was man sich an den Feuerstellen erzählte, war entsetzlich grauenhaft und wurde noch schlimmer durch die furchtsamen Auslassungen und das unbestimmte Drumherumreden. Meine Vorfahren wurden darin als eine Familie von ketzerischen Dämonen geschildert, gegen die Gilles de Rais und der Marquis de Sade wie blutige Anfänger erschienen, und über viele Generationen machten Gerüchte sie für das gelegentliche Verschwinden von Dorfbewohnern verantwortlich.
Die Schlimmsten sollen die Barone und ihre direkten Nachkommen gewesen sein, zumindest beschäftigten sich die meisten Geschichten mit ihnen. Wenn einer der Erben weniger abseitig veranlagt war, so wurde behauptet, dann starb er auf geheimnisvolle Weise früh, um einem Nachkommen Platz zu machen, der mehr der Art entsprach. Es schien einen inneren Zirkel in der Familie zu geben, der vom Familienoberhaupt angeführt wurde und nur ein paar Mitgliedern zugänglich war. Mehr die Veranlagung als die Abstammung regelte offensichtlich den Zugang zu diesem Zirkel, denn ihm gehörten auch einige an, die in die Familie einheirateten. Lady Margaret Trevor aus Cornwall, Gemahlin von Godfrey, dem zweiten Sohn des fünften Baron, wurde zu einem beliebten Schreckgespenst aller Kinder in der Gegend und die dämonische Heldin einer besonderen, schrecklichen Ballade, die man an der walisischen Grenze immer noch kennt. Ebenso in einer Ballade am Leben erhalten, doch als Beispiel für eine ganz andere Sache, ist die abscheuliche Geschichte von Lady Mary de la Poer, die kurz nach ihrer Heirat mit dem Earl von Shrewsfield von diesem und seiner Mutter getötet wurde, wobei beide Mörder von dem Priester, dem sie erzählten, was sie öffentlich nicht preiszugeben wagten, die Absolution erhielten und gesegnet wurden.
Diese Legenden und Balladen waren typisch für den groben Aberglauben und widerten mich entsetzlich an. Ihr Beharrungsvermögen und ihre Verbindung zu der langen Reihe meiner Vorfahren war dabei besonders abstoßend, während die Andeutung von schrecklichen Gewohnheiten unangenehm an den einzigen bekannten Skandal unter meinen unmittelbaren Vorfahren erinnerte, an meinen jungen Cousin Randolph Delapore aus Carfax, der sich unter die Neger mischte und ein Voodoopriester wurde, nachdem er aus dem amerikanisch-mexikanischen Krieg zurückgekehrt war.
Viel weniger beunruhigten mich die unbestimmten Berichte von Heulen und Stöhnen in dem kahlen, stürmischen Tal unterhalb der Kalksteinklippe, den Friedhofsgerüchen nach den Frühjahrsregen, dem zappelnden, quiekenden Ding, auf das Sir John Claves Pferd eines Nachts in einem einsamen Feld getreten war, und über den Diener, der über das, was er am helllichten Tage in dem Gebäude gesehen hatte, wahnsinnig geworden war. Das waren abgedroschene Gespenstergeschichten, und zu diesem Zeitpunkt war ich ein ausgewiesener Skeptiker. Die Berichte über das Verschwinden von Bauern konnte man nicht so leicht abtun, doch sie waren auch nichts Besonderes, wenn man von mittelalterlichen Verhältnissen ausging. Unverschämte Neugierde bedeutete den Tod, und mehr als einmal wurden die abgeschlagenen Köpfe öffentlich um das Gebäude herum zur Schau gestellt.
Einige dieser Erzählungen waren überaus bildhaft, und ich wünschte, ich hätte mich in meiner Jugend mehr mit den unterschiedlichen Mythologien beschäftigt. Zum Beispiel glaubte man, Legionen von Teufeln mit Fledermausflügeln hielten jede Nacht in dem Gebäude Hexensabbat. Diese Legionen erklärten zum Beispiel die übermäßig reiche Ernte an Feldfrüchten in den weiten Gärten. Am ausgeschmücktesten aber war der dramatische Bericht von den Ratten – dieses wogende Heer ekelhaften Ungeziefers, das drei Monate nach der Tragödie, die in der Flucht endete, aus der Burg hervorbrach – dieses glatte, schmutzige, eklige Heer, das alles vor sich her trieb und das Geflügel, Katzen, Hunde, Schafe und sogar zwei hilflose Menschen tötete, bevor seine Raserei abgeklungen war. Um diese unvergessliche Nagetierflut hatte sich ein eigener Reigen von Geschichten gebildet, denn sie kursierten zwischen den Dorfbewohnern, und in ihrem Kielwasser schwammen die Flüche und das Grauen.
Mit dieserart von Gerüchten hatte ich es zu tun, als ich mich mit einer durch das Alter bedingten Hartnäckigkeit an die Arbeit machte, das Haus meiner Vorfahren wieder aufzubauen. Man sollte aber nicht einen Moment lang glauben, dass diese Erzählungen meinen psychischen Zustand in irgendeiner Form beeinflussten. Auf der anderen Seite wurde mir von Hauptmann Norry und den Gelehrten, die mir beistanden und halfen, unausgesetzt Beifall und Ermutigung zuteil. Nachdem die Aufgabe zwei Jahre nach ihrem Beginn gelöst war, betrachtete ich die großen Räume, die getäfelten Wände, die hohen Decken, die Sprossenfenster und breiten Treppen mit einem Stolz, der mich für die immensen Kosten der Arbeiten entschädigte.
Jeder Aspekt des Mittelalters war beeindruckend wiederhergestellt, und die neuen Abschnitte verbanden sich perfekt mit den alten Mauern und Fundamenten. Der Stammsitz meiner Väter war fertig, und ich hoffte, dass mir nun doch noch der Ruhm eines Geschlechts zuteilwurde, dessen letzter Vertreter ich war. Ich würde hier wohnen und beweisen, dass ein de la Poer (ich hatte wieder die eigentliche Schreibweise des Namens angenommen) nicht notwendigerweise ein Teufel sein musste. Für meine Bequemlichkeit war natürlich gesorgt, denn wenn auch die Burg von Exham im mittelalterlichen Baustil errichtet war, war innen doch alles neu und frei von Ungeziefer und Geistern.
Wie ich schon gesagt habe, zog ich am 16. Juli 1923 ein. Mein Haushalt bestand aus sieben Bediensteten und neun Katzen, die mir besonders ans Herz gewachsen waren. Meine älteste Katze Blacky war sieben Jahre alt und stammte noch aus meinem Haus in Boston, Massachusetts, die anderen hatte ich mir, als die Burg restauriert wurde, während meines Aufenthalts bei Hauptmann Norrys’ Familie angeschafft.
Die ersten fünf Tage waren geprägt durch außerordentliche Gelassenheit, und ich widmete mich der Auflistung der alten Familiendaten. Ich hatte inzwischen einige ausführliche Berichte von der letztendlichen Tragödie und der Flucht von Walter de la Poer zusammengetragen, von denen ich überzeugt war, dass sie der Inhalt des Umschlags waren, der beim Brand von Carfax vernichtet wurde. Es hatte den Anschein, dass mein Vorfahr zu Recht verflucht wurde, weil er alle anderen Mitglieder des Haushalts, außer vier mitbeteiligten Dienern, im Schlaf ermordet hatte. Dies geschah ungefähr zwei Wochen nach einer schockierenden Entdeckung, die sein ganzes Verhalten veränderte, die er aber niemandem sonst enthüllte, außer vielleicht den Bediensteten, die ihm halfen und danach die Flucht ergriffen.
Dieses Abschlachten, das den Vater, drei Brüder und zwei Schwestern einschloss, wurde ihm von den Dorfbewohnern verziehen und so nachlässig von den Vertretern des Gesetzes geahndet, dass der Verantwortliche geehrt, unbehelligt und offen nach Virginia auswandern konnte, wobei das allgemeine Gerücht die Runde machte, dass er das Land von einem uralten Fluch befreit hätte. Welche Entdeckung zu einer solch schrecklichen Handlung geführt haben konnte, lag außerhalb meiner Vorstellungskraft. Walter de la Poer musste schon jahrelang gewusst haben, was über seine Familie geredet wurde, sodass ihm neue Gerüchte keinen Anlass gegeben haben konnten. War er dann Zeuge eines abstoßenden, uralten Rituals geworden oder war er über ein furchtbares und enthüllendes Symbol in der Burg oder in unmittelbarer Nähe gestolpert? In England hatte er den Ruf eines zurückhaltenden, sanften Jünglings. In Virginia erschien er weniger hart und verbittert als eher gequält und ängstlich. Ein anderer herrschaftlicher Abenteurer, Francis Harley, erwähnt ihn in seinem Tagebuch als einen Mann von beispiellosem Gerechtigkeitssinn, Ehre und Geschmack.
Am 22. Juli ereignete sich der erste Zwischenfall, der, zuerst leicht abgetan, im Licht der späteren Ereignisse seine Bedeutung gewann. Er war so beiläufig und bedeutungslos und unter den gegebenen Umständen völlig unauffällig, aber man muss sich vor Augen führen, dass ich mich in einem, mit Ausnahme der Mauern, völlig neuem Gebäude aufhielt und von gut ausgewählten Bediensteten umgeben war, sodass jegliche Vorahnung, wenn man nicht den Ort in Betracht zog, ganz abseitig war.
Woran ich mich später erinnerte, war Folgendes: mein alter schwarzer Kater, dessen Stimmungen ich gut kannte, war ohne Zweifel in einem Maße, das gar nicht seinem Charakter entsprach, beunruhigt und verängstigt. Er lief ruhelos und verstört von einem Raum in den anderen und schnüffelte unausgesetzt an den Mauern, die noch Teil des ehemaligen Bauwerks waren. Ich weiß, wie abgedroschen das klingt – wie der unvermeidliche Hund in einer Gespenstergeschichte, der immer knurrt, bevor sein Herr die Gestalt im Betttuch sieht – trotzdem kann ich es nicht ändern.
Am nächsten Tag beschwerte sich ein Diener über die Ruhelosigkeit sämtlicher Katzen im Haus. Er suchte mich in meinem Arbeitszimmer, einem hohen, nach Westen gelegenen Raum im ersten Stock auf, der weite Bögen, eine dunkle Eichentäfelung und ein dreigeteiltes spitzbogiges Fenster hatte, von dem man die Kalksteinklippe hinunter auf das öde Tal blickte, und selbst als er sprach, sah ich die schwarze Gestalt von Blacky an der westlichen Mauer entlangschleichen und an den neuen Paneelen kratzen, die die alte Steinmauer verkleideten.