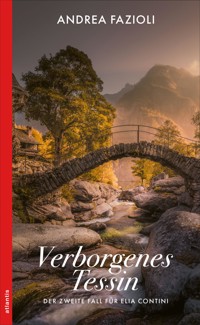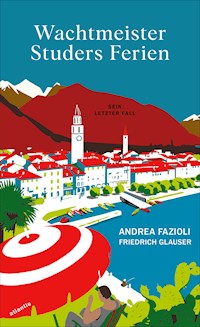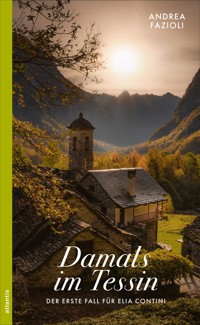
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Elia Contini
- Sprache: Deutsch
Zwanzig Jahre sind vergangen, seit Malvaglia, ein kleines Dorf in den Tessiner Bergen, geflutet wurde, um auf dem Gelände einen Stausee entstehen zu lassen. Beinahe haben die einstigen Bewohner, deren Häuser damals unter Wasser gesetzt wurden, das Unrecht vergessen. Besonders der verschlossene Privatdetektiv Elia Contini, der zurückgezogen in einem Häuschen in den Bergen wohnt und am liebsten durch die Wälder streift, um Füchse zu fotografieren, denkt ungern an die Zeit zurück, in der sein Vater unter ungeklärten Umständen verschwand. Doch jetzt soll der Stausee erweitert und jener Teil des Sees trockengelegt werden, auf dem auch das Haus seiner Kindheit stand. Alte Wunden brechen auf. Als kurz hintereinander der Bürgermeister und ein Ingenieur ermordet werden, gerät Contini ins Fadenkreuz der Ermittler. Um sich selbst zu entlasten, muss er sich endlich der Vergangenheit stellen und herausfinden, was damals wirklich geschah ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andrea Fazioli
Verschwundenes Tessin
Kriminalroman
Aus dem Italienischen von Barbara Schaden
atlantis
Da ist er. Ganz nahe, spürbar. Mit angehaltenem Atem hinter dem Vorhang versteckt. Schräg fällt die Sonne in den Dachboden. Tommi duckt sich in den Schatten. Die Schritte knarzen auf dem Holzboden. Licht und Dunkel. Der Nachmittag in den Fensterscheiben nimmt kein Ende.
Es sind Sommerferien. Ein Tag im Juli. Erinnert sich jemand, dass es außer Spielen, Wettrennen auf den Wiesen und Abenteuern im Wald noch etwas anderes gibt? Was ist aus der Welt geworden?
Draußen auf der Straße fährt hupend das Postauto vorbei.
Er darf sich nicht erwischen lassen. Aber der andere ist geduldig: Er wartet und wartet, bis es Tommi nicht mehr aushält.
»Hab dich!«
»He, das gilt nicht, du kannst nicht einfach bloß hier rumstehen!«
»Jetzt musst du dich verstecken …«
»Ja, aber du musst mich suchen!«
Die Stimmen schrillen. Staubteilchen kreisen in den Sonnenstrahlen. Das große Haus ist voller Geheimnisse. Die beiden Buben rennen zwischen den Möbeln im Salon hindurch, verstecken sich hinter dem Flügel, steigen in Schränke, in denen es alt riecht.
Später laufen sie hinaus auf die Wiesen rings ums Haus, hinaus ins Brummen der Insekten und ins Abendlicht. Bis Tommi, der wie ein Indianer durchs hohe Gras robbt, die Stimme seines Vaters hört: »Tommiiii! Eeeeessen!«
Die Vokale ziehen sich in die Länge, auch sie enden nie, wie der Nachmittag. Tommi muss trotzdem gehen. Sein Haus steht ein paar hundert Meter entfernt.
»Mein Vater wird böse, wenn ich nicht sofort komme!«
»Na, dann geh …«
»Ciao!«
»Bis morgen!«
1Das Fotozimmer
An einem Tag im Sommer beschloss Tommi, als er morgens aufwachte, jemanden umzubringen. Er hatte am Abend die Fensterläden offen gelassen, und ein Sonnenstrahl hatte ihn noch vor dem Wecker aus dem Schlaf gerissen. Eigentlich war es kein richtiger Entschluss, nur eine unbestimmte Idee, die sich zwischen Halbschlaf und dem ersten bewussten Gedanken breitmachte.
Nach so vielen Jahren war allmählich die Normalität zurückgekehrt. Auch Tommi war fast so weit gewesen, das Unrecht zu vergessen. Aber jetzt wollten sie das Becken des Stausees verbreitern und die Orte seiner Kindheit noch tiefer unter Wasser setzen. Jetzt musste er reagieren und war sogar bereit, Gewalt anzuwenden, um der Welt zu zeigen, was Unrecht und was Recht war. Das empfand er wie eine Pflicht, eine Schuld gegenüber dem Andenken seines Vaters und seines Elternhauses.
Er schälte sich aus dem Bett. Normalerweise brauchte er eine gute halbe Stunde, bis er vollständig wach war, an diesem Morgen aber rüttelte ihn die Wut binnen Minuten auf. Er schlüpfte in seine Pantoffeln und riss mit nacktem Oberkörper das Fenster auf. Die Sonne blendete ihn, und er kniff die Augen zusammen.
Auf den Kaffee verzichtete er. Er schenkte sich ein Glas Milch ein und trat damit vors Haus. Es war ein Dienstag im August, Viertel nach sieben, und draußen war es kühl. Auf der Straße nach Malvaglia, zwei Meter von ihm entfernt, fuhr der alte Toyota der Signora Bionda vorbei. Da schau her, dachte Tommi, die sitzt sogar im August um Punkt acht an ihrem Schreibtisch. Signora Bionda arbeitete in Bellinzona in der Bank und nahm morgens und abends eine halbe Stunde Fahrt in Kauf, weil sie nicht aus dem Bleniotal fortwollte. Verständlich; auch Tommi wäre nie von Malvaglia, nie von dem Staudamm weggezogen.
Er reckte sich und dachte an den Tag, der vor ihm lag. Gegen halb neun musste er sich auf den Weg machen, damit er um neun in Lodrino war, im Autohaus Barenco. Hoffentlich hatte sich das Ehepaar Barenco inzwischen versöhnt. In letzter Zeit herrschte dicke Luft. Am Vortag hatte Tommi das Büro als verlassenes Schlachtfeld vorgefunden: verstreute Papiere, die Kundenkartei umgekippt, die Kaffeemaschine auf dem Fußboden. Blass und ohne ihm in die Augen zu schauen, hatte ihn Signor Barenco empfangen.
»Ich hatte eine Auseinandersetzung mit meiner Frau …«
»So kann ich nicht arbeiten«, hatte Tommi geantwortet.
»Du musst entschuldigen, Tommaso, es ist so, dass …«
»Ich fahr wieder heim«, hatte Tommi entgegnet und war, ohne auf Barencos Beteuerungen einzugehen, in seinen brandneuen Honda Civic gestiegen und nach Malvaglia zurückgekehrt. Schließlich war er Büroangestellter und kein Hanswurst, mit dem man umspringen konnte, wie es einem passte.
Dabei gefiel ihm sein Job. Besonders anstrengend war er nicht: Er kümmerte sich um die Buchhaltung, erledigte die Korrespondenz und hielt die Kundenkartei auf aktuellem Stand. Interessant fand er, wie die Leute mit ihren Autos umgingen. Da gab es die Pedanten, die den Versicherungsvertrag bis zum letzten Komma auswendig kannten und jeden Monat eine »Generalüberholung« machen ließen, wie Signor Barenco das nannte. Und es gab andere, denen alles egal war und die ihr Auto behandelten wie … na, eben wie ein Auto. Dabei müssten Autos eigentlich wie Menschen behandelt werden, an ihnen ist genauso viel Unvorhersehbares und Geheimnisvolles wie beispielsweise an einer faszinierenden Frau.
Aber faszinierende Frauen gibt es wenige, dachte Tommi, während er sich vor dem Spiegel rasierte. Wenig faszinierende Frauen und noch weniger phantastische Autos.
An diesem Morgen empfand er beim Blick auf den Staudamm nicht die gewohnte Bitterkeit, sondern beinahe Euphorie. Die Zeit der Trauer war vorbei. Jetzt würde er kämpfen, endlich. Man hatte ihn seiner Kindheit beraubt, und das forderte Strafe.
Im Büro war nicht viel zu tun. Die Barencos hatten offenbar einen Waffenstillstand geschlossen, zum Glück, und dass Tommi sie tags zuvor einfach hatte sitzen lassen, wurde mit keinem Wort erwähnt. Außer an Signor Costantini zu schreiben und ihn daran zu erinnern, dass in der kommenden Woche die Motorfahrzeugkontrolle für seinen alten Accord fällig war, tat Tommi bis zum Mittag praktisch nichts. Er hatte also Zeit zum Nachdenken. Irgendwann zog er den Brief wieder hervor, den er kürzlich erhalten hatte.
Sehr geehrter Signor Porta,
hiermit setzen wir Sie in Kenntnis, dass im Rahmen des Verfahrens zum Ausbau des Staudamms der Tessiner Elektrizitätsgesellschaft (SET) in Malvaglia, welche der Erhöhung der Speicherkapazität des Stausees dient, die Unterlagen über die zur Enteignung vorgesehenen Flächen in der Gemeindeverwaltung ausliegen; sollte sich eine der genannten Flächen am Nordufer des Stausees in Ihrem Eigentum befinden, bringen wir Ihnen hiermit zur Kenntnis, dass in nächster Zeit auf Kosten des Kantons eine Schätzung des Grundstückswerts vorgenommen wird.
Für die Gemeinde Malvaglia:
Der Bürgermeister
Giovanni Pellanda.
Ein einziger langer Satz, eine Verurteilung. Sie fühlten sich sicher, das war klar. Zusammen mit dem Brief hatten sie ihm eine Landkarte geschickt: Auf dem Gelände, das geflutet werden sollte, stand kein einziges Wohnhaus, nur ein paar Stadel. Es würde also niemand protestieren. Schon damals, vor zwanzig Jahren, war jeder Protest sinnlos gewesen. Damals hatten auf dem Gelände, das dem Ausbau des Stausees zum Opfer fallen sollte, eine Handvoll Häuser gestanden. Eine Handvoll Häuser, die trotz der Beschwerden der Bewohner unter Wasser gesetzt worden waren. Erbarmungslos ausgelöscht.
Er legte die Hände flach auf den Schreibtisch, seufzte und schloss sekundenlang die Augen. Denk jetzt nicht mehr dran. Denk an die MFK am Wagen von Signor Costantini.
Er stand auf und trat an den Schreibtisch seines Chefs.
»Diesmal schafft er’s nicht mehr«, sagte er.
»Wie bitte?«, fragte Barenco, der noch immer ein wenig mitgenommen wirkte.
»Der Accord von Signor Costantini. Er möchte, dass wir es noch mal versuchen, aber schon beim letzten Mal hat er’s nur mit Müh und Not geschafft.«
»Hm … tatsächlich? Weiß ich gar nicht mehr.«
»Es war das reinste Wunder, dass sie ihn noch mal durchgelassen haben, und Sie hatten eine ganze Woche dran gearbeitet. Ich weiß ja nicht, wie viel Signor Costantini in das Auto noch reinstecken will, aber …«
»Er wird es auf jeden Fall versuchen. Er liebt diese alte Kiste. Und wenn nur noch ein einziger Reifen übrig ist, wird er sagen, ich soll ihn gut aufpumpen und es versuchen.«
Tommi missbilligte diese Sentimentalität gegenüber Autos. Das Gesetz sieht alle zwei Jahre eine Fahrzeugkontrolle vor, deren Zweck es ist, nicht mehr funktionstüchtige Gefährte zur Verschrottung zu schicken. Und das war richtig so.
Im Lauf des Nachmittags las er den Brief der Gemeinde noch ein paar Mal. Ohne einen Anflug von Zweifel und ohne Taktgefühl: Sie fassten einen Beschluss und teilten ihn dem Volk mit, Punkt. Schweizer Effizienz. Es brauchte mehr Strom? Wurden eben ein paar Dörfer geflutet. Malvaglia war ein kleines Gebirgskaff in einem der touristisch besterschlossenen Täler des Kantons Tessin. Tommi war Mitte dreißig und bestimmt nicht menschenscheu. Aber wenn er abends von der Arbeit nach Hause kam, liebte er die Stille, den Dialekt der Leute, die dunklen Straßen im Winter. Die Touristen liebte er nicht, und in der Stadt hielt er es nicht länger als einen Monat aus: Nach kurzer Zeit ergriff ihn eine Schwermut, die ihn niederdrückte, ihm nachts den Schlaf raubte und ihn nervös machte, ja aggressiv.
An diesem Abend schlenderte er den Staudamm entlang. Er hatte versucht, an etwas anderes zu denken. An Mathematik: Er betrieb sie im Selbststudium, das war sein Freizeitvergnügen, mit Begeisterung löste er Gleichungen und Rätsel, und momentan las er eine Abhandlung über Realanalyse. Aber jetzt gelang es ihm nicht, sich zu konzentrieren.
Diese Sache macht mich fertig, dachte er. Sein morgendlicher Entschluss war fast vergessen. Statt gleich Gewalt anzuwenden, sollte er sich vielleicht lieber an die Justiz wenden. Erst einmal abwarten, beschloss er. Vor dem Herbst konnte er sowieso keinen konkreten Schritt unternehmen.
Die nächsten Monate zogen sich hin wie Sekunden für einen, der die Luft anhält. Tommi hatte das Gefühl, er sei unter Wasser und halte mit geschlossenen Augen den Atem an. Er fuhr zur Arbeit, abends ging er manchmal in die Disco oder trank ein Bier in einem Pub. Er nahm eine Woche Urlaub und fuhr mit einem Freund fünf Tage nach Amsterdam.
Aber vergessen konnte er nicht.
Im Lauf der Wochen sammelte Tommi methodisch und geduldig die Fotos. Er sagte sich, das sei nichts als ein harmloses Hobby, genau wie die Mathematik. Manche Fotos fand er im Haus, in einem alten Album, auf andere stieß er in den Zeitungen oder im Internet. Am Ende warf er die hässlichsten weg, die restlichen unterzog er einer strengen Auswahl. Fünf Bilder blieben übrig. Sorgfältig ausgesuchte Porträts.
Als ein zweiter Brief eintraf, war Tommi bereit. Er hatte in seinem Gästezimmer, oben unter dem Dach, eine Wand frei gemacht. Jetzt schaffte er sämtliche Möbel hinaus, montierte sogar die Deckenlampe ab. Zurück blieben eine nackte Glühbirne, drei weiße Wände mit den Schmutzrändern der abgehängten Bilder und eine vierte Wand – die mit dem Fenster zum Staudamm –, an der er die Fotos befestigte.
Ein paar Tage lang hielt er sich immer nur wenige Minuten im Dachzimmer auf. Jeden Abend, wenn er von der Arbeit heimkam, ging er hinauf. Er sah sich die Fotos an, dann ging er wieder hinunter und machte sich Abendessen.
Manchmal rauchte er eine Zigarette, während er die fünf Gesichter betrachtete. Oder er nahm sich ein Glas Weißwein mit hinauf, oder ein Päckchen Chips. Nach und nach verbrachte er immer mehr Zeit in dem leeren Zimmer. Inzwischen starrte er die Gesichter nicht mehr nur an, sondern begann, sich einen Plan zurechtzulegen. Doch er schrieb keine Zeile davon auf, sprach kein Wort laut aus.
Dann kam Weihnachten. Der geplante Ausbau des Stausees begann Wirklichkeit zu werden, die Leute im Dorf redeten. Im Dezember waren auch die letzten Auseinandersetzungen zwischen den Parteien im Großen Rat beigelegt. Im Januar erhielt er wieder einen Brief, in dem die Behörden mitteilten, das im Eigentum von Herrn Tommaso Porta befindliche Grundstück habe einen Marktwert von zwanzigtausend Franken.
An diesem Abend nahm Tommi zwei Beistelltischchen und ein paar Kerzen mit ins Dachzimmer. Die Tischchen stellte er rechts und links neben den Fotos an die Wand. Dann zündete er zwei Kerzen an, steckte sie je in einen Kerzenständer und stellte einen auf jeden Tisch; das sah aus wie ein Altar. Die Glühbirne an der Decke schaltete er nicht ein; die Kerzen schienen ihm intimer, verschwiegener.
Er ließ den Blick hin und zurück über die Reihe der Gesichter wandern, die ihn von der Wand anstarrten. Der Bürgermeister Giovanni Pellanda. Der geachtete Ingenieur Alessandro Vassalli. Desolina Fontana. Andrea Porta – ein Jugendbild. Und auf einem Foto aus neuerer Zeit das hagere Gesicht von Elia Contini.
Tommi streckte die Hand nach einem der Fotos aus. Er betrachtete es mit halb geschlossenen Augen.
»Mach dich bereit«, flüsterte er. »Sei auf der Hut, Freund, jetzt ist es so weit. Morgen musst du bereit sein.«
Und in rauem, fast zärtlichem Ton fügte er hinzu: »Denn morgen bist du tot, verstehst du … Morgen bring ich dich um.«
2Die Gedanken einer Statue
Elia Contini widmete sich dem Anblick einer verliebten Frau. Ob es ein fröhlicher oder trauriger Anblick war, hätte er nicht sagen können, er beobachtete nur. Mit aller gebotenen Diskretion, versteht sich: Dafür wurde er bezahlt. Um herauszufinden, in wen und, vor allem, wie sehr Signora Elisa Rovelli verliebt war.
Von der Via Praella bis zum Kreisel verringerte Contini den Abstand zwischen ihren beiden Wagen. Denn gerade die Übergänge – eine Abzweigung, ein Kreisverkehr, eine Kreuzung – waren die kritischen Momente, in denen man häufig den Kontakt verlor. Und er wollte auf Nummer sicher gehen. Er hatte das Gefühl, dass seine Chance, nach zwei, drei Tagen ergebnisloser Beschattung, diesmal gekommen war. Signora Rovelli hatte gegen ihre morgendliche Routine verstoßen und sich um neun Uhr mit dem Audi A6 ihres Ehemannes in Lugano auf den Weg gemacht. Contini war ihr auf der Autobahn bis zur Ausfahrt Richtung Mendrisio gefolgt.
Es war ein kalter Vormittag, der Himmel von einem kompakten Weiß, das wie eine feste Wand wirkte; die Fahrzeuge und die Münder der Passanten stießen Dampfwolken aus. Elisa Rovelli parkte ihr Auto und ging zu Fuß die ansteigende Via Lavizzari hinauf. Contini setzte seinen Hut auf, versenkte die Hände in den Taschen und folgte ihr schlendernd, wie einer, der nichts zu tun hatte.
Ehemänner, die alles über ihre Gattinnen wissen wollen, sind die Rettung der Privatdetektive. Geier sind wir, dachte Contini. Das ist unsere Arbeit: uns im Schatten verstecken und heimlich die Liebe fotografieren.
Oben angelangt, bog Elisa Rovelli nach links und blieb auf dem Platz vor der Kirche stehen. Contini mimte Interesse an der Statue, die am Fuß der Treppe stand: eine männliche Gestalt, die aussah, als sei sie schon vor ihrer Statuenwerdung steinern gewesen. Ein stolzer Blick, empor und in die Zukunft gerichtet. Ein Schnauzbart, wie ihn heute keiner mehr trägt, eine hohe Stirn, eine mächtige Kinnlade.
Darunter eine Inschrift:
LUIGILAVIZZARI,
DEMGLÜHENDENPATRIOTEN,
GEOLOGENUNDNATURFORSCHER,
ENTDECKER
UNBEKANNTERWAHRHEITEN,
VONSEINENMITBÜRGERN
1900
Während er verstohlen Elisa Rovelli im Auge behielt, kam Contini die Erkenntnis, dass er und der glühende Patriot im Grunde Kollegen waren. Denn ein Privatdetektiv mag zwar ein Geier sein, mit Fug und Recht aber darf er sich als »Entdecker unbekannter Wahrheiten« bezeichnen. Grinsend trat der Detektiv ein paar Schritte zurück, um das edle Antlitz des Herrn Lavizzari genauer betrachten zu können.
»Na, Alter«, murmelte er, »wie viele Gehörnte hast du unter deinen Zeitgenossen aufgedeckt?«
Die Statue erwiderte nichts, aber Contini meinte hinter dem Schnauzbart gelinden Tadel zu erkennen.
Unterdessen war Elisa Rovelli nach einem Blick auf die Uhr in eine der Gassen der Altstadt eingebogen. Es war Viertel nach zehn an einem Montagmorgen im Januar, und die Straßen waren weitgehend menschenleer. Signora Rovelli und Elia Contini gingen vorbei an den Messingschildern der Anwaltskanzleien, an Bars mit verriegelten Türen, an neu eröffneten Läden, die gern Boutiquen sein wollten. Aus einer Seitengasse kam eine Alte, in einer Hand ihre Einkaufstasche, und fingerte umständlich ihren Schlüssel ins Schloss eines Haustors. Mendrisio mit seinen Lädchen, seinen Weinfesten, seinem Tratsch ist eine Kleinstadt mit dörflicher Seele. In diesen schmalen Gassen der Altstadt kam sich Contini vor, als beträte er ein fremdes Haus zu ungehöriger Stunde. Fast hatte er das Bedürfnis, auf Zehenspitzen zu schleichen.
Elisa ging jetzt eilig vor ihm her. Als er sie die Gemäldegalerie betreten sah, wusste er, dass sein Klient sich nicht geirrt hatte: Ein Museum ist ein idealer Ort für ein Stelldichein. Bevor auch er eintrat, wartete er ein paar Minuten, dann spähte er verstohlen hinein und sah Signora Rovelli mit großem Interesse ein Gemälde von Antonio Barzaghi-Cattaneo betrachten. Neben ihr stand ein Mann. Contini fotografierte die zwei von hinten und sah sie beim Klicken der Kamera zusammenzucken. Dann trat er näher, bat um Verzeihung, fotografierte das Bild und entfernte sich.
Mit weithin hörbaren Schritten durchquerte er den angrenzenden Saal, kehrte dann lautlos zurück und richtete von der Türschwelle aus seine Kamera auf das Paar. Es war wie im Theater.
SIE: Bin ich jetzt erschrocken!
ER: Das war nur ein Tourist.
SIE: Meinst du wirklich, dass hier ein guter Ort ist? Du weißt doch, ich kann’s mir nicht leisten …
ER: Ich weiß, ich weiß. Obwohl ich dich nicht verstehe.
SIE: Paolo, ich habe zwei Kinder, und wenn ich meinen Mann …
Etcetera. Sie wären fast in Streit geraten, aber Contini wusste, dass Heimlichkeit keinen ausgedehnten Krach zulässt.
ER: Eine Woche haben wir uns nicht gesehen …
SIE: Ach, Liebster, mir kommt es vor wie ein Jahr …
Und Contini bekam Gelegenheit, unter Barzaghi-Cattaneos düsteren Farbtönen einen unmissverständlichen Kuss festzuhalten. Der Titel des Gemäldes lautete Extremum dedit suavium, und wie der Titel vermuten ließ, schien es die Darstellung von Leidenschaft zu sein, bis in den Tod, als einer letzten Liebesgeste. Was jedoch den Geier interessierte, war der Beweis der Untreue.
Nach einem Dutzend Fotos ließ er es genug sein und wollte durch den Hinterausgang verschwinden. Aber in dem Moment, als er sich zum Gehen wandte, legte sich ihm eine Hand auf die Schulter.
Der Detektiv erstarrte.
»Nein so was! … Wenn ich nicht irre, bist du der junge Contini, oder?«
»Ja, aber es tut mir leid – wer …«
Contini erkannte ihn, noch bevor er die Frage beendet hatte. Die Brille war noch immer dieselbe, schwer und altmodisch, aber um die stecknadelkopfgroßen Augen hatte sich inzwischen ein Kranz von Runzeln gebildet.
»Ewig haben wir uns nicht gesehen! Wie ich höre, bist du Polizist geworden?«
»Mehr oder weniger. Aber gehen wir doch raus …«
Sie verließen das Museum durch den hinteren Ausgang und betraten eine Bar in der Via Santa Maria. Ausgerechnet ihn muss ich hier treffen, dachte Contini. Don Giacomo Bernardi, der vor der Flutung des alten Dorfkerns Pfarrer von Malvaglia gewesen war – mindestens fünfzehn Jahre hatte er ihn nicht gesehen.
»Hast du dir den Barzaghi-Cattaneo angesehen?«, fragte Don Giacomo. »Der Realismus dieses hingestreckten Körpers! Wirklich ergreifend, findest du nicht?«
Contini ging nicht darauf ein.
»Was verschlägt Sie denn nach Mendrisio?«, fragte er den Pfarrer. »Ich dachte, Sie sind noch im Bleniotal?«
»Nein, ich bin ans Selige-Jungfrau-Hospital versetzt worden. Ich bin ja nun nicht mehr der Jüngste … je näher ich also einem Krankenhaus bin, desto besser ist es!«
Eine Plaudertasche war Don Giacomo schon immer gewesen. Älter war er geworden, aber davon abgesehen schien er derselbe Geistliche, der sich in den achtziger Jahren der Seelen von Malvaglia angenommen hatte. Er trug einen Mantel, der eigentlich eine getarnte Soutane war: so schwarz und priesterlich, dass er seinen Träger auf den ersten Blick als das offenbarte, was er war.
»Weißt du, dass ich erst neulich an dich gedacht habe?«, fragte der Priester, und seine Äuglein funkelten hinter den Brillengläsern. »Du hast doch sicher den Ärger um den Ausbau des Stausees mitbekommen?«
»Nein, wieso, um was geht’s?«
»Na ja, sie wollen doch jetzt auch das Nordufer fluten, aber es regt sich Protest.«
Contini horchte auf.
»Und sollten sie den See vorher trockenlegen«, fuhr der alte Priester fort, »werden wohl auch die alten Häuser wieder auftauchen, unter anderem eures. Und wer weiß, was aus der Christophoruskapelle geworden ist – nach so vielen Jahren Feuchtigkeit!«
Continis Miene verfinsterte sich. Er hielt sich nicht gern mit der Vergangenheit auf. Wer in einer kleinen Realität lebt, muss sich vor der Erinnerung zu schützen wissen. Die Schweiz, im Herzen Europas, am Kreuzungspunkt aller Geschichten und aller Intrigen gelegen, ist von ihrer Fläche her wohl ein kleines Land, aber ihr Keller böser Erinnerungen ist tief.
»Davon weiß ich nichts«, sagte der Detektiv und winkte dem Kellner. »Was nehmen Sie?«
»Wie viel Uhr ist es denn? Elf – na gut, dann ist es schon Zeit für einen Aperitif. Einen Wermut, würde ich sagen …«
»Für mich ebenfalls. Sie sagten, es gibt Proteste. Wieso denn? Am Nordufer stehen doch keine Häuser, soviel ich weiß?«
»Nein, aber das Gelände dort ist zum Teil Bauland.«
Contini war seit Jahren nicht in Malvaglia gewesen, er wollte die alten Geschichten nicht wieder aufwärmen: Die neuen waren schon mühsam genug. Doch während er dem alten Pfarrer zuhörte, drängte sich, ob er wollte oder nicht, die Gestalt seines Vaters in seine Gedanken.
»Klar, von den früheren Eigentümern lebt fast keiner mehr«, sagte Don Giacomo, »aber was damals passiert ist, haben alle noch in sehr lebendiger Erinnerung, und wenn jetzt …«
»Aber es ist damals nichts passiert, was soll denn passiert sein«, fiel ihm Contini hastig ins Wort.
Der Pfarrer sah ihn verblüfft an. Aber er sagte nichts, hob nur die Brauen, schob seine Brille zurecht und wartete.
»Ich weiß schon, was Sie meinen«, sagte Contini, leise, denn nun brachte der Kellner die zwei Gläser Wermut. »Aber dass mein Vater und Martignoni damals verschwunden sind, hat mit dem Staudamm nichts zu tun.«
»Tja.« Mit einer Kopfbewegung, die an einen Spatz auf einem Brunnenrand erinnerte, nahm der Priester einen Schluck. »Davon weiß ich freilich nichts …«
Der Detektiv schüttelte den Kopf.
»Genau. Niemand weiß das, und was diese Legenden angeht …«
Don Giacomo hatte seine Brille abgenommen und riss die kurzsichtigen Äuglein auf. Jeder kannte die alten Gerüchte, und keiner redete offen darüber.
»Jedenfalls«, schloss der Detektiv, »reicht es mir mit diesen ewigen Andeutungen. Wenn sie den See ablaufen lassen, wäre das die Gelegenheit, uns ein für alle Mal Klarheit zu verschaffen.«
»Komisch.« Mit einem kleinen Lächeln setzte Don Giacomo die Brille wieder auf. »Du willst auf einmal Klarheit, Leute protestieren, ich treffe dich ganz zufällig in Mendrisio …«
»Don Giacomo! Jetzt sagen Sie mir nicht, dass Sie darin ein Zeichen sehen …«
»Ich weiß nicht.« Der Priester lächelte nicht mehr. »Ich weiß nicht. Aber manchmal bete ich noch für deinen Vater.«
Chico Malfanti stieg vorsichtig die Treppe neben dem Kino hinunter. Erst tags zuvor hatte er sich auf einer vereisten Stufe beinahe den Hals gebrochen. Diesmal war er auf der Hut, setzte die Füße auf jeder Stufe quer auf und erreichte sein Büro ohne misslichen Zwischenfall.
Die Anwaltskanzlei »Calgari & Partner« präsentierte sich der Welt mittels eines Messingschilds, das zwischen dem eines Kinderarztes und dem eines Zahnarztes hing. Signor Calgari pflegte zu scherzen, er nehme nur volljährige Klienten mit gesunden Zähnen, um seinen Nachbarn keine Konkurrenz zu machen.
Von den Volljährigen aber, dachte Chico, nehmen wir wirklich jeden. Der Mandant zum Beispiel, mit dem er an diesem Morgen einen Termin hatte: Der kam ihm vor wie ein Naivling, der sich wunder was von der Justiz erhofft. Außerdem hatte er die unangenehme Angewohnheit, ihn Federico zu nennen und zu duzen, nur weil er, Chico, erst siebenundzwanzig und frisch von der Uni war.
Der Blondschopf von Alessia Boldini, der Sekretärin, war das Erste, was ihm ins Auge stach, als er die Kanzlei betrat.
»Ciao, Alessia«, begrüßte er sie. »Ist der Herr Porta schon da?«
»Noch nicht.«
»Na gut, dann hab ich noch Zeit für einen Kaffee. Trinkst du einen mit?«
»Gern.«
Junganwalt Chico Malfanti war stolz auf seinen Kaffee. Dessen Zubereitung übernahm er grundsätzlich selbst: Unter Verschmähung von Kaffeemaschinen aller Art kochte er ihn in einem orientalischen Gefäß auf dem Herd. Während er mit der Kaffeemühle die Bohnen mahlte, blickte er zum Fenster hinaus und dachte daran, was ihn an diesem Tag erwartete. Um acht Uhr Termin mit Tommaso Porta; von neun bis zehn Erledigung der Korrespondenz; von zehn bis zwölf zwei weitere Termine mit Mandanten, und um zwei eine kleine Verhandlung vor dem Strafgericht wegen Fahrens in alkoholisiertem oder, wie man heute sagte, in fahruntüchtigem Zustand (was am Tatbestand des guten alten Rausches freilich nichts änderte).
Ein ziemlich ereignisreicher Tag, zum Glück. Chico saß nicht gern am Schreibtisch: Er liebte es, unterwegs zu sein, mit Leuten zu reden. Manchmal kamen ihm Zweifel, ob er den richtigen Beruf gewählt hatte; ein bisschen mehr Abenteuer wären ihm schon recht gewesen. Aber solche Gedanken gab ihm vielleicht nur der triste Anblick des Viertels San Giovanni in Bellinzona an einem kältestarren Januarmorgen ein. Die grauen Zweige der Platane vor dem Fenster regten sich kaum. Es war ein trockener Winter mit oft scharfem Wind, von dem die Hände rot und die Lippen rissig wurden. Kein Schnee, nicht mal an Weihnachten, und kein Nebel: nichts als Wind und eingerollte Blätter.
Chico empfing Porta, um ihn ein bisschen zu beeindrucken, im großen Besprechungssaal. Dort gab es einen ovalen Tisch, der sehr auf Weißes Haus machte, einen Zimmerfarn und an den Wänden zwei Hopper-Drucke. Chico spielte mit seinem Montblanc, während Porta redete.
»Also, Signor Porta«, unterbrach er ihn nach einer Weile unter spezieller Betonung des Signor. »Nur damit wir uns richtig verstehen: Sie wollen gegen den von der Elektrizitätsgesellschaft beschlossenen Ausbau des Stausees Beschwerde erheben und gleichzeitig das Beschwerdeverfahren von vor zwanzig Jahren wiederaufnehmen, bei dem es um den letzten Ausbau desselben Stausees ging. Verstehe ich das richtig?«
»Das verstehst du richtig, ja.«
Chico seufzte.
»Also, um ehrlich zu sein, ich sehe da keine großen Chancen, Signor Porta. Vor allem was die Vergangenheit betrifft. Was sollen wir denn tun? Nach zwanzig Jahren noch eine Entschädigung herauszuholen, halte ich für ausgeschlossen.«
Porta fuhr auf, als hätte Chico ihn beleidigt. Aber dann zwinkerte er zwei, drei Mal rasch hintereinander und fasste sich wieder.
»Heute ist das Umweltbewusstsein größer«, sagte er mit gesenkter Stimme.
»Ja, aber das Gesetz ist immer noch dasselbe.« Chico blätterte in den Unterlagen vor ihm auf dem Tisch. »Gut, im Bundesgesetz heißt es, Kraftwerke sind so anzulegen, dass die Landschaft dabei so wenig wie möglich verunstaltet wird. Aber was heißt ›so wenig wie möglich‹ im Fall eines bereits vorhandenen Staudamms?«
Tommaso Porta presste die Lippen zusammen und nickte langsam.
»Natürlich«, fuhr der Anwalt fort, »kann man eine Beschwerde gegen die neuerliche Enteignung ins Auge fassen. Wer weiß – vielleicht könnte man sich auf irgendeinen Verfahrensfehler berufen. Aber das ist vermintes Gelände, versprechen kann ich Ihnen nichts.«
»Keine Sorge, Versprechen brauche ich nicht.«
Porta starrte ihm in die Augen, und Chico verspürte einen Anflug von Nervosität.
»Wenn ich richtig verstanden habe, sprechen Sie für eine Gruppe von Grundeignern?«
»Sicher, ich habe jede Menge Unterschriften gesammelt. Sie sind alle auf meiner Seite.«
»Gut. In dem Fall werde ich mich mit Rechtsanwalt Calgari besprechen und mich dann wieder bei Ihnen melden.«
»Denen zeigen wir’s.« Tommaso Porta lächelte, aber sein Blick blieb ernst. »Die Achtziger sind vorbei, diesmal läuft es anders.«
»Hoffentlich«, schloss Chico und stand auf.
»Ich bin ganz sicher!« Tommaso Porta drückte ihm die Hand. »Gar kein Zweifel.«
Auch wenn der Kanton Tessin laut offizieller Bezeichnung eine Republik ist, wäre es falsch, ihn als einheitliches Gebilde zu betrachten. Zwar bezeichneten sich die Tessiner vor zwei Jahrhunderten als ein unteilbares Volk von Brüdern, in der Realität aber sieht sich der Bewohner von Airolo, der die Hockeymannschaft von Ambrì unterstützt und einen kantigen Dialekt spricht, durchaus nicht als Bruder eines Luganers – Fan des reicheren Hockey-Clubs Lugano und aufgebrezelt wie ein Mailänder … Der Monte Ceneri wird immer die Trennmauer bleiben.
Dann gibt es Leute wie Elia Contini, die im nördlichen Kantonsteil Sopraceneri wohnen und im Bezirk Lugano arbeiten. Jeden Abend kehrte der Detektiv in die Abgeschiedenheit seiner Berge zurück, tagsüber aber empfing er seine Klienten im mediterranen Paradiso, in einem ehemaligen Fischerschuppen mit Blick auf den Luganersee und den Monte Brè. Abgesehen davon, war Contini keiner von denen, die gefragt wurden, ob sie ein Ambrì- oder ein Lugano-Fan seien.
Contini, der an seinem Bericht über Elisa Rovellis Seitensprung saß, stand vom Schreibtisch auf und trat an das breite Fenster, das auf den See hinausging. Das graue Wasser sah aus wie eine endlose, vom Wind glatt geschliffene Steinplatte, und die Wolkendecke, hinter der die Sonne verschwand, verstärkte seine schlechte Laune.
Er setzte sich wieder. Der Rohrstuhl vor seinem Schreibtisch gab ein klagendes Knarzen von sich, das genau seiner Stimmung entsprach. Im Büro herrschte das gewohnte Chaos. Auf dem Tisch hatte er zwei Kakteen, seine Kamera, ein Miniaturfloß aus Holz, etliche Bleistifte, einen Computer und einen löchrigen Strohhut, der seit dem letzten Sommer hier lag.
Es war halb eins. Contini beschloss, sein Büro abzusperren und sich ein Mittagessen in Pieros Restaurant zu gönnen. Er machte sich auf den Weg ins Zentrum von Lugano, und eine halbe Stunde später, als er an einem Tisch mit kariertem Tischtuch saß, ließ ihn ein Teller mit dampfendem Risotto Elisa Rovelli und ihre heimliche Liebe für eine Weile vergessen.
Erst als er sich nach dem Essen eine Zigarette anzündete, ging ihm auf, dass es nicht die Beschattung war, die ihn aufwühlte – es war schließlich nicht die erste und ganz sicher nicht die letzte ihrer Art –, sondern die Begegnung mit Don Giacomo.
Er war es nicht gewohnt, seine Vergangenheit hinterfragen zu lassen. Vielleicht war er deshalb Detektiv geworden: Lieber war er derjenige, der die Fragen stellte, der ins Leben anderer Leute einbrach und dabei die Gewissheit hatte, dass er es früher oder später genauso plötzlich, wenn auch vielleicht mit kleinem Bedauern, für immer wieder verließ. Jetzt indes zeichnete sich ein Geheimnis ab, das ihn direkt anging. Seit Jahren hatte er nicht mehr an seinen Vater gedacht, und während er seine Zigarette ausdrückte, hatte er unwillkürlich die Hoffnung, dass der Stausee nicht abgelassen würde, dass die alten Häuser blieben, wo sie waren: unsichtbar auf dem Grund des Sees und in der Erinnerung.
Am Nachmittag brachte er nichts Sinnvolles mehr zustande. Gegen vier kehrte er, immer noch grüblerisch, nach Corvesco zurück.
Auf der Autobahn hörte er eine Jacques-Brel-Kassette, die ihm endlich die trüben Gedanken vertrieb. Avec le vent du nord qui vient s’écarteler … und diesen Wind über dem See, der ihn den ganzen Nachmittag nervös gemacht hatte, empfand er jetzt fast als wohltuend. Avec le vent du nord, écoutez-le craquer le plat pays qui est le mien …
Als er die Straße ins Dorf hinauffuhr, nahm sich Contini vor, den Abend seinen Füchsen zu widmen: Als Detektiv war er nämlich auch ein ganz passabler Amateurfotograf, und sein Spezialgebiet waren Füchse. In seiner Nachbarschaft lebten zwei, drei Exemplare, und abends ging Contini oft mit seiner Kamera in die Wälder hinaus. Einmal im Jahr klebte er seine Fotos in ein Album mit festem Einband und dem Etikett FÜCHSE. Im Januar begann die Paarungszeit, und man musste die Gelegenheit nutzen, wenn die Rüden weniger vorsichtig waren als sonst. Eingepackt in seinen Mantel mit Pelzkragen, die Mütze tief über die Ohren gezogen, waren ihm einige seiner besten Fotos im Januar gelungen.
Der Detektiv wohnte ein wenig außerhalb der Ortschaft Corvesco in einem Haus auf einem Hügel, einem alten Haus mit dicken Mauern, grünen Fensterläden und Veranda mit Blick auf das Tal.
Zu Hause zündete er im Wohnzimmer als Erstes ein Feuer im Kamin an und ließ sich dann in die daneben aufgespannte Hängematte fallen. Wie sein Büro war auch sein Zuhause mit den abwegigsten Gegenständen vollgestopft, die von einem mächtigen Orang-Utan aus Keramik bis hin zu einem violetten Fahrradrahmen reichten, in einer Ecke hatte er seine Kakteensammlung untergebracht. Er war beinahe eingenickt, als ihn die Türklingel aufschreckte.
Mit einem Ruck sprang er auf.
Francesca. Er hatte vergessen, dass sie vor der Abfahrt nach Mailand noch einmal vorbeischauen wollte. Er fuhr sich mit einer Hand durch die Haare und ging zur Tür.
»Ciao, Contini«, begrüßte sie ihn. »Ich wette, du hast mich vergessen!«
»Aber nein, bestimmt nicht …«
»Lüg nicht!«, sagte sie und küsste ihn auf den Mund.
Contini spürte die Kälte des Winterabends auf ihrer Haut. Er nahm sie bei der Hand und zog sie ins Haus. Er hatte Francesca Besson bei der Affäre um das Ruggeri-Collier kennengelernt, einer Verbrechensserie, die vor einiger Zeit die ganze Schweiz in Atem gehalten hatte und sogar in der italienischen Presse auf ein gewisses Interesse gestoßen war. Zwischen ihnen hatte sich eine Beziehung entwickelt und mit Höhen und Tiefen die folgenden Monate überdauert. Francesca war in den letzten Zügen ihrer Dissertation über Giorgio Bassani und hatte am nächsten Tag eine wichtige Unterredung mit ihrem Doktorvater an der Katholischen Universität Mailand vor sich.
»Na, bist du vorbereitet?«, fragte Contini, während er ihr aus dem Mantel half.
»Mehr oder weniger«, antwortete sie mit skeptischer Miene. »Ich hoffe nur, er reitet nicht auf der Bibliographie herum.«
Francesca trug einen langen Rock und einen weißen Pullover mit Rollkragen. Kaum hatte sie das Wohnzimmer betreten, schob sie sich die Ärmel hinauf. Der plötzliche Temperaturwechsel trieb ihr die Röte ins Gesicht. »Möchtest du was trinken?«, fragte Contini.
»Danke«, sagte Francesca, nahm einen Hut von einem der Wohnzimmersessel und ließ sich mit einem Seufzer hineinfallen. »Vielleicht einen Tee, falls du so was hast.«
»Müsste da sein.«
»Uff.« Francesca schüttelte ihr langes schwarzes Haar. »Ich bin wirklich todmüde. Und du, was machst du so? Hast du einen neuen Fall?«
»Nicht wirklich«, antwortete Contini aus der Küche.
»Das ist wieder mal eine typische Contini-Nichtaussage«, gab sie zurück. »Was heißt ›nicht wirklich‹?«
Contini sagte nichts mehr. Francesca stand auf und trat in die Küchentür.
»Und?«
»Es ist nicht wirklich ein neuer Fall«, brummte er, während er den Kessel unter den Wasserhahn hielt. »Heute Vormittag hab ich zufällig den ehemaligen Pfarrer von Malvaglia getroffen und musste dran denken, wie ich als Kind mit meinem Vater dort gewohnt habe.«
Francesca wurde hellhörig.
»Davon hast du nie was erzählt.«
Contini schwieg. »Jedenfalls«, sagte er nach einer ganzen Weile, »war ich noch keine fünfzehn, als mein Vater verschwand. Ich weiß nicht mehr viel.«
»Du kommst mir aber nicht vor wie einer, der leicht was vergisst.«
»Nein, leider. Aber in dem Fall gibt es nichts zu erinnern. Wir hatten ein Haus in einem kleinen Ortsteil von Malvaglia, in der Nähe des Staudamms. Wir mussten ausziehen, weil sie den See erweitern wollten, und kamen hierher, nach Corvesco.«
»Und dein Vater, wohin ist er verschwunden?«
»Weiß ich nicht. Aber ich glaub nicht, dass dich diese alten Geschichten interessieren …«
Francesca sah ihn eindringlich an.
»Verstehe: Sie interessieren dich.«
»Richtig!«
»Kurz bevor das Staubecken vollgelaufen war, ist mein Vater verschwunden. Er ist noch mal zum alten Haus zurück, um die letzten Sachen zu holen, daran erinnere ich mich. Und ich erinnere mich, wie ich mit dem Abendessen auf ihn gewartet habe … Aber danach hat ihn nie mehr jemand gesehen.«
Wieder entstand eine Pause.
»Und dann?«, fragte Francesca, nachdem er nicht weitersprach.
»Nichts. Man weiß nicht, was aus ihm geworden ist.«
In dem Moment begann der Kessel zu pfeifen.
»Der Tee«, sagte Contini. »Willst du ihn mit …«
»Aber hat ihn denn keiner gesucht?«
Der Detektiv seufzte.
»Gehen wir rüber ins Wohnzimmer, ich erzähl dir alles.«
Als sie sich wieder gesetzt hatten, fragte Francesca: »Wie kann es sein, dass ein Mensch von einem Tag auf den anderen einfach verschwindet?«
»Es kommt vor. In meinem Beruf kann ich ein Lied davon singen. Manche tauchen wieder auf, manche sind tot, und manche bleiben ein Geheimnis.«
»Wie dein Vater …«
»Wie mein Vater. Glaubst du vielleicht, man hätte ihn nicht gesucht? Aber keiner hat wirklich je wieder etwas von ihm gehört. In derselben Zeit ist außerdem ein Freund von ihm verschwunden, ein gewisser Luigi Martignoni, und später war zu hören, dass dieser Martignoni seinen Teilhaber übers Ohr gehauen hat und sich mit einem ansehnlichen Haufen Franken aus dem Staub gemacht hat, wer weiß, wohin. Das Gerede kannst du dir vorstellen …«
»Das heißt, die Leute haben gedacht, dass auch dein Vater …?«
»Genau. Mein Vater war durchaus nicht reich, aber … Die Leute dachten, er hat Martignoni bei der Flucht geholfen.«
»Und du?«
»Ich denke gar nichts.«
Francesca schwieg eine Weile. Dann murmelte sie: »Weißt du noch, als mein Vater gestorben ist?«
Contini nickte.
»Du hast gesagt, dass du’s nicht richtig findest, zu vergessen. Dass man die Toten nicht einfach gehen lassen soll, dass man sie nicht verlieren darf.«
»Die Toten …« Contini griff zu Zigarette und Feuerzeug. »Eben, die Toten. Mein Vater aber ist weder lebendig noch tot.«
Er zögerte.
»Er ist einfach verschwunden«, fügte er dann hinzu.
»Aber heute, sagst du, hast du was erfahren?«
»Nein, ich habe nur den damaligen Dorfpfarrer getroffen.« Contini zündete die Zigarette an. »Er sagt, sie wollen vielleicht den Stausee ablassen.«
Francesca sah ihn verständnislos an.
»Am Grund des Sees steht unser altes Haus«, erklärte er. »Und in der Gegend hier kursieren Legenden …«
Contini starrte in seinen Tee, als fände sich auf dem Grund der Tasse die Geschichte, die er erzählen sollte.
»Nicht weit von unserem Haus hatte Luigi Martignoni ein Ferienhaus. Mein Vater und er waren oft miteinander auf dem Berg und beim Angeln. Wie gesagt – nach dem Verschwinden der beiden stellte sich raus, dass Martignoni seinen Teilhaber betrogen hatte, einen gewissen Finzi, mit dem er eine Treuhandgesellschaft hatte. Als Martignoni und mein Vater verschwunden waren, dachten die einen an Flucht und die anderen … tja, es gab auch etliche, die dachten, sie seien gar nie fort gewesen.«
»Sondern?«
»Manche vermuteten, mein Vater und Martignoni seien ermordet und in einem der Häuser versteckt worden, die tags drauf geflutet wurden.«
»Oh! Hat die Polizei denn gesucht?«
»Gesucht schon … aber du kannst ja nicht einen ganzen See leeren und seinen Grund absuchen, bloß weil ein paar Leute Gerüchte in die Welt setzen. Außerdem soll Martignoni, bevor er verschwand, die eine oder andere Andeutung fallen lassen haben … Jedenfalls war die Fluchthypothese nicht so weit hergeholt.«
»Und du selber hast nie Nachforschungen angestellt?«
»Vor Jahren.«
»Und jetzt?«
»Jetzt weiß ich nicht, ob ich noch einen Versuch machen soll.«
Francesca trank einen Schluck Tee, um Zeit zu gewinnen. Vergessen … sie glaubte nicht, dass Contini je dazu in der Lage wäre.
»Wirst du denn jetzt noch mal nach deinem Vater suchen?«
»Vielleicht«, sagte Contini. »Aber schau mal, wie spät es ist … Musst du nicht zum Zug?«
»Du hast recht.« Francesca warf einen Blick auf die Uhr. »Jesusmaria, jetzt pressiert es aber!«
Contini begleitete sie zur Tür. Sie küsste ihn, dann rückte sie von ihm ab und sah ihm in die Augen.
»Pass auf dich auf.« Sie streichelte seine Wange. »Sieh zu, dass du keinen Ärger kriegst, ja?«
»Und du sieh zu, dass du deinen Prof um den Finger wickelst …«
Contini stand noch eine Weile vor der Tür und horchte Francescas davonfahrendem Auto nach. Dann kehrte er ins Haus zurück, schenkte sich den restlichen Tee ein und ging in den ersten Stock hinauf, wo ein angefangener Brief auf ihn wartete. Er drehte das letzte Blatt um und fügte auf der Rückseite ein paar Zeilen hinzu.
… und ich weiß wirklich nicht, wie ich Ihnen erklären soll, was ich damals dachte. Verstehen Sie, ich war noch keine fünfzehn, der Elia Contini, der ich damals war, kommt mir heute vor wie ein Fremder. Dabei habe ich damals begonnen, der zu werden, der ich heute bin, damals dachte ich zum ersten Mal daran, Detektiv zu werden. Ich weiß noch, wie merkwürdig mich Desolina Fontana immer ansah – als hätte sie mir was sagen wollen, sich aber nicht getraut. Aber wie ich schon sagte, ich wusste doch alles. Ich kannte die Geschichten von Abrechnung und überstürzter Flucht, ich kannte die Legenden von Gespenstern und Rache … aber konnte ich denn etwas tun? Ich war ja noch ein Kind.
Das Haus am Grund des Sees.
Während Francesca in Bellinzona den Bahnsteig auf und ab ging, kehrten ihre Gedanken zu Elias versenkter Kindheit zurück. Dass er nie ein Wort darüber verloren hatte. Dieser Mann hatte immer die gleiche undurchsichtige Miene, es war ein Elend. Sein Gesichtsausdruck änderte sich nie, egal, ob er seine französischen Chansons hörte oder von einem Fall erzählte oder, ja, ob er sie küsste. Immer das gleiche Gesicht.
Oft hatte Francesca ihn zu animieren versucht, sich auch einmal gehen zu lassen, aber ohne Erfolg: Zwischen Contini und der Welt stand eine unsichtbare Mauer. Er redete nie über sich, und er steckte voller Geheimnisse: zum Beispiel diese Briefe, die er an wer weiß wen schrieb und auf die er anscheinend nie eine Antwort erhielt. Vielleicht hatten sie beide wirklich nicht viel gemeinsam … Sie war etliche Jahre jünger als er, liebte soziale Kontakte, interessierte sich für Politik und Kunst, las mit Begeisterung. Er hingegen nahm nie ein Buch in die Hand, scherte sich einen Teufel um Politik und Kunst, kroch aber Stunden um Stunden durch die Wälder hinter Corvesco, wo er seinen Füchsen auflauerte.
Nein, vielleicht war das ungerecht. Neugierig war Elia schon, und wenn sie mit einem Vorschlag auf ihn zukam – einer Idee, einem Buch, einem Treffen –, ließ er sich immer darauf ein. Und jetzt? Hätte er wenigstens mal angedeutet, was er sich wünschte, wovor er Angst hatte. Aber nichts – er sah sie mit steinerner Miene an und erwartete, dass sie ohne irgendeinen Anhaltspunkt aus der Situation schlau würde. Es war, als müsste sie die Gedanken einer Statue erraten.
Francesca war so tief in Gedanken, dass sie den Mann mit der Windjacke glatt übersah. Erst kurz vor dem Zusammenstoß schreckte sie auf und versuchte noch auszuweichen, aber zu spät – sie verlor das Gleichgewicht und fiel ihm direkt in die Arme. Der Mann hielt sie fest und half ihr wieder auf die Beine. Er hatte eine Mütze auf dem Kopf, deren Schirm seine Augen verbarg, doch er wirkte belustigt.
»Obacht!«, sagte er überflüssigerweise.
»Entschuldigung, ich hab nicht aufgepasst, wo ich hintrete …«
»Das hab ich gemerkt! Haben Sie Ärger?«
»Nein … war nur in Gedanken.« Der Mann lächelte und nahm die Mütze ab. Er hatte blonde Haare und braune Augen. Francesca bemerkte seine Augenringe und stellte sich vor, dass er sich schon seit einer Ewigkeit auf einer strapaziösen Reise befand.
»Fahren Sie auch nach Mailand?«, fragte sie.
»Nur bis Lugano. Aber ich hab mich gar nicht vorgestellt.« Er schüttelte ihr die Hand und lächelte wieder. »Tommaso Porta. Und Sie?«
»Francesca.«
»Angenehm. Sagen wir du zueinander? Ich bin Tommi.«
3Chico und das Abenteuer
Federico Malfanti, genannt Chico, liebte das Abenteuer. Er kannte es nur vom Hörensagen, ahnte indes, dass hier die große Lücke seines Lebens klaffte. Bis er an einem kalten Januarabend, hinter dem Steuer seines ramponierten Peugeot 206 sitzend, eine erste, flüchtige Bekanntschaft mit dem Abenteuer machte. Und es gefiel ihm gar nicht.
Jeden Morgen fuhr er von seinem Elternhaus in Biasca zur Kanzlei Calgari & Partner in Bellinzona. Abends schleppte er sich entkräftet ins Fitnessstudio und anschließend nach Hause zum Essen. Er hätte sich gern eine Mietwohnung in der Stadt gesucht, aber damit wollte er noch warten, bis er genug verdiente, um sich was wirklich Schickes leisten zu können.
Auf der Autobahn dauerte die Fahrt nur eine Viertelstunde, an diesem Abend aber nahm Chico die Kantonstraße, denn er wollte über Lodrino fahren und Tommaso Porta die Stellungnahme von RA Calgari zu den Erfolgsaussichten der Beschwerde vorbeibringen. Vor zwanzig Jahren hatte Calgari eine Gruppe von Ausbaugegnern vertreten. Damals war er gescheitert; vielleicht wollte ihm Porta eine zweite Chance ermöglichen? Calgari riet ihm jedoch von seinem Vorhaben ab.
Vielleicht aber ließ sich Tommaso Porta von seinem Vorhaben nicht abraten.
Es war fast sieben, und Chico kam zügig voran: Die Welle des Sechs-Uhr-Verkehrs war bereits abgeebbt. Nach Gnosca legte er eine CD mit den alten Hits der Gruppe 883 ein. Solche Musik erlaubte er sich nur, wenn er ohne Zeugen im Auto saß – nicht dass ihn etwa jemand für spätpubertär hielt.
Dieser Abschnitt der Talsohle zwischen Bellinzona und Biasca ist ein modernes Niemandsland. Die Dörfer hier überlegen, sich zu zwei Großgemeinden zu vereinigen, sind aber unentschlossen. Das Tessin, pflegte Rechtsanwalt Calgari zu sagen, ist eines Abends als Dorf eingeschlafen und am anderen Morgen als Stadt wieder aufgewacht: eine einzige große Stadt aus verschiedenen, aneinandergrenzenden Gemeinden. Tatsächlich legte Chico zwischen einem Dorf und dem anderen ziemlich viele Kilometer zurück, bergauf und bergab. In einer Metropole wären das »Fahrten«. In der italienischen Schweiz nennt man es Reisen.
Zwischen Garagen, Nachtlokalen, Statuen- und Gartenmöbel-Lagerverkaufsstellen und dem einen oder anderen gelb oder blau gestrichenen Apartmentblock führte die Straße geradeaus, entlang der Bahnstrecke.
Chicos Stimmung war gut. Wieder lag ein Arbeitstag hinter ihm, und die Fahrt auf einer menschenleeren Straße, während aus den Lautsprechern Come mai schmetterte, behagte ihm. Am Ortseingang von Lodrino fiel ihm links sofort das Firmenschild des Autohauses Barenco auf: eine Leuchtschrift, die des amerikanischen Hinterlands würdig gewesen wäre. Der Junganwalt hielt neben der Zapfsäule, die zur Werkstatt gehörte. In dem Moment, als er aussteigen wollte, klopfte jemand an die Fensterscheibe der Beifahrertür.
»Salve!« Es war Tommaso Porta. »Danke, dass du extra herkommst!«
»Keine Ursache«, antwortete Chico. »Ich bringe die Stellungnahme meines Chefs.«
Porta setzte sich zu ihm ins Auto.
»Das Büro ist zu, Signor Barenco ist schon nach Haus gegangen. Aber wir können hier im Auto reden, wenn’s dir nichts ausmacht.«
»Wenn es dir nichts ausmacht …«, antwortete Chico, der sich mit der Duzerei abgefunden hatte.
Porta strahlte.
»Dann lass sehen!«, rief er. »Seid ihr kampfeslustig?«
»Ähm, also«, begann Chico hüstelnd. »Um die Wahrheit zu sagen: Die Angelegenheit ist komplizierter, als es den Anschein hat.«
»Kompliziert?«
»Also die Sache ist die, dass mein Chef, Rechtsanwalt Calgari, nicht sicher ist, ob der Heilige die Kerze wert ist …«
»Welcher Heilige? Welche Kerze?«
»Er meint, es steht nicht dafür. Sich gegen die Elektrizitätsgesellschaft und gegen den Kanton zu stellen, gegen ein Projekt von öffentlichem Nutzen, nur um ein paar Wiesen und Ställe zu retten …«
»Ställe?«
Chico war ratlos. Porta machte nicht den Eindruck, als sei er in der Lage, dem Gespräch zu folgen. Er versuchte es mit einem anderen Erklärungsansatz und kehrte dabei zur Höflichkeitsform zurück. »Schauen Sie, Signor Porta, es ist doch so, dass eine Klage, die sich allein auf mehr oder minder vorgeschobene ökologische Argumente …«
»Vorgeschoben?«
»… und vielleicht auf den einen oder anderen Verfahrensfehler stützt, Gefahr läuft, abgewiesen zu werden. Mein Chef rät Ihnen deshalb, auf den Rechtsweg zu verzichten, zumal …«
An dieser Stelle rastete Porta aus. Er stürzte sich auf den Anwalt und packte ihn am Kragen, und Chico hörte ihn schnaufen wie ein verletztes Tier, blickte in seine vor Wut schmal gewordenen Augen.
»O nein, ganz sicher nicht, kommt überhaupt nicht infrage, der Herr Rechtsanwalt Calgari wird sich hier nicht vornehm heraushalten!«
»Aber …«, versuchte Chico einzuwenden.
»Vor zwanzig Jahren hat er’s doch schon mal versucht, oder? Wieso will er diesmal nicht?«
»Jetzt reißen Sie sich bitte zusammen, Porta, und lassen Sie mich los!«
Aber Tommaso Porta ließ ihn nicht los, im Gegenteil: Jetzt quetschte er Chico gegen die Lehne. Das Fürchterlichste an dieser unmöglichen Situation war, dass Porta nicht einmal die Beherrschung verloren zu haben schien, sondern in ruhigem und festem Ton sprach: Seine Gewalttätigkeit wirkte eher wie das Ergebnis rationaler Überlegung als eines Affekts.
»Lassen Sie mich los! Ist Ihnen eigentlich klar, dass …«
»Mir ist nur eines klar: dass du jetzt zu deinem Boss gehst und dieses Mandat persönlich übernimmst.«
»Aber er will es nicht!«
»Überzeuge ihn. Lass dir was einfallen. Ich will kämpfen, verstehst du, und ihr seid die letzte Möglichkeit, um eine Tragödie zu verhindern!«
Der Typ ist wahnsinnig, dachte Chico.
»Schauen Sie, beruhigen Sie sich doch, gehen Sie vielleicht zu einem Arzt – vielleicht hat Sie der Stress, die Anspannung … und …«
Chico verstummte jäh.
Im Halbdunkel des Wagens blitzte etwas auf, eine Messerklinge, die einen Lichtschein einfing. Und im nächsten Moment auf ihn zuschnellte und ihn mit der Spitze in die Wange traf.
»Du tust, was ich dir sage. Klar?«
»Ich …«
»Ist das klar?«
»Hören Sie, Porta …«
»Ist das klar?«
»Ja.«
Das also war Abenteuer. Sanft, fast liebkosend, ließ Porta das Messer Chicos Wange hinab zur Kehle gleiten.
»Und glaub ja nicht, du kannst mich austricksen, okay?«
»Okay.«
»Die Sache ist wichtig für mich, verstehst du?«
»Verstehe.«
Und im nächsten Moment war Porta auf und davon, verschluckt von der Dunkelheit.
Chico brauchte mehrere Minuten, bis er wieder so weit bei Kräften war, um den Motor anzulassen. Musiklos fuhr er weiter nach Biasca. Zum ersten Mal in seinem Leben war der Junganwalt froh, als er das Leuchtschild der Apotheke und die erleuchteten Fenster der Häuser wiedersah.
Das ist meine Gegend, hier sind die Leute wie ich.
Zu Hause angelangt, wehte ihn Röstiduft an. Seine Mutter hatte Gulasch gekocht, und man wartete nur noch auf das Familienoberhaupt, bis man sich zu Tisch setzte. Malfanti senior war ebenfalls Anwalt mit eigener Kanzlei in Biasca, was Chico von Zeit zu Zeit zum Nachdenken veranlasste. Zwar hätte er nicht ungern eines Tages die väterlichen Mandanten übernommen, doch die Aussicht, sein gesamtes Leben in Biasca zu verbringen, fand er weniger verlockend.
Andererseits – Abenteuer geschahen auch hier im Tal, in der tiefsten Provinz, wo Irre mit Messern aus dem Nichts auftauchen und im Nichts wieder verschwinden konnten.
Nach dem Essen, als er im Wohnzimmer saß und im Fernsehen Ein Fall für zwei lief, dachte Chico, dass er sich eigentlich nicht so schlecht geschlagen hatte. Vor allem hatte er seine Argumente geltend gemacht. Seinen Eltern erzählte er nichts davon, aber er erlaubte sich ein kleines zufriedenes Lächeln.
»Wie war’s in der Kanzlei?«, fragte Malfanti senior wie jeden Abend.
»Das Übliche«, sagte Chico.
Behaglich warm war es im Haus, und das einlullende Geplapper aus dem Fernsehen geleitete diesen Januartag sanft seinem Ende entgegen. Chico hatte ein ausgezeichnetes Gulasch mit Rösti verspeist und die Mahlzeit mit einem körperreichen Bordeaux begossen, mit Obstsalat beendet und mit einem kleinen Grappa gekrönt. Jetzt hörte er dem Geplauder seines Vaters zu und kam unterdessen zu der Überzeugung, dass Abenteuer eben doch nicht schlecht sind. Natürlich hatte er Angst gehabt. Natürlich hatte er überlegt, die Polizei zu verständigen. Aber während er auf dem Bildschirm Matula allein gegen allerlei Widrigkeiten kämpfen sah und aus dem Augenwinkel einen Blick auf seine auf dem Sofa nebeneinander sitzenden Eltern tat, sagte er sich: Mir ist alles recht, was mich von hier fortbringt.
Und er beschloss, sich so zu verhalten, als wäre nichts geschehen.
»Also ich bin sicher, du hast dir wegen irgendwas Sorgen gemacht«, sagte Tommi.
»Ach ja?« Francesca lächelte. »Woher willst du das denn wissen?«
»Na, ich hab dich doch gesehen, wie du am Bahnsteig auf und ab getigert bist … wie ein Wachposten!«
»Bis ich mit dir kollidiert bin.«
Sie lachten beide. Der Zug hatte den Bahnhof Taverne-Torricella hinter sich, die nächste Station war Lugano, und Francesca musste zugeben, dass dieser Typ eigentlich ganz nett war, auch wenn ihr seine spontane Herzlichkeit irgendwie sonderbar vorkam. Auch ein bisschen aufdringlich. Aber nachdem er in Lugano aussteigen wollte, bestand keine Gefahr, dass sie ihn nicht mehr loswurde. Er war eine große Plaudertasche: Hatte ihr von seiner Arbeit in der Verwaltung eines Autohauses, von seiner Liebe zum Malvagliatal, seiner Leidenschaft für Autos und für die Mathematik erzählt. Erst am Ende seines Redeschwalls kamen auch ein paar Fragen.
»Also, es stimmt schon, dass ich in Gedanken war. Beziehungsgeschichten halt …«
»Verstehe. Ich hatte auch schon Streit mit meiner Freundin.«
»Es ist eigentlich kein Streit, eher sind es meine Zweifel. Aber vielleicht bin ich einfach ein bisschen erschöpft – seit Ewigkeiten arbeite ich an meiner Dissertation und muss endlich fertig werden …«
»Ja, klar. Ich hab auch ziemlich viel gearbeitet in letzter Zeit. Weißt du was?« Tommi beugte sich vor, hell begeistert von sich. »Wenn man müde oder erschöpft ist, dann ist es echt schwer, Entscheidungen zu treffen. Das ist mir in letzter Zeit klar geworden.«
»Ja, schon … in Beziehungsangelegenheiten, meinst du?«
»Nicht nur. Ich zum Beispiel hab vor einiger Zeit eine wichtige Entscheidung getroffen, ich habe beschlossen, etwas zu tun. Etwas Schwieriges. Aber dann hab ich’s nicht geschafft. Zwar bin ich immer noch dran, ich nähere mich, versuch’s, aber … bringe es nicht fertig.«
Der Zug fuhr in den Bahnhof von Lugano ein. Tommi stand auf.
»Ich muss aussteigen. War nett, mit dir zu plaudern.«
»Fand ich auch. Und ich bin sicher, dass du’s schaffst.«
Tommi sah sie fragend an.
»Diese wichtige Sache. Irgendwann schaffst du’s bestimmt.«
»Ah! Klar.« Tommi lächelte. »Du hast recht, Francesca, danke. Ja, ich werd meinen Mut zusammennehmen und tun, was zu tun ist!«
Giovanni Pellanda war seit zwanzig Jahren Bürgermeister von Malvaglia. Weil schon sein Vater vor ihm