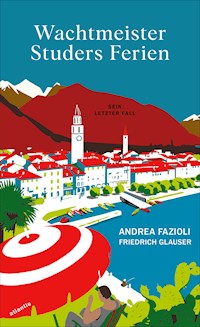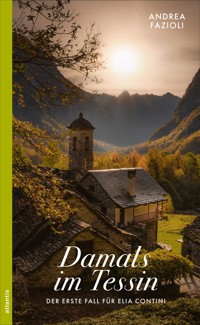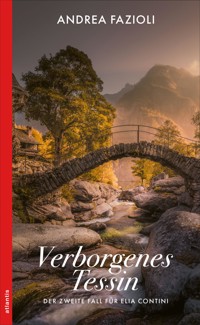
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Elia Contini
- Sprache: Deutsch
Der Tessiner Kleinmafioso Luca Forster steckt tief in den Miesen. Um seine Schulden zu begleichen, hat er die Tochter von Jean Salviati entführt, dem einst geschicktesten Dieb der Schweiz, der ganz ohne Gewalt Banken und Villen ausgeraubt hat, nur mit dem nötigen Know-how. Nach langen Haftstrafen hat er sich zur Ruhe gesetzt und kümmert sich als Gärtner in der Provence um Blumenrabatten und Gemüsebeete. Für seine Tochter, eine notorische Spielerin, die selbst verschuldet ist, soll Salviati nun zehn Millionen Schweizer Franken Lösegeld an Forster zahlen. Dem pensionierten Meisterdieb bleibt nichts anderes übrig, als einen letzten großen Coup einzufädeln: Er plant, eine Filiale der Junker-Bank in Bellinzona zu überfallen, und rekrutiert mehrere Komplizen. Darunter auch der eigenbrötlerische Privatdetektiv Elia Contini, der Salviati noch einen Gefallen schuldet. Und während Forster sich schon die Hände reibt, überlegen die Hobbyganoven bereits, wie sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andrea Fazioli
Verborgenes Tessin
Der zweite Fall für Elia Contini
Kriminalroman
Aus dem Italienischen von Franziska Kristen
atlantis
Erster TeilDas Netz
1Unverschämtes Glück
Es genügt eine Kleinigkeit, um reich zu werden. Eine winzige Kleinigkeit. Ein Staubkorn in der Mechanik, ein Zögern der Kugel, bevor sie auf der Fünfunddreißig liegen bleibt.
Oder ganz einfach: der richtige Zeitpunkt, den man erkennen muss.
Ich dagegen, dachte Lina Salviati, während sie an dem Hebel des Einarmigen Banditen zog, ich habe nie auch nur irgendwas erkannt. Ringsum breiteten sich die Geräusche des Casinos aus. Geflüsterte Worte, um das Glück nicht zu stören, Lachen, Geschrei beim mechanischen Pferderennen.
Man sollte nicht spielen, um zu gewinnen. Lina merkte, dass sie nicht bei der Sache gewesen war. Aber zu spät. Am Ende kam es ohnehin nur auf die Ausdauer an. Eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Früher oder später gewinnt jeder mal. Es genügt eine Kleinigkeit.
»Scheiße!«, rief eine Frau neben ihr. »Irgendwas funktioniert heute Abend nicht!«
Sie hatte einen starken schweizerdeutschen Akzent. Ihr Haar war mit einem geblümten Tuch zusammengebunden und auch sonst überall Blumen: gelbe Rosen auf der Bluse und dem Rock, gläserne Margariten an den Ohren und Augen so kalt wie zwei Chrysanthemen.
Lina sah sie an. Normalerweise sprechen Spieler an den Automaten nicht miteinander. Aber vielleicht zählte im Casino von Lugano die gute Erziehung mehr als der Aberglaube. Lina rang sich zu einem schwachen Lächeln durch:
»Ja, stimmt … heute Abend sieht’s nicht gut aus!«
»Was sagst du?«, platzte die Frau auf Deutsch heraus, um gleich darauf in fehlerhaftem Italienisch und mit hartem, fast metallischem Akzent fortzufahren. »Unterbrich nicht dein Spiel! Sind schon andere da, die Unglück bringen, oder?«
Lina folgte ihrem Blick und sah zwei, drei Automaten weiter einen jungen Mann in Abendgarderobe. Um die dreißig, tief liegende Augen, blondes, kurzes Haar. Er spielte nicht, sondern sah zu ihnen herüber. Lina schauderte. Und wenn er wegen mir hier ist?
»Ins Casino kommt man, um zu spielen!«, bemerkte die geblümte Frau, und sah zuerst den jungen Mann, dann Lina an. »Man kommt nicht, um Liebe zu machen.«
Dann zog sie mit einem Ruck den Hebel hinunter. Die Symbole bewegten sich vor ihren Augen wie die Farben eines Kaleidoskops. Die Aufmerksamkeit der Frau war wieder ganz auf den Automaten gerichtet. Jedes Mal ein billiger Hoffnungsschimmer. Ein Franken, du ziehst den Hebel, und alles ist möglich … Lina wandte den Blick ab. Weder in den großen Casinos noch in den kleinen darf man jemals einen anderen Spieler anstarren.
»Nie auch nur ein bisschen Glück«, murmelte die geblümte Frau, »nie kann man mal mit ein bisschen Ruhe spielen!«
Lina drehte den Spielautomaten den Rücken zu. Die Unterbrechung hatte sie aus dem Rhythmus gebracht, und der Blick des Blonden ging ihr auf die Nerven.
Sie war längere Zeit nicht in der Schweiz gewesen. In den letzten Monaten hatte sie mal hier, mal dort gespielt: von den großen Metropolen bis zu den kleinen Ferienortcasinos und den halblegalen Spielclubs, wo hoch gesetzt wird und die Profis auf Beutejagd gehen. Am Ende hatte sie beschlossen zurückzukehren, um ihr Glück in der Heimat zu versuchen.
Aber man braucht nur ans Glück zu denken, um es zu vertreiben. Momentan hatte Lina eine Wohnung in Lugano, ein paar hundert Franken und einen Schuldenberg, so hoch, dass er sich von selbst vermehrte: Die Schulden brachten neue hervor, die sich ihrerseits vervielfachten und so weiter. Bis der Berg über dir zusammenbricht und du aufhörst zu spielen.
Sie setzte sich in die Bar, ans Fenster, von wo aus man auf die Stadt blickt, und bestellte ein Mineralwasser. Das Schlimme war, dass sie sich nicht unglücklich fühlte. So dicht vor dem Abgrund war es erstaunlich, wie gut es ihr gelang, nicht daran zu denken. Sie saß dort, in ihrem flammendroten Abendkleid, geschminkt, gut frisiert, jung und selbstsicher. Nur einen Schritt vom Reichtum entfernt.
Es kommt darauf an, wie man die Dinge betrachtet, dachte sie.
»Woran denken Sie?«, fragte eine männliche Stimme.
Lina fuhr zusammen. Der junge Blonde war ihr in die Bar nachgekommen. Also hatte sie richtiggelegen. Es waren ihre Schwierigkeiten, die sie verfolgten, in Abendgarderobe und dazu bereit, jede Spur von Traum auszulöschen.
»Was wollen Sie?«
»Ich heiße Matteo. Gestatten Sie?«
Ohne eine Antwort abzuwarten, nahm er ihr gegenüber Platz. Sein Glas war mit einer dunklen Flüssigkeit gefüllt.
»Ich kenne Sie nicht«, sagte Lina und versuchte, Ruhe zu bewahren.
»Wie das? Ich habe mich doch soeben vorgestellt. Es gibt nichts mehr zu verbergen.«
»Hören Sie …«
»Ich weiß, dass Sie Lina Salviati heißen und dass Sie gewinnen müssen.«
Der junge Mann legte eine Pause ein und nahm einen Schluck von der dunklen Flüssigkeit. Whisky, vermutete Lina.
»Sehen Sie«, fuhr Matteo fort, »ich kenne Ihr Problem, denn ich habe eine Menge Freunde. Aber ich bin eher Ihr Freund als der der andern, Sie brauchen sich also keine Sorgen zu machen.«
Lina hatte sich bei zweifelhaften Leuten verschuldet. Sie wusste, dass sie früher oder später dafür geradestehen musste: Sie hatte bereits einige unangenehme Begegnungen hinter sich. Aber dieser blonde junge Kerl schien anders zu sein als die üblichen Geldeintreiber, die sich meistens darauf beschränkten, auf ihren Busen zu schielen und finstere Drohungen auszustoßen.
»Ich kenne Signor Forster«, sagte Matteo. »Ich weiß, dass Sie ihm unter besonderen, dem Beruf Ihres Vaters zu verdankenden Umständen begegnet sind.«
»Aber was …«
»Sagen Sie nichts! Ich weiß außerdem, dass Sie dem alten Forster in den letzten Jahren eine schöne Stange Geld abgeknöpft haben. Und dass er es zurückhaben will. Spüren Sie nicht seinen Atem im Nacken?«
»Ich … ich …«
Matteo beugte sich zu ihr und berührte ihr Knie.
»Ich bin ihnen bis ins Casino gefolgt und habe zugeschaut, wie Sie zuerst fünfhundert Franken beim Roulette und dann ich weiß nicht wie viel bei den Automaten verloren haben. Was würde Forster dazu sagen?«
Matteo wartete die Antwort nicht ab. Er lehnte sich zurück und schloss:
»Forster könnte Sie beschatten lassen. Er ist nicht dumm, verstehen Sie? Er weiß, dass Sie in Lugano sind und sein letztes Geld durchbringen.«
»Was erlauben Sie sich?« Lina wählte die unbeugsame Tour. »Wer gibt Ihnen das Recht …«
Matteo sah ihr starr in die Augen.
»Ich bin jemand, der Ideen hat. Seit Monaten tüftel ich schon daran. Und auch für Sie habe ich einen Plan.«
Lina wusste nicht, was er von ihr wollte. Dieser Typ war mindestens vier oder fünf Jahre jünger als sie, und dennoch sprach er in väterlichem Ton mit ihr, verzog keine Miene. Sie warf ihm einen durchdringenden Blick zu und erhob sich, in der Absicht, ihm eine Szene zu liefern. Matteo kam ihr zuvor:
»Ich muss jetzt gehen.« Er erhob sich ebenfalls. »Aber ich lasse wieder von mir hören. Ich rate Ihnen, spielen Sie nicht länger!«
Bevor Lina antworten konnte, eilte er bereits dem Ausgang zu.
Rings um die Bar hatte sich nichts verändert. Ein Casino ist ein ewig gleichbleibender Ort. Der trübe Blick der Kellner, Pärchen, die händchenhaltend die Würfel werfen, eine Gruppe Jugendlicher, die sich wie Erwachsene geben. Und dieses Hintergrundgemurmel, das durch die stets wiederkehrenden, monotonen Stimmen der Croupiers seinen eigenen Rhythmus bekommt. Lina mochte die dunkelroten Vorhänge, den Teppichboden, der die Schritte dämpfte, die goldfarbenen Spieltische.
Ich darf nicht lockerlassen, dachte sie. Das ist mein Kampf, nur hier kann ich alles lösen. All das hatte angefangen, als … Sie wusste es nicht mehr. Eines Tages hatte sie begonnen zu spielen, an der Côte d’Azur, um die Langeweile zu besiegen und um dem Vater zu entkommen. Und dann hatte sie nicht mehr aufgehört: die Nächte, die Nachmittage, die Mahlzeiten, die Ferien, das Meer und die Arbeit, alles aufgesaugt von diesem Augenblick des Innehaltens kurz vor der Entscheidung. Dieser Moment des Rausches, solange noch alles möglich ist.
Sie beschloss, es noch einmal am Roulettetisch zu probieren. Sie hatte ein besonderes Verhältnis zur Fünfunddreißig. Früher oder später wird es klappen, dachte sie, während sie weitere Jetons eintauschte. Wer über diese Dinge lacht, hat nichts vom Leben begriffen. Sie spielte ohne Unterbrechung, nahm sich nicht einmal Zeit, um auf die Toilette zu gehen. Aus ihrem Bewusstsein verschwand jegliche Erinnerung.
Auch an diesem Abend hatte sie kein Glück. Vielleicht, weil es ihr nicht gelungen war, zu vergessen, dass sie Geld brauchte. Vielleicht hatte die Begegnung mit dem blonden jungen Kerl sie zerstreut. Am Ende ließ sie weitere zweihundert Franken im Casino und trat hinaus auf die Uferpromenade.
Die Straße, die am Ceresio entlangführte, war für den Verkehr gesperrt. Lina lief, ohne an irgendetwas zu denken. Rings um sie der rege Trubel eines Sommerabends. Familien beim Spaziergang, junge Männer mit gierigen Augen und Mädchen, die sich gewollt naiv gaben.
Die Voralpen bekommen im Sommer einen mediterranen Anstrich. Lina kam an der Tropical Lounge vorbei, sah weiße Hemden und Tattoos aufblitzen. Im Hintergrund das dunkle Profil der Berge. Salsa- und Merengue-Rhythmen verloren sich auf dem See. Lina blieb, um einen Mojito zu trinken, setzte sich auf einen Holzstuhl. Nebenan befand sich ein Kiosk, der Eis und Getränke verkaufte. Etwas weiter ein Holzpodest für südamerikanische Tänze.
Lina versuchte, in die Normalität zurückzukehren. An diesem Abend hatte sie alles verspielt. Jetzt blieben ihr nur noch die gewohnten Handlungen: nach Hause gehen, duschen, schlafen und dabei gegen die Schwüle ankämpfen, um am nächsten Morgen weiter nach einer Arbeit zu suchen. Neben der Tanzfläche stand eine Statue. Ein Mann mit einem Finger, der in den Himmel zeigte. Lina fragte sich, wer das war.
Mit einem Mal gingen ihr die Leute und die Musik auf die Nerven. Und die Handydisplays, die im Schatten aufblitzten wie die Leuchtkäfer auf dem Land. Sie bemerkte, dass ihr die Männer von der Tanzfläche aus neugierige Blicke zuwarfen. Ihr Abendkleid war tatsächlich etwas unpassend.
Sie lief die Seepromenade hinunter bis zur Piazza della Riforma. Dann schlug sie den Weg ins Zentrum und zum Parkhaus ein, wo sie den Wagen gelassen hatte.
Die Straßen um die Piazza San Carlo waren nicht sehr belebt. Die massiven Wände der Häuser und Geschäfte ließen ein Leben ohne Unwägbarkeiten vermuten. Ein Bankgebäude, klobig und sicher hinter einer Umfassungsmauer gelegen, löste ein Gefühl der Traurigkeit in ihr aus. Ich jage einem Irrlicht hinterher, einem Gebilde, das meiner Phantasie entsprungen ist. Der wahre Reichtum liegt hier, dachte sie, das wahre Ansehen hinter diesen Mauern. Und dennoch wusste sie, dass es zu spät war, um eine andere Richtung einzuschlagen.
Es war nicht nur eine Frage des Geldes. In Zeiten der Krise fehlt allen das Geld. Aber Lina hatte es sich von den falschen Leuten geliehen. Während sie sich dem Parkhaus näherte, wurde ihr die eigene Situation immer klarer. Forster und seine Freunde waren Profis, Leute, die sich keine Ausnahme erlauben konnten. Vielleicht würden sie ihr etwas antun: Sie waren zu allem fähig.
Jemanden um Hilfe bitten? Aber wen? Lina dachte an ihren Vater, verscheuchte den Gedanken jedoch gleich wieder. Er hatte sich vom Leben abgewandt, er war praktisch tot. Und dennoch … auf einmal erkannte Lina ihre eigene Situation. Sie war in Gefahr, und sie war allein. Sie zahlte den Parkschein. Während sie im Dunkeln nach ihrem Wagen suchte, wurde ihr – vermutlich zum ersten Mal – klar, dass es, um da herauszukommen, nicht genügte, wie gewohnt eine forsche Miene aufzusetzen. Diesmal war eine besondere Maßnahme erforderlich. Unverschämtes Glück. Etwas, das die Vergangenheit wegwischen würde, das stärker war als die Worte des Croupiers. Rien ne va plus.
2Der Gärtner
Die alte Madame Augustine ließ sich in das Rückenpolster sinken. Sie blinzelte in die Sonne, die sich allmählich dem Horizont zuneigte, strich sich den Rocksaum glatt und lauschte – ohne sich etwas anmerken zu lassen – dem Geräusch der Zikaden. Madame Augustine liebte Zikaden.
Der Hausdiener brachte ein Tablett und stellte es auf dem schmiedeeisernen Tischchen ab. Die Dame bedankte sich mit einem Kopfnicken und sagte:
»Danke, Georges, nehmen Sie auch etwas.«
Georges bedankte sich seinerseits und schenkte zwei Gläschen Pastis ein. Dann nahm er Platz und sah in den Garten. Die Gewitter der vergangenen Woche hatten Wunder bewirkt. Der Hibiskus war endlich aufgeblüht, und neben dem Eingangsweg zeugten zwei Eisenkrautbüsche davon, dass auch der provenzalische Sommer leuchtende Farben hervorbringen kann.
»Heute ist kein Wind«, stellte Madame Augustine fest.
»Stimmt«, nickte Georges, »das bedeutet, dass es nicht mehr regnen wird.«
Gewitter zu Beginn des Sommers waren selten, aber gern gesehen, da sie einen Wasservorrat brachten, der bis Ende August reichte. Die Dame fragte Georges, ob er in diesem Jahr auf die Jagd gehen würde.
»Hm«, machte Georges und zog eine Grimasse, »ich werd’s versuchen. Letztes Jahr haben sich die Rebhühner nicht blicken lassen. Aber ich habe ein paar Hasen erlegt.«
»Ah, schön!«
»Ich habe sie verkauft, aber die nächsten sind für Sie.«
»Oh, das ist nicht nötig …«
»Aber sicher doch, ich hab’s auch Jean versprochen … da ist er ja, immer noch bei der Arbeit!«
Georges begrüßte den Gärtner, der gerade ein mit Rosmarin, Thymian und Majoran bepflanztes Beet wässerte. Madame Augustine forderte Georges auf, auch Jean ein Glas anzubieten. Der nahm die Einladung an, wobei er sich für seine mit Erde beschmutzten Hände entschuldigte.
»Zum Ausgleich dafür schenken Sie mir Rosmarinduft«, lächelte Madame Augustine.
Alle nippten an ihrem Pastis, während die Zikaden im Garten ihr Konzert fortsetzten. Die Villa stammte aus dem frühen zwanzigsten Jahrhundert. Ein großes, gelb gestrichenes Gebäude mit grünen Jalousien und Gipsstuck über den Fenstern. Hier und dort fehlte ein wenig Farbe, und auch das Holz am Geländer des Portikus schien täglich morscher zu werden. Aber, so Madame Augustine, es war besser, sich ans Morschwerden zu gewöhnen.
Als er ausgetrunken hatte, verabschiedete sich der Gärtner: Er habe noch einige Arbeiten zu erledigen und müsse wegen einer Bestellung runter ins Dorf. Madame Augustine ermahnte ihn, keine Zeit zu verlieren.
Bevor er ging, wässerte er noch zwei Kornelkirschen und einige besonders empfindliche Schneeballbüsche. Dann begab er sich in den östlichen Teil des Gartens, wo er ein paar Tage zuvor einen jungen Olivenbaum gesetzt hatte. Die ersten Tage waren entscheidend dafür, ob er anwuchs oder nicht.
Es war ein klassisch angelegter Garten, ohne allzu strenge Geometrien, aber mit einer klaren Einteilung durch Wege, Baumgruppen, Büsche und Blumenrabatten. Der Hauptweg lief mitten durch eine leicht abschüssige Wiese und verzweigte sich dann: auf der einen Seite die Gemüsebeete, auf der anderen der Obstgarten. Der Gärtner nahm einen Spaten aus einem Schuppen neben den Gemüsebeeten und durchquerte den Obstgarten.
Der Baum kam allmählich zu Kräften. Der Gärtner hatte rings um den Stamm Erde gehäufelt und eine Art Wall geschaffen, damit das Wasser in der Mulde blieb und ja kein Tropfen verloren ging. Er grub den Boden ein weiteres Mal um, erneuerte den Erdwall. Schließlich nahm er eine Gießkanne und wässerte den Olivenbaum.
Dann wusch er sich, zog sich um und beeilte sich ins Dorf zu kommen, bevor Bank und Post schlossen. So konnte er noch ein paar Formalitäten erledigen: zwei Rechnungen begleichen, das Gehalt einzahlen, drei Bestellungen für Saatgut und einige Rosenpflanzen aufgeben.
Er blieb auf ein Gläschen bei Marcel. Vor dem Restaurant, im Schatten dreier riesiger Platanen, lag ein offener Platz mit ein paar Tischen und einer Bahn für die Pétanque-Spieler. Marcels Kundschaft war gemischt: Touristen, die nach einer spécialité verlangten, Alteingesessene, die auf einen Aperitif vorbeischauten, Jäger, die sich nach einem wenig erfolgreichen Tag mit einem Halben trösteten.
Der Gärtner ließ sich auf eine Partie ein. Er war ein ganz guter Spieler: präzise beim Wurf und vor allem ein guter pointeur. Meistens spielte er mit Georges, dem Hausdiener, in einer Mannschaft, der ein sehr guter frappeur war (fünf von sechs Kugeln im Schnitt), und mit einem Mechaniker aus dem Dorf als milieu.
An diesem Abend beließ er es allerdings bei einigen wenigen Würfen, um nicht aus der Übung zu kommen. Der Platz begann sich allmählich zu füllen, während die Sonne hinter dem Kirchturm verschwand. Drei Jugendliche mit Mofas hielten unter einer Platane. Die ganz Alten saßen nebendran und musterten die Vorübergehenden.
Es gab auch ein paar Touristen. Einer fotografierte die Pétanque-Spieler, obwohl das dem Gärtner nicht behagte. Er liebte das geregelte Leben: den Garten, einen Aperitif, die Angeltouren, die Markttage und den sonntäglichen Kirchgang. Das war nicht immer so gewesen, aber nun hatte er einen Weg eingeschlagen, der ihm guttat. Er hatte einige Freunde unter den Urlaubsgästen; aber die lauten Touristen mochte er nicht, und fotografiert werden mochte er schon gar nicht.
Gerade in dem Augenblick, als er zum Wurf durch den rond ansetzte, rief Marcel nach ihm.
»Hey, Jean, ein Anruf für dich!«
»Für mich?«, wunderte sich der Gärtner. »Wer ruft mich denn hier an?«
Sie gingen hinein.
»Vermutlich eine Verwandte von dir«, meinte Marcel. »Sie wollte wissen, ob ich Jean Salviati kenne und sagte: Fragen Sie ihn, ob er Lina Salviati sprechen möchte.«
Marcel sprach den Nachnamen mit der Betonung auf dem letzten i aus.
»Lina Salviati?«, fragte der Gärtner.
»Genau. Ist sie mit dir verwandt?«
Jean Salviati nickte und nahm den Hörer ans Ohr, sagte jedoch nichts. Er wollte abwarten, bis Marcel sich entfernt hatte. Dann sprach er mit leiser Stimme:
»Hallo?«
»Hallo«, antwortete ein Mann auf Italienisch. »Spreche ich mit Herrn Salviati?«
Diesmal lag die Betonung auf dem zweiten a.
»Ja, das tun Sie«, erwiderte der Gärtner.
»Ich bin der Inhaber der Bar La Pergola, hier in Lugano«, fuhr die männliche Stimme fort. »Ihre Tochter hat Sie angerufen, aber dann musste sie weg. Sie hat mich gebeten, Sie zu benachrichtigen. Wenn Sie mich nun …«
»Aber wie kann ich sie erreichen?«, fragte Salviati.
»Was weiß denn ich? Ich kenne sie überhaupt nicht!«
»Ach so, natürlich … tut mir leid. Aber was hat sie denn gesagt …?«
»Sie hat nur diese Nummer gewählt, dann ist sie gegangen und hat mich gebeten, sie zu entschuldigen. Aber Sie werden doch wissen, wo Sie Ihre Tochter erreichen, oder?«
»Natürlich«, murmelte Salviati, während er den Hörer auflegte, »natürlich.«
Er lehnte an der Mauer, ohne sich zu rühren. Für ein paar Sekunden lauschte er auf die Geräusche, die vom Platz kamen, und dachte an seine Tochter. Wie lange hatte er nichts von ihr gehört? Sechs Monate, mindestens.
Auf einmal bekam Jean Salviati es mit der Angst zu tun. Er hatte noch immer ein gewisses Gespür für diese Dinge. Er sah die Flammen, lange bevor es verbrannt roch. Seine Tochter war schon oft in Schwierigkeiten geraten, ohne jemals seine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Hatte sie es sich diesmal anders überlegt? Aber weshalb? Was war geschehen … oder was geschah gerade?
3Vor allem braucht man Mut
Bisweilen tut man etwas aus dem vielleicht banalen, aber deshalb nicht minder zwingenden Grund, nichts Besseres zu tun zu haben. Welche Möglichkeiten Lina auch erwog, welche Alternativen sie sich überlegte, es blieb doch ein Samstagabend ohne Geld.
Sie konnte nicht ins Casino, hatte keine Jobs in Aussicht … was blieb ihr also? Eine Einladung zum Abendessen, die sie im Briefkasten gefunden hatte. Zuerst hatte sie nicht gewusst von wem, vielleicht wegen des Nachnamens. Aber dann war ihr der junge Blonde aus der Spielbank eingefallen.
Ich bin Matteo, erinnern Sie sich? Der Freund, der mit Ihnen den Kummer eines Casinoabends geteilt hat. Wenn Ihre Situation immer noch dieselbe ist und Sie sich nichts Besseres überlegt haben, würde ich Ihnen gerne eine Idee unterbreiten. Was halten Sie davon, wenn wir uns um acht in der Bar am Lido von Lugano treffen? Falls Sie nichts dagegen haben, würde ich Sie gerne zum Essen einladen.
Ich erwarte Sie heute Abend!
Matteo Marelli
Durfte man jemandem trauen, der so schrieb? Aber immerhin, dachte Lina, während sie die passende Garderobe auswählte, lohnte es sich vielleicht zu schauen, welches Spiel er spielte. Sie hatte zwar einen Versuch unternommen, ihren Vater um Hilfe zu bitten, es dann aber doch nicht fertiggebracht. Seitdem er sich zurückgezogen hatte, war ihr Verhältnis nicht mehr besonders gut. Lina konnte seine Entscheidung, in diesem Kaff zu leben und eine stumpfsinnige Tätigkeit als Gärtner anzunehmen, nicht verstehen.
Letztlich stand es noch gar nicht so schlimm um sie. Wenn sie eine Arbeit finden und es schaffen würde, sich eine Weile zusammenzunehmen. Vielleicht war ja auch an diesem ominösen Plan des Blonden was dran …
Sie beschloss, nicht zu übertreiben. Keine dekolletierten Kleider oder allzu kurzen Röcke. Jeans, hochhackige Schuhe und ein schwarzer Seidenpulli. Sie ließ das Haar offen und schminkte sich nur leicht. Schließlich hatte er sie nicht in ein Luxusrestaurant eingeladen.
Der Lido von Lugano ist ein Ort mit zwei Gesichtern. Tagsüber drängen sich am Seeufer und um die Schwimmbecken haufenweise Jugendliche, Mütter mit ihren Kindern, Großeltern, die sich unter riesigen Strohhüten verstecken. Am Abend aber gehen in der Bar die Lichter an, hautenge Oberteile, violett lackierte Fingernägel tauchen auf, Musik und Gin-Tonic erobern das Feld.
Matteo, ebenfalls in Jeans und T-Shirt, hatte zwei Plätze in einer Ecke ergattert.
»Schön, Sie zu sehen«, begann er, und lud sie ein, Platz zu nehmen. »Wollen wir uns nicht duzen?«
»Du hast von einer Idee gesprochen«, erwiderte Lina.
»Ich erklär’s dir gleich. Willst du was trinken?«
Sie bestellten zwei Martini und sahen sich erneut in die Augen. Vorsichtig. Lina wurde aus diesem Kerl immer noch nicht schlau. Sein Verhalten hatte etwas Aggressives, aber sein Interesse schien nicht geheuchelt. Lina dachte: Und wenn er nur mit mir ins Bett will?
»Ich seh schon, du entspannst dich allmählich«, bemerkte Matteo.
»Ziemlich viele Leute hier«, lenkte sie ab.
»Ja, das ist gar nicht schlecht. Musik, Blick auf den See … so kann man in Ruhe reden, oder?«
»Schon.«
Jeder nahm einen Schluck Martini.
Die Musik und die Stimmen machten eine Unterhaltung zwar nicht unmöglich, aber um zu reden, musste man zusammenrücken. Beide hatten die Ellenbogen aufgestützt. Andererseits bildete der Lärm einen Schutzwall, schuf eine Art Vertraulichkeit.
»Ich weiß, wer du bist«, sagte Matteo, »ich habe Informationen über dich gesammelt.«
»Ich nicht. Könnte ich erfahren …?«
»Du kannst alles wissen. Aber eins nach dem andern. Du steckst in Schwierigkeiten, und zwar tiefer, als du ahnst. Forster wird in den nächsten Tagen anfangen, nach dir zu suchen, und zwar mit allen Mitteln.«
»Hast du mich kommen lassen, um mir das zu erzählen …?«
»Zehntausende von Franken. Oder Hunderttausende? Wie viel schuldest du ihm?«
Lina machte Anstalten zu gehen.
»Es reicht. Ich …«
»Warte!«, hielt er sie zurück. »Ich kann dir helfen. Außerdem solltest du nichts überstürzen … schau mal dahinten!«
Weiter hinten, fernab von der Atmosphäre des Lido und scheinbar fernab von allem entdeckte Lina den Mann, auf den Matteo gezeigt hatte. Er wirkte etwas deplatziert, war groß, muskulös, aber ohne das schwarze T-Shirt der Wachleute vom Lido. Stattdessen trug er einen unpassenden Nadelstreifenanzug und ein Baseballcap.
»Wer ist das? Was willst du …?«
»Warte, ich werde euch bekannt machen!«
Der Koloss kam auf sie zu, und Lina fragte sich, ob sie am Ende nicht einen Fehler begangen hatte. Erst der Blonde mit seinen vielsagenden Blicken und jetzt dieser Gorilla, der ohne ein Lächeln auf sie zutrat, ihr die Hand gab und sich an den Tisch setzte.
»Er heißt Elton«, erklärte Matteo. »Ein Freund von Forster. Wenn du findest, dass Elton ein seltsamer Name ist, sind wir ganz einer Meinung.«
»Was wollt ihr?«, fragte Lina. Zum Glück befanden sie sich unter Leuten. Beim kleinsten Warnsignal war sie zur Flucht bereit.
»Entspann dich«, meinte Matteo, »keiner will dir was Böses. Ich habe für dich vermittelt. Stimmt’s, Elton?«
»Signor Forster sagt, dass er im Großen und Ganzen keine Einwände hat«, erklärte Elton. Dieser Gorilla hatte eine gepflegte Aussprache und eine sanfte Stimme.
»Keine Einwände gegen was?«, fragte Lina, der die Situation allmählich immer absurder schien. Aber sie wusste, dass sie weder den einen noch den anderen ihrer Gesprächspartner unterschätzen durfte.
»Gegen einen Vergleich«, erwiderte Elton. »Zumal Signor Forster über Ihre schwierige finanzielle Situation im Bilde ist.«
»Sprich darüber, dass du keinen einzigen Franken mehr hast«, ergänzte Matteo, und Elton fuhr fort:
»Bisher hat Signor Forster abgewartet, auch aus Achtung vor Ihrem Vater. Aber nun, wo sich Ihr Vater aus dem Metier zurückgezogen hat, bleibt als einzige Lösung jene, die uns Herr Marelli vorschlägt.«
»Also ich!« Matteo lächelte. »Elton liebt große Worte. Allerdings liegen die Dinge tatsächlich so. Du brauchst Geld, Forster will seins wiederhaben. Und dein Vater war ein Profi, noch dazu einer der fähigsten.«
»Aber …«
»Banken, Geschäfte, Postämter, auch Villen und Privathäuser. Alles ohne Gewalt, mit dem nötigen Wissen und …«
»Es reicht«, unterbrach ihn Lina. »Mein Vater führt jetzt ein anderes Leben.«
»Aber er hat noch Beziehungen. Abgesehen von seiner Erfahrung, verstehst du?«
»Ich bin sicher, dass sie versteht«, sagte Elton, der sich unterdessen eine Flasche Bier beschafft hatte. »Matteos Idee gründet sich auf eine Information bezüglich einiger ziemlich heikler Banktransfers.«
Ein misslungener Abend im Casino, dachte Lina, und schon lande ich hier. Elton beugte sich zu ihr vor und bewegte kaum merklich die Lippen, als würde er etwas auswendig lernen. Lina überlegte, was sie falsch gemacht hatte. An den andern Tischen flirteten die Mädchen und betranken sich. Weshalb war sie hier, um über Geld zu sprechen?
»Es wäre eine gute Gelegenheit für uns alle, aber leider fehlen uns einige Kontakte, von denen wir jedoch sicher sind, dass Ihr Vater sie hat.«
»Entschuldigt«, sagte Lina, »aber Forster hat alle Kontakte, die er braucht, oder? Zu was …«
»Signor Forster ist es nicht gewohnt …«
»… wollt ihr mich da überreden?«
»… auf diesem speziellen Gebiet zu arbeiten. Wir …«
»Leute!« Matteo lächelte. »Eins nach dem andern! Im Grunde geht es bloß darum, eine Bank auszurauben, oder?«
An dieses Gespräch sollte Lina später noch oft denken. Der Gorilla, der sich geschliffen wie ein Professor ausdrückte, Matteos glänzende Augen, Alkohol- und Schweißgeruch, Dance Music aus den Lautsprechern. Eine Bank ausrauben! Die Worte schienen wie aus einem Film.
Obwohl … obwohl Matteos Idee vielleicht gar nicht so übel war. Wie oft hatte Lina ihren Vater gebeten, ihr von seinen Aktivitäten zu erzählen? Aber er hatte sich immer geweigert, immer. Bis er sich in die Provence zurückgezogen hatte, um Salat anzubauen. Und reich war er garantiert nicht geworden.
Matteo wollte dagegen mit ihr zusammenarbeiten.
Und er wollte sie entführen.
»Überleg es dir gut, Lina, es ist der einzige Weg, um deinen Vater rumzukriegen. Ohne ihn können wir uns keinen Zugang ins Computersystem verschaffen. Außerdem brauchen wir jemanden, der in der Lage ist, alles zu organisieren.«
»Aber könnte ich ihn nicht einfach fragen, ob er uns behilflich ist?«
»Und was meinst du, würde er wohl antworten?«
In der Tat hätte sich Jean Salviati nie darauf eingelassen, wieder zu seinem alten Leben zurückzukehren. Aber wenn Forster ihm steckte, dass er seine hoch verschuldete Tochter in der Gewalt hatte … und ihn dann nach Informationen für einen Raubüberfall fragen würde …
»Um ehrlich zu sein«, stellte Elton klar, »geht es nicht nur um Informationen, sondern um die Ausführung des Überfalls selbst.«
Inmitten des Lärms und der Farben des Lido wirkten Eltons und Matteos Worte fehl am Platz. Aber Lina war sofort klar, dass sie es ernst meinten. Sie schob das Martiniglas weit von sich, wandte sich um und sah auf den See hinaus, um in der Dunkelheit Trost zu suchen. Sie wollten eine Entführung inszenieren, damit ihr Vater Geld beschaffte. Die Beute würden sie teilen. Und sie? Sie wäre endlich schuldenfrei.
»Und vielleicht«, meinte Matteo mit einem Augenzwinkern, »verdienst du auch was dabei!«
»Vielleicht?«
»Na ja, hängt davon ab, wie viel dabei rumkommt …«
»Und natürlich hängt es auch von der Tatsache ab«, Elton hüstelte kurz, »dass Signor Forster eine rasche Begleichung der Schulden wünscht.«
Lina wusste, dass sich ihr Vater ein Bein für sie ausreißen würde. Aber er würde sich nicht auf einen Überfall einlassen, niemals. Nicht mehr.
Wenn also nichts übrig blieb, als ihn zu täuschen …
»Natürlich«, fügte Elton hinzu, »muss die Entscheidung mit einer gewissen Eile gefällt werden.«
Zum Schluss würde sie ihm alles gestehen. Sie könnten zusammen darüber lachen. Vielleicht würde das Täuschungsmanöver sogar dazu beitragen, dass sie sich wieder näherkamen. Wie ein Spiel. Eine außergewöhnliche Idee, ein Trick, um aus ihren Schwierigkeiten herauszukommen.
Aber wenn ihr Vater es mit der Angst bekäme? Wenn er zur Polizei ginge? Ach was, nein, zumindest das war ausgeschlossen.
Lina versuchte, in aller Eile das Für und Wider abzuwägen.
»Aber auch für meinen Vater muss etwas rausspringen!«
»Sehen Sie, Fräulein Salviati«, sagte Elton, »für Ihren Vater springt dabei heraus, dass die Schulden seiner Tochter beglichen werden. Wenn die geraubte Summe natürlich beträchtlich ist, könnte eventuell noch ein Anteil hinzugefügt werden.«
»Aber wie kann ich mich darauf verlassen?«
»Man muss sich vertrauen«, sagte Matteo, »wir müssen uns alle gegenseitig vertrauen. Wir können auch einen Vertrag aufsetzen, wenn du magst, aber was hätte das für einen Wert?«
»Keinen«, erwiderte Elton.
»Man muss sich vertrauen«, wiederholte Matteo, »sonst funktioniert die ganze Sache nicht.«
Lina zog die Augenbrauen hoch.
»Und sollten wir das Risiko eingehen?«
»Vor allem braucht man Mut«, rief Matteo. »Und Vertrauen. Wenn wir zusammenhalten, können wir es schaffen … und glaub mir, Lina, ich rede von einem echten Coup, von einem, den sie im Fernsehen bringen!«
Lina glaubte ihm. Sie hatte ohnehin keine andere Wahl. Aber sie würde wachsam bleiben. Mut und Vertrauen waren bloße Worte, und Lina wusste, dass Worte, sobald Geld ins Spiel kam, rasch verflogen.
Elton verabschiedete sich betont höflich und verschwand.
Lina fragte Matteo nach weiteren Einzelheiten zu seinen Bankinformationen, aber er wollte das Thema wechseln. Mit einem Schlag war er ein ganz normaler junger Mann im Taumel eines Samstagabends. Schnell brachte er sie dazu, über andere Dinge zu reden.
»Wir haben genug gearbeitet heute Abend!«
»Gearbeitet? Aber wenn …«
»Ich habe Hunger. Du auch?«
Sie aßen in einem Restaurant am See, in Castagnola, und Lina merkte, dass sie tatsächlich ruhiger war. Die Aussicht, ihren Vater zu belügen, bereitete ihr Sorgen, aber dafür hatte sie keine Angst mehr vor Forster. Sie war nicht mehr in Gefahr. Fürs Erste.
»Lass uns vorläufig nicht dran denken«, sagte Matteo. »Weißt du was? Wir könnten irgendwo tanzen gehen. Hast du das Casino nicht satt?«
»Hier …«
»Ach komm, hier sind nur Alte! Lass uns unter junge Leute gehen!«
Lina lächelte. Und wenn ich ihm tatsächlich gefalle? Nicht, dass der Bankraub am Ende ein Vorwand ist, das wäre ziemlich dumm. Aber im Grunde, so ein bisschen, vielleicht, so zum Spaß …
»Und nun?«, drängte Matteo. »Ich würde vorschlagen, wir gehen ins Vera Cruz, das ist was Besonderes, und außerdem kenne ich den Besitzer. Was meinst du?«
Sie saßen an einem Holztisch, in der Ecke einer Terrasse, abseits der übrigen Gäste. Der See war ein dunkles Auge, in dem hier und da ein paar goldene Halme leuchteten: Touristenboote oder heimliche Angler.
»Warum nicht«, sagte Lina, die Hände unter dem Kinn, während sie den Blonden aufmerksam musterte.
Er lächelte breit.
»Also gehen wir! Die Nacht gehört uns! Oder hast du morgen was vor?«
»Nichts Wichtiges. Ach doch, ich muss einen Bankraub organisieren …«
»Ach wirklich? Vielleicht kann ich Ihnen behilflich sein, mein Fräulein. Darf es ’ne große Tasche sein, oder genügt das kleinere Modell?«
Sie brachen in Gelächter aus.
Lina gelang es nicht, ihre Zweifel ganz wegzuwischen, aber sie fühlte sich so leicht wie schon lange nicht mehr. Ohne Angst, ohne das Gewicht der Vergangenheit. Jahrelang hatte sie die Reue für ihr Handeln erdrückt: Die Zeit der Leichtigkeit wurde immer abgelöst durch die Zeit der zu begleichenden Schuld, der zerbrochenen Freundschaften, wie ein Teufelskreis. Aber jetzt lächelten alle, waren alle auf ihrer Seite.
Zumindest für diese Nacht.
Und wenn sie ihre Karten gut ausspielte, würde ihr das Glück am Ende vielleicht beistehen.
4Wein und Geplauder
In jener Gegend der Provence verliert sich während der Ferienmonate bisweilen die Zeit. Die Sonne steht still am Nachmittagshimmel und du siehst deine alten Sommer wieder, die sich durch die Jalousien zwängen oder im Staub eines schattigen Wohnzimmers kreisen. Du hörst sie beinahe summen, zusammen mit dem Geräusch eines Mofas auf der Straße.
Jean Salviati achtete auf die Zeichen verschütteter Sommer. Schon deshalb, weil er nicht viele erlebt hatte. Das Jahr über war er in der Schweiz geblieben, während der Ferien nach Frankreich zu den Großeltern gegangen. Dort hatte er viele Dinge gelernt, Dinge, von denen man gar nicht weiß, dass man sie gelernt hat, bis man sie vergisst.
»Hier lässt es sich aushalten, stimmt’s?«, sagte Filippo Corti.
»O ja!«, rief seine Frau Anna. »Am liebsten würde ich gar nicht mehr zurück nach Hause!«
Salviati nickte nur. Etwas an dieser langsam hereinbrechenden Dämmerung erinnerte ihn an seinen Vater. An dessen bedächtige Gebärden, die Präzision, mit der er seine Coups vorbereitete. Als er ihn zum ersten Mal beim Ausräumen einer Wohnung begleitet hatte, waren die Großeltern bereits seit einigen Jahren tot. So hatte Jean Salviati ohne Konflikte der Kindheit den Rücken gekehrt.
»Hast du eigentlich deine Kiefer wieder hinbekommen, Jean?«, erkundigte sich Filippo.
»Na ja«, antwortete der Gärtner, »sagen wir, ich habe das Problem gefunden.«
»Und das wäre?«
»Es war eine … chenille, wie sagt man noch? Ein Prozessionsspinner, glaub ich.«
»Ein Schädling?«, fragte Anna.
»So was Ähnliches. Später werden Falter draus, aber erst mal hocken sie tagsüber in ihrem Gespinst. Und jede Nacht kommen sie der Reihe nach raus, um die frischen Kiefernnadeln abzufressen.«
»Was du nicht sagst!«
Sie saßen bei einem Glas Rotwein auf der Terrasse des Ehepaars Corti. Weit unten, hinter den Bergen, schimmerte die Küste. Im Hintergrund das Meer. Um diese Tageszeit war es jedoch kaum noch zu erkennen, die Dinge verloren allmählich ihre Umrisse.
»Später werden Falter draus, dunkel mit gelben Flecken«, sagte Salviati und zog bedächtig an seiner Pfeife. »Sie anzufassen ist übrigens gefährlich, sie brennen wie Quallen im Meer.«
»Und zuerst fressen sie die Nadeln der Strandkiefern?«, fragte Anna.
»Es ist eine Pin d’Alep, allerdings macht das für sie, glaub ich, keinen Unterschied. Ich habe jedenfalls ein Insektenmittel genommen.«
»Schon interessant diese Sache, dass sie nachts zum Fressen rauskommen«, bemerkte Filippo. »Wie die Raubtiere.«
»Oder wie die Diebe«, sagte Anna lachend.
Salviati blieb ungerührt. Er verspürte nicht einmal mehr Anspannung. Früher hätten diese Worte ihn innerlich in Alarmbereitschaft versetzt. Aber jetzt lebte er ein anderes Leben. Er nahm die Pfeife aus dem Mund und sagte:
»Ja, stimmt … wie die Diebe … tagsüber schlafen sie, und nachts schlagen sie zu.«
Die Cortis kamen aus dem Tessin. Er war Lehrer für Naturwissenschaften, sie arbeitete halbtags in einer Bibliothek. Seit Jahren verbrachten sie ihren Urlaub in der Provence. Sie mieteten immer dasselbe Haus, das unweit des Dorfes, aber bereits in den Bergen lag. Salviati kam nicht zuletzt deshalb so gern zum Essen bei ihnen vorbei, weil man das Gefühl hatte, fernab von der Welt zu sein.
»Wenn ich’s mir recht überlege«, begann Filippo erneut, wobei er sein Weinglas zwischen den Händen schwenkte, »wäre ein Leben als Juwelendieb gar nicht so schlecht. Wie Cary Grant in Über den Dächern von Nizza. Eine hübsche Villa an der Côte d’Azur, schöne Frauen, Sportwagen …«
»Das Haus in der Provence haben wir schon«, bemerkte seine Frau. »Sag bloß, dir fehlen schöne Frauen!«
Filippo lächelte. Er war mager, um die vierzig mit dichtem, gelocktem Haar und Bart.
»Vielleicht fehlt mir ein Überfall. Es muss Spaß machen, einen Coup zu organisieren, die Zeiten zu studieren, die Flucht zu planen …«
Salviati kannte dieses Gedankenspiel recht gut. Hin und wieder kam es dazu: ein Sommerabend, ein wenig Zeitvertreib, ein Ausflug der Phantasie. Stell dir vor, du würdest eine Bank ausrauben! Und ohne zu viele oder allzu wenige Worte ging er auf das Spiel ein.
»Warum nicht?« Er deutete ein Lächeln an. »Wenn ihr wollt, können wir’s probieren.«
»Ich bin dabei!«, rief Filippo.
»Wir landen einen echten Coup, und dann könnt ihr das ganze Jahr über hierbleiben …«
»Aber heutzutage schafft das keiner mehr«, widersprach Anna. »Am Ende werden alle geschnappt, selbst die, denen es gelingt, mit dem Geld zu entkommen.«
»Ach was, nicht alle«, sagte Filippo. »Ich hab neulich in der Zeitung die Geschichte von diesem Ronnie Biggs gelesen, der in den sechziger Jahren einen Postzug überfallen hat und … ich glaube, mit beinahe vier Millionen Pfund Sterling abgehauen ist! Das war damals übrigens eine unglaubliche Summe.«
»Und haben sie ihn nie gefasst?«, fragte Anna.
»Nicht so richtig.«
Filippo liebte es, Geschichten zu erzählen, die er in der Zeitung gelesen hatte. Er streckte sich auf seinem Stuhl aus und wartete auf die Frage. Salviati reagierte prompt:
»Nicht so richtig?«, fragte er. »Wie meinst du das?«
»Es waren sechzehn Mann«, erklärte Filippo, »und die Vorbereitungen haben über ein Jahr gedauert. Der Anführer war Reynolds. Er und Biggs hatten sich im Gefängnis kennengelernt und dabei eine Menge Gemeinsamkeiten entdeckt: ihre Leidenschaft für Jazz, für Hemingway und für Steinbeck.«
Salviati lächelte in die Dunkelheit. Wie oft hatte er schon die Geschichte vom Großen Postraub gehört.
»… und indem sie das Signal manipulierten, gelang es ihnen, den Zug zu stoppen«, erzählte Filippo. »Eine Gruppe hielt den Lokführer und den Heizer in Schach, eine zweite koppelte die hinteren Wagen ab. Die Lok setzte ihren Weg mit dem Geldwaggon fort. Rund einen Kilometer weiter wartete eine dritte Gruppe auf das Zugstück. Das Spiel war bereits gelaufen: Sie haben das Geld genommen und sind geflohen.«
»Wohin?«, fragte Salviati.
»Sie haben sich in einem Gehöft versteckt, das sie vor dem Coup gekauft hatten. Nachdem die Beute aufgeteilt war, rund zweihunderttausend Pfund Sterling pro Kopf, sind alle abgehauen und in London untergetaucht.«
Filippo schwieg, alle schwiegen. Zufrieden atmeten sie die laue provenzalische Nachtluft ein und gaben sich dem Traum eines Millionenraubs hin. Aber Salviati beschloss, den Zauber zu durchbrechen.
»Und weiter?«, fragte er.
»Sie haben einen Fehler begangen.« Filippo seufzte. »Das Bandenmitglied, das den Hof in Brand stecken sollte, hat seinen Teil eingesackt, sich aus dem Staub gemacht und alles so hinterlassen, wie es war, inklusive Fingerabdrücken. Die von Biggs haben sie auf einem Monopoly-Spiel gefunden.«
»Also werden am Ende doch alle geschnappt«, meinte Anna.
»Scheint so …«, bemerkte Salviati.
»Nein, Moment mal!«, warf Filippo ein. »Einige Bandenmitglieder sind nie identifiziert worden. Sie haben sich mit ihrem Geld ein schönes Leben gemacht. Biggs ist allerdings gefasst worden, aber er hat es geschafft, aus dem Hochsicherheitsgefängnis zu entkommen, mit einer Strickleiter, stellt euch das vor, und dann ist er nach Südamerika geflohen.«
»Und hat ihn die englische Polizei nicht aufgespürt?«
»Natürlich hat sie ihn aufgespürt! Er hat einen Haufen Werbung gemacht, bei Rockgruppen mitgesungen, er war auf Reisen, hat Kinder gezeugt. Aber es gab kein Auslieferungsabkommen mit Brasilien, und so haben sie ihn nie gekriegt.«
»Und jetzt?«, fragte Salviati leise.
»Jetzt sitzt er im Gefängnis.«
»Ah.«
»Er ist aus gesundheitlichen Gründen nach Großbritannien zurück. Er ist fast achtzig und in einem ziemlich schlechten Zustand. Wenn man bedenkt, dass er vierzig Jahre lang auf der Flucht war!«
»Aber sie haben ihn geschnappt«, wandte Salviati ein.
»Sagen wir, er hat sich schnappen lassen. Und er hat seine Story an die Boulevardpresse verkauft. Aber wer weiß, wie viele Diebe es schaffen, ihr Ding zu drehen und unterzutauchen …«
»Wir werden es schaffen«, rief Anna. »Wir legen uns einen perfekten Plan zurecht. Man muss nur gründlich genug die Zugfahrpläne studieren …«
»Schon, aber wie wollen wir den Zug stoppen?«
»Wir stoppen ihn nicht, wir schmeißen die Geldsäcke aus dem Fenster!«
»Und einer steht bereit, um sie aufzusammeln.«
»Aber die Wachleute?«
»Man müsste die Säcke einfach vorher austauschen, während sie in den Zug geladen werden.«
»Wenn wir eine Schaffneruniform hätten …«
»Und wieso keine Polizeiuniform? So kämen wir in den Waggon mit dem Geld.«
»Und du, Jean, hast du keine Idee?«, fragte Anna.
Salviati lächelte. Die Augen der Frau glänzten im Dunkeln. Es genügt so wenig, dachte er, so wenig …
»Oh, ich verstehe von diesen Dingen nicht besonders viel«, sagte er und führte ein Streichholz an die Pfeife. »Ich weiß nicht, ob ich euch helfen könnte.«
»Wir werden schon eine Rolle für dich finden«, meinte Filippo.
»Ich bin das Gehirn der Bande!«, rief Anna. »Du, Filippo, wirst dich um die Fahrpläne und die Koordination der Zeiten kümmern, du weißt, dass ich nicht pünktlich bin. Und du, Jean, könntest Informationen sammeln. Weißt du, als Bahnbeamter die Schichtwechsel herausfinden und so weiter.«
»Perfekt«, murmelte Salviati.
»Man muss einen kühlen Kopf bewahren und zu allem bereit sein«, warf Filippo ein.
»Weiß nicht!«, Salviati schüttelte den Kopf. »Ich bin nicht besonders geeignet für Überfälle …«
»Wir werden’s dir schon beibringen!« Anna lächelte. »Wir sind wie Bonnie und Clyde.«
»Hör sie dir an!«, rief ihr Mann. »Sie spricht, als hätte sie ihre gesamte Jugend damit verbracht, Banken auszurauben!«
Sie lachten alle drei, auch Salviatis Lachen war aufrichtig. Das Lachen eines Gärtners in einer alten provenzalischen Villa. Das Lachen eines Mannes, der nie das Gesetz übertreten hat. Und weit weg, über dem Meer, färbte der Mond die dunkle, von Zikadenklängen und Düften erfüllte Nacht. Hin und wieder bewegte ein leichter Wind die Zweige im Garten und verlor sich auf der Terrasse.
»Hier lässt es sich aushalten, stimmt’s?«, wiederholte Anna.
Ihr Mann nickte. Salviati blies ein wenig Rauch aus und sagte:
»Wirklich ein schöner Abend.«
Später, als er mit seinem alten Motorroller auf dem Heimweg war, ging Salviati das Geplauder auf der Terrasse erneut durch den Kopf. Das Gedankenspiel endete immer mit der Rückkehr zur Ruhe, zum Rhythmus der Ferien.
Zum Glück. Wenn alle, die davon träumen, einen Coup zu landen, es tatsächlich täten, würden die Gefängnisse aus allen Nähten platzen. Salviati war draußen, und er war froh darüber. Er hatte alles in allem fast zehn Jahre gesessen. Das Geld war schnell weg gewesen, ebenso wie die Bereitschaft zum Risiko. Und auch die Abenteuerlust, die einem Überfall vorangeht, und jene träge Befriedigung, die danach kommt, waren verflogen.
Salviati durchquerte die warme, von Zauber und Gerüchen erfüllte Nacht, fuhr zügig über die kaum beleuchteten Straßen. An einem bestimmten Punkt, als er den Hügel hinabkam, dachte er an seine Tochter. Später fragte er sich, ob es vielleicht eine Art Vorahnung gewesen war. Trug er nicht letztlich Schuld daran, dass seine Tochter so leidenschaftlich gern spielte? Hatte er ihr nicht die Freude am Wagnis, am Überraschungscoup nahegebracht?
Er gab sich nie eine Antwort darauf, denn kaum zu Hause angelangt, kam die Zeit des Handelns.
Salviati wohnte in einem Gebäude am Parkrand. Ein stabiler Bau mit dicken Mauern, klein, aber hübsch gelegen: Nebenan befand sich eine Quelle, die das gesamte Jahr über für frisches Wasser sorgte. Nachdem er seinen Motorroller abgestellt hatte, zündete er die Laterne unter dem Vordach an und trat in den Flur. Der Brief lag auf dem Boden, unter der Tür. Salviati vermutete, dass Gilbert, der Laufbursche, der ihm hin und wieder zur Hand hing, ihn gebracht hatte.
Er ging in die Küche. Er hatte noch Appetit, aß ein Stück Brot und etwas Käse. Dann nahm er einen Schluck Wasser und öffnete schließlich den Brief. In diesem Augenblick verschwamm alles miteinander: die Zeit der Überfälle, die Reue, der provenzalische Himmel, der Gedanke an seine Tochter und die Tatsache, dass das Spiel noch nicht zu Ende war. Noch konnte er sich nicht zurückziehen.
Jean Salviati,
ich habe ein Projekt, das dich interessieren wird. Ich weiß, dass du gerne Nein sagen würdest. Aber da Lina auf unbestimmte Zeit mein Gast sein wird, glaube ich, du solltest die Sache noch einmal überdenken.
Schreibe mir an das Postfach 4980, 6900 Lugano.
Und füge deiner Antwort dieses Schreiben bei.
Herzliche Grüße,
Luca
Luca Forster. Wenige Worte, keine Details. Aber Salviati brauchte nicht mehr. Das Spiel war noch nicht zu Ende, so viel war sicher. Und er musste Madame Augustine um Beurlaubung bitten.
5Rückkehr nach Lugano
Manche sagen, dass Orte ihre eigenen Erinnerungen bergen.
Salviati fand das nicht. Die Erinnerungen sind in den Menschen, in ihren Blicken. Oder in ihren Sachen. Linas Wohnung war klein und roch ungelüftet. Das Bett ungemacht, eine Milchpackung auf dem Küchentisch, eine rot-gelb karierte Decke auf dem Sofa. Schmutzige Gläser auf dem Glastischchen im Wohnzimmer.
Auf dem Teppich vor dem Fernseher lagen eine Platte von John Coltrane, ein Buch über Meditation und eine DVD mit Hugh Grant. Salviatis Blick schweifte langsam durch die Räume, auf der Suche nach etwas Auffälligem, nach etwas, das nicht hierhergehörte.
Aber es herrschte einfach nur Unordnung. Nichts Besonderes.
Eine Menge Papiere auf dem Schreibtisch. Belege, offene Rechnungen, Eintritts-, Kino- und Konzertkarten. Nirgendwo Geld, außer zwanzig Franken in der Nachttischschublade.
Salviati setzte sich an den Küchentisch. In der Wohnung gab es weder Zeichen eines Kampfes noch Zeichen eines freiwilligen Aufbruchs. Allerdings war die Milch abgelaufen. Und die Geranien auf dem Balkon waren verwelkt. Lina hatte nicht damit gerechnet fortzubleiben.
Hatte Luca Forster ihr etwas angetan?
Keine voreiligen Schlüsse, dachte Salviati, während er die Wohnung verließ. Er hatte Werkzeug dabei, um sich Zugang zu verschaffen, aber die Tür war nicht abgeschlossen gewesen. Er verließ die Wohnung, wie er sie vorgefunden hatte, und trat auf die Straße. Die Haustür war vollkommen unbewacht. Um hineinzukommen, hatte sich Salviati einer mit Einkaufstüten bepackten Bewohnerin angeschlossen, die er gegrüßt und der er in den Aufzug geholfen hatte.
Er lief die Straße am Cassarate hinunter. Seit Jahren war er nicht mehr in der italienischen Schweiz gewesen. Aber unterwegs erkannte er die Straßen, den Geruch der Stadt wieder. Es gab mehr Autos, mehr fremde Stimmen und Gesichter. Einschließlich meinem eigenen, dachte er. Er blieb stehen und sah auf den Fluss. Ein roter Ball war ins Wasser gefallen, unterhalb eines kleinen Wasserfalls. Strömung und Gegenströmung hielten ihn an einem Punkt fest.
Salviati ließ sich in den Bann ziehen. Reglos fixierte er den Ball, bis alle Gedanken aus seinem Kopf verschwunden waren.
Dann trank er auf der Terrasse eines Restaurants, wenige Meter vom Cassarate entfernt, ein Bier. Mittlerweile war alles ziemlich klar: Forster saß am längeren Hebel. Und solange Salviati nicht herausfand, wo Lina war, musste er nach dessen Pfeife tanzen.
Es war ein warmer Tag, Schwüle lastete auf dem Asphalt. Die Sonne brachte die Autodächer auf dem Parkplatz des Padiglione Conza zum Glühen.
Salviati überquerte die Kreuzung am Ende der Via Cassarate und ging zu Fuß in Richtung Innenstadt. Er hatte auf Forsters Brief schlicht geantwortet: Ich bin in Lugano. Und Forster hatte ihm für denselben Abend gegen sechs Uhr ein Treffen in einer Wohnung in Paradiso vorgeschlagen.
Als er das Stadtzentrum erreichte, war es vier. Er bemerkte, dass die Busstation neu war. Eine moderne Angelegenheit, Plastik und geometrische Formen. Er studierte den Fahrplan, suchte eine Linie heraus, die gegen fünf nach Paradiso fahren würde. Dann vertrieb er sich die Wartezeit und schlenderte ein wenig durch die verkehrsfreie Innenstadt. Er versuchte sich zu beruhigen. Die Straßen waren nicht übermäßig belebt. Ein paar blonde Touristen, einige Pärchen mit einem Eis in der Hand. Flip-Flops. Bermudas. Sonnenbrille. Kleine Jungs auf Rollern. Verschwitzte Angestellte, Krawatten, die wie Hundeleinen wirkten.
Später, als Salviati das Haus erreichte, das Forster angegeben hatte, war er noch immer ruhig, frei von Gedanken. Er hatte den passenden inneren Zustand gefunden, die Sinne angespannt, die Gefühle unter Kontrolle.
Das Haus lag auf einem Hügel zum See hin. Salviati überquerte eine Fußgängerbrücke, die über einen mit Johanniskraut und Polyantha-Rosen bepflanzten Garten führte. Die Wohnungstür wurde sofort geöffnet. Salviati erkannte Eltons affenartiges Gesicht. Er begrüßte ihn herzlich. In einem anderen Leben hätten sie gemeinsam Hehlereigeschäfte abgewickelt.
»Salviati, sehr erfreut, Sie wiederzusehen«, sagte Elton. »Ich sehe, Sie sind zu früh.«
»Ja.«
»Ich werde nachschauen, ob Signor Forster bereit ist …«
»Sag ihm, er soll kommen!«, tönte Forsters Stimme von innen.
Das Arbeitszimmer hatte drei vollkommen weiße Wände. Die vierte war eine Glasfront zum See. Die Sonne blendete in den Augen, sie wirkte beinahe unwirklich in der von der Klimaanlage eiskalten Wohnung.
»Salviati«, sagte Forster. »Wir haben uns eine Weile nicht gesehen.«
Er war eine stattliche Erscheinung, mit tiefschwarzem Haar und einem Schnauzbart, der ihm ein vornehmes Äußeres verlieh. Salviati hatte ihn schlanker in Erinnerung.
»Du hast abgenommen«, stellte Forster fest, als sie sich die Hand gaben.
Obwohl sie ungefähr das gleiche Alter hatten, wirkte Salviati mit seinen bereits leicht ergrauten Schläfen einige Jahre älter.
»Was ist das für eine Geschichte mit meiner Tochter?«
»Setz dich, damit wir darüber reden können.« Forster deutete ein verkniffenes Lächeln an. Seine Stimme war angenehm, ohne jeglichen Akzent.
In dem Zimmer befanden sich lediglich ein Schreibtisch und zwei Stühle. Keine weiteren Gegenstände, kein Nippes. Auf dem Schreibtisch ein Packen weißes Papier, ein Bleistift, ein Füller.
Salviati nahm Platz und wiederholte:
»Was ist das für eine Geschichte mit meiner Tochter?«
»Ich weiß, dass du dich aus dem Geschäft zurückgezogen hast …«, sagte Forster.
Salviati sah ihn an.
»Dir ist bekannt, dass deine Tochter Schulden bei mir hat, und zwar in Höhe von … Elton?«
Elton war an der Tür stehen geblieben. Bevor er zu sprechen begann, trat er einen Schritt näher, um in Salviatis Blickfeld zu gelangen.
»Zweihundertdreiundzwanzigtausend Franken, soweit ich weiß, ohne Zinsen.«
»Reisen«, kommentierte Forster, »Glücksspiele, Hotels, Casinos und …«
»Forster«, sagte Salviati.
Forster hob die Hand.
»Ich komme zur Sache. Du brauchst nicht zu glauben, dass du sie einfach so zurückbekommst. Aber schließlich haben wir schon einige gemeinsame Geschäfte gemacht. Erinnerst du dich?«
Salviati erwiderte nichts. Die Lider halb geschlossen, sah er aus, als würde er gleich einschlafen. Aber Forster kannte ihn gut und fuhr eilig fort:
»Ich habe einen Hinweis auf eine ganz lukrative Sache, aber mir fehlen die Mittel, das Ganze zu organisieren. Dir dagegen nicht. Du erledigst also für uns die Arbeit, und wir streichen deiner Tochter die Schulden. Okay?«
»Wo ist meine Tochter?«
»Das kann ich dir nicht sagen.«
»Was habt ihr mit ihr gemacht?«
»Nichts. Sagen wir, sie ist mein Gast, so lange, bis wir unser Geschäft abgewickelt haben.«
»Und wenn ich zur Polizei gehe?«
Diesmal war es Forster, der keine Antwort gab. Nach einiger Zeit meinte Salviati: »Du bist ein Bastard.«
»Ich weiß. Aber ich will das Geld.«
»Welche Garantie habe ich?«
»Wir sind Geschäftsleute. Ich will bloß das Geld.«
»Und wenn Lina dich anzeigt, sobald sie frei ist?«
»Wir wissen beide, dass sie das nicht tun wird.«
»Du kannst nicht sicher sein, dass mir gelingt, was du von mir verlangst.«
»Nein. Aber du kannst es probieren. Sieh mal, Salviati, ich will dich nicht übers Ohr hauen. Im Gegenteil wird am Ende, angesichts der Summe, auch für dich etwas herausspringen, zusätzlich zu …«
»Leck mich am Arsch«, murmelte Salviati, in einem Ton, als ließe er eine Bemerkung über das Wetter fallen.
Forster senkte den Kopf, wie zur Entschuldigung. Dann griff er nach dem Füller auf dem Schreibtisch und betrachtete ihn eingehend.
»Jedenfalls ist es ein sehr guter Plan«, sagte er schließlich. »Elton kümmert sich um die ganze Angelegenheit, er steht in Kontakt mit der Person, die die Idee hatte. Der alte Salviati hätte nicht gezögert.«
»Der alte Salviati hat nicht nach anderer Leute Plänen gearbeitet. Und sich schon gar nicht erpressen lassen.«
»Den Plan kannst du selbst ausarbeiten. Wir geben dir die Informationen.«
»Und was soll ich für euch tun?«
»Du sollst die Junker-Bank um zehn Millionen Franken erleichtern.«
Schweigen. Forster hob den Blick, ließ den Füller los. Salviati starrte ihn an, schloss die Augenlider.
»Zehn Millionen Franken …«, flüsterte er. »Zehn. Millionen. Die Junker-Bank. Das ist also deine Idee. Deshalb hast du meine Tochter entführt.«
»Hör zu, Salviati, das Ganze ist machbar. Mein Informant …«
»Tu mir den Gefallen«, Salviati hob die Hände, »tu mir den Gefallen, und sage nichts mehr.«
»Aber …«
»Es reicht!«
Schweigen. Salviati schloss die Augen. In seinem Inneren wuchs von Minute zu Minute die Gewissheit, dass es keinen Ausweg gab.
6Den Blicken der Welt entzogen
Er arbeitete für einen Hersteller von Sicherungssystemen für Banken und Registrierkassen. Matteo erinnerte sich gut an ihn. An seine feuchtglänzenden, klugen Augen, an seinen Tick, sich jedes Mal, wenn er sich in einer Scheibe spiegelte, zu kämmen.
»Ich denke, wir werden uns heute mit einem neuen Gedanken vertraut machen«, sagte er immer, »und zwar mit der Bank als Erfahrungsbereich.«
Die Bank als Erfahrungsbereich? Warum nicht? Es kommt auf den Blickwinkel an …
Dieses Ausbildungsseminar für Sicherheitskräfte hatte sich am Ende als nützlicher erwiesen, als gedacht. Zunächst hatte Matteo erkannt, dass die Wachschutz- und Security-Branche nichts für ihn war. Darüber hinaus hatte er einige wertvolle Freundschaften geschlossen.
Matteo Marelli hätte sich niemals träumen lassen, eine Bank auszunehmen, normalerweise gab er sich mit kleinen Betrügereien ab. Aber er hatte nichts dagegen, einen Coup im größeren Stil zu wagen. Deshalb saß er im Clayton Pub von Viganello bei einem Bier mit Jean Salviati zusammen.
»Ich kann Ihnen nicht helfen«, sagte Salviati, »ich kenne niemanden mehr.«
»Aber Sie müssen mir helfen«, wiederholte Matteo.
Salviati warf ihm einen durchdringenden Blick zu.
»Sie werden es am Ende nicht bereuen«, fuhr Matteo fort. »Wie dem auch sei …«
»Es reicht. Sagen Sie mir, was Sie von mir wollen.«
Matteo war voller Bewunderung. Der Alte saß da, sonnengegerbt und unbeweglich wie eine Eiche, ohne jemals der Versuchung nachzugeben, ihn zu beschimpfen oder zu ohrfeigen. Und dennoch schien er eher ein hitziges Gemüt zu haben. Aber ein guter Dieb muss so sein, oder nicht?
»Es ist ganz einfach, Herr Salviati. Ich habe viele Freunde in dem Umfeld und kann eine Menge Informationen sammeln. Aber ich kann sie nicht nutzen, Sie dagegen schon.«
»Ich bin Gärtner.«
»Herr Salviati …«
Schweigen. Salviati holte seine Pfeife hervor und fing an, sie zu stopfen.
»Sagen Sie, was Sie vorhaben.«
»Sie wissen, dass man in öffentlichen Lokalen nicht mehr rauchen darf.«
»Ich rauche nicht. Ich stopfe meine Pfeife.«
»Verstehe.«
Besser dem Alten nicht widersprechen, dachte Matteo. Er zog sein Bierglas heran, beugte sich über die Tischkante und senkte die Stimme.
»Wir wollen keine große Junker-Filiale in Zürich oder Lugano überfallen. Das wäre unmöglich, oder zumindest ziemlich riskant.«