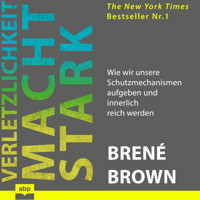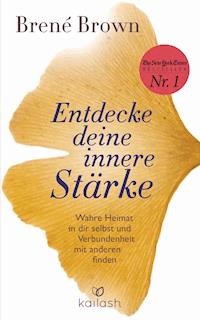21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Was braucht es, um eine erfolgreiche Führungskraft zu sein? Bestsellerautorin Brené Brown weiß es: Gute Führung zieht ihre Kraft nicht aus Macht, Titeln oder Einfluss. Effektive Chefs haben zu ihrem Team vielmehr eine intensive Beziehung, die von Vertrauen und Authentizität geprägt ist. Ein solcher Führungsstil bedeutet auch, dass man sich traut, mit Emotionen zu führen und immer mit vollem Herzen dabei zu sein. »Dare to lead - Führung wagen« ist das Ergebnis einer langjährigen Studie, basierend auf Interviews mit hunderten globalen Führungskräften über den Mut und die Notwendigkeit, sich aus seiner Komfortzone rauszubewegen, um neue Ideen anzunehmen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Brené Brown
Dare to lead – Führung wagen
Brené Brown
Führung wagen
Mutig arbeiten.
Überzeugend kommunizieren.
mit ganzem Herzen dabei sein.
Übersetzung aus dem Englischen von Petra Pyka
Sich mehr zutrauen und im Beruf durchstarten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
Wichtiger Hinweis
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
Originalausgabe
1. Auflage 2023
© 2023 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
© 2018 by Brené Brown. All rights reserved.
Die Originalausgabe erschien 2018 bei Random House, einem Imprint von Penguin Random House LLC unter dem Titel Dare to lead.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Übersetzung: Petra Pyka
Redaktion: Christiane Otto
Umschlaggestaltung: Marc Fischer
Satz: ZeroSoft, Timisoara
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-86881-781-2
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96267-193-8
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96267-194-5
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.redline-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Inhalt
Ein paar persönliche Worte von Brené
Einleitung
Mutige Führungskräfte und Mutkultur
Erster Teil:
Auseinandersetzung mit Verletzlichkeit
Erster Abschnitt:
Der Moment und die Mythen
Zweiter Abschnitt:
Aufruf zum Mut
Dritter Abschnitt:
Der Panzer
Vierter Abschnitt:
Scham und Empathie
Fünfter Abschnitt:
Neugier und geerdetes Selbstvertrauen
Zweiter Teil:
Unsere Werte leben
Dritter Teil:
Vertrauen wagen
Vierter Teil:
Aufstehen lernen
Danksagung
Über die Autorin
Anmerkungen
Für meinen Freund Charles Kiley. Wer hätte damals gedacht, dass wir irgendwann einmal zusammenarbeiten und andere führen würden, als wir noch gemeinsam gekellnert haben und später aus deinem Gästezimmer Exemplare meines ersten, im Selbstverlag erschienenen Buches verkauften? Ohne dich hätte ich es nie geschafft.
#outrageous #pingpong #playsomecheap
Ein paar persönliche Worte von Brené
Ich werde oft gefragt, ob ich vor öffentlichen Auftritten noch Lampenfieber habe. Allerdings. Ich bin jedes Mal nervös. Mit zunehmender Erfahrung ist die Angst geschwunden, aber die Nerven flattern immer noch. Schließlich opfern mir die Menschen ihr kostbarstes Gut – ihre Zeit. Und Zeit ist zweifellos unsere begehrteste und am wenigsten erneuerbare Ressource. Wer keinen Kloß im Hals und kein Kribbeln im Bauch hat, wenn ihm dieses wertvollste Geschenk des Lebens dargebracht wird, der hat etwas nicht richtig verstanden.
Außerdem ist so ein Vortrag grundsätzlich störanfällig. Ich bete schließlich nichts Auswendiggelerntes herunter und halte mich auch nicht sklavisch an ein vorgefertigtes Konzept. Effektiv zu sprechen, setzt die unberechen- und unbeeinflussbare Kunst voraus, Verbundenheit herzustellen. Selbst wenn ich in einem Kongresszentrum ganz allein auf dem Podium stehe und vor mir an die 10 000 Menschen auf Klappstühlen sitzen, versuche ich deshalb, so vielen wie möglich in die Augen zu sehen. Und ja, ich bin davor grundsätzlich nervös.
Ich habe mir aber in den letzten Jahren ein paar Tricks angeeignet, die mir helfen, mich zu sammeln. Obwohl es die Techniker regelmäßig zur Verzweiflung treibt, bestehe ich darauf, dass die Bühnenbeleuchtung auf 50 Prozent gedimmt wird. Bei 100 Prozent kann ich das Publikum nicht mehr sehen, und ich spreche nicht gern ins Nichts. Ich muss zumindest so viele Gesichter sehen können, dass ich merke, ob der Funke überspringt. Erzeugen meine Worte und Bilder Nähe? Oder Distanz? Erkennt sich das Publikum in meinen Geschichten wieder? Man sieht es den Menschen an, wenn sie glauben, was sie hören. Sie nicken oder lächeln dann, und manche heben die Hände ans Gesicht. Skeptische Zuhörer erkenne ich daran, dass sie den Kopf schief legen. Und sie lachen seltener.
Aber es gibt noch einen Trick, den ich einsetze, wenn ein übereifriger Veranstalter versucht, mich durch Einschüchterung zu Höchstleistungen anzuspornen, indem er mir beschreibt, wer da alles im Publikum sitzt. Das klingt dann etwa so: »Weißt du eigentlich, dass heute Abend jede Menge hochrangige Militärs im Saal sitzen, Brené?« Oder hohe Tiere aus der Wirtschaft, elitäre Mitglieder dieser oder jener ganz besonderen Gruppierung, erfolgreiche Karrierefrauen oder – mein absoluter Favorit: »Heute sind nur Vollblutwissenschaftler da. Die sind bestimmt superkritisch, also halte dich besser an die Daten.« So etwas bekomme ich oft zu hören, wenn das Publikum ein bisschen unwillig wirkt, vielleicht weil die Leute nicht so genau wissen, warum ich eingeladen wurde, oder im schlimmsten Fall, weil sie nicht wissen, warum sie dazu verdonnert wurden, an dieser Veranstaltung teilzunehmen.
In solchen Fällen greife ich auf die klassische Strategie zurück, mir »das Publikum nackt vorzustellen«. Nein, nicht ohne Kleider. Das bringt mir nichts. Einfach ohne den Panzer ihrer Titel, Positionen, Machtstellungen oder Einflusssphären. Fällt mir eine Zuhörerin mit skeptisch geschürzten Lippen und fest verschränkten Armen auf, überlege ich mir, wie sie wohl in der dritten Klasse ausgesehen haben mag. Bleibt mein Blick an einem Mann hängen, der immer wieder den Kopf schüttelt und Kommentare abgibt wie: »Erfolgreiche Menschen zeigen am Arbeitsplatz keine Schwäche«, dann stelle ich mir vor, wie er ein Kind im Arm hält oder bei seiner Therapeutin auf der Couch sitzt. Okay, bei der Therapeutin, die er meiner Ansicht nach dringend aufsuchen sollte.
Bevor ich aufs Podium trete, sage ich mir leise drei-, viermal das Wort »Menschen« vor. »Menschen. Menschen, Menschen, Menschen.« Diese Strategie wurde 2008 aus der Verzweiflung geboren, als ich gefühlt zum ersten Mal vor Topmanagern auftreten sollte. Ich hatte zuvor schon in großer Runde in Krankenhäusern referiert und viele verhaltensmedizinische Vorträge gehalten, doch schon als ich damals im Vorraum hinter der Bühne stand, unterschied sich diese Erfahrung spürbar von allem, was ich bis dahin erlebt hatte.
Bereits als ich versuchte, mich in dem Raum mit 20 anderen Referenten einzurichten, die alle bei dieser ganztägigen Veranstaltung auf ihren 20-Minuten-Vortrag im TED-Stil warteten, beschlich mich ein intensives Außenseitergefühl. Ich fühlte mich gründlich fehl am Platz. Instinktiv fragte ich mich, ob es an meinem Geschlecht liegen konnte, denn bis heute bin ich bei solchen Anlässen oft die einzige Frau hinter der Bühne. Doch das war nicht der Grund. Heimweh konnte es ebenfalls nicht sein, denn ich lebte nur 30 Minuten entfernt in Houston.
Als ich hörte, dass die Veranstalter das Publikum begrüßten, zog ich den schweren Samtvorhang ein Stück zur Seite, der uns vom Saal trennte, und spitzte hinaus. Da draußen sah es aus wie bei einem Brooks-Brothers-Kongress – reihenweise fast ausschließlich Männer in weißen Hemden und sehr dunklen Anzügen.
Ich ließ den Vorhang zufallen und bekam Panik. Gleich neben mir stand ein junger Referent, der ganz versessen darauf schien, das Podium zu betreten, und ganz offensichtlich keinerlei Berührungsängste hatte. Ich weiß nicht mehr, was er zu mir sagte, als ich ihm ins Wort fiel: »Du lieber Himmel, das sind ja lauter Geschäftsleute da draußen – lauter Manager. Oder FBI-Agenten.«
Er schmunzelte. »Ja, sicher, Frau Kollegin. Es ist eine C-Level-Konferenz. Hat Ihnen das denn keiner gesagt?«
Ich wurde blass und ließ mich auf den nächsten Stuhl sinken.
Er holte zu einer Erklärung aus: »Sie wissen schon, C wie in CEO, COO, CFO, CMO, CHRO …«
Ich hatte nur noch einen Gedanken: Ich kann dem Kerl auf gar keinen Fall die Wahrheit sagen.
Er kniete sich neben mich und legte mir den Arm um die Schulter. »Sind Sie okay?«
Vielleicht war es sein australischer Akzent oder sein breites Lächeln oder sein Name (er hieß Pete). Aus irgendeinem Grund fasste ich sofort Zutrauen und gestand: »Das hat man mir schon gesagt, aber ich dachte, das stünde für S-E-A wie in ›Salt of the Earth‹ – also für bodenständig und geerdet.«
Er lachte dröhnend. »Das ist genial! Das sollten Sie unbedingt verwenden!«
Ich sah ihn an und meinte: »Das ist nicht komisch. Ich soll hier über Scham sprechen und über das Gefühl der Unzulänglichkeit.«
Zögernd setzte ich hinzu: »Was für eine Ironie.«
Da mischte sich eine Dame aus Washington ein, die 20 Minuten lang über das Ölgeschäft referieren würde: »Sie meinen Scham – im emotionalen Sinn? Wie in sich schämen?«
Noch bevor ich bejahen konnte, sagte sie: »Interessant. Na, ich möchte nicht in Ihrer Haut stecken.« Und weg war sie.
Was Pete dann zu mir sagte, werde ich mein Leben lang nicht vergessen. »Schauen Sie sich das Publikum doch an. Das sind Menschen. Bloß Menschen. Denen erzählt keiner etwas über Scham, dabei stecken sie alle bis zum Hals drin. Genau wie wir. Schauen Sie sie an. Es sind Menschen.«
Ob ihm die Wahrheit an die Nieren ging, die in seinem Rat steckte, oder der Gedanke an mein Thema – jedenfalls erhob er sich, klopfte mir auf die Schulter und ließ mich allein. Rasch klappte ich meinen Laptop auf und suchte nach »gängigen MBA- und Wirtschaftsbegriffen«. Vielleicht konnte ich meinem Thema ja ein paar Konturen verleihen, indem ich ein bisschen Fachjargon einflocht.
Verflixt. Das erinnerte mich an das Kinderbuch Old Hat, New Hat aus der Berenstain-Bears-Reihe, das meine Kinder so geliebt hatten, als sie noch klein waren.1 Die Geschichte handelt vom Bärenpapa, der in den Hutladen geht und 50 verschiedene Modelle aufprobiert, um seine alte, abgetragene Kopfbedeckung zu ersetzen. Doch natürlich gibt es bei jedem neuen Hut ein Problem: »Zu groß. Zu klein. Zu schwer. Zu leicht.« So geht das Seite um Seite, bis er sich folgerichtig entschließt, den alten, gammligen Hut zu behalten, weil er ihm so gut passt.
Ich flüsterte ein paar Begriffe vor mich hin, um zu prüfen, ob ich damit arbeiten konnte.
Long Pole Item? Zu wuchtig.
Kritischer Pfad? Zu ausgelutscht.
Skip-Level? Zu sprunghaft.
Vielleicht Incentive?
Incentivieren? Moment mal. Was war das? Das ist doch Quatsch. Man kann doch nicht einfach »ivieren« an irgendein Wort anhängen.
Zum Glück rief in diesem Moment mein Mann Steve an und unterbrach meine Berenstain-Bears-Suche nach Managementbegriffen.
»Na, wie geht’s? Bist du bereit?«, wollte er wissen.
»Nein! Das wird ein totaler Reinfall«, sagte ich und erklärte ihm, was mir bevorstand. Da wurde er ganz still.
In seinem ernstesten Tonfall – der normalerweise für panische Eltern reserviert ist, wenn sie medizinische Beratung brauchen (er ist Kinderarzt), oder für mich, wenn ich kurz vor dem Nervenzusammenbruch stehe – sagte er: »Brené, versprich mir, dass du keinen dieser dämlichen Begriffe verwendest. Tu das auf keinen Fall.«
Ich war inzwischen den Tränen nahe. »Versprochen«, flüsterte ich. »Aber du solltest diese Leute sehen. Es ist wie auf einem Begräbnis. Und keinem wie in meiner Familie, zu dem die Leute flippig in Jeans und mit anständigen Cowboyhüten kommen. Wie auf einem britischen Begräbnis. Oder einer Beisetzungsfeier bei den Sopranos.«
Da sagte er: »Hör auf den Australier. Schau dir das Publikum noch einmal an. Das sind nur Menschen wie du und ich. Wie unsere Freunde. Es sind doch auch ein paar Bekannte da, oder? Echte Menschen mit einem wirklichen Leben und richtigen Problemen. Zieh dein Ding durch.«
Dann versicherte er mir noch, dass er mich liebe, und wir beendeten das Gespräch. Ich erhob mich und schob noch einmal den Vorhang zur Seite. Der Saal war jetzt abgedunkelt und auf dem Podium stand ein Redner. Ich hätte gern ein paar Gesichter im Publikum gesehen, aber von der Seite war das schwierig. Da – wie in einer Zeitlupenszene im Film – drehte sich ein großer Glatzkopf zu seinem Sitznachbarn, um ihm etwas zuzuflüstern, und ich sah sein Gesicht.
Ich schnappte nach Luft und zog den Vorhang zu. Ich kannte den Mann. Wir wurden damals zur selben Zeit trocken und suchten Mitte der 1990er-Jahre dieselben Treffen der Anonymen Alkoholiker auf. Ich konnte es kaum fassen. Ich fühlte mich, als sei gerade ein Wunder geschehen. Da tauchte mein neuer Freund Pete wieder auf.
»Na, geht’s?«, fragte er.
Ich lächelte. »Ja, ich glaube schon. Sind ja nur Menschen, stimmt’s?«
Er klopfte mir noch einmal auf die Schulter und meinte, da sei eine Frau an der Tür, die mich sprechen wolle. Ich dankte ihm und ging nachsehen, wer die Besucherin war. Meine Nachbarin! Sie war damals geschäftsführende Gesellschafterin einer Anwaltssozietät und nahm mit mehreren Kollegen und ein paar Mandanten an der Veranstaltung teil. Sie wollte mir nur kurz Hallo sagen und mir alles Gute wünschen. Ich drückte sie kurz, dann ging sie in den Saal zurück. Ich lief durch die Lobby hinaus, um frische Luft zu schnappen.
Sie wird vielleicht nie erfahren, was unsere kurze Begegnung damals für mich bedeutete. Natürlich war es eine nette persönliche Geste, aber für mich machte das damals wirklich einen Unterschied. Natürlich ist sie Partnerin in einer renommierten Anwaltskanzlei, aber sie ist auch Tochter, die erst vor Kurzem ihre Mutter aus dem Betreuten Wohnen ins Hospiz verlegen musste. Und sie ist Mutter und Ehefrau, die gerade eine schwierige Scheidung zu bewältigen hatte.
Menschen. Menschen. Menschen.
Bei meinem Auftritt damals sprang der Funke über. Ich hatte sofort einen guten Draht zum Publikum. Wir lachten, wir weinten, und sie beugten sich so konzentriert vor, um zu hören, was ich über Scham, überzogene Erwartungen und Perfektionismus zu sagen hatte, dass ich befürchtete, sie würden gleich vom Stuhl fallen. Wir hoben gemeinsam ab.
Bevor ich wieder auf die Schulbank zurückkehrte, um Anfang der 90er-Jahre soziale Arbeit zu studieren, war ich in einem Fortune-10-Unternehmen die Karriereleiter hochgeklettert. Ich kündigte, um zu studieren, und hätte nie gedacht, dass ich noch einmal in diese Welt eintauchen würde, die nach meinem Empfinden genau das Gegenteil von dem verkörperte, was mir wichtig war – nämlich Mut, Verbundenheit und Sinn.
In meinen ersten Jahren als Doktorandin konzentrierte ich mich auf Change Management im System und Umfeldbeobachtung in Organisationen. Später veränderte sich meine Forschungsrichtung, und ich promovierte über Verbundenheit und Verletzlichkeit. Ich hätte nie gedacht, dass ich noch einmal auf dem Gebiet der Organisationsentwicklung tätig werden würde, denn das lag mir seinerzeit überhaupt nicht.
Doch der Vortrag, den ich an jenem Tag hielt, sollte sich als wichtiger Wendepunkt in meiner Laufbahn herausstellen. Die innige Erfahrung mit diesem Publikum bewirkte, dass ich mich fragte, ob es nicht ein Fehler gewesen war anzunehmen, dass sich meine beiden Interessensgebiete gegenseitig ausschlossen. Was, wenn man Mut, Verbundenheit und Sinn auf die Arbeitswelt übertragen würde?
Das zweite seltsame Ereignis jenes Tages führte zu einer spektakulären Wendung in meiner Karriere als Vortragsrednerin. Damals waren gleich mehrere Agenturen vertreten, die Referenten vermittelten, und nachdem die Referenten und ihre Agenten die Publikumsbewertungen erhalten hatten, riefen mich sämtliche Agenturen an und erkundigten sich nach meinen Karrierezielen. Nach monatelanger Gewissensprüfung beschloss ich, wieder in die Welt der Führungskräfte und der Organisationsentwicklung zurückzukehren. Diesmal allerdings mit einem ganz neuen Schwerpunkt: Menschen, Menschen, Menschen.
Nicht der Kritiker zählt
2010, zwei Jahre nach jenem Schlüsselerlebnis, schrieb ich Die Gaben der Unvollkommenheit.2 In diesem Buch stellte ich meine Forschungsarbeit zu den zehn Wegweisern zu einem Leben aus vollem Herzen vor. Es fand ein sehr breit gefächertes Publikum, darunter Manager, Verwaltungsleiter, hochrangige Vertreter der Kirchen und gemeinnütziger Organisationen.
Zwei Jahre später, 2012, nahm ich mit Verletzlichkeit macht stark Verletzlichkeit und Mut in den Blick. Es war das erste Buch, in das meine Erkenntnisse über Führung und meine Beobachtungen aus meiner Arbeit mit Organisationen einflossen. Verletzlichkeit macht stark wird von folgendem Zitat von Theodore Roosevelt auf den Punkt gebracht:3
Es ist nicht der Kritiker, der zählt, nicht derjenige, der aufzeigt, wie der Starke gestolpert ist oder wo der, der Taten gesetzt hat, sie hätte besser machen können. Die Anerkennung gehört dem, der wirklich in der Arena ist; dessen Gesicht verschmiert ist von Staub und Schweiß und Blut; der sich tapfer bemüht; der irrt und wieder und wieder scheitert; der die große Begeisterung kennt, die große Hingabe, und sich an einer würdigen Sache verausgabt; der, im besten Fall, am Ende den Triumph der großen Leistung erfährt; und der, im schlechtesten Fall des Scheiterns, zumindest dabei scheitert, dass er etwas Großes gewagt hat.
Auf dieses Zitat stieß ich in einer besonders schwierigen Phase meiner Karriere. Mein TEDxHouston-Talk über Verletzlichkeit4 verbreitete sich viral. Er stieß zwar auf zunehmende Zustimmung, aber vielfach auch auf brutale, persönliche Kritik. Das bestätigte meine schlimmsten Befürchtungen in Bezug auf solche Auftritte. Dieses Zitat brachte genau zum Ausdruck, wie ich mich fühlte, und auch meine wachsende Entschlossenheit, ganz auf Tom Petty zu machen und nicht nachzugeben.
Bei dem Mut zur Verletzlichkeit geht es nicht darum, zu gewinnen oder zu verlieren. Es geht darum, sich Situationen auszusetzen, die man nicht vorhersehen und deren Folgen man nicht beeinflussen kann. Dieses Zitat entsprach nicht nur meinem Wunsch, trotz des zunehmenden Zynismus und der Angstmacherei auf der Welt mutig zu leben, sondern fand auch bei Führungskräften Widerhall. Viele kannten das Zitat nur aus Verletzlichkeit macht stark, doch bei manchen hing es schon seit Jahren im Büro oder zu Hause an der Wand, weil sie sich ebenfalls darin wiederfanden. Kürzlich sah ich ein Bild von LeBron James’ Basketballschuhen. Darauf stand seitlich: »Der Mann in der Arena«.
Auf Verletzlichkeit macht stark folgte schnell Laufen lernt man nur durch Hinfallen – ein Buch, das sich mit dem Prozess befasst, den die widerstandsfähigsten meiner Probanden anwenden, um sich nach einem Sturz wieder aufzurappeln.5 Ich fühlte mich förmlich gezwungen, dieses Buch zu schreiben, denn wenn ich aus all meiner Forschungsarbeit etwas gelernt habe, dann das: Wer viel wagt, der kriegt unweigerlich irgendwann einen Knüppel zwischen die Beine geworfen. Wer sich für Mut entscheidet, der weiß auch, was Misserfolge, Enttäuschungen, Rückschläge oder gar ein gebrochenes Herz bedeuten. Deshalb nennen wir es ja Mut. Und deshalb ist Mut so selten.
2016 führte ich die Forschungsergebnisse aus Verletzlichkeit macht stark und Laufen lernt man nur durch Hinfallen zusammen und entwickelte daraus ein Programm, das gezielt Mut aufbauen sollte. Wir lancierten Brave Leaders Inc. und boten Online- und Präsenzschulungen an. Innerhalb eines Jahres arbeiteten wir mit 50 Unternehmen und beinahe 10 000 Führungskräften zusammen. Im Jahr darauf erschien Entdecke deine innere Stärke – ein Buch über den Mut, seine Heimat in sich selbst zu finden als Voraussetzung für echte Verbundenheit, und über die Gefahren, die es birgt, wenn wir unser Leben damit zubringen, uns anzupassen und um Akzeptanz zu buhlen.6 Zu diesem Thema zu forschen und zu schreiben, drängte sich mir förmlich auf angesichts der zunehmenden Polarisierung, der um sich greifenden Entmenschlichung von Personen, die anders sind als wir, und unseres wachsenden Unvermögens, aus Echokammern auszubrechen, um wirklich kritisch zu denken.
In den vergangenen zwei Jahren hat unser Team mehr geforscht, ausgewertet, nicht geschafft, erneut versucht, gehört, beobachtet, verfolgt, hinzugewonnen und gelernt, als wir uns je hätten vorstellen können. Doch damit nicht genug. Ich hatte die Gelegenheit, manche der bedeutendsten Leitfiguren der Welt kennenzulernen und von ihnen zu lernen. Ich brenne förmlich darauf weiterzugeben, was ich gelernt habe und wie das unser Auftreten komplett verändern kann, warum es funktioniert, wieso es mitunter wirklich schwerfällt und wo es mir persönlich immer wieder misslingt (um die Wahrheit zu sagen).
Führung wagen
Wer mutig werden will, muss sich mit Verletzlichkeit auseinandersetzen.
Finden Sie sich mit dem Mist ab.
Einleitung
Mutige Führungskräfte und Mutkultur
Mit diesem Buch verfolge ich ein täuschend einfaches und ein bisschen egoistisches Ziel: Ich möchte unbedingt weitergeben, was ich alles gelernt habe. Ich möchte die Forschungsergebnisse und Erfahrungen der letzten 20 Jahre hernehmen und sie Hunderten von Organisationen vermitteln – ihnen einen praxistauglichen, vernünftigen, umsetzbaren Ratgeber in die Hand drücken, der verrät, wie man eine mutige Führungskraft wird.
»Täuschend einfach« deshalb, weil die Daten, auf denen dieses Buch beruht, die Quintessenz sind aus:
über die letzten 20 Jahre gesammelten Daten aus Befragungen,
neuer Forschungsarbeit einschließlich Interviews mit 150 C-Level-Führungskräften über die Zukunft der Führung,
Programmauswertungen aus unserer Arbeit bei Brave Leaders Inc. zum Aufbau von Mut,
den im Rahmen einer dreijährigen Studie zur Entwicklung von Instrumenten für mutige Führung erfassten Daten.
Die Codierung und sinnvolle Interpretation von 400 000 Daten ist an sich bereits ein komplexes Unterfangen, doch je engagierter ich die Daten in realisierbare, forschungsgestützte Verfahrensweisen übersetzen möchte, desto akribischer muss ich damit umgehen und desto mehr Tests muss ich durchführen.
Egoistisch ist mein Ziel insofern, als ich meine eigenen Führungsqualitäten gern verbessern möchte. In den letzten fünf Jahren habe ich mich von der forschenden Professorin zur forschenden Professorin und Gründerin mit CEO-Posten entwickelt. Meine erste und demütigendste Erkenntnis? Ganz gleich, wie komplex die Konzepte sind, sich wissenschaftlich mit Führung auseinanderzusetzen, ist viel einfacher, als selbst zu führen.
Wenn ich meine persönlichen Erfahrungen als Führungskraft aus den letzten Jahren Revue passieren lasse, dann sind die einzigen anderen Unterfangen, die ähnlich viel Selbsterkenntnis und Kommunikationsplanung erfordern, 24 Jahre Ehe und die Elternschaft. Und das will schon etwas heißen. Wie das die komplette Bandbreite meiner Emotionen strapazieren würde, wie viel Entschlossenheit es erfordern würde, unter Druck gelassen zu bleiben, und wie belastend es sein würde, ständig Probleme lösen und Entscheidungen treffen zu müssen, habe ich komplett unterschätzt. Von den schlaflosen Nächten ganz zu schweigen.
Mein anderes mehr oder minder eigennütziges Ziel ist: Ich möchte gern in einer Welt mit mutigeren, couragierteren Leitfiguren leben und ich möchte meinen Kindern eine solche Welt hinterlassen. Für mich ist eine Führungspersönlichkeit jemand, der es auf sich nimmt, in Menschen und Prozessen Potenzial aufzuspüren, und sich traut, dieses Potenzial zu entwickeln. Ob in Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen, Schulen oder Glaubensgemeinschaften – wir brauchen dringend mehr Führungspersönlichkeiten, die sich einer mutigen, aufrichtigen Führung verschrieben haben und sich ihrer selbst bewusst sind, um aus ihrem Herzen heraus führen zu können. Unausgereifte Führungskräfte, die aus verletzten Gefühlen und Angst heraus führen, braucht kein Mensch.
Das ist ein großes Thema, und ich habe zu Steve gesagt, ich wolle ein Buch schreiben, das die Einstellung seiner Leserinnen und Leser zu Führung verändert, zumindest in einem maßgeblichen Bereich zu Verhaltensänderungen führt und im Flieger durchgelesen werden kann. Lachend fragte er: »Auf einem Flug von Houston nach Singapur?«
Wie er weiß, war das bisher mein längster Flug (Moskau liegt erst auf halber Strecke). Ich lächelte und meinte: »Aber nein. Von New York nach Los Angeles. Mit kurzer Verspätung.«
Mutige Leitfiguren und Mutkultur
Immer wieder bekomme ich gesagt: »Wenn etwas lesenswert ist, dann schreib es auf.« Was ich als Führungskraft brauche – und worum jede Führungskraft, mit der ich in den letzten Jahren zusammengearbeitet habe, gebeten hat –, sind praktische Spielregeln zur Umsetzung der Lehren aus Verletzlichkeit macht stark und Laufen lernt man nur durch Hinfallen. Auch Entdecke deine innere Stärke liefert ein paar Erkenntnisse, die uns helfen können, am Arbeitsplatz eine Kultur der Verbundenheit entstehen zu lassen. Wer diese Bücher kennt, darf mit ein paar vertrauten Lektionen in neuem Kontext und mit Geschichten, Werkzeugen und Beispielen rechnen, die einen Bezug zu unserem Arbeitsleben haben. Sie haben sie noch nicht gelesen? Auch kein Problem. Ich gehe auf alles ein, was Sie wissen müssen.
Die in den Folgekapiteln verwendete Sprache und die erwähnten Werkzeuge und Kompetenzen erfordern Mut und die ernsthafte Bereitschaft, zu üben. Sie sind aber nicht kompliziert und meiner Ansicht nach für jeden zugänglich und praktizierbar, der dieses Buch in Händen hält. Die Hindernisse und Widerstände, auf die mutige Führung trifft, sind allerdings ausgesprochen real und mitunter hartnäckig. Doch aus meiner Forschungsarbeit und aus persönlicher Erfahrung weiß ich: Solange wir sie ansprechen, neugierig bleiben und nicht nachgeben, können sie uns nicht davon abhalten, mutig zu handeln.
Wir haben auf brenebrown.com einen Dare-to-Lead-Hub eingerichtet. Dort finden Sie verschiedene Ressourcen, darunter auch ein herunterladbares Handbuch für alle, die das Gelesene schon während der Lektüre dieses Buches in die Praxis umsetzen möchten. Ich kann es Ihnen nur empfehlen. Im Zuge unserer Recherchen für Laufen lernt man nur durch Hinfallen haben wir erkannt: Wir wissen, dass der Weg der Informationen vom Kopf ins Herz über die Hände führt.
Sie finden dort aber auch Empfehlungen für Bücher zum Thema Führung und Videos mit Rollenspielen, die Sie sich beim Aufbau ihrer eigenen Mutkompetenz anschauen können. Diese Videos ersparen Ihnen zwar nicht die praktische Umsetzung der Inhalte, vermitteln Ihnen aber eine Vorstellung davon, wie diese aussehen könnte, wo es schwierig wird und wie man die Kurve kriegt, wenn man – und das passiert unweigerlich – fehlgegangen ist.
Außerdem können Sie sich ein Glossar zu den Begriffen, Werkzeugen und Kompetenzen herunterladen, die ich in diesem Buch erörtere. (Die im Glossar enthaltenen Begriffe sind im Buch durchgängig fett gedruckt.)
Das Hindernis ist der Weg
Am Anfang unserer Gespräche mit Topmanagern stand die Frage: Was, wenn überhaupt, muss sich daran ändern, wie Menschen heute führen, damit Führungskräfte in einem komplexen, im raschen Wandel begriffenen Umfeld erfolgreich sind, in dem sie vor scheinbar unlösbaren Problemen stehen und mit unersättlichen Forderungen nach Innovation konfrontiert sind?
Die Antwort war jedes Mal dieselbe: Wir brauchen mutigere Führungskräfte und eine mutigere Kultur.
Als wir nachgehakt haben, um herauszufinden, warum mutigere Führung gefordert wurde, war das ein entscheidender Wendepunkt für unsere Forschungsarbeit. Auf diese Frage gab es nämlich nicht nur eine Antwort, sondern an die 50 verschiedene, von denen viele intuitiv gar nichts mit Mut zu tun hatten. Die Befragten sprachen über alles Mögliche, von kritischem Denken und der Fähigkeit, Informationen zu synthetisieren und zu analysieren, über neue Konzepte für das Bildungssystem, Innovationsimpulse, die Suche nach gemeinsamen politischen Grundlagen angesichts einer um sich greifenden Polarisierung und schwierigen Entscheidungen bis hin zur Bedeutung von Empathie und dem Aufbau von Verbundenheit im Kontext des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz.
Wir schälten die metaphorische Zwiebel weiter und fragten: Können Sie die konkreten Kompetenzen benennen, die mutiger Führung Ihrer Ansicht nach zugrunde liegen?
Überrascht stellte ich fest, wie schwer es den Studienteilnehmern fiel, diese Frage zu beantworten. Knapp die Hälfte der von uns befragten Führungskräfte bezeichnete Mut zunächst als Charakterzug, nicht als Kompetenz. Auf die Frage nach bestimmten Kompetenzen kam gewöhnlich die Antwort: »Mut hat man eben, oder man hat ihn nicht.« Wir blieben neugierig und forschten nach beobachtbaren Verhaltensweisen: Worin manifestiert sich Mut denn eigentlich?
Etwas mehr als 80 Prozent der Probanden – darunter auch solche, für die Mut zum Verhalten gehörte – konnten keine spezifische Kompetenz angeben. Problematische Verhaltensweisen und kulturelle Normen, die Vertrauen und Mut unterwandern, konnten sie dagegen auf Anhieb benennen und hatten dazu eine dezidierte Meinung. Zum Glück ist das Konzept vom »Abholen« anderer ein Grundsatz fundierter wissenschaftlicher Forschung und sozialer Arbeit, und genau das versuche ich. Soviel meiner Zeit ich auch dem Streben widme, zu verstehen, wo es hingehen soll – um zu ergründen, was uns dabei im Weg steht, brauche ich grundsätzlich zehnmal so lange.
So wollte ich beispielsweise ursprünglich gar nicht über Scham forschen. Eigentlich wollte ich Verbundenheit und Empathie verstehen. Doch wer nicht weiß, wie Scham eine Verbindung im Bruchteil einer Sekunde kappen kann, hat keine Ahnung, was Verbundenheit bedeutet. Ich wollte mich anfänglich auch nicht mit Verletzlichkeit befassen. Sie ist nur zufällig der allergrößte Hemmschuh für alles, was wir im Leben erreichen möchten – vor allem für Mut. Wie uns Mark Aurel schon lehrte: »Das Hindernis ist der Weg.«7
Hier nun die zehn Verhaltensweisen und kulturellen Aspekte, die Führungskräfte weltweit als hinderlich für die Organisationen bezeichnen:
Wir drücken uns vor unangenehmen Gesprächen wie ehrlichem, produktivem Feedback. Das schrieben manche Probanden mangelndem Mut zu, andere mangelnder Kompetenz. Schockierend ist, dass über die Hälfte von der kulturellen Norm, »nett und höflich« zu sein, sprachen, die als Ausrede benutzt wird, um heiklen Gesprächen aus dem Weg zu gehen. Doch gleich aus welchem Grund: Datenübergreifend herrschte große Einigkeit, dass solches Verhalten mangelnde Klarheit, schwindendes Vertrauen und Engagement und eine Zunahme problematischer Verhaltensweisen zur Folge hatte wie passiv-aggressives Verhalten, Unaufrichtigkeit, häufige Kommunikation über inoffizielle Kanäle (oder »das Meeting nach dem Meeting«) sowie Gerüchte und Verlogenheit (wenn ich Ihnen ins Gesicht etwas ganz anderes sage als hinter Ihrem Rücken).
Statt die Ängste und Gefühle, die sich im Wandel und im Umbruch einstellen, mit verhältnismäßig geringem Zeitaufwand proaktiv zur Kenntnis zu nehmen und zu bewältigen, wenden wir lieber unverhältnismäßig viel Zeit dafür auf, Verhaltensprobleme in den Griff zu bekommen.
Vertrauen schwindet durch mangelnde Verbundenheit und Empathie.
Zu wenige gehen durchdacht Risiken ein oder entwickeln und teilen kühne Ideen, um auf Veränderungen der Nachfrage und die unersättliche Gier nach Innovation zu reagieren. Wenn jeder, der etwas ausprobiert und scheitert oder auch nur eine radikale neue Idee äußert, Angst haben muss, zurückgewiesen oder der Lächerlichkeit preisgegeben zu werden, dann können Sie bestenfalls erwarten, dass der Status quo erhalten bleibt und Gruppendenken herrscht.
Rückschläge, Enttäuschungen und Misserfolge bremsen und prägen uns. Doch statt die nötigen Ressourcen in die Bereinigung dieser Situation zu stecken, um Verbrauchern, Interessengruppen oder internen Prozessen wirklich gerecht zu werden, verschwenden wir zu viel Zeit und Kraft darauf, Teammitgliedern Rückhalt zu geben, die ihren Beitrag und ihren Wert infrage stellen.
Zu viel Scham und Schuldzuweisungen, zu wenig Verantwortungsgefühle und Lernprozesse.
Manche entziehen sich den so wichtigen Gesprächen über Diversität und Inklusivität, weil sie befürchten, einen falschen Eindruck zu erwecken, etwas Verkehrtes zu sagen oder unrecht zu haben. Wenn die eigene Komfortzone wichtiger wird als heikle Gespräche, so ist das der Inbegriff der Privilegiertheit. Dadurch bröckelt das Vertrauen und echte, bleibende Veränderungen werden unwahrscheinlicher.
Geht etwas schief, greifen Einzelne und Teams in aller Eile zu ineffektiven, wenig nachhaltigen Lösungen, statt dem Problem diszipliniert auf den Grund zu gehen und es zu lösen. Doch die falschen Lösungen aus den falschen Gründen führen dazu, dass dieselben Probleme immer wieder auftauchen. Das kostet Geld und torpediert die Moral.
Organisationen formulieren ihre Werte vage und bewerten sie anhand von angestrebtem anstelle von tatsächlichem Verhalten, das sich schulen, messen und evaluieren lässt.
Perfektionismus und Angst halten die Menschen davon ab, zu lernen und sich weiterzuentwickeln.
Sicherlich erkennen die meisten von uns auf dieser Liste nicht nur unschwer die Probleme ihrer eigenen Organisationen wieder, sondern auch unsere eigenen inneren Kämpfe, Flagge zu zeigen und zu führen, auch wenn wir dazu unsere Komfortzone verlassen müssen. Ob es sich dabei um Verhaltensweisen am Arbeitsplatz oder Bedenken in Bezug auf die Kultur einer Organisation handelt, in allen Fällen liegen zutiefst menschliche Probleme zugrunde.
Nachdem wir die Blockaden ermittelt hatten, mussten wir die spezifischen Kompetenzen zur Entwicklung von Mut ermitteln, an denen wir arbeiten müssen, um solche Probleme zu bewältigen. Wir führten also weitere Gespräche, entwickelten Instrumente und testeten sie so lange an den MBA- und EMBA-Studenten der Jones Graduate School of Business der Rice University, der Kellogg School of Management der Northwestern University und der Wharton School der University of Pennsylvania aus, bis wir die Antworten gefunden hatten. Dann stellten wir diese auf den Prüfstand, optimierten sie und unterzogen sie weiteren Tests. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, was wir daraus gelernt haben.
Das Herzstück mutiger Führung
1. Wer mutig werden will, muss sich mit Verletzlichkeit auseinandersetzen. Finden Sie sich mit dem Mist ab.
Im Kern mutiger Führung steckt eine zutiefst menschliche Wahrheit, die wir, vor allem am Arbeitsplatz, nur selten an uns heranlassen: Mut und Angst schließen einander nicht aus. Die meisten Menschen fühlen sich gleichzeitig mutig und angstvoll. Wir kommen uns verletzlich vor. Manchmal den ganzen Tag. In den Momenten »in der Arena«, von denen Roosevelt sprach, sind wir hin- und hergerissen zwischen unserer Angst und dem Aufruf, Mut zu zeigen. Um in dieser Auseinandersetzung zu bestehen, brauchen wir eine gemeinsame Sprache, Fertigkeiten, Werkzeuge und tägliche Übung.
Der Begriff »Auseinandersetzung« (englisch: rumble) wird dabei in einer viel weiter gefassten Bedeutung verwendet als seinerzeit für das »Bandenduell« aus der West Side Story: »Lasst uns ernsthaft miteinander reden, auch wenn es schwer ist.« Er steht für eine ehrliche Absicht und für einen Anstoß oder Wink, sich richtig zu verhalten.
So eine Auseinandersetzung kann eine Diskussion sein, ein Gespräch oder ein Meeting, das sich durch konsequentes Zulassen von Verletzlichkeit auszeichnet, durch Neugier und Großmut, durch unbeirrte Problemerkennung und -lösung, auch wenn es zwischendurch schwierig wird. Dadurch, dass Pausen eingelegt oder Kreise gedreht werden, wenn es nötig ist. Indem wir furchtlos zu unseren Aufgaben stehen und, wie die Psychologin Harriet Lerner lehrt, mit derselben Leidenschaft zuhören, mit der wir selbst gehört werden möchten.8 So eine Aufforderung zur »Auseinandersetzung« veranlasst mich vor allem anderen, mit aufgeschlossenem Herzen und Kopf anzutreten, um unsere Arbeit und einander voranzubringen – nicht unser Ego.
Unsere Studien führten zu einem ausgesprochen eindeutigen und zuversichtlich stimmenden Ergebnis: Mut ist das Zusammentreffen von vier Kompetenzen, die vermittelt, beobachtet und gemessen werden können – nämlich folgende:
Sich mit Verletzlichkeit auseinandersetzen
Die eigenen Werte leben
Vertrauen wagen
Aufstehen lernen
Die grundlegende Kompetenz zur Entwicklung von Mut ist die Bereitschaft und Fähigkeit, sich mit Verletzlichkeit auseinanderzusetzen. Ohne diese Kernkompetenz lassen sich die übrigen drei Kompetenzen nicht umsetzen. Denken Sie das gründlich durch: Unsere Fähigkeit, Führung zu wagen, wird nie größer sein als unsere Kapazität zur Verletzlichkeit. Haben wir diese Kompetenz erst aufgebaut, können wir uns auch die übrigen aneignen. Dieses Buch soll Ihnen die Sprache und die Besonderheiten der Werkzeuge, Praktiken und Verhaltensmuster vermitteln, die entscheidend sind, damit uns diese Konzepte im täglichen Leben in Fleisch und Blut übergehen.
Wir haben diesen Ansatz mittlerweile in über 50 Organisationen an rund 10 000 Personen erprobt, die diese Kompetenzen für sich oder im Team erwerben. Von der Gates-Stiftung bis zu Shell, vom kleinen Familienbetrieb bis zum Fortune-50-Unternehmen und zu vielen Teilbereichen des US-amerikanischen Militärs – wir haben überall deutliche positive Auswirkungen dieses Prozesses festgestellt, und zwar nicht nur im Umgang von Führungskräften mit ihren Teams, sondern auch bei deren Leistung.
2. Selbstwahrnehmung und Selbstliebe sind wichtig. Wer wir sind, bestimmt, wie wir führen.
Allzu oft sehen wir Mut als angeborenen Wesenszug an. Dabei geht es gar nicht so sehr darum, wer einer ist, als vielmehr darum, wie er sich benimmt und in schwierigen Situationen auftritt. Angst ist das Gefühl, das ganz oben auf der Liste problematischer Verhaltensweisen und Kulturaspekte steht – und genau diese grundlegende Barriere steht dem Mut erwartungsgemäß im Weg. Doch all die couragierten Führungskräfte, mit denen wir gesprochen haben, erzählten uns, dass sie regelmäßig viele verschiedene Arten von Angst empfinden. Angstgefühle als solche sind daher offenbar nicht das Hindernis.
Mutige Führung scheitert in Wahrheit höchstens daran, wie wir auf unsere Angst reagieren. Was uns in Wirklichkeit davon abhält, Führung zu wagen, ist unser Panzer, sind also die Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen, die wir einsetzen, um uns zu schützen, wenn wir nicht willens oder nicht in der Lage sind, uns mit Verletzlichkeit auseinanderzusetzen. In den folgenden Kapiteln werden wir Hilfen erhalten und Kompetenzen aufbauen, aber auch auswerten, was uns bei der Entwicklung von Mut im Weg steht – umso mehr, als wir damit rechnen müssen, dass unser Panzer zutage treten und neuen Methoden und Daseinsmöglichkeiten im Weg stehen wird. In diesem Prozess müssen wir uns unbedingt auch in Mitgefühl und Geduld mit uns selbst üben.
3. Mut ist ansteckend. Um mutige Führung hoch zu skalieren und mutige Teams und Organisationen aufzubauen, müssen wir eine Kultur pflegen, in der von allen erwartet wird, mutig zu agieren, sich unbequemen Gesprächen zu stellen und mit vollem Herzen bei der Sache zu sein – eine Kultur, in der es nicht nötig ist und auch nicht honoriert wird, einen Panzer anzulegen.
Wollen wir, dass sich jeder voll mit ganzem, ungepanzertem Herzen einbringt, damit wir innovativ sein, Probleme lösen und die Menschen voranbringen können, müssen wir darauf achten, eine Kultur zu schaffen, in der sich die Menschen sicher, wahrgenommen, gehört und respektiert fühlen.
Mutige Führungskräfte müssen sich um die Menschen kümmern, die sie führen, und eine Verbindung zu ihnen herstellen.
Die Daten belegen unmissverständlich, dass Fürsorge und Verbundenheit irreduzible Voraussetzungen für engagierte, produktive Beziehungen zwischen Führungskräften und Teammitgliedern sind. Empfinden wir für die Menschen, die wir führen, keine Fürsorglichkeit und/oder fühlen uns ihnen nicht verbunden, gibt es zwei Möglichkeiten: Wir entwickeln die nötige Fürsorglichkeit und Bindung, oder wir suchen uns eine Führungskraft, die das besser kann. Das ist keine Schande. Wir alle haben schon erlebt, dass wir einfach keinen Draht zu jemandem finden, sosehr wir uns auch bemühen. Ist uns klar, dass die Verpflichtung zu Fürsorge und Verbundenheit den Mindeststandard darstellt, brauchen wir echten Mut, um uns einzugestehen, wenn wir den Menschen, die uns unterstellt sind, keine guten Dienste leisten können.
Angesichts der Realität der Welt, in der wir leben, heißt das: Führungskräfte – also Sie und ich – müssen Räume schaffen und wahren, in denen höhere Verhaltensstandards gelten, als wir sie aus den Nachrichten, aus dem Fernsehen und von der Straße kennen. Für manche heißt das, dass die Kultur am Arbeitsplatz womöglich sogar einen höheren Standard haben muss als das, was sie in ihrem häuslichen Umfeld erleben. Manchmal färbt das ab, sodass Führungsstrategien aus uns sogar bessere Ehepartner und Eltern machen können.
Lehrern, die zu unseren wichtigsten Leitfiguren gehören, sage ich oft: Wir können von unseren Schülern nicht ständig verlangen, zu Hause oder auf dem Schulweg ihre Panzer abzulegen, weil ihre emotionale und physische Sicherheit unter Umständen Selbstschutz erfordert. Was wir aber tun können und wozu wir aus ethischen Gründen aufgefordert sind: Wir können in unseren Schulen und Klassenzimmern einen Raum schaffen, in dem alle Schüler für den Tag oder die Stunde die erdrückende Last ihres Panzers abwerfen, ihn an der Garderobe abgeben und ihr Herz öffnen können, damit sie wirklich wahrgenommen werden.
Wir sind die Wächter dieses Raums, der es Schülern ermöglicht, frei zu atmen, neugierig zu sein, die Welt zu erforschen und sie selbst zu sein, ohne daran zu ersticken. Sie verdienen einen Ort, an dem sie sich mit Verletzlichkeit auseinandersetzen und ihren Herzen Luft machen können. Wie ich aus den Forschungsergebnissen weiß, sollten wir nie unterschätzen, wie gut es einem Kind tut, einen Ort zu haben, an den es hingehört – wenn es auch nur einer ist – und an dem es seinen Panzer ablegen kann. Das kann seinem Leben eine ganz neue Richtung geben – und oft genug trifft das auch ein.
Müssen wir einen Panzer tragen, weil es die Kultur in unserer Schule, Organisation, Glaubensgemeinschaft oder gar Familie aufgrund von Problemen wie Rassismus, Klassenbewusstsein, Sexismus oder einer Manifestation angstgeleiteter Führung erfordert, dann dürfen wir nicht mit Engagement rechnen, das aus vollem Herzen kommt. Ebenso gilt: Belohnt unsere Organisation Verhaltensweisen, die der Panzerung Vorschub leisten, wie Schuldzuweisungen, Anprangerungen, Zynismus, Perfektionismus und emotionalen Stoizismus, dann dürfen wir keine innovative Arbeit erwarten. Unter einem Panzer kann sich niemand richtig entfalten und seinen vollen Beitrag leisten. Es kostet eine Menge Kraft, einen Panzer mit sich herumzutragen – manchmal sogar unsere ganze Kraft.
Was uns an diesem Prozess am meisten beeindruckt hat: Es kristallisierte sich eine Liste von Verhaltensweisen heraus, die keinesfalls »fest verdrahtet« sind und folglich vermittelbar, beobachtbar und messbar, ob mit 14 oder mit 40. Bei den Studienteilnehmern, die eingangs überzeugt waren, dass Mut genetisch verankert ist, löste schon allein der Befragungsprozess Veränderungen aus.
Ein Proband erzählte mir: »Ich bin jetzt Ende 50, und mir ist erst heute klar geworden, dass mir jede einzelne dieser Verhaltensweisen in meiner Jugend beigebracht wurde – von meinen Eltern oder meinen Trainern. Ich kann mich sogar detailliert an fast jede einzelne Lektion erinnern – also wie und wann ich das gelernt habe. Das könnten und sollen wir allen Menschen beibringen.« Dieses Gespräch war für mich wichtig, weil es mir vor Augen führte, dass unsere Erinnerungen an schmerzhafte Lektionen mit der Zeit verblassen können – so sehr, dass aus einer einst so schwierigen Lernerfahrung ein lapidares »So bin ich eben« wird.
Die Kompetenzen, aus denen Mut entsteht, sind nicht neu. Es sind Führungskompetenzen, die schon angestrebt werden, seit es Führungsstrukturen gibt. Doch bei der gezielten Entwicklung dieser Kompetenzen in Führungskräften haben wir keine großen Fortschritte gemacht, weil wir uns dabei nicht in die menschlichen Aspekte vertiefen, die uns zu chaotisch sind. Es ist so viel einfacher, darüber zu sprechen, was wir wollen und brauchen, als über Ängste, Gefühle und Defizite (also die Überzeugung, dass ein Mangel vorliegt), die unserem Erfolg auf ganzer Linie im Weg stehen. Im Grunde fehlt uns – vielleicht paradoxerweise – der Mut, ungeniert über Mut zu sprechen. Doch es ist höchste Zeit dafür. Und wenn Sie diese Kompetenzen auch noch als »Soft Skills« bezeichnen möchten, nachdem Sie versucht haben, sie in der Praxis umzusetzen, dann bitte. Ich fordere Sie heraus. Suchen Sie sich bis dahin einen Platz für Ihren Panzer. Wir sehen uns dann in der Arena.
Erster Teil:
Auseinandersetzung mit Verletzlichkeit
Mut ist ansteckend.
Erster Abschnitt:
Der Moment und die Mythen
Als mir das Universum das Roosevelt-Zitat vor die Nase hielt, traten dadurch drei Lektionen in aller Klarheit zutage. Die erste bezeichne ich als »Physik der Verletzlichkeit«. Sie ist ganz einfach: Sind wir oft genug mutig genug, werden wir irgendwann zu Fall kommen. Mut bedeutet nicht, zu sagen: »Ich bin bereit, einen Fehlschlag zu riskieren.« Mut bedeutet, zu sagen: »Ich weiß, dass ich früher oder später scheitern werde, aber ich bin trotzdem mit vollem Einsatz dabei.« Ich kenne keinen mutigen Menschen, der nicht schon Enttäuschungen oder Misserfolge erlebt hätte oder sogar ein gebrochenes Herz.
Zweitens spricht aus Roosevelts Worten alles, was ich über Verletzlichkeit weiß. Verletzlichkeit lässt sich als das definieren, was wir in ungewissen, gefährlichen Zeiten empfinden, wenn die Gefühle blank liegen. Das ergab meine Forschungsarbeit schon vor 20 Jahren, und es hat sich durch jede Studie, die ich seither durchgeführt habe, bestätigt – die vorliegende Forschungsarbeit über Führung eingeschlossen. Verletzlichkeit bedeutet nicht, zu gewinnen oder zu verlieren. Es geht dabei um den Mut, überhaupt anzutreten, wenn man keinen Einfluss auf das Ergebnis hat.
Im Laufe der Jahre haben wir mehrere Tausend Probanden gebeten, uns zu schildern, was sie unter Verletzlichkeit verstehen. Hier ein paar der treffendsten Antworten: das erste Date nach meiner Scheidung; mit meiner Mannschaft über Rassismus zu sprechen; der Versuch, nach meiner zweiten Fehlgeburt wieder schwanger zu werden; mein eigenes Unternehmen zu gründen, als mein Kind ausgezogen ist, um auswärts zu studieren; mich bei einem Kollegen dafür zu entschuldigen, dass ich mich in einem Meeting im Ton vergriffen hatte; meinen Sohn in dem Wissen in die Orchesterprobe zu schicken, wie gern er die erste Geige spielen würde, obwohl er vermutlich nicht einmal die Aufnahmeprüfung schaffen würde; auf den Rückruf des Arztes zu warten; Feedback zu geben; Feedback zu bekommen; entlassen zu werden; andere zu entlassen.
Dabei liefert unser gesamter Datenbestand nicht den Hauch eines empirischen Belegs dafür, dass Verletzlichkeit Schwäche ist.
Fällt es uns leicht, Verletzlichkeit zu erleben? Nein.
Ängstigen und verunsichern uns solche Erfahrungen? Ja.
Lösen Sie einen Selbstschutzreflex aus? Immer.
Erfordert es Mut, sich solchen Erfahrungen aus vollem Herzen und ohne Panzer zu stellen? Auf jeden Fall.
Meine dritte Erkenntnis schließlich ist mir zum Lebensauftrag geworden: Wenn Sie nicht gelegentlich selbst in der Arena stehen und Prügel einstecken, dann bin ich auch nicht offen für Ihr Feedback. Was Sie mir zu sagen haben, interessiert mich nicht. Millionen Menschen weltweit »sitzen auf den billigen Plätzen«. Sie werden im Leben nie Mut beweisen, verwenden aber ihre ganze Energie darauf, anderen, die sich das trauen, Ratschläge zu geben und ihnen ihre Meinung zu sagen. Ihr Beitrag beschränkt sich auf Kritik, Zynismus und Panikmache. Wer mich kritisiert, ohne sich je selbst aus dem Fenster zu lehnen, kann sagen, was er will – es interessiert mich nicht.
Wir müssen uns dem Feedback von den billigen Plätzen entziehen und dürfen uns trotzdem nicht hinter unseren Panzer zurückziehen. Die Probanden, die in beiden Disziplinen gut abschneiden, haben eine Gemeinsamkeit: Sie wissen genau, auf wessen Urteil sie Wert legen.
Solche Menschen sind es, von denen wir uns Feedback einholen sollten. Auch wenn wir nicht gern hören, was sie uns zu sagen haben, wir müssen es zur Kenntnis nehmen und darüber nachdenken, bis wir daraus gelernt haben. Mir hat meine Forschungsarbeit eines ganz klar vor Augen geführt:
Lassen Sie verletzende Äußerungen nicht näher an sich heran, indem Sie sie immer wieder lesen und darüber nachgrübeln. Spielen Sie nicht im Kopf durch, wie cool Sie nächstes Mal darauf reagieren werden. Und verbittern Sie nicht.
Werfen Sie Ihrem ungepanzerten Ich alles vor die Füße, was unproduktiv oder schmerzhaft ist. Ganz gleich, wie sehr Ihre Selbstzweifel Sie drängen, die Kritik an sich heranzulassen und sich in Ihrer Negativität zu baden, damit sich Ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigen können, ganz gleich, wie erpicht die Schamkobolde darauf aus sind, solche Verletzungen zu nutzen, um Ihren Panzer zu verstärken: Atmen Sie tief durch und bringen Sie die Kraft auf, alles Kleinliche einfach links liegen zu lassen. Sie müssen nicht einmal darauf herumtrampeln oder es wegtreten. Gemein zu sein, ist billig, leicht und feige. Ein solches Verhalten verdient nicht, dass Sie Ihre Energie oder Ihr Engagement darauf verschwenden. Gehen Sie einfach über solche Aussagen hinweg und bleiben Sie mutig. Vergessen Sie nie: Ein Panzer kommt Sie zu teuer zu stehen. Lassen Sie sich daher gar nicht erst auf Feedback von den billigen Plätzen ein.
Noch einmal zum Mitschreiben: Schotten wir uns gegen jedes Feedback ab, entwickeln wir uns nicht weiter. Setzen wir uns aber mit jedem Feedback auseinander, ungeachtet seiner Qualität und Absicht, schmerzt das zu sehr, und wir legen uns früher oder später einen Panzer zu, indem wir so tun, als ob es uns nichts ausmacht – oder, schlimmer noch, indem wir uns so hermetisch gegen Verletzlichkeit und Gefühle abschirmen, dass wir uns gar nicht mehr verletzt fühlen. Ist der Panzer erst einmal so dick, dass wir gar nichts mehr spüren, sterben wir innerlich ab. Wir zahlen dann für den Selbstschutz, indem wir unser Herz vor allem und jedem verschließen – nicht nur vor Verletzungen, sondern auch vor der Liebe.
Was es für Folgen hat, wenn der Selbstschutz wichtiger wird als die Liebe, hat niemand so treffend formuliert wie C. S. Lewis:9
Lieben heißt verletzlich sein. Liebe irgend etwas, und es wird dir bestimmt zu Herzen gehen oder gar das Herz brechen. Wenn du ganz sicher sein willst, daß deinem Herzen nichts zustößt, dann darfst du es nie verschenken, nicht einmal an ein Tier. Umgib es sorgfältig mit Hobbys und kleinen Genüssen; meide alle Verwicklungen; verschließ es sicher im Schrein oder Sarg deiner Selbstsucht. Aber in diesem Schrein – sicher, dunkel, reglos, luftlos – verändert es sich. Es bricht nicht; es wird unzerbrechlich, undurchdringlich, unerlösbar.10
Lieben heißt verletzlich sein.
Schützenhilfe in der Auseinandersetzung: Das Zettelkommando
Wer sich nach der Meinung aller anderen definiert, kann nur schwerlich mutig sein. Wenn uns aber vollkommen gleichgültig ist, was andere denken, ist unser Panzer zu dick, um echte Verbundenheit herzustellen. Doch woher wissen wir, wessen Meinung für uns zählen sollte?
Die Lösung kennen Sie aus Verletzlichkeit macht stark. Nehmen Sie einen Zettel und notieren Sie darauf die Namen der Menschen, auf deren Meinung Sie Wert legen. Der Zettel darf nicht zu groß sein, damit Sie Prioritäten setzen. Falten Sie ihn zusammen und stecken Sie ihn in Ihr Portemonnaie. Nehmen Sie sich dann zehn Minuten Zeit, um diese Menschen – Ihr Zettelkommando – zu kontaktieren und sie wissen zu lassen, wie froh Sie sind, sie zu haben. Das geht ganz einfach: Ich überlege mir gerade, wessen Meinung für mich zählt. Danke, dass du dazugehörst. Wie schön, dass ich dir so viel bedeute, dass du ehrlich und aufrichtig zu mir bist.
Brauchen Sie ein Raster für die Auswahl, taugt Folgendes meiner Ansicht nach am besten: Die Menschen auf Ihrer Liste sollten Sie nicht trotz, sondern wegen Ihrer Verletzlichkeit und Unvollkommenheit schätzen.
Auf Ihrer Liste sollten keine Jasager stehen. Es soll ja kein Schleimerkommando werden. Es sollten Menschen sein, die Ihnen so viel Respekt entgegenbringen, dass sie, obwohl sie das verletzlich machen könnte, riskieren, Ihnen zu sagen: »Es passt gar nicht zu dir, wie du dich da verhalten hast. Du musst das in Ordnung bringen und dich entschuldigen. Ich helfe dir dabei.« Oder: »Stimmt, das war ein gewaltiger Schlag ins Kontor. Aber du warst mutig, und ich klopfe dir den Staub ab und feuere dich an, wenn du zur nächsten Runde antrittst.«
Die sechs Mythen zur Verletzlichkeit
In Verletzlichkeit macht stark habe ich über die vier Mythen zur Verletzlichkeit geschrieben. Doch seither habe ich das Projekt, Mut zu entwickeln, in Organisationen hineingetragen und mit Führungskräften daran gearbeitet. Die Daten haben gesprochen, und es sind eindeutig sechs irreführende Mythen, die sich über viele Variablen hinweg halten wie Geschlecht, Alter, Ethnie, Land, Fähigkeit und Kultur.
Mythos 1: Verletzlichkeit ist Schwäche
Ich habe lange gebraucht, um mit den Mythen zur Verletzlichkeit aufzuräumen, allen voran mit dem Mythos, dass Verletzlichkeit Schwäche ist. 2014 stand ich auf einem Militärstützpunkt im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten vor mehreren Hundert Angehörigen militärischer Spezialeinheiten. Ich beschloss, nicht länger drum herumzureden, und brachte meine Ausführungen mit einer Frage auf den Punkt.
Ich schaute die tapferen Soldaten an und meinte: »Verletzlichkeit empfinden wir in ungewissen, gefährlichen Zeiten, wenn die Gefühle blank liegen. Können Sie mir ein an einem Kameraden oder an sich selbst beobachtetes Beispiel für Mut nennen, das nicht die Erfahrung der Verletzlichkeit voraussetzt?«
Absolute Stille. Man hörte nur die Grillen zirpen.
Endlich meldete sich ein junger Mann zu Wort: »Nein, Ma’am. Drei Einsätze. Und ich kann mich an keine einzige mutige Handlung erinnern, die nicht erfordert hätte, sich mit gewaltiger Verletzlichkeit auseinanderzusetzen.«
Ich habe dieselbe Frage inzwischen weltweit hundertfach in Konferenzräumen gestellt. Ich habe Kampfpiloten und Softwareentwickler, Lehrer und Wirtschaftsprüfer, CIA-Agenten und CEOs, Geistliche und Profisportler, Künstler und Aktivisten befragt, und nicht einer konnte mir ein Beispiel für Mut ohne Verletzlichkeit liefern. Der Mythos von der Schwäche zerbröselt unter dem Gewicht der Daten und der persönlichen Muterfahrungen der Menschen.
Mythos 2: Verletzlichkeit ist mir fremd
Im Alltag erleben wir ständig Ungewissheit und Gefahr, und unsere Gefühle liegen blank. Wir können uns dem nicht entziehen, haben aber zwei Möglichkeiten: Entweder wir stehen zu unserer Verletzlichkeit oder nicht. Sich zu seiner Verletzlichkeit zu bekennen und sie bewusst zuzulassen bedeutet, dass wir uns mit diesem Gefühl auseinandersetzen und begreifen, wie es unser Denken und Verhalten beeinflusst, damit wir unseren Werten treu bleiben und Integrität leben können. Tun wir so, als seien wir nicht verletzlich, lassen wir unser Denken und Verhalten von der Angst bestimmen, ohne selbst darauf einzuwirken oder uns dessen überhaupt bewusst zu sein. Das führt fast immer dazu, dass wir anderen etwas vorspielen oder einfach ganz dicht machen.
Wenn Sie die Daten nicht überzeugen, fragen Sie doch jemanden aus Ihrem Zettelkommando: Wie verhalte ich mich, wenn ich mich verletzlich fühle? Setzen Sie sich bewusst mit Verletzlichkeit auseinander, dann werden Sie nichts zu hören bekommen, was Sie nicht schon wissen und woran Sie nicht bereits aktiv arbeiten. Sind Sie aber ein Anhänger der Vorstellung von absoluter Einzigartigkeit (nach dem Motto »Für alle anderen auf der Welt mag das gelten, nur für Sie nicht«), dann stellen Sie sich besser auf ein hartes Feedback ein.