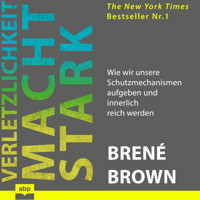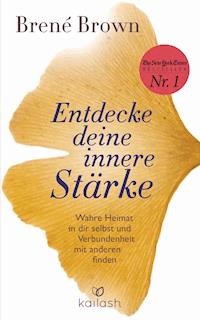
19,99 €
Mehr erfahren.
Das Leben aus vollem Herzen leben
In einer Welt, die so schnelllebig und flüchtig ist, in einer Zeit der Heimatlosigkeit und emotionalen Entwurzelung, ist es umso wichtiger zu wissen, wo wir hingehören und woran wir uns festhalten können. Die renommierte Psychologin Brené Brown zeigt, dass innere Stärke der Raum ist, wo Liebe, Zugehörigkeit, Freude und Kreativität entstehen. Unter ihrer behutsamen Anleitung entdecken wir unsere innere Verwurzelung neu und entwickeln eine kraftvolle Vision, die uns ermutigt, Großes zu wagen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zu dem Buch:
In einer Welt, die so schnelllebig und flüchtig ist, in einer Zeit der Heimatlosigkeit und emotionalen Entwurzelung, ist es umso wichtiger zu wissen, wo wir hingehören und woran wir uns festhalten können. Die renommierte Psychologin Brené Brown zeigt, dass innere Stärke der Raum ist, wo Liebe, Zugehörigkeit, Freude und Kreativität entstehen. Unter ihrer behutsamen Anleitung entdecken wir unsere innere Verwurzelung neu und entwickeln eine kraftvolle Vision, die uns ermutigt, Großes zu wagen.
Zu der Autorin:
Brené Brown ist Professorin am Graduate College of Social Work in Houston, Texas. Seit dreizehn Jahren erforscht sie die Themen Verletzlichkeit, Scham, Authentizität und innere Stärke. Ihr TED-Talk „Die Kraft der Verletzlichkeit“, der über 23 Millionen Mal heruntergeladen wurde, machte sie weltweit bekannt. Ihre Bücher, darunter „Die Gaben der Unvollkommenheit“ und „Verletzlichkeit macht stark“, avancierten in den USA zu Bestsellern. Die beliebte Vortragsrednerin lebt mit ihrem Mann Steve und zwei Kindern in Houston.
Brené Brown
Entdecke deine innere Stärke
Wahre Heimat in dir selbst und Verbundenheit mit anderen finden
Aus dem Amerikanischen von
Heide Lutosch
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel
» Braving the wilderness. The quest for true belonging and the courage to stand alone« bei Random House, einem Imprint und einer Abteilung von Penguin Random House LLC, New York, USA.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe
Links nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung
geprüft werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung ist daher ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
1. Auflage
Deutsche Erstausgabe
© 2018 der deutschsprachigen Ausgabe Kailash Verlag, München
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
© 2017 Brené Brown. Alle Rechte vorbehalten.
Lektorat: Anne Nordmann
Umschlaggestaltung: ki 36 Editorial Design, München, Daniela Hofner unter Verwendung eines Motivs von © plainpicture/Christine Höfelmeyer
Layout-Motiv: © plain picture/Christine Höfelmeyer
Satz und E-Book: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-23238-2V001
www.kailash-verlag.de
Besuchen Sie den Kailash Verlag im Netz
Inhalt
EINS
Überall und nirgends
ZWEI
Die Suche nach wahrer Zugehörigkeit
DREI
High Lonesome: unsere spirituelle Krise
VIER
Nähe erschwert Hass. Gehen Sie näher heran.
FÜNF
Entlarven Sie Blödsinn. Bleiben Sie zivilisiert.
SECHS
Hand in Hand. Mit Fremden
SIEBEN
Starker Rücken, weicher Bauch, wildes Herz
Für meinen Vater. Danke, dass du darauf bestanden hast, dass ich stets den Mund aufmache und Position beziehe – selbst dann, wenn du entschieden anderer Meinung warst.
Eins
Überall und nirgends
Immer wenn ich anfange zu schreiben, spüre ich, wie mich die Angst überwältigt. Besonders schlimm ist es, wenn ich daran denke, dass die Ergebnisse meiner Forschung alt hergebrachte Vorstellungen über den Haufen werfen werden. Von dort aus ist es nur noch ein kleiner Schritt, bis ich mir sage: Wer bin ich eigentlich, das zu behaupten? Oder: Es wird bei den Leuten gar nicht gut ankommen, wenn ich ihre Überzeugungen infrage stelle.
In diesen unsicheren und riskanten Momenten der Verletzlichkeit lasse ich mich von Menschen inspirieren, die mutig neue Wege beschreiten oder sich als unbequeme Störenfriede betätigen. Ihre Unerschrockenheit wirkt ansteckend auf mich. Jedes Interview, jeden Aufsatz, jeden Vortrag und jedes Buch, das ich von ihnen oder über sie zu fassen bekomme, lese ich. Ich tue dies, damit sie mir beistehen und Mut zusprechen, wenn ich gerade wieder einmal von meiner Angst beherrscht werde. Außerdem lassen sie mir kaum irgendwelchen Blödsinn durchgehen, während sie mir über die Schulter blicken.
Ich habe ein bisschen gebraucht, um diese Methode zu entwickeln. Als ich jünger war, zog ich den umgekehrten Ansatz vor – holte mir haufenweise Kritiker und Schwarzmaler in den Kopf. Ich saß am Schreibtisch und stellte mir die Gesichter der Professoren vor, die ich am wenigsten mochte; die meiner schroffsten und zynischsten Kollegen oder die meiner gnadenlosesten Online-Kritiker. Wenn ich sie bei Laune halten kann oder zumindest verhindere, dass sie meckern, dachte ich, bin ich aus dem Schneider. Das führte zu einer Situation, die für Sozialwissenschaftler fatal ist: Ich kam auf Ergebnisse, die sich leicht in bestehende Weltbilder einfügen ließen; Ergebnisse, die existierende Vorstellungen höchstens vorsichtig anstupsten, ohne dass sie irgendwen verstimmten, ungefährliche, ausgewählte, angenehme Forschungsergebnisse. Nichts davon war authentisch, es waren »Beiträge«, die ich zollte.
Ich entschloss mich also, die Schwarzmaler und Panikmacher zu feuern. Statt ihrer trommelte ich jene Männer und Frauen zusammen, die mit ihrem Mut und ihrem Einfallsreichtum die Welt gestalten. Und die, zumindest hin und wieder, die Leute so richtig wütend gemacht haben. Es ist ein bunt gemischter Haufen: J.K. Rowling, die Autorin der Harry-Potter-Bücher, die ich so sehr liebe, ist meine Ansprechpartnerin, wenn ich darum kämpfe, für eine noch fremde Ideenwelt, die sich gerade erst aus meinen Forschungsergebnissen herauskristallisiert, Worte zu finden. In meiner Fantasie sagt sie zu mir: Es ist wichtig, neue Welten zu entwerfen, aber du solltest sie nicht bloß beschreiben. Schenk uns die Geschichten, aus denen deine neue Welt besteht. Wie merkwürdig und wild diese neue Welt auch sein mag: In ihren Geschichten werden wir uns wiedererkennen.
Die Autorin und Aktivistin bell hooks tritt vor, wenn ich in eine mühselige Diskussion über Rasse, Geschlecht oder Klasse verwickelt bin. Von ihr habe ich gelernt, das Unterrichten als heiligen Akt zu betrachten, und sie hat mir beigebracht, dass das Unbehagen zum Lernen dazugehört. Ed Catmull, Shonda Rhimes und Ken Burns wiederum stellen sich hinter mich und flüstern mir ins Ohr, wenn ich eine Geschichte erzähle. Sie stoßen mich an, wenn ich schludrig werde und die Einzelheiten und Dialoge überspringen will, die überhaupt erst Sinn in eine Geschichte bringen. »Nimm uns mit in diese Geschichte«, beharren sie. Auch zahlreiche Musiker und Künstler kreuzen auf, genau wie Oprah. Ein Ratschlag von ihr hängt in meinem Arbeitszimmer an der Wand: »Glaube nur nicht, dass du dein Leben oder deine Arbeit mutig bestreiten kannst, ohne jemanden zu enttäuschen. Das wird nicht funktionieren.«
Meine längste und treuste Beraterin aber ist Maya Angelou. Mit ihrem Werk kam ich zum ersten Mal in Kontakt, als ich mich vor 32 Jahren im College mit Lyrik beschäftigte. Ihr Gedicht »Still I Rise«1 änderte alles für mich. Es strahlte so viel Kraft und Schönheit aus. Ich sammelte dann jedes Buch von ihr, das ich finden konnte, jedes Gedicht und jedes Interview. Ihre Worte waren mir Lehre, Ansporn und Heilung zugleich. Ich weiß nicht wie, aber sie schaffte es, voller Freude und gleichzeitig völlig schonungslos zu sein.
Ein Zitat von Maya Angelou allerdings gab es, dem ich aus tiefstem Herzen widersprechen wollte. Es war eine ihrer Aussagen zum Thema Zugehörigkeit, auf die ich stieß, als ich an der University of Houston ein Seminar über Rasse und Klasse gab. In einem Interview, das Bill Moyers mit ihr geführt hat und das im Jahr 1973 im öffentlichen Fernsehen ausgestrahlt wurde, sagt Angelou:
Man ist erst dann frei, wenn man erkennt, dass man nirgendwo hingehört: Man gehört überall hin – und nirgends. Der Preis ist hoch. Aber die Belohnung auch.2
Ich weiß noch genau, was ich dachte, als ich dieses Zitat las: Das stimmt einfach nicht. Was wäre die Welt, wenn niemand irgendwo hingehörte? Nur eine Ansammlung einsamer Menschen, die nebeneinanderher leben. Ich habe das Gefühl, dass sie die Kraft der Zugehörigkeit nicht versteht.
Über zwanzig Jahre lang, immer wenn ich über dieses Zitat stolperte, fühlte ich Ärger in mir hochkommen. Warum sagt sie das? Es stimmt einfach nicht. Zugehörigkeit ist wesentlich. Zu irgendetwas, zu irgendjemanden, an irgendeinen Ort müssen wir doch gehören. Ich erkannte bald, dass mein Ärger zwei Ursachen hatte. Zum einen bedeutete mir Maya Angelou inzwischen so viel, dass ich den Gedanken, dass wir in einer so wichtigen Sache unterschiedlicher Meinung sein sollten, kaum ertragen konnte. Zum anderen zählten der Druck, sich anzupassen und das Leiden an der Nichtzugehörigkeit in meinem eigenen Leben zu den schmerzhaftesten Themen überhaupt. Das Konzept »nirgends hinzugehören« hatte für mich beim besten Willen nichts mit Freiheit zu tun. Mich zu fühlen, als würde ich niemals wirklich irgendwo hingehören, war der große Schmerz meiner Kindheit und Jugend gewesen.
Von Freiheit konnte keine Rede sein.
Erfahrungen der Nichtzugehörigkeit bilden das Zeitraster meiner Biografie, und sie begannen früh. In den Kindergarten ging ich an der Paul Habans Elementary in New Orleans, West Bank. Wir schrieben das Jahr 1969, und so wundervoll diese Stadt war und immer noch ist – sie erstickte fast am Rassismus. Erst in diesem Jahr war die Rassentrennung an den Schulen offiziell aufgehoben worden. Ich erfuhr und verstand kaum etwas von dem, was da vor sich ging, dazu war ich noch zu klein; aber ich wusste, wie geradeheraus und hartnäckig meine Mom sein konnte. Sie meldete sich häufig zu Wort und schrieb sogar einen Brief an die Zeitung Times-Picayune, in dem sie die Rechtmäßigkeit eines Verfahrens infrage stellte, das wir heute »Racial Profiling«nennen. Ich spürte die enorme Energie, die von ihr ausging. Für mich war sie trotzdem einfach die Mutter, die im Klassenzimmer aushalf und die für mich, meine Barbiepuppe und sich selbst die gleichen gelbkarierten Shiftkleider nähte.
Wir waren aus Texas hergezogen, was für mich sehr schwierig gewesen war. Ich vermisste meine Großmutter schrecklich, doch gleichzeitig war ich ganz wild darauf, im Kindergarten und in unserer Straße neue Freunde zu finden. Das erwies sich allerdings als kompliziert. Die Namenslisten der Klassen wurden damals für alles genutzt, für Anwesenheitsnachweise genau wie für Geburtstagseinladungen. Eines Tages winkte die andere Freiwillige, die an diesem Tag zusammen mit meiner Mutter im Klassenzimmer aushalf, mit der Liste und rief: »Sieh dir nur all diese schwarzen Kinder an! Und diese Namen! Sie heißen alle Casandra!«
Huch, dachte meine Mutter. Vielleicht erklärte das, warum ich fast nie zu den Partys meiner weißen Freunde eingeladen wurde. Meine Mutter lässt sich bei ihrem zweiten Vornamen rufen, aber ihr erster Name ist Casandra. Und wie lautete wohl mein vollständiger Name auf der Liste? Casandra Brené Brown. Jeder Afroamerikaner weiß genau, warum die weißen Familien mich nie zu sich nach Hause einluden. Es ist der gleiche Grund, aus dem mir eine Gruppe afroamerikanischer Magisterstudentinnen am Ende des Semesters eine Karte überreichte, auf der stand: »Na gut, Sie sind wirklich Brené Brown.« Die Studentinnen hatten sich zu meinem Seminar über Frauenfragen angemeldet und fielen fast von ihren Stühlen, als ich mich am ersten Tag im Seminarraum hinter das Pult setzte. Eine Studentin sagte: »Sie sind aber nicht Casandra Brené Brown?« Jawohl, die bin ich. Aus demselben Grund rief die zuständige Dame, als ich in einer Arztpraxis in San Antonio zum Vorstellungsgespräch für einen Job als Teilzeit-Rezeptionistin eintraf: »Sie sind Brené Brown! Was für eine angenehme Überraschung!« Und ja, ich beendete das Gespräch, bevor wir uns auch nur hingesetzt hatten.
Die schwarzen Familien luden mich herzlich ein – aber ihr Schreck war ihnen deutlich anzumerken, wenn ich durch die Tür trat. Eine Freundin erzählte mir, dass ich der erste weiße Mensch gewesen sei, der jemals ihr Zuhause betreten habe. Es ist verdammt schwierig, sich auf so etwas einen Reim zu machen, wenn man vier Jahre alt ist und eigentlich gekommen ist, um mit den anderen Topfschlagen zu spielen und Geburtstagstorte zu essen. So einfach Zugehörigkeit im Kindergarten sein sollte – mich beschäftigte schon damals, warum ich mich in jeder Gruppe als Außenseiter fühlte.
Ein Jahr später zogen wir in den Garden District, damit mein Dad näher an der Loyola University war, und ich wechselte an die Schule »Holy Name of Jesus«. Als Mitglied der Episkopalkirche war ich nun die Einzige nicht-katholische Schülerin. Ich hatte also auch noch die falsche Religion, was einen weiteren Keil zwischen mich und die Zugehörigkeit trieb. Nach ein oder zwei Jahren des Aussitzens, des Aufgerufen- und manchmal Ausgeschlossenwerdens wurde ich ins Sekretariat geschickt, wo Gott persönlich auf mich wartete. Zumindest glaubte ich, dass es Gott sei, in Wirklichkeit handelte es sich um den Bischof. Er gab mir eine Ablichtung des Nizänischen Glaubensbekenntnisses3, das wir dann Zeile für Zeile durchgingen. Zum Schluss drückte er mir einen kurzen Brief an meine Eltern in die Hand, in dem stand: »Brené ist jetzt katholisch.«
Trotz allem entwickelten sich die Dinge im Laufe der nächsten Jahre ganz gut für mich. Ich fing langsam an, in New Orleans Fuß zu fassen. Das lag vor allem an der allerbesten Freundin der Welt: Eleanor. Doch dann folgte eine Reihe weiterer Umzüge. Als ich in der vierten Klasse war, gingen wir nach Houston. Dann, in der sechsten Klasse, verließen wir Houston in Richtung Washington, D.C. In Klasse acht zogen wir aus Washington zurück nach Houston. Dadurch, dass ich ständig »die Neue« war, verstärkten sich die ganz normalen Turbulenzen und Unbehaglichkeiten der Teenagerzeit gewaltig. Meine einzige Rettung inmitten all dieser Veränderungen war, dass meine Eltern sich wohlfühlten und gut miteinander klar kamen. Mein Zuhause war sicher, trotz aller Unruhe durch die ständig wechselnden Schulen, Lehrer und Freunde. Zuhause war die Zuflucht aus dem Schmerz der Nichtzugehörigkeit. Auch wenn alles andere schieflief – hier gehörte ich hin, zu meiner Familie.
Doch dann begann auch diese Sicherheit zu bröckeln. Der letzte Umzug zurück nach Houston wurde zum Anfang des langen, elenden Endes der Ehe meiner Eltern. Und auf dem Höhepunkt dieses Chaos passierte das mit den Bearkadettes.
Als wir am Ende der achten Klasse zurück nach Houston zogen, hatte ich glücklicherweise gerade noch genügend Zeit, mich für das Synchron-Tanz-Team der Highschool zu bewerben, das sich »die Bearkadettes« nannte. Ich hatte vor, es zu meinem Ein und Alles zu machen. In einem Zuhause, das zunehmend von den Streitereien meiner Eltern dominiert wurde, die ich durch die Wände meines Zimmers gedämpft hören konnte, würde dieses Team die Rettung sein. Man stelle sich Reihen von Mädchen in mit weißen Fransen besetzten blauen Leibchen und kurzen Röcken vor, alle mit den gleichen Perücken, weißen Cowboystiefeln, kleinen weißen Cowboyhüten und knallrotem Lippenstift, die in die mit Menschenmassen gefüllten Football-Stadien der umliegenden Highschools einmarschieren: Niemand würde es wagen, während der Halbzeitpause seinen Platz zu verlassen – aus Angst, unsere »Highkicks« und perfekt choreografierten Nummern zu verpassen. Das sollte mein Ausweg werden, meine neue, adrette, tadellos geordnete Zuflucht.
Acht Jahre Ballett waren mehr als genug, um die Nummer einzustudieren und mithilfe einer zweiwöchigen Diät schaffte ich es durch die brutale Gewichtskontrolle. Alle Mädchen schworen auf Kohlsuppen- und Wasserdiät. Es ist nur schwer vorstellbar, wie man einer Zwölfjährigen erlauben kann, eine Flüssigdiät zu machen, aber aus irgendwelchen Gründen fand man das damals ganz normal.
Bis heute bin ich nicht sicher, ob ich jemals irgendetwas in meinem Leben so sehr gewollt habe wie einen Platz in diesem Synchron-Tanz-Team. Seine Perfektion, Präzision und Schönheit würde nicht nur die zunehmende Unruhe zu Hause wettmachen, sondern mir außerdem den heiligen Gral der Zugehörigkeit verschaffen. Ich würde eine »große Schwester« bekommen, und sie würde meinen Spind dekorieren. Wir würden Übernachtungspartys feiern und mit Footballspielern ausgehen.
Als ein Mädchen, das den Film Grease fünfundvierzig Mal gesehen hatte, erwartete ich eine Highschool-Zeit, in der kollektive und spontane Gesangseinlagen und die 80er-Jahre-Version der berühmten Strumpfsockenpartys gang und gäbe sein würden.
Das Wichtigste aber war, dass ich an etwas teilhaben würde, bei dem man im wahrsten Sinne des Wortes alles im Gleichschritt tat. Eine Bearkadette zu sein, war die Zugehörigkeit selbst.
Bisher hatte ich noch keine richtige Freundin gefunden, also ging ich allein zum Vortanzen. Die Choreografie war einfach – eine jazzige Nummer, die zu einer Bigband-Version von »Swanee« aufgeführt wurde. (Sie wissen schon, dieser »How I love ya, how I love ya«-Song.) Es gab darin viel jazziges Geschiebe mit den Händen und eine längere Passage mit Highkicks. Ich kam mit den Füßen höher als alle anderen, abgesehen von einer Tänzerin namens LeeAnne. Irgendwann konnte ich die Nummer im Schlaf, so viel hatte ich geübt. Noch heute kann ich mich an Teile daraus erinnern.
Der Tag des Vortanzens war der Horror. Ich weiß nicht, ob es an meiner Nervosität oder an der Nulldiät lag, aber als ich aufwachte, war mir schwindelig, und so blieb es, bis meine Mutter mich vor der Schule absetzte. Von heute aus betrachtet, wo ich selbst Kinder in dem Alter habe, kann ich nur schwer begreifen, wie man es fertigbringt, sein Kind ganz allein zu so etwas gehen zu lassen. Ich war umringt von Mädchengruppen, die aus Autos purzelten, in die sie sich gemeinsam gequetscht hatten, und die nun Hand in Hand nach drinnen rannten. Doch wie mir bald klar wurde, war allein gehen zu müssen mein geringstes Problem.
Alle Mädchen – und ich meine wirklich alle Mädchen – waren von Kopf bis Fuß herausgeputzt. Einige trugen blaue Satin-Shorts und goldfarbene Oberteile, andere gold-blaue Trägerhemdchen mit kurzen weißen Röcken. Man sah jede denkbare Variante von gold-blauen Schleifchen. Und alle waren aufwendig geschminkt. Ich war ungeschminkt gekommen und trug graue Baumwollshorts über einem schwarzen Gymnastikanzug. Keiner hatte mir gesagt, dass man sich in den Schulfarben zurechtmachen sollte. Alle sahen so fröhlich und strahlend aus. Ich sah aus wie das traurige Mädchen mit den zerstrittenen Eltern.
Bei der Gewichtskontrolle hatte ich sechs Pfund Luft nach oben, doch bis heute geht mir der Anblick der Mädchen nach, die weinend in die Umkleideräume liefen, nachdem sie von der Waage gestiegen waren.
Wir trugen Nummern, die mit Sicherheitsnadeln an unsere Oberteile geheftet waren, und tanzten in Fünfer- oder Sechsergruppen vor. Schwindel hin oder her, ich kriegte die Choreografie auf die Reihe. Als meine Mutter mich abholte, damit ich das Ergebnis zu Hause abwarten konnte, war ich ziemlich zuversichtlich. Unsere Nummern sollten dann abends aushängen. Die Stunden bis dahin vergingen in Zeitlupe.
Endlich, um fünf nach sechs, rollten wir auf den Parkplatz meiner zukünftigen Highschool. Meine ganze Familie saß im Auto – Mom, Dad, mein Bruder und meine Schwestern. Wir waren auf dem Weg nach San Antonio, wo wir meine Großeltern besuchen wollten, und hielten nur kurz an, damit ich nachsehen konnte, wie das Vortanzen gelaufen war. Ich lief zum Schwarzen Brett, das draußen neben der Turnhallentür hing. Es stand schon ein Mädchen dort, das mit mir zusammen vorgetanzt hatte. Sie war die Fröhlichste und Strahlendste von allen. Zu allem Überfluss hieß sie auch noch Kris. Ja, sie hatte tatsächlich einen dieser begehrten Namen, die für beide Geschlechter funktionierten. Alle wollten damals so einen Namen haben.
Die Liste war nach Nummern geordnet. Wenn die eigene Nummer auf der Liste stand, war man im Team. Wenn die eigene Nummer nicht auftauchte, war man raus. Ich war Nummer 62. Meine Augen wanderten sofort zu den 60er-Nummern: 59, 61, 64, 65. Ich guckte noch einmal. Es war unbegreiflich. Wenn ich nur fest genug auf die Liste starrte, dachte ich, und wenn das Universum wusste, wie viel für mich auf dem Spiel stand, dann würde meine Nummer wie durch Zauberei doch noch erscheinen. Meine Verhandlungen mit dem Universum wurden jäh von Kris’ Aufschrei unterbrochen. Sie sprang wild umher, und bevor ich auch nur verstand, was passierte, war ihr Vater aus dem Auto gesprungen, hatte sie gefasst und wirbelte sie herum, genau wie im Film. Später ist mir zu Ohren gekommen, dass ich angeblich zwar eine solide Tänzerin war, aber einfach nicht das Material, aus dem die Bearkadetten gemacht waren. Keine Verbeugungen, kein Strahlen. Keine Gruppe. Keine Freunde. Kein Ort, an den ich gehörte.
Ich war allein. Es war niederschmetternd.
Ich trottete zurück zu unserem Kombi, kletterte auf den Rücksitz, und mein Dad fuhr los. Meine Eltern sagten kein Wort. Kein einziges Wort. Diese Stille war für mich, als würde mir jemand mit dem Messer ins Herz stechen. Meine Eltern schämten sich für mich, und mit mir. Dad war in seinem Football-Team der Kapitän gewesen. Mom die Erste in ihrem Synchron-Tanz-Team. Und ich war gar nichts. Dazugehören und Coolsein war für meine Eltern, vor allem für meinen Vater, das Allerwichtigste. Ich gehörte nicht dazu.
Und zum ersten Mal gehörte ich nun auch nicht mehr zu meiner Familie.
Wenn man sich vor Augen hält, was heute in der Welt los ist, kann man meine Geschichte mit dem Synchron-Tanz-Team natürlich als unwichtig abtun. (Ich sehe schon den Hashtag #Erste-Welt-Probleme!) Ich möchte trotzdem erzählen, welche Bedeutung dieses Ereignis für mich gehabt hat. Ob es nun die Wahrheit war oder nur eine Geschichte, die ich mir selbst erzählte: Von diesem Tag an gehörte ich nicht mehr zu meiner Familie – also zu der frühesten und wichtigsten sozialen Gruppe, die der Mensch hat. Wenn meine Eltern mich getröstet oder mir gesagt hätten, wie mutig es gewesen sei, dass ich es zumindest versucht hatte – oder, was noch besser gewesen wäre und was ich in diesem Moment wirklich wollte: Hätten sie sich auf meine Seite gestellt und mir versichert, wie furchtbar das alles sei und wie sehr ich es verdient gehabt hätte, in dieses Team gewählt zu werden – dann hätte diese Geschichte nicht mein ganzes weiteres Leben bestimmt. Aber genau das hat sie getan.
Diese Geschichte mit Ihnen zu teilen war viel schwieriger, als ich gedacht hätte. Ich musste auf iTunes gehen, weil ich mich nicht erinnern konnte, wie das Lied hieß, zu dem wir vortanzen mussten. Als ich es gefunden und angeklickt hatte, musste ich sofort losweinen. Nicht, weil ich es seinerzeit nicht ins Team geschafft hatte. Ich weinte um das Mädchen, das ich damals nicht hatte trösten können. Das Mädchen, das nicht verstand, was geschah und warum es geschah. Ich weinte um meine Eltern, die nicht gut dafür ausgestattet waren, mit meinem Schmerz und meiner Verletzlichkeit umzugehen. Eltern, die einfach nicht die Fähigkeiten hatten, den Mund aufzumachen und mich zu trösten, oder zumindest die Geschichte zu widerlegen, dass ich nicht mehr zu ihnen gehörte. Wenn solche Situationen aus unserer Kindheit nicht in Worte gefasst oder gelöst werden, bringen sie uns als Erwachsene dazu, verzweifelt nach Zugehörigkeit zu suchen und uns schließlich für die Anpassung zu entscheiden. Glücklicherweise waren meine Eltern nie der Auffassung, dass das Elternsein aufhört, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Wir haben seitdem gemeinsam viel über Mut, Verletzlichkeit und wahre Zugehörigkeit gelernt. Das kann man als kleines Wunder bezeichnen.
Selbst im Zusammenhang mit Leid – Armut, Gewalt, Menschenrechtsverletzungen – ist die Nichtzugehörigkeit zur eigenen Familie eine der gefährlichsten Verletzungen überhaupt. Das liegt daran, dass dieses Nichtdazugehören die Macht hat, uns das Herz zu brechen und unsere Lebensenergie und unser Selbstwertgefühl zu unterminieren. Wie ich aus meinem eigenen Leben und aus meiner Arbeit weiß, gibt es darauf nur drei mögliche Reaktionen:
Man lebt in permanentem Schmerz und sucht Erleichterung, indem man ihn betäubt oder ihn anderen Menschen zufügt.Man verleugnet seinen Schmerz, und diese Verleugnung führt unweigerlich dazu, dass man den Schmerz an die Menschen in seiner Umgebung und an seine eigenen Kinder weitergibt.Man findet den Mut, sich den Schmerz offen einzugestehen und Mitgefühl für sich selbst und andere in einer Weise zu entwickeln, die es einem dann erlaubt, den Schmerz in der Welt auf besondere Art wahrzunehmen.Ich selbst habe die ersten beiden Möglichkeiten definitiv ausprobiert. Und nur durch Gnade habe ich dann den Weg zu der dritten Möglichkeit gefunden.
Nach dem Bearkadette-Alptraum wurden die Streitereien zu Hause immer schlimmer. Oft waren es regelrechte Schlachten, in denen alle Mittel erlaubt waren. Meine Eltern waren einfach nicht in der Lage, es anders zu machen. Ich schämte mich sehr, weil ich davon überzeugt war, dass meine Eltern die Einzigen waren, die Schwierigkeiten hatten, ihre Ehe aufrechtzuhalten. Die Freunde, die mein Bruder und meine Schwestern zum Spielen mit nach Hause brachten, nannten meine Eltern »Mr und Mrs B«, das hatte so etwas beiläufig Cooles, so, als wären die beiden einfach großartig. Doch ich wusste von den geheimen Kämpfen und wusste daher auch, dass ich nicht zu den Freunden gehörte, deren Eltern so toll waren wie die im Fernsehen. Es kam also auch noch die Scham der Heimlichkeit hinzu.
Durchblick ist naturgemäß eine Frage von Erfahrung. Ich hatte nicht genug Erfahrung, um das, was in meiner Umgebung geschah, in einem größeren Zusammenhang zu sehen. Meine Eltern wollten das einfach nur überstehen, ohne katastrophalen Schaden anzurichten. Es kam ihnen schlicht nicht in den Sinn, uns an ihren Sichtweisen teilhaben zu lassen. Ich war mir sicher, dass ich die Einzige in unserer Stadt, ja auf der ganzen Welt war, die diese spezielle Form der Katastrophe erleben musste. Und das, obwohl es meine Schule in die landesweiten Nachrichten geschafft hatte, weil dort eine alarmierend hohe Zahl von Schülerinnen und Schülern Selbstmord begangen hatte. Erst sehr viel später, als die Welt sich veränderte und die Menschen anfingen, wirklich über ihre Probleme zu sprechen, erfuhr ich, wie viele von diesen perfekten Eltern sich letztendlich hatten scheiden lassen, wegen ihres harten Lebens früh gestorben waren oder sich, mit viel Glück, endlich auf dem Weg der Besserung befanden.
Manchmal ist für Kinder die Stille am gefährlichsten, denn sie erlaubt es ihnen, sich ihre eigenen Geschichten zurechtzubasteln – Geschichten, in denen sie selbst fast immer die Rolle desjenigen spielen, der allein ist und Liebe und Zugehörigkeit nicht verdient hat. So jedenfalls ging meine Geschichte, und deshalb versteckte ich nun Gras unter meinem Sitzsack und hielt mich in der Schule an die krassen Kids, statt in der Halbzeitpause Highkicks vorzuführen – irgendwo musste ich schließlich meine Clique finden. Ich habe in meinem ganzen Leben nie wieder freiwillig bei irgendeiner Auswahlprüfung mitgemacht. Stattdessen wurde ich richtig gut darin, mich anzupassen. Ich war bereit, alles zu tun, um mich gewollt und als Teil von etwas zu fühlen.
Während der fortdauernden und sich verschlimmernden Streitereien meiner Eltern kamen mein Bruder und meine beiden Schwestern meist in mein Zimmer, bis es vorbei war. Als die Älteste begann ich meine neu erworbenen Anpassungssuperkräfte zu nutzen, um zu analysieren, was zu der Ehekrise geführt hatte und mir dann aufwendige Vermittlungsmaßnahmen auszudenken, die »alles wiedergutmachen« würden. Ich konnte die Retterin meiner Geschwister, ja meiner gesamten Familie sein. Wenn es funktionierte, betrachtete ich mich selbst als Heldin, wenn nicht, gab ich mir die Schuld und verstärkte meine Suche nach analysierbaren Anhaltspunkten. Erst jetzt, während ich dies schreibe, wird mir plötzlich klar, dass ich genau in dieser Zeit begonnen habe, die Analyse und die Forschung der Verletzlichkeit vorzuziehen.
Wenn ich zurückblicke, erkenne ich, dass ich wahrscheinlich der Nichtzugehörigkeit meine Karriere verdanke. Schon als kleines Kind und später als Teenager begegnete ich dem Gefühl, nicht dazuzugehören, dadurch, dass ich die Leute genau beobachtete. Ich wurde zur Expertin im Auffinden von Mustern und Zusammenhängen. Wenn ich im Verhalten der Leute Muster entdecken und diese Muster mit dem, was sie fühlten und taten in Verbindung bringen konnte, dann, so war ich mir sicher, würde ich mich zurechtfinden. Meine Fähigkeit, Muster zu erkennen, nutzte ich, um vorherzusehen, was die Leute wollten, dachten oder taten. Ich lernte, wie man die richtigen Sachen sagte und auf die richtige Weise auftrat. Ich wurde eine Anpassungsexpertin, ein Chamäleon. Und mir selbst eine sehr einsame Fremde.