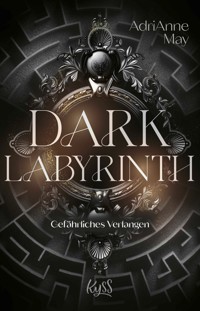
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Labyrinth-Dilogie
- Sprache: Deutsch
Ein tödliches Labyrinth. Eine Heldin ohne Erinnerung. Und ein verführerisches Monster. Als ich die Augen aufschlage, weiß ich nicht, wo ich bin. Nur dass ich auf einem Bett aus Moos auf einem schwarzen, spiegelglatten Boden liege. Ich weiß auch nicht, wer ich bin. Nur dass Macht unter meiner Haut vibriert. Noch bevor ich mich irgendwie orientieren kann, bekomme ich Gesellschaft. Ein Daemon namens Daesra, halb Mensch, halb Monster. Ebenso gefährlich wie verführerisch. Er kennt mich – und er hasst mich. Er verrät mir, dass mein Name Sadaré ist, dass ich eine mächtige Hexe bin und dass wir uns am Eingang eines Labyrinths befinden. Es ist eine Prüfung der Götter. Daesra soll mich durch diesen tödlichen Ort führen. Doch wie soll ich einem Mann vertrauen, der mich verabscheut? Vor allem wenn ich nicht mal weiß, was ich ihm angetan habe …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 607
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
AdriAnne May
Dark Labyrinth – Gefährliches Verlangen
Roman
Über dieses Buch
Ein tödliches Labyrinth. Eine Heldin ohne Erinnerung. Und ein verführerisches Monster.
Als ich die Augen aufschlage, weiß ich nicht, wo ich bin. Nur dass ich auf einem Bett aus Moos auf einem schwarzen, spiegelglatten Boden liege. Ich weiß auch nicht, wer ich bin. Nur dass Macht unter meiner Haut vibriert. Noch bevor ich mich irgendwie orientieren kann, bekomme ich Gesellschaft. Ein Daemon namens Daesra, halb Mensch, halb Monster. Ebenso gefährlich wie verführerisch. Er kennt mich – und er hasst mich. Er verrät mir, dass mein Name Sadaré ist, dass ich eine mächtige Hexe bin und dass wir uns am Eingang eines Labyrinths befinden. Es ist eine Prüfung der Götter. Daesra soll mich durch diesen tödlichen Ort führen. Doch wie soll ich einem Mann vertrauen, der mich verabscheut? Vor allem, wenn ich nicht mal weiß, was ich ihm angetan habe …
Eine dunkle und unwiderstehliche Neuinterpretation des Minotaurus-Mythos.
Vita
AdriAnne May hat unter dem Namen A.M. Strickland bereits Jugendbücher geschrieben, mit «Dark Labyrinth» legt sie nun ihr erwachsenes Debüt vor. Ihrer Leidenschaft, über sympathische Monster zu schreiben, bleibt sie allerdings in allen ihren Büchern treu. Sie lebt mit ihrem Ehemann und ihren Hunden in Alaska und Spanien und arbeitet zurzeit an einer Fortsetzung von «Dark Labyrinth». In Band 2 begegnen Sadaré und Daesra dem unwiderstehlichen Herrn der Unterwelt. Mehr Informationen sind auf ihrer Homepage www.adriannestrickland.com oder auf Instagram @adriannemaystrickland zu finden.
Bianca Dyck ist in einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen. Die Neugier auf das Leben in der Großstadt zog sie nach Köln, von wo aus sie Anglistik und Keltologie studierte. Anschließend führte die langjährige Liebe zu Büchern und der Sprache sie an die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, wo sie den Master in Literaturübersetzen abschloss. Seit 2022 arbeitet sie als freie Übersetzerin und überträgt Romane aus dem Englischen ins Deutsche.
Impressum
Die englische Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel «Exquisite Ruin» bei Gallery Books.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Exquisite Ruin» Copyright © 2025 by AdriAnne May
Redaktion Gesa Weiß
Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung Shutterstock
ISBN 978-3-644-02387-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Wenn du dich darüber informieren möchtest, findest du auf unserer Homepage unter www.endlichkyss.de/darklabyrinth1 eine Content-Note.
Für Lukas.
Ohne dich hätte ich dieses Buch nicht schreiben können – weder die guten noch die schweren Teile.
1
Als ich die Augen aufschlage, weiß ich nicht, wo ich bin, nur dass ich auf einem Bett aus samtweichem Moos liege, auf einem spiegelglatten schwarzen Steinboden. Ich weiß auch nicht, wer ich bin. Nicht einmal meinen Namen kenne ich. Doch unter meiner Haut vibriert Macht wie eine Quelle, die nur darauf wartet, angezapft zu werden. Ich weiß nicht, wie ich sie erreichen soll, aber ich weiß, dass sie da ist. Ihre Präsenz ist tröstlich, während alles andere mir fremd ist, selbst mein eigener Körper.
Als mein Magen sich zusammenkrampft, rolle ich mich auf die Seite und würge, doch es kommt nichts hoch. Einen Moment lang liege ich einfach da und atme. Um meine Handgelenke sind seltsame Seile gewickelt, aber wenigstens bin ich nicht gefesselt. Mir verschwimmt die Sicht, und mein Bauch rumort wie eine stürmische See, während ich blinzle, um die Welt schärfer wahrzunehmen.
Skulpturen aus weißem Marmor treten anmutig aus Hecken hervor, die wie hohe grüne Mauern aufragen, nur vom Himmel begrenzt. Obwohl die Statuen leblos sind, huscht mein Blick von einer zur nächsten, auf der Suche nach Gefahr. Die Steinfiguren stellen Menschen und Götter dar, aber auch Tiere, seltsame Bestien und Kreaturen, halb Tier, halb Mensch. Der zarte Duft von Blumen kitzelt mich in der Nase. Einige der Gestalten stehen abseits der Hecken, Ranken und Blätter winden sich um Hälse und Schultern, und frische Blüten verzieren Köpfe und Hörner.
Sie alle wirken friedlich, wohlwollend, als wären sie mitten in einer netten Zusammenkunft im Freien erstarrt. Schmetterlinge schweben ziellos durch die Luft, einer landet auf der erhobenen Hand einer nahe stehenden Statue, ein lächelnder Mann mit einem Fischschwanz anstelle von Beinen. Dieser Ort wirkt zugleich wie eine alte Ruine und etwas einzigartig Neues.
Ich krümme mich zusammen – der harte Boden unter mir drückt gegen meine Hüfte. Ich stütze einen Ellbogen auf ein moosbedecktes Fleckchen und betrachte meinen Körper, um meinem Magen Zeit zu geben, sich zu beruhigen. Die blasse Haut meines Oberschenkels wird kaum von einer cremeweißen Tunika bedeckt, die für mehr Bewegungsfreiheit von der Hüfte abwärts geschlitzt ist. Mysteriöse dünne, faserige Seile, scheinbar von Gold durchzogen, sind um meine Arme und meine schmale Taille geschlungen und winden sich zwischen meinen bescheidenen Brüsten entlang. Ich erinnere mich an das flüchtige Gefühl von Lippen, die über sie streichen, und für einen Moment ist es, als würde ich mich selbst von außerhalb meines Körpers betrachten.
Wie es scheint, bin ich eine Frau. Diese Erkenntnis ist, genau wie alles andere, verwirrend. Meine Hand wandert zu meinen Rippen, dann an meinen Po. Ja, ich habe eine feste Form. Ich scheine die Grenzen meiner Welt zu begreifen, ich verstehe nur nicht, was sie beinhaltet.
«Na so was. Sieh an, wo du gelandet bist, du verdammte, kolossale Närrin», sagt eine Stimme hinter mir, zugleich Zischen und Schnurren, zornig und hämisch.
Ich werfe einen Blick über meine Schulter und mir entfährt ein erstickter Schrei.
Er ragt über mir auf, sowohl Mann als auch Monster und dabei keine Statue – dafür ist er zu bedrohlich, zu plastisch und lebendig. Er ist groß und gut gebaut, eine schwarze Tunika, ähnlich geschnitten wie meine, lässt kräftige Arme erkennen, um die sich scharlachrote Seile schlingen. Seine Haut ist blass, allerdings auch leicht rauchig, beinahe bläulich sogar. Starke Hände mit feingliedrigen Fingern und spitzen schwarzen Nägeln ruhen auf Hüften, die sich auf eine Art aus den breiten, sehnigen Schultern verjüngen, die meinen Blick abwärts zieht.
Doch es ist vielmehr sein zorniger Ausdruck als seine düstere Schönheit, der meine Aufmerksamkeit wieder auf sein Gesicht lenkt. Seine Augen, von einem kräftigen, wütenden Rot, sitzen über markanten Wangenknochen, die aussehen wie aus Stein gemeißelt. Noch seltsamer sind die geschwungenen dunklen Hörner, die aus den schieferfarbenen Locken auf seinem Kopf wachsen, zwei von ihnen, wie die Zinken einer bösen großen Gabel.
«Anscheinend bist du mir gegenüber im Nachteil», sagt er mit einem weißen, scharfzahnigen Grinsen. «Wie üblich.»
Allerdings erkenne ich ihn nicht, aber ich erkenne ja nicht einmal mich selbst. Ein Schwanz, bedeckt mit seidigem Fell in der Farbe seines Haars, peitscht hinter ihm durch die Luft. Dort, wo sonst Schuhe und Füße wären, wächst das gleiche Fell über seine Knöchel und umhüllt dunkle gespaltene Hufe.
«Was bist du?», krächze ich. Wer bist du? wäre wohl die höflichere Frage gewesen, aber es fällt mir schwer, mich auf etwas anderes als seine Hörner und Hufe zu konzentrieren.
Er macht eine Geste, als wollte er sich selbst präsentieren. «Ein Daemon.» Als ich nur blinzle, fügt er hinzu: «Einst ein Halbgott, der seine göttliche Seele gebunden hat. Göttliche Seelen sind lästige Dinger, so begrenzt durch göttliche Regeln. Ich bevorzuge es, selbst über meine Bindungen zu entscheiden – und in diesem Fall haben sie mich befreit. So macht Unsterblichkeit doch viel mehr Spaß, denkst du nicht auch? Eigentlich solltest du das wissen, aber du erinnerst dich natürlich an nichts, richtig?» Er wartet nicht auf meine Antwort. «Mein Gedächtnis scheint größtenteils intakt, denn leider erinnere ich mich an dich, wenn auch nicht daran, wie wir hier gelandet sind.»
«Wo …?», setze ich an, räuspere mich und setze mich aufrecht hin. Ich habe Füße, stelle ich fest, in robusten Sandalen, deren Riemen sich an meinen schlanken Unterschenkeln emporwinden. Langes bronzefarbenes Haar fällt mir in Wellen ins Gesicht. Seltsamerweise erinnere ich mich nicht daran, diese Haarfarbe zu haben, allerdings weiß ich noch, dass mir dieser Ton, der irgendwo zwischen Rot, Dunkelblond und Hellbraun liegt, immer gefiel. Ich streiche mir die Strähnen aus dem Gesicht und blicke auf. Mir ist schwindelig, aber nicht so sehr, dass ich die hoch aufragenden grünen Wände und den moosbedeckten, glatten schwarzen Boden um mich herum nicht besser wahrnehmen könnte.
Ich befinde mich in einem kleinen Hof, ein Fleck nichtssagenden Himmels über mir, der mir weder die Tageszeit noch das Wetter zu verraten vermag. In drei verschiedenen Richtungen gehen Gänge ab, die von weißen Marmorstatuen gesäumt sind. Die Wege biegen zu früh ab, als dass ich erkennen könnte, wohin sie führen. In der Mitte des Hofes befindet sich ein riesiger Springbrunnen, dessen trockenes Becken stellenweise mit Moos bewachsen und von Ranken überwuchert ist. Kein Wasser, doch trotz meines trockenen Mundes habe ich auch keinen Durst.
«In einem Labyrinth», sagt der Daemon und beantwortet damit meine halb gestellte Frage. «Es gehört nicht zum Reich der Sterblichen, und trotzdem muss ich betonen, dass du für dieses Schlamassel selbst verantwortlich bist. Ihr Hexen seid alle so überambitioniert, greift nach Dingen, die euch nicht gehören. Greift nach Wesen, die ihr nicht versteht.» Er wedelt mit der Hand herum. «Gute Arbeit, endlich hast du eins davon so sehr verärgert, dass es die Herausforderung angenommen hat. Wenn irgendjemand so nerven kann, dann du.»
Sein harter Tonfall passt nicht zu diesem Schauplatz, er passt nicht zu mir, und er bereitet mir Kopfschmerzen. Ich presse einige Finger an meine Schläfe, als würde das dafür sorgen, dass alles aufhört, sich zu drehen.
«Welche Herausforderung?», frage ich. Momentan komme ich mir weder besonders herausfordernd noch besonders nervig vor.
Er legt eine Hand an seinen Mund. «Götter, ich liebe es. Du, ganz tief unten. Aber ich kann großzügig sein, auch wenn du mich mit dir herabgezogen hast.» Er schluckt seine unverkennbar gehässige Freude herunter. «Dieses Labyrinth ist eine Prüfung. Es ist dein Weg zum Erfolg. Dein Untergang.»
Die Umgebung hat durchaus ihren Reiz, und die luftigen grünen Gänge werden nur von diesen seltsamen friedlichen Statuen bevölkert. Ich sehe nichts, was hier herumstreift. Doch die Mauern wirken bedrückend. Erwartungsvoll. Lebendig. Mehr, als Hecken es sein sollten. Es war ganz richtig, nach Gefahr Ausschau zu halten.
Und vielleicht habe ich sie genau vor mir, in Form dieses hünenhaften, böswilligen Daemons. Auch er ist nicht reizlos, doch das umwerfende Lächeln und die ansprechend definierten Muskeln, die ich selbst unter der Tunika problemlos erkennen kann, können über die scharfen Nägel und die Brutalität in seinen Bewegungen nicht hinwegtäuschen.
«Was für ein Erfolg?», frage ich, während ich ihn aus zusammengekniffenen Augen ansehe und versuche, meine Zunge zu befeuchten.
Mit einer blassblauen Hand deutet der Daemon auf unsere Umgebung. «Nun, wenn du hier lebend rauskommst, das Rätsel löst und das Monster am Ende besiegst, erhältst du eine immense Macht, die deine wildesten Fantasien übersteigt. Meine allerdings nicht, denn ich bin bereits mächtig.»
«Das bin ich auch», sage ich. Das ist die einzige Wahrheit, die ich kenne. Bevor er meine Fähigkeiten in Zweifel gezogen hat, habe ich mir eher Sorgen um das Monster gemacht.
Er lacht, ein Laut, scharf genug, um jemanden bluten zu lassen. «Du bist nichts im Vergleich zu mir.»
Das erscheint mir nicht richtig. «Warum sollte ich dir glauben?»
Immerhin ist er ein Daemon. Auch wenn ich nicht ganz begreife, was das bedeutet, hat er sich selbst als das Gegenteil seiner einst göttlichen Natur beschrieben – frei von Regeln. Und das heißt, er könnte auch ein Lügner sein.
Dann wiederum ist er angeblich unsterblich. Das könnte mich im Vergleich zu ihm tatsächlich zu einem Nichts machen. Und doch fühle ich mich nicht wie nichts.
«Fragen über Fragen.» Er legt eine seiner Hände mit den langen Nägeln flach auf seine Brust. «Aber ich bin großzügig, weißt du noch? Jetzt werde ich dir sogar noch mehr helfen. Ich werde dir helfen, das hier zu meistern. Ich tue das nicht nur aus Selbstlosigkeit. Wenn du nicht ans Ende gelangst, tue ich es auch nicht. So lautet die Abmachung.»
Ich schüttle den Kopf. «Das ergibt doch alles keinen Sinn. Warum kann ich mich an nichts erinnern?»
Der Daemon zuckt mit den Schultern, offenbar hat er genug von den Fragen. Dafür breitet sich eine köstliche Zufriedenheit auf seinem Gesicht aus wie Sahne auf den Schnurrhaaren einer Katze. Sein peitschender Schwanz passt perfekt ins Bild.
Als würde ein Blitz eine dunkle Landschaft erhellen, erinnere ich mich plötzlich wieder: ich, wie ich ihn unter einem Blätterdach mit einer in Honig getauchten Feige füttere, in einem Raum voll weicher Seide und hellem Marmor. Seine Zunge, wie sie die klebrige Masse von meinen Fingern leckt, bevor er den Bissen in den Mund nimmt und sich selbst mit ihr über die Lippen fährt. Sein verruchtes Grinsen. Doch in seinen roten Augen liegt noch mehr als nur Hunger. Etwas Mächtigeres, Besitzergreifendes.
Ich ziehe die Knie an meine Brust, meine Sandalen streifen über das Moos. Ein Schaudern lauert unter meiner Haut, doch die Kälte, die ich fühle, ist nicht an meiner Oberfläche; sie liegt irgendwo vergessen tief in mir. Ich weiß nicht viel, doch ich weiß, dass dieser Mann, dieser Daemon mich nicht leiden kann. Und instinktiv kann auch ich ihn nicht leiden. Daher erscheint es unmöglich, dass es einmal eine Zeit gegeben hat, in der ich ihm solch eine süße Köstlichkeit angeboten habe und er mich im Gegenzug so angesehen hat.
Ganz eindeutig steckt noch mehr hinter unserer Geschichte. Aber ich muss beim Anfang beginnen.
«Wie heiße ich?», flüstere ich.
Ungewollte Emotionen huschen über seine harten, kalten Gesichtszüge. Widerwilliges Mitleid vielleicht. Vermutlich sehe ich wirklich erbärmlich aus, wie ich hier auf dem Boden kauere.
«Sadaré», sagt er.
Ich wiederhole den Namen, ohne ihn wiederzuerkennen. «Und du?»
«Daesra.»
Seinen Namen wiederhole ich nicht, um ihn nicht zum Näherkommen aufzufordern – vergeblich, denn als ich versuche, auf dem glatten Boden aufzustehen, der dort, wo das Moos ihn nicht mit blühendem Grün bedeckt, funkelt wie der Nachthimmel, zittern meine Beine. Erneut zeigen sich diese ungewollten Gefühle auf Daesras Gesicht, und er streckt eine Hand aus, um mir Halt zu bieten.
Wie ich diesen Blick bereits hasse, nachdem ich ihn erst zweimal gesehen habe. Ich weiche vor ihm zurück.
Spöttisch verzieht er das Gesicht und packt mit alarmierender Kraft meinen Ellbogen, bevor er ihn angewidert wieder wegstößt und mich ins Wanken bringt. «Ich weiß nicht, warum ich dir überhaupt helfe. Ach ja, wenn ich es nicht tue, sitze ich mit dir hier fest. Du kannst wenigstens sterben.»
Ich schaffe es gerade so, mein Gleichgewicht wiederzuerlangen. Seine Größe und Stärke scheinen meine eigene Zerbrechlichkeit noch hervorzuheben, auch wenn ich mich trotzdem noch mächtig fühle – möglicherweise unverdientermaßen. Wieder sehe ich mich um, nehme die steil aufragenden Hecken wahr, die doppelt so hoch sind wie ich, die abzweigenden Gänge voller Gesichter und Gliedmaßen – die drei Wege nach vorn. Doch bevor ich mich diesen nähern kann – oder dem Monster an deren Ende –, habe ich noch grundlegendere Dinge zu klären. «Was bin ich?»
Ich schätze, in Bezug auf mich selbst kann ich eine solch unfreundliche Frage ruhig stellen.
Daesra hebt eine dunkle Augenbraue, aber überraschenderweise liegt diesmal kein Spott in seinem Ausdruck. «Wie schon gesagt, du bist eine Hexe. Auch als Blutsaugerin oder Schmarotzerin bekannt», fügt er hinzu.
«Eine Frau», sage ich nur halb fragend und ignoriere den letzten Teil.
«Ich denke schon, aber der Schein kann trügen, und das Äußere ist ohnehin wandelbar.»
«Ich bin sterblich?»
«Sterblicher geht nicht.»
«Aber du bist es nicht», sage ich. «Du bist ein Daemon.»
«Brillant, dir sind die Hörner und der Schwanz aufgefallen», sagt er, obwohl er derjenige war, der es mir mitgeteilt hat. «Und schon verstehst du unsere jeweilige Bedeutsamkeit. Oder vielmehr deine Bedeutungslosigkeit.»
Auch das ignoriere ich und lege mehr Selbstsicherheit in meine Stimme, als ich fühle. «Also, ich bin hier, um ein Rätsel zu lösen und etwas zu gewinnen. Mehr Macht. Unsterblichkeit vielleicht, wenn ich gegen ein höheres Wesen antrete. Du bist verpflichtet, mir zu helfen, zumindest wenn du selbst wieder hier herauskommen willst, denn du tust das alles nicht aus der Güte deines Herzens. Ich erinnere mich an nichts, da das Teil der Herausforderung ist, und du hast nicht vor, meiner Erinnerung auf die Sprünge zu helfen. Habe ich alles erfasst?»
Daesra neigt den Kopf, und seine geschwungenen dunklen Hörner funkeln. Abgesehen von den erhabenen Ringen, die sich über ihre Länge verteilen, wirken sie so glatt wie der dunkle Steinboden, der mich umgibt. Meine Finger zucken, und einen Moment lang frage ich mich, wie sie sich wohl anfühlen würden, doch dann sieht er mir in die Augen, und erneut kann ich mir keine Welt vorstellen, in der ich jemals die Distanz zwischen uns überwinden könnte. Ich unterdrücke ein Schaudern und balle die Fäuste.
«Habe ich dich irgendwie dazu gezwungen, mir zu helfen?», rate ich. «Hasst du mich deshalb so?»
«Meine liebe Sadaré», sagt er mit einem ruhigen, trägen Lächeln. «Ich habe weitaus triftigere Gründe, dich zu hassen.» Er zuckt mit den Schultern und fährt nach dieser Aussage so beiläufig fort, als würde er ein Kleidungsstück abstreifen.
Ich fühle mich so wackelig auf den Beinen wie bei einem Erdbeben.
«Also nein», fügt er hinzu. «Ich helfe dir, weil ich dir tatsächlich etwas schulde.»
«Was habe ich getan? Ach, egal.» An dem Blick des Daemons erkenne ich bereits, dass er mir darauf keine Antwort geben wird, und ich will ihm nicht die Genugtuung lassen, sie mir zu verweigern.
Allmählich begreife ich, dass ich ihn möglicherweise aus ebenso geringem Anlass hasse wie er mich.
Ich wende mich von ihm ab, um auf eine der Statuen zuzugehen, meine Beine fühlen sich an wie die eines Fohlens, ungeübt noch, aber meine Kraft nimmt zu. Die Skulptur eines heldenhaften Kriegers mit Schild und Schwert stellt neben seinen nackten Brustmuskeln noch einiges mehr zur Schau, denn abgesehen von einem Gürtel trägt er nichts weiter. Rundum ein meisterhaftes Kunstwerk, muss ich sagen. Der helle Marmor ist an gewissen… Erhebungen beinahe durchsichtig. Der Künstler – übernatürlich oder nicht – hat ein Auge fürs Detail.
«Was ist das?» Ich berühre eine Wange der Statue, auf der ich beinahe einen Bartschatten erkennen kann, halte jedoch inne, als ein seltsamer Ausdruck über Daesras Gesicht huscht, kurz taucht er auf und verschwindet dann wieder. Wenigstens habe ich nicht weiter unten hingegriffen.
«Teil des Labyrinths», ist alles, was er sagt.
«Eifersüchtig, wenn ich ihm meine Zuneigung schenke?» Ich weiß nicht, warum ich das frage, außer um ihn zu provozieren. Mir ist bewusst, dass er mich hasst; das hat er deutlich gemacht. Wenn ich die Worte zurücknehmen könnte, täte ich es, vor allem da nun unmissverständlich Zorn in seinen roten Augen auflodert.
«Eifersüchtig», sagt er mit vollkommen ausdrucksloser Stimme. «Deinetwegen.» Eine Aussage, keine Frage.
Das Herz in meiner Brust galoppiert los, mein Körper spürt die Gefahr, während mein Verstand noch nicht so weit ist.
Bevor ich überhaupt zusammenzucken kann, packt Daesra mit erdrückender Kraft mein Handgelenk, und seine schwarzen Nägel graben sich in meine Haut. «Du tätest gut daran, meine Zuneigung zu wollen», zischt er, «so gering meine Achtung für dich auch sein mag.»
Ich schreie vor Schmerzen auf und versuche, mich zu befreien, doch er zieht mich noch näher und senkt seine listigen Lippen an mein Ohr. Wieder erinnere ich mich daran, wie seine Zunge über den üppigen Bogen seines Mundes leckt, diesmal allerdings fletscht er scharfe Fangzähne. Die Dissonanz dieser sich überlagernden Bilder macht mich ganz schwindelig, doch seine nächsten Worte lassen die Realität wieder klar und deutlich werden. Vielleicht sind es auch seine Nägel, die sich in mein Handgelenk bohren.
«Wenn du mit blutigen Nägeln blind am Grund dieses speziellen Brunnens kratzt, ohne Hoffnung auf Entkommen, und da ist niemand, dem du wichtig bist», flüstert er beinahe verführerisch in mein Ohr, «denk daran, dass ich der Einzige bin, der dich hier rausbringen kann. Und wenn du mich nervst, werde ich nicht zögern, dich dem Tod zu überlassen, auch wenn das mein eigenes Ende bedeutet.»
Angst durchdringt mich. Obwohl ich selbst mächtig bin, ist seine Stärke überwältigend. Seine breite Gestalt beugt sich über mich, seine Finger versengen mich wie im Feuer erhitztes Eisen, seine Drohung brennt mir heiß auf der Wange. Aus dieser Nähe kann ich seinen Duft wahrnehmen – sauberer, erdiger Moschus, irgendwas zwischen Mann und Bestie, das mich zu einem anderen Zeitpunkt möglicherweise dazu brächte, meine Nase in seiner Halsbeuge zu vergraben und tief einzuatmen.
Doch plötzlich rieche ich Holzrauch, den ich zuvor nicht wahrgenommen habe, und Herbstlaub, obwohl die Hecken um mich herum grün sind und die Luft eher warm. Mir stockt der Atem in der Brust, und Panik vibriert in meinen Adern, steigt in mir empor, bis ich sie fast schmecken kann. Und dann kann ich es schmecken – unerklärlicherweise, Erde in meinem Mund, Blut auf meiner Zunge. Der Druck, der mich auf den Boden presst, hilflos, obwohl meine Füße noch fest auf dem Marmor stehen.
Es ist weniger eine aufflackernde Erinnerung als vielmehr eine tief vergrabene Verletzung, die durch Daesras Hand wieder zum Leben erweckt wird, eine alte, vergessene Wunde, auf der mein instinktives Verständnis davon beruht, dass Macht einem genommen werden kann. Und dass ich ohne meine Macht verletzlich bin.
Etwas muss mir passiert sein. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber mein Körper hat es nicht vergessen.
Hat er mir das angetan?
Anstatt vor ihr zurückzuweichen, will ich diese Kraft, die sich in mich bohrt, sowohl die gegenwärtige als auch die vergangene, packen und wegschieben. Ich stemme mich dem Griff des Daemons entgegen, seine Nägel graben sich tiefer, und ich ignoriere seinen schmaler werdenden Blick, bis ich etwas anderes spüre als Angst. Schmerz, ja, doch er verleiht mir Klarheit, und jetzt rufe ich ihn herbei. Und dann spüre ich etwas darunter lauern, es surrt unter meiner Haut.
Ein warmes Glühen des Potenzials, das mein Körper birgt, wie auch immer es sich außerhalb davon offenbaren mag. Macht. Nur weiß ich nicht, wie ich auf sie zugreifen kann. Sie ist so fest in mir eingeschlossen, wie Daesra mein Handgelenk umklammert.
Ich habe bereits erfolglos versucht, mich von ihm loszureißen, also schlucke ich die Angst herunter und warte stillschweigend auf den Moment, in dem er die Finger lockert. Schließlich tut er genau das, als er sieht, wie ich entschlossen die Zähne zusammenpresse – doch nicht bevor seine starken, flinken Finger sich einen von meinen greifen und zügig etwas um den Ansatz binden, mitsamt einer winzigen Schleife.
Daesra zieht sich zurück, und ich sehe einen dünnen, scharlachroten Faden zwischen uns, der in einem identischen Knoten an seinem Finger endet.
«Was …?», ist alles, was ich hervorbringen kann, bevor er den durchhängenden Faden strafft und kräftig reißt. Der Knoten an meinem Finger zieht sich schmerzhaft zusammen, das Band schneidet heiß in meine Haut. Keuchend krümme ich mich darüber, will nicht zurückweichen. Kurz frage ich mich, ob das seine Absicht ist – ob er meinen Finger abreißen will. Doch dann lässt der Schmerz so schnell nach, wie er eingesetzt hat.
Durch einen Tränenschleier starre ich schockiert auf meinen Finger. Dort ist nur noch eine dünne rote Linie zu sehen, wie eine Narbe. Oder ein Ring.
«Was denn, weißt du mein Geschenk etwa nicht zu schätzen?», fragt Daesra unschuldig.
Mit heißer Wut funkle ich ihn an. Ich will die Macht in mir freisetzen und ihm ein Glied nach dem anderen ausreißen, doch bevor ich es überhaupt versuchen kann, wackelt er mit seinem Finger, auf dem sich ebenfalls eine lilarote, ringähnliche Narbe abzeichnet. Er lächelt neckisch. «Mir hat’s auch wehgetan. Jammer nicht.»
Soweit ich weiß, habe ich gar nichts gesagt, erst recht nichts, was als Jammern ausgelegt werden könnte. «Was hast du gemacht?»
«Nur einen Faden um deinen Finger gewickelt», sagt er, «zur Erinnerung.»
Ziegenficker, denke ich. Dieses Mal muss mehr als das bedeuten, da ich mich immer noch an kaum etwas erinnern kann. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was. Und ich weiß, dass er es mir nicht sagen wird.
Früher oder später werde ich es herausfinden. Ob ich nun will oder nicht.
«Nun denn», sagt der Daemon, und ich zucke zusammen, denn er klatscht in die Hände, als wäre das hier ein ganz normaler Tag – als wüsste ich, wie ein ganz normaler Tag aussieht. «Sonst noch was, bevor wir weiterziehen?»
«Was ist die Quelle meiner Macht?», frage ich, während ich erneut erst meinen Finger und dann seinen betrachte, die nicht länger durch den roten Faden verbunden sind, jedoch vielleicht durch etwas anderes.
«Ah, also erinnerst du dich zumindest ein wenig daran, wie deine Hexenkraft funktioniert.» Er nickt in Richtung der dickeren faserigen Seile, die um meine Brust geschlungen sind. «Durch Opfer. Schmerz. Du hast einen besonderen Hang zu Seilen und scharfen, spitzen Gegenständen. In diesem Fall gibt es keine arme Kreatur, die du fesseln und leiden lassen kannst, um dein Feuer zu zünden. Du musst mit dem arbeiten, was dir zur Verfügung steht. Mit dir selbst. Benutze deinen eigenen Schmerz.»
Jetzt, da er es erwähnt, wirken die Seile an meinem Körper unangenehm fest, sodass mir das Atmen schwerfällt und meine Rippen schmerzen. Genau wie vorhin, als ich mich seinem harten Griff entgegengestemmt habe, atme ich tief gegen die Seile an. Unter dem Unbehagen meldet sich derselbe warme Funken wie zuvor, wie ein heißes Feuer, das beinahe meine Fingerspitzen erreicht. Ich muss nur danach greifen.
Und doch… Ich würde es bevorzugen, nicht selbst leiden zu müssen. Aber es war nicht der Schmerz von Daesras Nägeln, der mir Angst gemacht hat. So, wie ich weiß, dass ich mächtig bin, weiß ich auch, dass es einst anders war. Auch wenn ich mich nicht daran erinnern kann, was mich zu Boden geworfen hat, hallt die Furcht noch durch meinen Körper wie ein Schrei. Ich werde alles tun, um nicht noch einmal in diese Situation zu geraten. Die Vorstellung von Schmerz ist sogar aufregend, wenn er die Aussicht auf etwas Größeres bereithält. Etwas, womit ich andere verbrennen kann, bevor sie mir wehtun – selbst wenn ich mir dafür zuerst selbst wehtun muss.
Vielleicht hat Daesras Wunsch, nur selbst gewählten Bindungen zu unterliegen, etwas für sich. Ein weiteres Mal wandert mein Blick zu ihm, verweilt auf seinen breiten, dunklen Hufen und den gefährlich geschwungenen Hörnern. Es sind nicht direkt Fesseln, und doch stellen sie Kennzeichnungen dar, von demjenigen, der seine Seele genauso fest gefangen hält, wie es die Seile an meiner Brust mit mir tun. Kennzeichen von Macht.
Und dabei ist es sicher furchtbar, ein Daemon zu sein.
«Es gibt auch noch dich», sage ich, während meine Finger an den verknoteten Enden der Seilmanschette an meinem Unterarm spielen.
Die roten Augen des Daemons lodern vor einem Zorn, der stärker ist, als ich jemals verstehen könnte. «Wenn du versuchst, mich zu binden, werde ich dich Stück für Stück zerreißen, dein verkümmertes Herz roh verschlingen und auf deine Überreste pissen.»
Unbewusst trete ich einen Schritt zurück. Er hat erst kürzlich demonstriert, dass er zu alldem und vermutlich sogar mehr fähig wäre.
«Hast du nicht gerade mich gebunden?», will ich wissen und kann die Empörung unter meiner Furcht kaum verbergen. Ich denke, verkümmert war ein bisschen übertrieben.
«Sadaré, Sadaré», sagt er in plötzlich lässigem Tonfall, während sich auch sein Gesichtsausdruck komplett verändert. «Das war ein Kitzeln im Vergleich zu dem, was ich tatsächlich kann. Zu dem, was wir beide können, so ungern ich dir diesen Ruhm auch zugestehe.» Er streckt die drahtigen Arme aus, seine Muskeln und Sehnen treten hervor – was ich nun eher mit Vorsicht betrachte als mit Bewunderung –, und weist auf die Statuen, die hohen Hecken und die drei abzweigenden Pfade. «Sollen wir dann loslegen? Wir haben ein Labyrinth zu bezwingen und ein Monster zu besiegen. Andernfalls stecken wir hier fest, bis du stirbst.»
Wenn ich dich nicht schon vorher umbringe, denke ich.
Er grinst mich an, als wüsste er genau, was ich denke – und als dächte er etwas ganz Ähnliches. Und dann macht er, elegant wie ein Tänzer, auf einem gespaltenen Huf kehrt, sein Schwanz peitscht hinter ihm durch die Luft, und er dreht mir seinen breiten Rücken zu.
Anstatt ihn mit bloßen Händen zu packen, beiße ich die Zähne zusammen – und setze mich mit verschränkten Armen auf den Rand des Springbrunnens.
«Ich traue dir nicht», sage ich, als er stehen bleibt und sich mir mit fragend gerunzelter Stirn zuwendet.
«Und ich werde dir niemals trauen», sagt er mit einem tiefen Knurren. «Doch du bist eine noch größere Närrin, als ich erwartet habe, wenn du glaubst, es sei eine gute Idee, ohne mich hierzubleiben.»
Schulterzuckend betrachte ich die Statuen um mich herum. «Du bist das Schlimmste, was ich bis jetzt gesehen habe.»
Seine roten Augen werden schmal, und er setzt zischend zu einer Erwiderung an, als wir beide ein anderes, lauteres Zischen hören. Sein Blick geht über meine Schulter, und grelle Furcht blitzt darin auf.
Ich wirble herum und entdecke, dass heller Nebel aus dem Loch im Zentrum des Springbrunnens austritt. Wie auch sonst alles, was ich bis jetzt gesehen habe, wirkt er nicht sonderlich furchteinflößend, eher friedvoll, wie er langsam dort ausströmt – bis er einen Moosflecken erreicht und das Grün sofort bräunlich verwelkt, sich unmissverständlich im Tode zusammenkrümmt.
Ich springe vom Rand des Brunnens auf, als der Nebel gerade die Stelle erreicht, an der sich eben noch mein Hintern befand. Er sammelt sich im Becken, um jederzeit von dort über den Rand zu treten. Stolpernd entferne ich mich, meine Füße sind bereit zu rennen, erst recht, als die nebeligen Ranken sich entfalten und wie die Tentakel eines lebendigen Wesens nach uns greifen.
«Möchtest du jetzt gerne gehen?», fragt Daesra süffisant, während der Nebel an den Rankengewächsen knabbert, die vom Brunnen hängen, und ihrer grünen Leuchtkraft nachjagt, als tränke er sie.
«Los», keuche ich, und als er mir diesmal den Rücken zukehrt, eile ich ihm hinterher ins Labyrinth.
2
Ohne zu zögern, schreitet Daesra in den mittleren der drei Gänge, und ich folge ihm widerspruchslos. Ich warte nicht darauf, mir anzusehen, wie der Nebel den Rest des Grüns im Hof zerstört. Ganz sicher möchte ich nicht sehen, was er mit meiner bloßen Haut anstellen würde.
Obwohl meine Beine mich in aller Eile vorwärtstragen, um mit dem zackigen Tempo mitzuhalten, das die Hufe des Daemons auf dem Marmor zwischen den Moosflecken klappernd vorgeben, kommen wir nicht besonders weit, bevor uns die Notwendigkeit, eine Entscheidung zu treffen, zum Anhalten bringt: erneut drei mögliche Wege in Form einer Kreuzung. Immer wieder schaue ich mich nach dem Nebel um, doch er scheint uns nicht zu folgen, oder er ist zumindest nicht schnell genug. Die drei Gänge vor uns sehen mehr oder weniger identisch aus, von grünen Hecken gerahmt, spiegelglatte schwarze Böden und ein silberner Himmel. Weiße Marmorstatuen stehen verteilt am Rand.
Daesra unterbricht seine Betrachtung unserer Optionen, schürzt die Lippen und wirft mir einen Seitenblick zu, während ein paar Schmetterlinge um uns herumflattern. Sein leicht gehobener Mundwinkel lässt mich vermuten, dass er den Weg kennt und ihn mir einfach nicht mitteilt – mich absichtlich im Ungewissen lässt. Mich dazu zwingt, mich an ihn zu halten, zumal uns der drohende Tod im Nacken sitzt.
Ich widerstehe dem Drang, noch einmal über meine Schulter zu blicken, und versuche, ruhig zu atmen. Ich kann ihm nicht aus lauter Panik bereitwillig die Kontrolle über die Situation überlassen. Er hat bereits versucht, sie an sich zu reißen; als Beleg habe ich immer noch den Abdruck seiner Nägel am Handgelenk.
Der Nebel hat nur das bewiesen, was ich schon vermutet hatte, bevor Daesra darauf beharrte: Hier geht es um Leben und Tod. Um zu überleben, brauche ich meine Macht – nicht ihn.
Dennoch lasse ich mich gern von ihm inspirieren. Während ich vorgebe, an der Seite des Daemons die Optionen abzuwägen, grabe ich mir unauffällig die Nägel in den Unterarm. Schmerz durchzuckt mich, und das warme Gefühl meines Potenzials sammelt sich wie Blut unter meinen Fingernägeln, obwohl ich die Haut nicht verletzt habe. Ich versuche, die Wärme zu ergreifen, und drücke meinen Arm unabsichtlich noch fester, doch sobald ich sie packen will, zieht sie sich zurück.
Als der Daemon sich ganz zu mir umdreht, lasse ich die Hand sinken.
«Wo geht’s lang?», frage ich widerwillig und nicke in Richtung der drei Wege. Wenn ich ihm seinen Willen lasse, bleibt er vielleicht mit dem Labyrinth beschäftigt, während ich mit meinem eigenen inneren Rätsel experimentiere.
Träge hebt er eine Schulter. «Was denkst du? Ich habe das erste Mal entschieden.»
«Ich dachte, du bist mein Gehilfe.»
«Als dein höchst widerwilliger Verbündeter würde ich vorschlagen, dass du jetzt den Weg wählst und wir einfach sehen, was passiert, schließlich vertraust du mir nicht.»
Er wird mir nicht gestatten, mich einfach im Hintergrund zu halten, und ich folge seiner Aufforderung bereitwilliger, als vermutlich vernünftig ist. Ohne auf ihn zu warten, gehe ich nach links. Links ist meine starke Hand – eine Eigenschaft, die angeblich Unglück bringt, was ich immer töricht fand, auch wenn ich mich nicht an die genauen Umstände erinnern kann, in denen ich das tat. Das ist die einzige Begründung, die ich für meine Wahl habe, und sie ist so dürftig, dass es mir nicht notwendig erscheint, sie dem Daemon mitzuteilen.
Und doch will ich mich nicht drücken, falls er mich auf die Probe stellt. Jedenfalls ist mein Stolz wesentlich weniger schüchtern als meine Macht.
Ich höre Daesra feixen, als er mir folgt. «Jetzt übernimmst du die Führung, was?»
Ich spreche, ohne mich umzudrehen, während ich mich vorsichtig einer Biegung nähere. Und doch sind die Statuen immer noch unsere einzigen Begleiter. «Du schienst sie nicht zu wollen.»
«Oh, ich will sie immer», sagt er auf eine tiefe, träge Art, die mich wieder an eine sich rekelnde Katze erinnert. Ein Raubtier beim Müßiggang. Allmählich frage ich mich, ob die Wahrung meines Stolzes es wert ist, ihn in meinem Rücken zu haben, bereit zum Angriff. «Es stellt sich nur die Frage, ob du mir folgen würdest oder nicht. Du kannst ziemlich dickköpfig sein, wenn du es genau wissen willst.»
«Will ich nicht.» Ich presse den Kiefer zusammen, während ich um die Kurve gehe. «Da du mir noch keinen Grund gegeben hast, dir zu vertrauen, folge ich für den Moment meinem eigenen Urteilsvermögen.»
Abrupt bleibe ich stehen, und Daesra kräht: «Und welch hervorragendes Urteilsvermögen du doch hast!»
Der Gang endet in einer Sackgasse – eine weitere Heckenwand und die Statue eines einsamen Satyr-Mädchens, das mit einer Rebe Trauben in der Hand irgendwie verloren wirkt.
Wie passend.
«Dann also rechts», verkünde ich und marschiere den Weg wieder zurück.
«Warum nicht der mittlere Weg?», fragt der Daemon. Den hat er beim ersten Mal gewählt. Ein Blick über meine Schulter verrät mir, dass er mir noch immer folgt – und noch immer grinst. «Erscheint mir ausgeglichener.»
«Und es ist die offensichtliche, einfache Wahl.»
«Natürlich würdest du das Offensichtliche übergehen.»
Ich ignoriere ihn und nehme den rechten Weg, nachdem ich wieder an der Kreuzung angekommen bin. Kurz darauf – noch schneller als zuvor – erreichen wir wieder das Ende einer Sackgasse, an dem die Statue eines Jungen steht, der sich eine nicht entzündete Kerze an die Brust presst und überrascht über seine Schulter blickt. Wenn das ein Test war, habe ich wohl versagt.
«Na gut», sage ich, verschränke die Arme und funkle die Heckenwand wütend an. «Du entscheidest.»
Die roten Augen des Daemons weiten sich in gespielter Dankbarkeit. «Du bietest mir die Führung an, wenn nur noch eine Option verbleibt, und zwar die, die ich vorgeschlagen habe und du ignoriert hast – wie großzügig von dir.»
Ich wirble zu ihm herum und lasse die Arme sinken. «Ich habe dich schon vorher nach deiner Meinung gefragt.»
«Ah, aber du hast nicht höflich genug darum gebeten.»
Ich schüttle den Kopf. «Ich wusste es. Du kennst den Weg oder weißt zumindest, wie man ihn erkennt, aber du willst es mir nicht verraten. Oder du willst eine Gegenleistung, wie dass ich darum bettle.» Ich schiebe mich an ihm vorbei, um erneut denselben Weg wieder zurückzugehen. «Aber ich habe nie um deine Hilfe gebeten», zumindest glaube ich das, «also werde ich jetzt auch nicht darum betteln.»
«Schade», sagt er hinter mir. «Damit würdest du viel weiter kommen.»
«Weil du dir wünschst, dass ich dir ausgeliefert bin?», frage ich, ohne mich umzudrehen. Ich ignoriere das Prickeln, das seine ungesehene Präsenz in meinem Nacken verursacht.
«Weil du mir bereits ausgeliefert bist», sagt er mit tiefer, brummender Stimme. «Und je eher du dir dessen bewusst wirst und dich vor meiner überlegenen Stärke und meinem Wissen verneigst, desto besser.»
Seine Worte bestärken mich in meinem Entschluss: Je eher ich lerne, meine Macht einzusetzen, desto besser. Denn jetzt kenne ich noch eine dritte Tatsache, abgesehen davon, dass ich über eine solche Macht verfüge und es einst nicht tat: Ich kann ihm nicht trauen, egal, wie viel Wissen er möglicherweise besitzt. Nicht wenn er mich meiner Macht so bereitwillig berauben würde.
Oder schlimmer noch: wenn er mich dazu bringen will, ihm freiwillig meine Stärke zu überlassen.
«Du meinst, ich soll mich vor dir verneigen?», schnauze ich und marschiere schneller, als könnte ich ihn abhängen. Doch seine langen Beine halten mit mir mit, seine Hufe klappern über den rutschigen Boden, bis wir wieder bei der Kreuzung ankommen. «Für irgendein krankes Spiel von dir? Als wäre das Labyrinth nicht schon genug.»
Der einzige Hinweis, dass er mich gehört hat, ist sein dezentes Lächeln, das ich sehe, als er neben mich tritt. Ich halte inne, als etwas anderes meine Aufmerksamkeit auf sich zieht – das flüsternde Rascheln von Blättern, als würde eine leichte Brise wehen, nur ist um uns kein einziger Lufthauch.
Ich drehe mich um und erspähe Nebelschwaden, die aus dem Gang kriechen, der uns hierhergeführt hat. Unaufhaltsam fließen sie über den Boden und lassen nichts als Tod zurück. Die Hecken zu beiden Seiten verwelken, als eine Art morbider Schauer fällt ein Regen aus braunen Blättern hinab.
Entsetzt keuche ich auf, aber Daesra tritt nur um mich herum. Trotz seiner Größe und Breite hat er flinke Füße – oder Hufe –, und doch streift mich beim Vorbeigehen seine Schulter, und sein Schwanz peitscht schmerzhaft gegen meinen Oberschenkel.
«Sollen wir dann?», fragt er, als wäre das hier ein entspannter Spaziergang.
Ich protestiere nicht, als er die Führung übernimmt; ich laufe ihm nach, um ihn einzuholen, als er den mittleren Weg dem Nebel gegenüber einschlägt, und mein Herz hämmert wild.
Dieses Mal erwartet uns keine Sackgasse oder Ähnliches. Wäre da nicht der Nebel hinter uns, hätte ich gewünscht, es wäre anders, nur um ihn zu ärgern. Wenigstens bringen wir so schnell Distanz zwischen uns und ihn. Trotzdem kann ich es nicht lassen, alle paar Schritte über meine Schulter zu blicken, für ein Gespräch bin ich zu nervös.
Stattdessen nutze ich die Gelegenheit, um mir erneut den Arm zu drücken, diesmal mit mehr Verzweiflung als zuvor. Ich bleibe absichtlich zurück, damit der Daemon es nicht sehen kann. Zusammen mit dem Schmerz spüre ich die Macht in mir aufsteigen, und anstatt sie mit unsichtbaren Händen so fest zu packen, wie ich die Finger in meine Haut grabe, heiße ich die Empfindung einfach willkommen. Lasse mich in die stechende Wärme sinken. Meine Augen schließen sich, zuckend vor Erleichterung.
Es ist, als würde sich ein Tor öffnen. Abrupt reiße ich die Augen auf, als die Hitze unter meiner Haut in meiner Handfläche zu echtem Feuer wird, genau wie ich es für möglich gehalten habe. Ich lasse es vor mir aufsteigen, staune über die kühlen blauen Flammen, die über meine Fingerspitzen tanzen, ohne mich zu verbrennen… und dann wandert meine Aufmerksamkeit zu Daesra.
Um genau zu sein, zu seinem Schwanz, der sich geschmeidig aus den Falten seiner schwarzen Tunika schlängelt.
Ich strecke den Arm aus, kanalisiere meine Kraft – und das Feuer schießt aus meiner Hand. Doch es strauchelt in der Luft, flackert und wird schwächer, und zischt nur noch leicht gegen das Büschel an seinem Schwanz. Wenigstens versengt es ein wenig Fell.
Der Daemon wirbelt zu mir herum, peitscht mit dem Schwanz umher, um die Funken zu löschen, und Zorn erhellt seine roten Augen. «Spielen wir jetzt Spielchen?»
«Nicht mehr als du», blaffe ich zurück.
Als wollte er mich an meine Sterblichkeit erinnern, schnippt Daesra mit den Fingern, und als Antwort lodern blaue Flammen um seine Hand, prasseln hell wie eine Fackel, sodass ich zurückspringe.
«Wenn du gegen mich spielst, Sadaré», sagt er, und seine Augen glühen lila im Feuerschein, «wirst du verlieren. Ich brauchte nicht einmal neuen Schmerz hierfür. Nur die Bindung meiner Seele. Willst du sehen, was ich mit einer frischen Wunde vollbringen kann?»
Sein Blick wandert zu seiner Hand und zieht meinen mit sich: Mit einem langen schwarzen Nagel sticht er sich in den Daumen. Es gibt kaum eine Wunde. Und trotzdem schießt eine Säule weißen Feuers, so dick wie sein Arm, aus seinen Fingerspitzen in den Himmel. Sie hält nicht lange an, aber lange genug, um sein Argument zu unterstreichen. Der grelle Schatten bleibt in mein Sichtfeld gebrannt, während ich erschrocken blinzle.
Nachdem die lodernde Flamme erloschen ist, streckt er mir seine Hand entgegen, mit der Handfläche nach oben. Auf seinem Daumen ist keine Wunde mehr zu sehen, nur ein Fleck dunklen Blutes – von so tiefem Rot, dass es beinahe schwarz ist. Daemonisch.
Er kann also ebenfalls seinen Schmerz einsetzen, allerdings wesentlich effektiver als ich. Und seine Unsterblichkeit heilt seine Wunden umgehend. Ihm steht eine unbegrenzte Quelle an Schmerz zur Verfügung. So grenzenlos wie sein Leben.
Auch wenn ich das Rätsel gelöst habe, wie ich auf meine Macht zugreifen kann, habe ich doch nichts gefunden, was an seine auch nur entfernt heranreicht. Ich kann nicht endlos Schmerzen erleiden. Ich muss mit dem arbeiten, was ich habe – mit meinen Grenzen. Es reicht nicht, den Schmerz willkommen zu heißen, ich muss ihn irgendwie in meinem Körper festhalten. Ihn in mir lagern, anstatt immer neue Wunden zu verursachen. Ich brauche meine eigene Quelle, nicht nur einen Eimer, mit dem ich aus dem Fluss schöpfe, wenn er vorbeifließt.
Ich kann nicht anders, als seine Hand hungrig zu beäugen. Ihm ist seine Stärke sicher – auf ewig. Wenn die Unsterblichkeit mein Gewinn ist, dann ist er alles.
Er muss die Sehnsucht in meinem Blick erkennen, denn hastig zieht er seine Hand zurück, wie man einem unartigen Kind ein Spielzeug wegnimmt. Ich presse die Zähne aufeinander.
«Ich schlage vor, wir arbeiten zusammen», sagt er. «Solltest du das allerdings ablehnen, werde ich mich vermutlich auch gut amüsieren.»
Die Drohung ist deutlich. Natürlich würde es ihm Spaß machen, mir wehzutun. In der Hinsicht scheint er sich nicht von einem Menschenmann zu unterscheiden. Vielleicht ist er sogar schlimmer, hat als Daemon möglicherweise noch verdorbenere Neigungen.
Wütend funkle ich ihn an, nehme seinen Anblick in mich auf, von dem unterteilten Schwung seiner Hörner über das Fellbüschel an seinem langen, peitschenartigen Schwanz bis zu den scharfen Spalten seiner Hufe – wobei ich die Neugier unterdrücke, wie es sich wohl anfühlen würde, mit den Fingerspitzen darüberzustreichen –, und blicke ihm schließlich in die blutroten Augen.
«Hast du mir wehgetan? Früher?», frage ich.
Er lächelt. «Nur, wenn du es verdient hast.» Meine Augen weiten sich, doch bevor ich zurückweichen kann, fügt er hinzu: «Und doch hast du mich nie gefürchtet, selbst dann nicht, wenn du es hättest tun sollen. Die Quelle deiner Angst… Die war nicht ich.» Es klingt, als gäbe er mir diese Information nur widerwillig.
Ich würde ihn gerne fragen, was mir an diesem Herbsttag mit dem Holzrauch, den modernden Blättern und dem Schmutz passiert ist, doch dieses Gefühl der Verletztheit möchte ich ihm nicht anvertrauen. «Und jetzt? Sollte ich dich fürchten?»
Ernst starrt er mich an. «Definitiv.»
Ich gebe mir alle Mühe, mein Zittern zu verbergen.
«Und ich dachte, das Monster wäre das Schlimmste hier», sage ich und schlage einen lässigen Tonfall an.
Er macht einfach auf einem Huf kehrt und geht weiter, sodass ich ihm folgen muss. Das Labyrinth bleibt weiterhin frei von jeglichen Monstern, wenn man von dem Daemon vor mir absieht. Stattdessen tauchen immer mehr Schmetterlinge auf, die vor uns herumflattern, als wollten sie zeigen, wie frei und friedvoll der Weg vor uns ist. Seltsamerweise wirken die Statuen nicht länger fröhlich und entspannt. Ihre Posen lassen es meist so aussehen, als gingen sie an unserer Seite, ihre Gesichter haben ernstere Ausdrücke. Sie wecken ein Gefühl der Unruhe in mir – den Drang, endlich anzukommen, wo auch immer wir hingehen, als wäre der Nebel, der uns langsam verfolgt, nicht schon Ansporn genug.
Als wir an eine weitere Kreuzung kommen und Daesra stehen bleibt, gehe ich nicht einfach geradeaus weiter, wie wir es beim letzten Mal getan haben und wie er es vermutlich vorschlagen wird. Ich gehe auch nicht nach links oder rechts. Stattdessen gehe ich auf eine Marmorsäule in der Mitte der Kreuzung zu, weil mir eine Idee kommt.
«Warum gehen wir nicht nach oben?», frage ich. «Verschaffen uns einen Überblick.»
«Weil kein Weg nach oben führt», sagt Daesra, als würde er mit einer Idiotin sprechen.
Ich weise mit dem Kopf Richtung Säule. «Aber wir haben die hier.» Ich lächle, bevor er mir mitteilen kann, dass ich nicht daran hinaufklettern kann. «Und dich.»
Er hebt einen Huf und setzt ihn mit einem Klacken wieder ab. «Ich bin noch schlechter dafür gemacht, glatten Marmor zu erklimmen, als du.»
«Aber du bist groß. Hilf mir rauf.» Nachdem er mir gerade gesagt hat, dass ich ihn fürchten sollte, ist der Gedanke, dass ich ihn zwingen kann, mir zu helfen, lächerlich befriedigend. Und es dient sehr wohl einem Zweck.
Stirnrunzelnd sieht er mich an. «Ich glaube, dir wird nicht gefallen, was du da zu sehen bekommst.»
«Das werde ich nicht wissen, solange ich nicht nachsehe, oder?», sage ich zuckersüß. «Und du hast schließlich gesagt, wir sollten zusammenarbeiten.»
Er knurrt weder zustimmend noch ablehnend, aber verschränkt die Finger ineinander zu einer Art Steigbügel und bückt sich für mich. Ich versuche, mir nicht vorzustellen, dass ich ein Pferd besteige, als ich meinen Fuß auf seine breiten Handflächen setze, denn sonst muss ich womöglich lachen.
Stattdessen entfährt mir ein erschrockener Schrei, als er mich mit Leichtigkeit hochhebt, sodass ich in die Luft geschleudert werde und mich an der Seite der Säule festklammern muss, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Sie ist tatsächlich zu breit und zu rutschig, als dass ich daran hinaufklettern könnte. Mit gebeugten Knien schwanke ich gefährlich an der Säule, und gegen meinen Willen streckt meine Hand sich Halt suchend nach einem der Hörner des Daemons aus.
Wir erstarren beide, nur meine Finger bewegen sich und umschließen reflexartig die harte Oberfläche seines Horns. Es fühlt sich kühl an und glatt wie Stein, abgesehen von den Erhebungen, die für einen festen Griff sorgen. Ich stelle mir vor, wie ich beide Spitzen halte und seinen Kopf dorthin lenke, wo ich ihn haben will – meine Arme wären die Zügel, mit denen ich sein Gesicht führe, vielleicht abwärts, zwischen meine Schenkel …
Hektisch blinzle ich, versuche, das lebendige Bild beiseitezuschieben, und sehe, dass er mich durch seine Haarsträhnen hindurch wütend anfunkelt.
«Willst du, dass ich dich fallen lasse?», knurrt er.
«Nein», keuche ich. «Nicht.»
«Dann lass los.»
Das tue ich hastig, und mir bleibt kaum Zeit, mich nach oben auszustrecken, bevor er mich noch höher hebt, hoch über seinen Kopf, und mir zusätzlich einen Schubser verpasst, mich beinahe in die Luft schleudert. Ich schlinge die Arme über die eckige Kante der Säule, um mich an der anderen Seite festzuhalten, bevor ich mit Mühe hinaufklettere. Sobald es mir möglich ist, hocke ich mich auf die schmale Plattform und versuche, nicht nach unten zu sehen. Ich nehme mir einen Moment, um zu Atem zu kommen und mein Gleichgewicht wiederzuerlangen – allerdings ist es weniger die Höhe, die mich schwanken lässt, als vielmehr der Weg, den meine Gedanken eingeschlagen hatten.
Das war keine Erinnerung – oder? Nein, wir können nichts dergleichen getan haben. Er hasst mich, und ich hasse ihn.
Ich schüttele mich innerlich, während ich mich vorsichtig in den Stand erhebe.
Und ich schaue auf das Labyrinth hinaus.
Soweit das Auge reicht, erstrecken sich Gänge aus Hecken in alle Richtungen, bis die vielen Wege sich unter dem dunstigen grauen Himmel zu einem schmalen grünen Streifen am Horizont verdichten. Statuen verschwinden sofort hinter Biegungen, werden verschluckt. Von diesem Aussichtspunkt aus kann ich den richtigen Weg genauso schlecht erkennen wie in einem verworrenen Garnknäuel auf dem Boden – einem Knäuel ohne Ende. Das Labyrinth ist unfassbar groß. Schwindelerregend. Wenigstens entdecke ich keinen Nebel in den Gängen, auch keine toten Pflanzen, wobei das nur wenig tröstlich ist.
Als ein Schmetterling auf meiner Schulter landet, löse ich den Blick vom Labyrinth und betrachte ihn irgendwie erleichtert. Er ist klein, vertraut, und seine langsam schlagenden Flügel sind bezaubernd in ihrem Schillern. Doch während ich die Myriade wunderschöner Farben in ihnen betrachte, entdecke ich noch etwas anderes.
Ein Gesicht. Auf seinem Rücken. Ich bilde es mir nicht ein, und es ist auch keine optische Täuschung im Muster; es ist dort, so deutlich wie jedes Gesicht der Skulpturen, ein Zusammenspiel winziger Erhebungen. Es bewegt sich nicht, die Augen sind fest zugekniffen, der Mund in einem endlosen stummen Schrei geöffnet.
Ich schreie und schlage nach ihm – und verliere das Gleichgewicht. Die Säule rutscht mir unter den Füßen weg, als ich zur Seite kippe, der Himmel und die Hecken verschwimmen in einem Bogen vor meinen Augen.
Starke Arme fangen meinen Sturz ab, anstatt mich mit knochenbrechender Kraft auf den Boden schlagen zu lassen. Heftig keuchend blicke ich zu Daesra auf. Sein Körper drückt sich fest an meinen, doch ich kann das donnernde Schlagen seines Herzens und das hastige Heben und Senken seiner kräftigen Brust spüren. Seine Augen sind weit aufgerissen – beinahe besorgt. Doch dann blinzelt er, und der Ausdruck verschwindet. Er schleudert mich geradezu auf die Füße, sodass ich von ihm fortstolpere und mich an der Säule festhalten muss.
«Was ist los mit dir?», zischt er. «Hast du vor, dich selbst zu töten, bevor das Labyrinth es tut?»
Ich werfe mir das Haar aus dem Gesicht. «Nein, Ich… Ich war abgelenkt.»
«Wovon? Von der Sinnlosigkeit deiner Mission?»
Da war die unfassbare Größe des Labyrinths, nur hat sie nicht meinen Sturz verursacht. Sondern das schreckliche schreiende Gesicht, verborgen in etwas scheinbar so Schönem. Ich kann nur hoffen, dass das Labyrinth nicht ähnlich ist und noch viel mehr verbirgt.
Ich öffne den Mund, um den Schmetterling zu beschreiben – und schließe ihn dann wieder. Es würde albern klingen, dass mich etwas so Kleines so sehr erschüttert hat, dass ich das Gleichgewicht verloren habe. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass sich mir schon bei der bloßen Erinnerung die Haare auf den Armen aufstellen.
«Ich konnte nicht erkennen, in welche Richtung wir müssen. Das Labyrinth erstreckt sich bis zum Horizont», sage ich so ruhig wie möglich und streiche meine Tunika glatt, wenn ich schon meine Würde nicht retten kann. «Es ist ganz eben, ohne charakteristische Merkmale.»
Daesra schüttelt den Kopf, als hätte er das bereits erwartet. «Ich glaube nicht, dass die Lösung darin besteht, möglichst viel Strecke zu machen. Ich glaube, der Weg, den wir einschlagen sollten, ist, abgesehen von vorwärts, abwärts.»
Ich schnaube. «Vorwärts und abwärts. Klingt zu simpel. Außerdem habe ich noch keinen Weg gesehen, der nach unten führt. Abgesehen von meinem Sturz von der Säule.» Und dann sehe ich ihn an und kann nichts dagegen tun, dass mein Blick auf dem Horn verweilt, an dem ich mich festgehalten habe. «Du hast mich aufgefangen. Danke.»
«Geh lieber nicht von einer Wiederholung aus. Beim nächsten Mal könnte ich mich durchaus dagegen entscheiden.»
Ich setze gerade zu einer Retourkutsche an, als ein weiterer Schmetterling vor mein Gesicht flattert und fast auf meinen Lippen landet, weshalb ich erschrocken zurückweiche und ausspucke. Dort, wo er herkam, sehe ich mehr von ihnen, sie bilden vor uns eine bewegliche Wolke – vielleicht, um auszuschwärmen.
Ohne zu zögern, rase ich durch sie hindurch, wedle wild mit den Armen und behalte gerade noch im Kopf, geradeaus zu gehen, wie wir es von Anfang an hätten tun sollen. Erst als ich mich jenseits der schimmernden Flügel des Schwarms befinde, zwischen den weniger bedrohlichen allgegenwärtigen Heckenmauern, bleibe ich stehen. Ich ignoriere den amüsierten Ausdruck auf Daesras Gesicht, als er mich einholt, und reibe meine schwitzigen Handflächen energisch über die Seile an meinen Armen, als könnte ich den Anblick dieses grässlichen Brustkorbs so aus meinem Gedächtnis verbannen.
Die Spitzen von Daesras Hörnern neigen sich nach vorn, als er mich mit gehobener Braue betrachtet. «Stimmt etwas nicht mit den Schmetterlingen?»
Als ich ihm in die roten Augen sehe, spüre ich eine unerklärliche Erleichterung. Dabei könnte er ebenfalls etwas Schreckliches hinter seiner Schönheit verstecken. Ich mag ihn nicht, und er ist furchteinflößend, aber er ist mir… vertraut? Ist er mir vertraut? Auf den ersten Blick hat auch der Schmetterling so auf mich gewirkt, und Daesra ist nicht viel greifbarer als das schreiende Gesicht auf dem Rücken des Insekts, mit seinen Hufen, den Hörnern, dem Schwanz und seinem tiefen Hass auf mich. Doch zumindest seine Beständigkeit ist beruhigend.
Und er hat mich aufgefangen, als ich gefallen bin.
«Sie sind… seltsam», ist alles, was ich diesmal herausbringen kann. Es gelingt mir nur halbwegs, ein Schaudern zu unterdrücken.
Da ist wieder dieser Ausdruck auf dem Gesicht des Daemons: Mitleid.
«Aber du bist seltsamer», äußere ich in einer Halblüge. «Wenn auch angeblich nützlich.»
Wie nützlich er wirklich ist, werde ich noch sehen.
Jetzt ist er mit Schnauben an der Reihe, als er sich wieder in Bewegung setzt. Vielleicht ist es diese Abscheulichkeit in dem, was auf den ersten Blick friedlich und lieblich erschien, die mich daran erinnert, aber nachdem wir uns eine kurze Weile durch die im Gang stehenden Statuen geschlängelt haben, frage ich: «Was ist mit diesem Monster, das sich angeblich im Zentrum des Labyrinths befindet?»
Daesra spaziert ein Stückchen vor mir her und verschränkt die Hände hinter seinem Rücken. Seine wohlgeformten Arme treten stärker in meinen Fokus, als mir lieb ist, die Muskeln zeichnen sich unter der rauchigen Haut ab. Das Klappern seiner Hufe ertönt laut inmitten unserer reglosen, schweigsamen Gefährten. Ich bin dankbar, als ein einzelner Schmetterling vor ihm, und somit auch vor mir, zurückweicht.
«Seinetwegen wurde das hier erbaut», sagt er. «Um dieses Wesen einzusperren, denn wer auch immer es gefangen hat, konnte es nicht töten – oder wollte es vielleicht nicht.»
«Aber warum denn nicht?»
«Ist es so unvorstellbar, dass jemand irgendwo, irgendwann, dieses Monster geliebt hat?» Er bedenkt mich mit einem ironischen Blick. «Meine Güte, Sadaré, selbst die Eltern von Daemonen lieben ihre Brut.»
Vielleicht sind Daesras Worte der Schlüssel zu dem, wer er ist, und im weiteren Sinne dann auch dazu, wer ich bin. Ich beäuge ihn von der Seite, nehme seinen feinen, scharf geschnittenen Kiefer und die kerzengerade Nase wahr, bevor mir im Vorbeigehen das seltsame Stirnrunzeln auf dem Gesicht einer Statue auffällt. Selbst in ihrer Erstarrung sehen sie immer noch so aus, als drängen sie gemeinsam mit uns immer tiefer in das Labyrinth vor.
«Wenn Daemonen einst Halbgötter waren», sage ich, «bedeutet das, einer ihrer Elternteile ist immer noch eine Gottheit.» Als er nicht antwortet, füge ich in der Hoffnung, wenigstens einen kleinen Hinweis auf seine Abstammung zu erhalten, hinzu: «Und Eltern lieben ihre Kinder, manchmal zu sehr.»
Ich kann mich nicht an irgendwelche Götter erinnern, daher weiß ich nicht wirklich, ob sie dieselben Gefühle haben wie sterbliche Eltern. Wobei ich mich genauso wenig daran erinnere, selbst Eltern zu haben.
Gibt es dort draußen noch eine Gottheit, die dich liebt? Dieser Gedanke versetzt mir einen seltsamen Stich – Mitleid für den Daemon, der einen unaussprechlichen Handel eingegangen ist und seine göttliche Seele gebunden hat, um so zu werden. Ich finde dieses Gefühl beinahe genauso unangenehm, wie wenn er es mir gegenüber zeigt. Wenn es solch eine fehlgeleitete Gottheit gibt, wer ist sie?, frage ich mich.
Bald schon gelangen wir zu einer weiteren Kreuzung in den Hecken. Diesmal gehen sechs Wege von ihr ab, die Pfade verteilen sich sternförmig um uns herum, doch Daesra geht ohne Zögern weiter geradeaus und sieht mich nur mit gehobener Braue an, um sicherzugehen, dass ich ihm folge.
Arroganter Mistkerl.
«Es gibt noch eine weitere Möglichkeit», sagt Daesra, während er vorwärtsläuft. «Dass Liebe nichts mit dem Monster an diesem Ort zu tun hat.»
«Wobei du das selbst in den Raum geworfen hast», murmle ich seinem Rücken zu.
«Vielleicht benutzt jemand dieses Wesen, macht sich seine Macht zu eigen», sagt er und ignoriert meine Worte, während er die Arme den Hecken um uns herum entgegenstreckt. «Dieses Labyrinth ist wie ein endloses Gewirr von Seilen, das die Bestie im Inneren fesselt – eine Bindung, die sie gefangen hält.»
Ein ähnlicher Gedanke ist mir schon selbst gekommen, daher ist es keine allzu seltsame Überlegung. «Und wir müssen es entwirren.»
Er nickt, als wäre das offensichtlich.
So arrogant er auch sein mag, erweist er sich in mancher Hinsicht leider als kundig. Wieder führt uns der Weg geradeaus tiefer ins Labyrinth hinein, keine Sackgassen in Sicht.
«Aber wenn wir hier die Knoten einer Bindung lösen, wie du behauptest», sage ich und zeige auf den steinernen Weg, «laufen wir dann nicht Gefahr, das Monster zu befreien?»
«Deshalb müssen wir es auch töten.»
Mir schwirrt der Kopf, und mein Verstand greift nach Fäden, als wollte er mich selbst fesseln. «Also gibt es da draußen eine Person, die dieses Wesen gefangen hat, weil sie es entweder aus Liebe oder mangelnder Stärke nicht töten konnte oder weil sie sich seine Macht zunutze macht, und wir sollen uns dem Willen dieser Person nun entgegenstellen.» Ich schweige nur für wenige klappernde Schritte von Daesras Hufen, während wir beide uns zwischen den Statuen hindurchschlängeln. Ich komme mit dem gleichzeitigen Gehen und Reden und den verstohlenen Blicken weit weniger gut zurecht als er. «Und wer hetzt uns gegen sie auf? Wessen Auftrag führen wir aus? Denn wenn er nicht vom», ich blicke mich um, «offenbar göttlichen Schöpfer dieses Labyrinths kommt, dann kommt er von jemand anderem. Von jemandem, der mich dazu benutzt, etwas zu töten, das jemand mit großer Macht nicht töten konnte oder wollte. Jemandem, den ich so sehr bedrängt oder genervt habe, wie du behauptest, dass er mir diese Aufgabe auferlegt hat. Eine Aufgabe mit hohem Risiko und einer großen Belohnung.»
Daesra zuckt mit den Schultern. «Vielleicht will dieser Jemand, dass du dir die Hände schmutzig machst, damit seine sauber bleiben. Was bedeutet, dass der Schöpfer des Labyrinths und der Aufgabensteller auch dieselbe Person sein könnten. Wer weiß das schon?»
Du, knurre ich innerlich. Oder zumindest glaube ich das, aber er gibt mir Informationen erst, wenn er will, dass ich sie habe. Und das könnte auch niemals sein.
«Auf jeden Fall tätest du gut daran, dich vor dem Schöpfer dieses Ortes zu hüten», fügt er hinzu und bleibt vor einem Rahmen aus hellem Stein in der Hecke stehen.
Es ist kein Teil einer Skulptur, stelle ich fest, als ich mich ihm zuwende, sondern ein Fenster. Ich sehe vielleicht ein weiteres Dutzend dieser Rahmen, gleichmäßig in der lebenden Wand verteilt erstrecken sie sich vor uns zwischen den wandernden Statuen, die jetzt in verzweifelteren Posen erstarrt sind.
Jenseits des Fensterrahmens ist nichts… wenn nichts ein Ozean wäre. Ein alles verschlingendes Nichts. Ich blicke auf einen Strandstreifen, der unter einem sternenlosen Himmel in endloses, aufgewühltes graues Wasser übergeht, dessen tosende Wellen unerbittlich und vernichtend an dem hoffnungslosen Sand zu nagen scheinen, gegen den sie schlagen. Ich sehe die blassen Gerippe von Schiffen aus der fernen Tiefe auftauchen, Ruinen einer verlorenen Zivilisation. Die Szene raubt mir den Atem und gleichzeitig die Lebenskraft, so eindrucksvoll und tot ist sie.
Ich habe das Labyrinth gerade erst von oben gesehen. Es gab kein Meer, nur Gänge, die sich bis zum Horizont erstrecken und winden. Jener Anblick war schon nahezu unfassbar, aber dieser hier ist es erst recht, und er ist weit mehr als beunruhigend. Es ist wie ein Fenster zu einer völlig anderen Welt, nur dass ich hindurchgreifen und sie anfassen kann.
Eine schrecklich tote Welt.





























