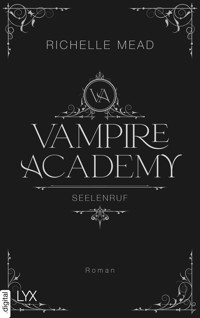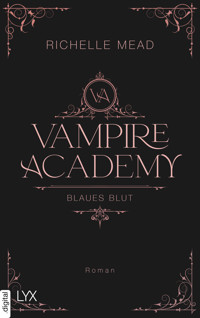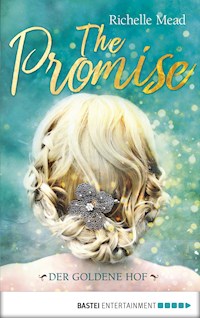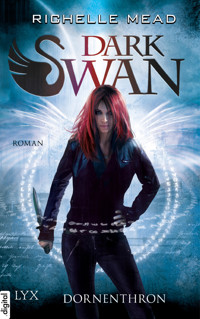
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Dark-Swan-Reihe
- Sprache: Deutsch
Die Schamanin Eugenie Markham muss sich erst noch an ihre neue Rolle als Königin des Dornenlandes gewöhnen. Und auch ihre Gefühlswelt gerät durcheinander, da ihr Geliebter Kiyo neuerdings viel Zeit mit seiner schwangeren Ex-Freundin verbringt. Da verschwinden plötzlich junge Mädchen aus der Anderswelt, und Eugenie muss der Sache auf den Grund gehen. Diesmal hat sie es jedoch mit einem äußerst perfiden Gegner zu tun, der es noch dazu auf sie persönlich abgesehen zu haben scheint. Eine gefahrvolle Reise liegt vor ihr, die sie tief in die Anderswelt führt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 568
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
TITEL
WIDMUNG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
IMPRESSUM
Richelle Mead
Roman
Ins Deutsche übertragenvon Frank Böhmert
Für Jen und Chad,die ein gutes Monster zu schätzen wissen.
KAPITEL 1
Traurige Tatsache: Zahlreiche Jugendliche wissen, wie man mit Messern und Schusswaffen umgeht.
Ich damals auch, aber anstatt kriminell zu werden, hatte ich mich zu einer Schamanin fürs Grobe ausbilden lassen. Während meine Freundinnen in der Disco und beim Football waren, hatte ich zusammen mit meinem Stiefvater Geister verbannt und Monster bezwungen. Das Gute daran war, dass ich nie Angst vor Straßenräubern oder sonstigen Angreifern haben musste. Das Blöde, dass es einem ganz schön die soziale Entwicklung versaut, so aufzuwachsen.
Ich war einfach nie wie die anderen. Ich hatte zwar ein paar Freundinnen, aber verglichen mit ihrer Welt war meine grausig hart und grausig tödlich. Ihre Dramen und Sorgen waren mir immer total belanglos vorgekommen, und ich hatte nie eine richtige Verbindung zu ihnen herstellen können. Jetzt, als Erwachsene, ging mir das mit Jugendlichen immer noch so, weil ich einfach keine vergleichbaren Erfahrungen hatte, auf die ich hätte zurückgreifen können.
Was meinen heutigen Auftrag umso schwieriger machte.
»Na komm, Polly«, säuselte die Mutter des Mädchens und lächelte mit mehr als vollen Lippen. Zu viel Collagen vermutlich. »Erzähl ihr von dem Gespenst.«
Polly Hall war dreizehn, trug aber genug Make-up, um mit einer vierzigjährigen Nutte mithalten zu können. Sie lümmelte auf einer Couch im perfekt eingerichteten Haus ihrer Eltern, kaute geräuschvoll Kaugummi und sah überall hin, nur nicht zu uns. Je länger ich sie mir ansah, desto mehr stand für mich fest, dass sie Probleme hatte. Probleme, die wahrscheinlich weniger mit übernatürlichen Einflüssen zu tun hatten als vielmehr damit, eine Mutter zu haben, die ihr den Namen Polly gegeben hatte und ihr erlaubte, Tangaslips zu tragen. Der hüftbetonte Schnitt von Pollys Jeans hatte die unangenehme Nebenwirkung, dass ich besagten Tangaslip sehen konnte.
Nach einer Minute des Schweigens seufzte Mrs Hall laut. »Polly, Schatz, das haben wir doch besprochen. Wenn du uns nicht hilfst, können wir dir auch nicht helfen.«
Lächelnd ging ich vor der Couch in die Hocke, um dem Mädchen in die Augen sehen zu können. »Das ist in Ordnung«, sagte ich in der Hoffnung, dass ich mich ehrlich und verlässlich anhörte und nicht nach Frühstücksfernsehen. »Egal, was du mir erzählst, ich werde dir glauben. Wir finden eine Lösung dafür.«
Polly seufzte genauso laut wie ihre Mutter eben und wollte mich immer noch nicht ansehen. Sie erinnerte mich an meine labile Halbschwester im Teenageralter, die zurzeit spurlos verschwunden war und vorhatte, die Welt zu erobern. »Mom«, sagte sie, »kann ich jetzt in mein Zimmer?«
»Erst wenn du mit dieser netten Dame gesprochen hast.« Mrs Hall sah wieder zu mir und erklärte: »Wir hören nachts ständig komische Geräusche: Scheppern, Knallen, dumpfe Schläge. Sachen fallen ohne Grund um. Ich habe sogar …« Sie zögerte. »Ich habe sogar irgendetwas im Zimmer herumfliegen sehen. Aber immer nur, wenn Polly da ist. Was immer das für ein Gespenst ist, es scheint sie zu mögen … oder von ihr besessen zu sein.«
Ich wandte meine Aufmerksamkeit wieder Polly zu, ihrer schlechten Laune und kaum verborgenen Verdrossenheit. »Beschäftigt dich etwas, Polly?«, fragte ich sanft. »Probleme in der Schule oder so? Probleme hier?«
Ihre blauen Augen huschten superkurz zu mir.
»Wie sieht es mit der Elektrik aus?« Das richtete ich an ihre Mutter. »Gibt es Kurzschlüsse? Stereoanlagen oder Haushaltsgeräte, die nicht richtig funktionieren?«
Mrs Hall blinzelte. »Woher wissen Sie das?«
Ich stand auf und bog meinen Körper wieder zurecht. Ich hatte in der vergangenen Nacht mit einem Geist gekämpft, und der war nicht sanft gewesen.
»Sie haben kein Gespenst. Sie haben einen Poltergeist.«
Die beiden starrten mich an.
»Ist das denn kein Gespenst?«, fragte Mrs Hall.
»Kein richtiges. Es handelt sich um eine Manifestation telekinetischer Kräfte, die oft durch Wut oder andere starke Emotionen während der Teenagerjahre hervorgebracht wird.« Da hatte ich den Frühstücksfernsehen-Tonfall vermieden, nur um jetzt in den Tonfall von Werbedokus zu verfallen.
»Ich … Moment mal. Wollen Sie damit sagen, dass Polly das verursacht?«
»Ja, wenn auch nicht mit Absicht. In Fällen wie diesem schlägt die Person – Polly – um sich, ohne es selbst zu merken, und reagiert so ihre Gefühle ab. Sie wird ihre telekinetischen Kräfte wieder verlieren. Sie lassen nach, wenn sie älter wird und ein bisschen zur Ruhe kommt.«
Ihre Mutter war immer noch skeptisch. »Es sieht definitiv wie ein Gespenst aus.«
Ich zuckte mit den Achseln. »Sie können mir glauben. Ist nichts Neues für mich.«
»Und … können Sie denn irgendetwas dagegen tun? Können wir etwas tun?«
»Eine Psychotherapie«, schlug ich vor. »Vielleicht kommen Sie mit einer Therapeutin da heraus.«
Ich gab Mrs Hall die Kontaktdaten einer Psychologin, die ich als fähig einschätzte. Was mein Honorar betraf, so berechnete ich ihr nur den Hausbesuch. Nachdem ich das Bargeld noch einmal durchgezählt hatte – Schecks nahm ich nie –, steckte ich es weg und ging zur Wohnzimmertür.
»Tut mir leid, dass ich Ihnen keine größere Hilfe war.«
»Nein, ich meine, das hat uns wohl schon geholfen. Es ist nur so merkwürdig.« Sie starrte ihre Tochter perplex an. »Sind Sie sicher, dass es kein Gespenst ist?«
»Definitiv. Das hier sind die klassischen Symp…«
Eine unsichtbare Kraft rammte mich und warf mich gegen die Wand. Ich schrie auf, stützte mich mit einer Hand ab und funkelte dieses kleine Miststück Polly böse an. Sie sah mich aus großen Augen an und schien genauso überrascht wie ich.
»Polly!«, rief Mrs Hall. »Das war’s, junge Frau. Kein Telefonieren, kein Chatten, kein …« Ihr fiel die Kinnlade herunter, und sie starrte auf etwas am anderen Ende des Raums. »Was ist das?«
Ich folgte ihrem Blick zu dem großen hellblauen Umriss, der vor uns materialisierte.
»Tja, ähm«, sagte ich, »ein Gespenst.«
Es schoss mit einem scheußlichen Kreischen auf mich zu. Ich brüllte den beiden zu, in Deckung zu gehen, und riss eine Athame mit Silberklinge aus meinem Gürtel. Man könnte meinen, dass ein solcher Ritualdolch gegen Geistwesen nichts bringt, aber sie müssen feste Gestalt annehmen, wenn sie ernsthaften Schaden anrichten wollen. Und dann sind sie auch anfällig gegen Silber.
Bei diesem Gespenst handelte es sich um eine Frau – um ein Mädchen eher. Lange blonde Haare flossen hinter ihr wie ein Umhang, und ihre Augen waren groß und leer. Ob es an mangelnder Erfahrung lag oder einfach an ihrer Art – ihr Angriff erwies sich als angestrengt und unkoordiniert. Noch während sie meine Athame zu schmecken bekam und aufschrie, hatte ich mit der anderen Hand meinen edelsteingespickten Zauberstab gezogen.
Jetzt, wo das Überraschungsmoment vorbei war, konnte ich eine solche Verbannung im Schlaf. Ich sprach die übliche Formel, zapfte meine innere Stärke an und sandte meinen Geist über die Grenzen dieser Welt hinaus. Ich berührte die Tore der Unterwelt, schnappte mir das Gespenstermädchen und schickte es hinüber. Monster und Feine schickte ich meistens zurück in die Anderswelt, das Zwischenreich, in dem sie zu Hause waren. Ein Geistwesen musste noch weiter, ins Totenreich. Sie verschwand.
Mrs Hall und Polly starrten mich an. Doch auf einmal sprang das Mädchen auf – ihre erste Gefühlsregung – und blitzte mich wutentbrannt an.
»Sie haben gerade meine beste Freundin umgebracht!«
Ich öffnete den Mund und machte ihn wieder zu. Nichts, das ich hätte sagen können, wäre angemessen gewesen.
»Um Himmels willen, was redest du da?«, rief ihre Mutter.
Pollys Gesicht war wutverzerrt, ihre Augen glänzten von Tränen. »Trixie. Sie war meine beste Freundin. Wir haben uns alles erzählt.«
»Trixie?«, fragten Mrs Hall und ich unisono.
»Ich fasse es nicht, dass Sie das gemacht haben. Sie war voll cool.« Traurigkeit schlich sich in ihre Stimme. »Ich wäre so gern mal mit ihr shoppen gegangen, aber sie konnte das Haus nicht verlassen. Darum hab ich ihr immer die Vogue und die Glamour mitgebracht.«
Ich drehte mich zu Mrs Hall um. »Mein Rat von vorhin gilt immer noch. Therapie. Und nicht zu knapp.«
Dann machte ich mich auf den Heimweg und fragte mich zum hundertsten Mal, warum ich mir den Beruf einer Schamanin ausgesucht hatte. Es gab doch bestimmt auch weniger stressige Branchen, in denen man sich nicht mit finsteren übernatürlichen Wesen herumschlagen musste. Buchhaltung. Werbung. Verbrechensbekämpfung. Na ja, Letzteres vielleicht nicht.
Ungefähr eine Stunde später war ich zu Hause und wurde gleich hinter der Tür von zwei mittelgroßen Hunden angefallen. Es waren Straßenköter, der eine völlig schwarz und der andere völlig weiß. Sie hießen Yin und Yang, aber ich konnte mir nie merken, welcher wer war.
»Aus!«, befahl ich, während sie mich beschnupperten und wild mit dem Schwanz wedelten. Der weiße versuchte, mir die Hand abzulecken. Ich drängte mich an ihnen vorbei in die Küche und stolperte beinahe über eine getigerte Katze, die platt in einem Flecken Sonne lag. Fluchend warf ich meinen Rucksack auf den Küchentisch. »Tim? Bist du da?«
Mein Mitbewohner, Tim Warkoski, steckte den Kopf in die Küche. Er trug ein T-Shirt, auf dem vor einem Schattenriss von amerikanischen Ureinwohnern stand: Heimatschutz – seit 1492 im Kampf gegen den Terrorismus. Ganz schön feinsinnig, aber die Wirkung ging ein bisschen verloren, weil Tim in Wirklichkeit gar kein Indianer war. Er spielte bloß manchmal einen im Fernsehen beziehungsweise in hiesigen Kneipen und Touristenkreisen und nutzte seine gebräunte Haut und die schwarzen Haare dazu, seine polnische Abstammung hinter sich zu lassen. Das hatte ihm einigen Ärger mit den Stämmen hier in der Gegend eingebrockt.
Eine Mülltüte in der einen Hand und eine kleine Schaufel in der anderen, bedachte er mich mit einem finsteren Blick. »Weißt du eigentlich, wie viele beschissene Katzenklos ich heute saubermachen musste?«
Ich goss mir ein Glas Milch ein und setzte mich an den Tisch. »Kiyo meint, wir brauchen eines für jede Katze und dann noch eins zusätzlich.«
»Ja klar, zählen kann ich, Eugenie. Das macht sechs Klos. Sechs Klos auf hundertfünfzig Quadratmetern Wohnfläche. Denkst du, dein fauler Freund taucht irgendwann noch mal auf und hilft uns dabei?«
Ich rutschte unbehaglich herum. Das war eine gute Frage. Nachdem wir uns drei Monate lang entweder in Tucson oder in Phoenix getroffen hatten, hatte mein Freund Kiyo beschlossen, sich die anderthalb Stunden Pendeln zu ersparen und hier eine Stelle anzunehmen. Wir hatten ein langes Gespräch darüber gehabt und waren zu dem Schluss gekommen, dass wir weit genug waren, dass er einfach bei mir einziehen konnte. Unglücklicherweise war mit Kiyo auch seine Menagerie eingezogen: fünf Katzen und zwei Hunde. Das war eine der Kehrseiten, wenn man mit einem Tierarzt zusammen war. Er musste jedes Tier bei sich aufnehmen, das ihm über den Weg lief. Welche Katze wie hieß, konnte ich mir ebenso wenig merken wie bei den Hunden. Vier waren nach den Reitern der Apokalypse benannt, und das Einzige, was ich noch wusste, war, dass Hunger ironischerweise um die fünfzehn Kilo wog.
Zu allem Überfluss war Kiyo auch noch ein Fuchs – sowohl bildlich gesprochen als auch wortwörtlich. Seine Mutter war ein Kitsune, ein japanischer Fuchsgeist. Er hatte ihre sämtlichen Eigenschaften geerbt, darunter eine unglaubliche Stärke und Schnelligkeit sowie die Fähigkeit, sich in einen richtigen Fuchs zu verwandeln. Was zur Folge hatte, dass er regelmäßig den »Ruf der Natur« verspürte und sich danach sehnte, in seiner tierischen Gestalt herumzustrolchen. Da er gerade zwischen zwei Jobs war, hatte er sich allein zu einer Art Fahrt ins Blaue aufgemacht. Ich akzeptierte es, aber nach einer Woche ohne ihn wurde ich langsam unruhig.
»Er kommt bald zurück«, sagte ich vage, ohne Tim anzusehen. »Abgesehen davon brauchst du ja keinen Haushalt mehr zu machen, wenn du stattdessen lieber Miete zahlen willst.« So lautete unsere Abmachung. Freies Wohnen gegen Putzen und Kochen.
Er ließ sich nicht einschüchtern. »Deine Kriterien in Sachen Männer sind fragwürdig. Das ist dir hoffentlich klar.«
Darüber machte ich mir eigentlich lieber keine Gedanken. Ich ließ ihn stehen und ging in mein Zimmer, wo ich Trost bei einem Puzzle mit einer Fotografie von Zürich suchte. Es lag auf meinem Tisch, genau wie eine der Katzen. Ich glaube, es war Schnurrli, der nichtapokalyptische Kater. Ich scheuchte ihn von dem Puzzle runter. Er nahm die Hälfte der Teile mit.
»Scheißvieh!«, fluchte ich.
Liebe, entschied ich, war hart. Sicher, ich war schlecht drauf, aber zum Teil beruhten meine Sorgen in Sachen Kiyo auch auf der Tatsache, dass er seine Auszeit in der Anderswelt unter anderem mit seiner Ex-Freundin verbrachte, die zufälligerweise eine umwerfend schöne Feenkönigin war. Feen, Elfen, Glanzvolle – Wie immer man sie nennen wollte, sie waren die hochgewachsenen, langlebigen Herrscher der Anderswelt. Die meisten Schamanen bezeichneten sie wie ich als Feine, ein Wort aus der mittelalterlichen Dichtung. Maiwenn, Kiyos Ex, war im neunten Monat schwanger, und obwohl sie nicht mehr zusammen waren, hatte er immer noch an ihrem Leben teil.
Ich seufzte. Vielleicht hatte Tim ja recht, was meinen fragwürdigen Geschmack in Sachen Männer betraf.
Der Abend verging. Ich vervollständigte das Puzzle bei Def Leppard auf voller Lautstärke und kam langsam wieder besser drauf. Ich machte die Musik gerade aus, als Tim rief: »Hey, Eug! Kujo ist da!«
Atemlos lief ich zur Tür meines Zimmers und riss sie auf. Ein Rotfuchs von der Größe eines Wolfes trottete den Flur herunter auf mich zu. Erleichterung durchströmte mich, und ich spürte, wie mir die Brust weit wurde, als ich ihn reinließ und zusah, wie er rastlos seine Kreise drehte.
»Wird aber auch Zeit«, sagte ich.
Er hatte ein geschmeidiges orangerotes Fell und einen flauschigen Schwanz mit einer weißen Spitze. Seine Augen waren gelb und zeigten manchmal ein sehr menschliches Funkeln. Heute Abend war nichts dergleichen zu sehen. Eine absolut tierische Wachsamkeit lag in ihnen, und mir wurde klar, dass es eine Weile dauern würde, bis er sich wieder zurückverwandelte. Er besaß die Fähigkeit, sich in alle möglichen Füchse zu verwandeln, von einem kleinen, normal großen Rotfuchs bis hin zu der kraftvollen Gestalt vor mir. Wenn er eine Zeit lang in dieser großen Form verbracht hatte, brauchte es mehr Zeit und Mühe, sich wieder in einen Menschen zu verwandeln.
Weil ich trotzdem hoffte, dass er sich bald verwandeln würde, schüttete ich ein anderes Puzzle auf meinem Schreibtisch aus und vertrieb mir damit die Wartezeit. Zwei Stunden später hatte sich nichts geändert. Er rollte sich in einer Ecke zusammen, zu einer richtig festen Kugel. Sein Blick ruhte weiter auf mir. Hundemüde gab ich auf und zog ein rotes Nachthemd an. Ich machte das Licht aus, schlüpfte endlich ins Bett und schlief zur Abwechslung mal prompt ein.
Ich träumte von der Anderswelt, genauer gesagt, von einem Teil davon, der frappierende Ähnlichkeit mit Tucson und der umliegenden Sonora-Wüste besaß. Nur dass die Anderswelt-Version besser war. Ein beinahe himmlisches Tucson mit einem Meer von blühenden Kakteen unter einem strahlend blauen Himmel. Diesen Traum kannte ich schon, und oft wachte ich am Morgen voller Sehnsucht nach diesem Land auf. Ich gab mir alle Mühe, den Impuls zu ignorieren.
Ein paar Stunden später wurde ich geweckt. Ein warmer, muskulöser Körper war zu mir ins Bett geschlüpft und presste sich von hinten an mich. Starke Arme legten sich um meine Taille, und Kiyos dunkler, moschusartiger Geruch hüllte mich ein. Bei seiner Berührung verflüssigte sich etwas in mir und wurde heiß. Grob drehte er mich zu sich herum. Seine Lippen verschlangen die meinen in einem heftigen Kuss, der von Intensität und Verlangen brannte.
»Eugenie«, grollte er, als er lange genug innehielt, um seine Lippen von den meinen zurückzuziehen – ein paar Millimeter nur. »Du hast mir gefehlt. Oh Gott, wie du mir gefehlt hast. Ich brauche dich.«
Wieder küsste er mich und verdeutlichte mit seinen fordernden Händen, wie sehr er mich brauchte. Auch ich ließ meine Hände seine nackte Haut entlangwandern, und ihre samtige Vollkommenheit turnte mich an. Heute Nacht gab es keine Zärtlichkeit zwischen uns, nur wilde Leidenschaft, als er sich auf mich rollte und mit einer Bedürftigkeit in mich eindrang, die ebenso sehr von animalischem Instinkt wie von Liebe befeuert wurde. Er hatte zwar seine menschliche Gestalt wiedererlangt, wurde mir klar, aber noch nicht ganz seine menschlichen Sinne.
Als ich am Morgen erwachte, lag ich allein im Bett. Kiyo stieg gerade in seine Jeans und sah zu mir herüber, als besäße er einen sechsten Sinn dafür, dass ich wach war. Ich rollte mich auf die Seite. Die Laken glitten über meine nackte Haut. Ich sah ihn mit träger, befriedigter Schläfrigkeit an, genoss den Anblick seines Körpers und seines attraktiven Gesichts, das er seiner japanischen und spanischen Herkunft verdankte. Sein sonnengebräunter Körper und die schwarzen Haare standen in krassem Kontrast zu der hellen Haut und den rötlichen Haaren, die mir meine nordeuropäischen Vorfahren mitgegeben hatten.
»Gehst du schon wieder?«, fragte ich. Mein Herz, das gestern bei seinem Anblick einen Satz gemacht hatte, krampfte sich zusammen.
»Ich muss.« Er zog sein dunkelgrünes T-Shirt zurecht und fuhr sich unbewusst durch die kinnlangen Haare. »Das weißt du doch.«
»Klar musst du.« Es klang schärfer als beabsichtigt. »Was denn sonst.«
Seine Augen wurden schmal. »Bitte fang jetzt nicht damit an«, sagte er leise. »Ich kann mich doch da nicht rausziehen.«
»Tut mir leid. Ist eben nicht gerade die reine Freude, wenn eine andere Frau ein Kind von dir bekommt.«
Rums, da war es auf dem Tisch. Das Thema, das die ganze Zeit über uns gehangen hatte.
Er setzte sich neben mich auf das Bett, seine dunklen Augen blickten ernst und ruhig. »Na ja, ich freue mich aber. Und ich fände es echt schön, wenn du mich dabei unterstützen und dich mitfreuen könntest.«
Aufgewühlt sah ich weg. »Ich freue mich für dich. Ich möchte, dass du glücklich bist … es ist nur … na ja, es ist hart.«
»Ich weiß.« Er beugte sich über mich, legte mir eine Hand in den Nacken und schlang seine Finger in mein Haar.
»Du hast in der letzten Woche mehr Zeit mit ihr als mit mir verbracht.«
»Das war auch nötig. Es ist bald so weit.«
»Ich weiß«, sagte ich. Mir war klar, dass meine Eifersucht ungerechtfertigt war. Armselig sogar. Ich wollte seine Freude darüber, dass er Vater wurde, gern teilen, aber irgendetwas in mir verhinderte das.
»Eugenie, du bist die Frau, die ich liebe. Das ist alles, was zählt.«
»Sie liebst du auch.«
»Ja, aber nicht auf dieselbe Weise wie dich.«
Er küsste mich mit einer Zärtlichkeit, die ganz anders war als die Wildheit der vergangenen Nacht. Ich ließ mich gegen ihn sinken. Der Kuss wurde drängender, füllte sich mit Leidenschaft. Schließlich entzog sich Kiyo mir, was ihm schwerfiel. Ich konnte das Verlangen in seinen Augen sehen. Er wollte wieder Sex haben. Was wohl etwas über meine weiblichen Reize aussagte.
Sein Verantwortungsgefühl gewann die Oberhand; er straffte die Schultern und stand auf. Ich blieb, wo ich war.
»Sehen wir uns dann drüben?«, fragte er mit ruhiger, neutraler Stimme.
Ich seufzte. »Klar. Ich komme.«
Er lächelte. »Danke. Das bedeutet mir viel.«
Ich nickte.
Er ging zur Tür und sah zu mir zurück. »Ich liebe dich.« Die Hitze in seiner Stimme sagte mir, dass er es ernst meinte. Ich erwiderte sein Lächeln.
»Ich liebe dich auch.«
Dann war er weg. Ich wickelte mich fester in die Laken und machte keine Anstalten aufzustehen. Leider konnte ich nicht den ganzen Tag im Bett bleiben. Heute verlangte anderes meine Aufmerksamkeit – zum Beispiel mein Versprechen gegenüber Kiyo. Eine Reise in die Anderswelt lag vor mir, und sie würde mich in ein Königreich führen, das ich geerbt hatte, ohne es zu wollen. Maiwenn war nämlich nicht die einzige Königin der Anderswelt in Kiyos Leben.
Aber erstaunlicherweise hatte ich heute mit meiner dortigen Rolle weniger ein Problem. Die war leicht im Vergleich zu dem, was mir sonst noch bevorstand.
Ich war zu einer Babyparty der Feinen eingeladen.
KAPITEL 2
In die Anderswelt überzuwechseln fällt mir leichter als den meisten anderen Menschen, erfordert aber dennoch ein bisschen Arbeit. Als ich alles Nötige eingepackt hatte, fuhr ich zum Saguaro-Nationalpark hinaus und wanderte zu einer abgelegenen Stelle. Dort kreuzten sich zwei kaum sichtbare Trampelpfade – solche Kreuzwege deuten oft auf ein Tor in die Anderswelt hin. Die Welten der Feinen und der Menschen liegen dicht beieinander, und an bestimmten Stellen ist die Trennwand zwischen ihnen besonders dünn. Natürlich reichte selbst eine solche durchlässige Stelle für manche Leute nicht aus, um die Reise im eigenen Körper anzutreten. Sie schafften es gerade mal, als Geist- oder Elementarwesen überzuwechseln. Und ich? Ich besaß das Blut von Menschen und von Feinen. Darum konnte ich problemlos beide Welten bereisen – wobei mir meine Feinen-Herkunft immer noch zusetzte. Ich hatte erst vor Kurzem davon erfahren und mich noch kaum daran gewöhnt.
Als ich am Kreuzweg stand, schloss ich die Augen und ging in eine Trance, die sehr derjenigen ähnelte, mit deren Hilfe ich gestern das Gespenst verbannt hatte. Um meinen einen Arm wand sich das Tattoo einer grünen Schlange, ein Tribut an die Göttin Hekate, die über solche Wegkreuzungen und Tore zwischen den Welten ihre schützende Hand hält. Ich rief sie an und erhielt Kraft von ihr, dehnte meinen Körper über unsere Welt hinaus. Einen Moment später stand ich in der Anderswelt. In einem Schloss. Meinem Schloss.
Nebenwirkungen merkte ich keine; inzwischen setzten mir solche Übergänge kaum noch zu. Ich befand mich in einem kleinen, spärlich möblierten Wohnzimmer. Genau in der Mitte stand ein Briefbeschwerer aus Kunstharz, ein weißes Kaninchen inmitten eines Fleckens blauer Blümchen. Ein albernes Teil, nur war dieses Kaninchen von meiner Essenz durchdrungen und sorgte dafür, dass mein Körper hier landete und nicht an irgendeiner willkürlichen Stelle.
Draußen im Flur waren Schritte auf den Steinfliesen zu hören. Eine junge Frau mit strahlend blauen Augen und langen blonden Haaren sah ins Zimmer. Auf ihrem Gesicht breitete sich ein breites Grinsen aus.
»Eure Majestät«, hauchte sie entzückt. Dann wandte sie sich um und rief den Flur hinab: »Die Königin! Die Königin ist hier!«
Ich verzog das Gesicht. Menno, musste das sein? Wenigstens den ganzen Wirbel hätten sie mir doch ersparen können.
Kaum hatte Nia ihre große Verkündigung gemacht, da kam sie angesaust und drückte mir die Hand. Sie gehörte zu meiner Dienerschaft. Jemanden wie sie nannte man wohl Kammerdienerin, da sie vor allem für mein Erscheinungsbild verantwortlich war. »Alles ist bereit für die Reise ins Weidenland«, erklärte sie. »Ich habe ein todschickes Kleid für Euch bereitgelegt.«
Ich schüttelte den Kopf und griff in den Rucksack, den ich praktisch ständig mit mir herumschleppte. Die Feinen standen in Modedingen auf schwere Brokatstoffe und ähnlichen Schnickschnack. So etwas konnte ich heute gar nicht gebrauchen. »Ich habe selbst eins mitgebracht.«
Sie starrte das Kleid an, das ich hervorzog, und sah mich mit hochgezogenen Brauen an. »Ihr erlaubt Euch einen Scherz mit mir, Majestät, nicht wahr?« Diese blauen Augen bettelten. »Nicht wahr?«
Eine Auseinandersetzung blieb mir erspart, weil wir nicht länger allein waren. Mit einem leidvollen Blick auf mein Kleid zog sich Nia zurück, damit meine Führungskräfte mit mir reden konnten. Ja, richtig. Meine Führungskräfte, bestehend aus Feinen. Drei Monate reichten nicht aus, sich an so etwas zu gewöhnen.
Eine hochgewachsene, bildschöne Frau mit glänzenden schwarzen Zöpfen war ins Zimmer getreten. Ihre Bewegungen waren athletisch und elegant zugleich. Sie hieß Shaya und war mein wichtigster Rückhalt hier. Als meine Regentin kümmerte sie sich um die ganze Drecksarbeit, mit der ich nichts zu tun haben wollte. Worüber ich heilfroh war.
Rurik begleitete sie, der Hauptmann meiner Wache. Wachleute zu haben war auch etwas, an das man sich erstmal gewöhnen musste – zumal sie ständig in meiner Nähe bleiben wollten. Rurik und ich hatten einen schlechten Start gehabt, was vielleicht auf seinen Vergewaltigungsversuch bei unserer ersten Begegnung zurückzuführen war. Der hellblonde Hüne hatte sich als fähiger Gefolgsmann erwiesen; allerdings ertappte ich ihn des Öfteren dabei, wie er mit Frauen rummachte, die ebenfalls hier arbeiteten. Ich hatte ihn mit sehr freundlicher Stimme wissen lassen, dass ich ihm den Arsch aufreißen würde, wenn ich je feststellen sollte, dass diese Frauen nicht mit seinen Avancen einverstanden gewesen waren.
Außer Shaya und Rurik kamen noch einige Würdenträger hereingeschneit, die zum Inventar des Schlosses gehörten, das ich durch meinen Sieg über dessen früheren Hausherrn gewonnen hatte. Ich konnte mich vielleicht noch an die Hälfte der Namen erinnern.
»Schön, dass Ihr wieder da seid«, sagte Shaya und lächelte. Kein Vergleich zu Nias Entzücken, aber es war anscheinend ehrlich gemeint.
»Eure Majestät«, tönten die anderen und verneigten sich.
Sie warteten, bis ich mich in einen der Sessel setzte, dann nahmen sie ebenfalls Platz.
»Nia meint, wir sind startklar?« Ich konnte meine Unlust, was die bevorstehende Reise anging, nur schlecht verbergen.
»Ja«, sagte Shaya. »Wir warten nur noch auf Euren Befehl. In ruhigem Tempo sollten wir binnen drei Stunden dort sein.«
Ich ächzte. »Drei Stunden. Ist euch eigentlich klar, was für ein Wahnsinn das ist? Ich könnte von meiner Welt aus in der halben Zeit dort sein, einfach indem ich mit dem Auto zu einem Tor fahre, von dem aus ich dichter dran rauskomme.«
Sie setzte eine nachsichtige Miene auf, weil sie dieses Argument schon kannte. »Ihr könnt bei Königin Maiwenn nicht ohne Euer Gefolge auftauchen.«
Rurik, der sich lässig in einem Sessel ausstreckte, bedachte mich mit einem Grinsen. »Gehört sich so für Majestäten, Eure Majestät.«
Ich rieb mir die Augen. »Na schön. Wie auch immer. Irgendetwas Neues von Jasmine?«
Sein Lächeln erstarb. »Nein. Wir lassen immer noch Suchtrupps die Königreiche durchstreifen, aber sie haben nichts gefunden.«
»Unglaublich. Ihr Leute könnt Bäume zum Leben erwecken und Felsen schweben lassen, aber den Schmollwinkel eines Teenagermädchens könnt ihr nicht ausfindig machen.«
»Wir finden Eure Schwester schon noch«, sagte Rurik grimmig. Ich glaube, er betrachtete diese Mission als eine Angelegenheit des persönlichen Stolzes. »Es braucht vielleicht eine Weile, aber dann haben wir sie.«
Ich nickte. Was hätte ich auch sonst tun sollen? Das Warten regte mich auf. Jede Minute, die verstrich, gab Jasmine, die gerade mal fünfzehn war, eine Möglichkeit mehr, schwanger zu werden und einem Thronerben das Leben zu schenken, der einer Prophezeiung zufolge die Menschenwelt erobern würde. Diese Prophezeiung galt auch für mich; bloß war ich klug genug, Verhütungsmittel zu benutzen.
»Und sonst? Wie läuft es so?«
Shaya setzte eine neutrale Miene auf. »Wir kommen zurecht, Eure Majestät.«
Ihr Tonfall war ebenso neutral wie ihr Gesicht, aber den anderen war ihr Missfallen deutlich anzusehen. Es gefiel ihnen nicht, dass ich meine Pflichten hier so vernachlässigte. Das galt vermutlich auch für Shaya; bloß schaffte sie es trotzdem, mich mit den Alltagsgeschäften des Dornenlands in Ruhe zu lassen. Sie wusste, dass ich nichts davon hören wollte, selbst wenn ich fragte. Also erzählte sie mir auch nichts.
Mir fiel auf, wie extrem drückend es hier drin war. Allen lief nur so der Schweiß herunter.
»Himmel, ist das heiß«, sagte ich.
Sie starrten mich an, und ich kam mir prompt blöd vor. Was hatte ich erwartet? Nach meiner Eroberung des Königreichs hatte es sich nach meinem Willen neu geformt, sich in meine Idealvorstellung verwandelt: die Sonora-Wüste. Das Schloss hatte sich nicht verändert, sondern bestand nach wie vor aus dicken Steinmauern. Schwarzen Steinmauern, die bestens Wärme speicherten und wenig Durchzug gestatteten. Ein Bauwerk, wie es besser in kalte, neblige Moorlandschaften passte.
Unter Aeson, seinem letzten Herrscher, war das Land grüner und kühler gewesen. Aeson und ich hatten ganz schön Stress miteinander gehabt, weil er unbedingt Jasmine schwängern wollte und es kurzzeitig auch auf mich abgesehen hatte, in der Hoffnung, damit der Vater dieses welterobernden Prinzen zu werden. Hinzu kam, dass er ein totales Arschloch gewesen war. Ich hatte ihn im Kampf getötet, und wenn ein Herrscher starb, suchte sich das Land jemand anderen mit Zaubermacht. Dieser Jemand war ich. Ich hatte, ohne es zu wissen, Anspruch auf das Land erhoben und so dafür gesorgt, dass es zu einem Spiegelbild von Tucson geworden war.
Erst jetzt wurde mir klar, wie schrecklich es sein musste, hier zu leben. Die Feinen verfügten nicht über die Technik der wirklichen Welt. Keine Klimaanlagen. Keine Ventilatoren. Die Leute hier gingen ein vor Hitze, zumal sie ein völlig anderes Klima gewohnt waren.
Weil sie mir leidtaten, griff ich mit meinem Geist nach der Luft aus, die mich umgab. Einen Moment lang war da nichts, dann nahm ich Feuchtigkeitspartikel wahr. Viele waren es nicht, aber sie waren vorhanden. Ich dehnte meinen Geist über die Grenzen des Zimmers aus und zog mehr Feuchtigkeit herein, womit ich die benachbarten Säle und Flure zweifellos in Backöfen verwandelte. Hier drinnen jedoch fiel die Temperatur, und die Luft roch frisch. Wie so oft, wenn ich die magischen Kräfte anzapfte, die ich von meinem Vater geerbt hatte, überlief mich ein Schauer der Erregung.
Vorsichtig versuchte ich, auch die Luft selbst in Bewegung zu versetzen und eine Brise zu erzeugen. Nichts. Ich hatte es erst ein einziges Mal geschafft und bisher nicht wiederholen können.
Als Shaya merkte, was ich getan hatte, bedachte sie mich mit einem schiefen Grinsen. »Vielen Dank, Eure Majestät.«
Ich lächelte zurück und stand auf. Alle anderen sprangen ebenfalls auf, aber ich bedeutete ihnen, sich wieder zu setzen. »Bleibt ruhig hier, wenn ihr möchtet. Die Kühle hält sicher noch ein bisschen an. Ich gehe mal eben und … erledige meine Sache. Dann brechen wir auf.«
Ich trat auf einen der Höfe hinaus, ein in Terrassen angelegtes Gelände, das ich liebte. Er war von Saguaros und blühenden Kaktusfeigen gesäumt. Lila blühende Rauchdorne, die Namenspatronen des Landes, standen Wache und erfüllten die Luft mit süßem Duft; auch einige Mesquiten. Kolibris schossen hin und her wie funkelnde Edelsteine mit Flügeln.
Ich setzte mich auf eine der Treppen zu den oberen Gartenanlagen und schloss die Augen. Dafür musste ich immer zurückkommen. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich nie wieder einen Fuß hierher gesetzt. Aber nachdem das Dornenland sich an mich gebunden hatte, gehörte es mir. Sein Überleben hing von mir ab. Ich durchschaute die Verbindung zwischen uns nicht, aber sie war unzerstörbar. Sie war der Grund, warum ich von diesem Ort träumte. Ich konnte ihm nicht entfliehen.
Die Sonne brannte auf mich herab. Sie erinnert uns seit jeher daran, dass wir am Ende der Natur gehorchen müssen. Ich entspannte mich, und bald rankte das Leben des Landes in mich hinein. Am Anfang erschreckte mich das immer, aber dann kam es mir vor wie das Allernatürlichste der Welt. Das Land war ich, und ich war das Land. Wir waren eins, waren ohneeinander nicht vollständig.
Als ich wieder zu mir kam, musste ungefähr eine Stunde vergangen sein. Ich stand auf und schüttelte die Trance ab. Damit wurde die Verbindung zum Land durchtrennt, aber es war natürlich immer noch bei mir. Die erneuerte Vereinigung hatte es gestärkt. Ich war meiner Pflicht nachgekommen.
Wenig später brachen wir auf. Da ich nun mal öfter hier sein würde, hatte ich zugesehen, dass eine anständige Reiterin aus mir wurde. Es gab hier weder Autos noch Flugzeuge.
Shaya, Rurik und Nia begleiteten mich, außerdem ein rundes Dutzend Wachen. Die Wachen ritten stoisch dahin, mit uns in ihrer Mitte, und behielten die Landschaft im Auge. Rurik bellte ab und zu einen Befehl, ansonsten witzelte er mit Shaya herum oder flirtete mit Nia. Ich hatte beiläufiges Geplauder nicht so drauf und hörte meistens nur zu, wobei ich die drei unterhaltsamer fand, als ich zugegeben hätte.
Es war später Vormittag, und die Sonne kannte keine Gnade. Ich war mit Shorts und Sonnenbrille noch am besten dran. Die anderen Frauen trugen wenigstens leichte Kleider, aber die Männer in ihrer kompletten Lederrüstung litten sichtlich. Niemand verlor ein Wort darüber, nicht einmal Rurik, aber ihnen lief der Schweiß nur so die Gesichter herunter.
Da war es schon eine Erleichterung, als wir das erste Mal das Land wechselten. Eine Besonderheit der Anderswelt ist es, dass sie sich in sich selbst zurückfaltet. Was auf Reisen sehr desorientierend ist. Man kann sich schnurgerade von meinem eigenen Reich wegbewegen und trotzdem durch sämtliche anderen Reiche kommen, sogar wieder durch meines, ohne vom Kurs abgekommen zu sein.
Wir gelangten ins Eichenland, und auf einmal war es so, als hätte es das Dornenland nie gegeben. Man konnte es nicht einmal mehr sehen hinter uns. Einer der sonst so grimmigen Wachsoldaten ließ sich gehen und brach in ein leises Jubeln aus, das alle zum Lachen brachte. Eine kühle, fast schon kalte Brise strich über uns hinweg. Hier war Spätherbst, und die Bäume loderten bunt. Es war herrlich hier und wesentlich angenehmer, aber ich hoffte insgeheim, dass wir bald wieder weg waren. Mit dem Eichenland waren zu viele verstörende Erinnerungen verbunden.
Bald wechselten wir tatsächlich wieder ins Dornenland über, und die gnadenlose Hitze traf uns wie eine Wand. Es vermittelte einem das Gefühl, im Kreis zu gehen, aber die anderen versicherten mir, dass die Richtung stimmte. Doch dies war nicht von langer Dauer, und wenig später fanden wir uns im Vogelbeerland wieder. Dort herrschte Spätsommer, aber ein viel milderer als bei mir. Überall wuchsen Kirschbäume. Beim letzten Mal hatten die Zweige von rosa Blüten geprangt. Nun waren sie schwer von knallroten Früchten.
Und dann griffen uns die Wichte an.
Da nutzte die Wachsamkeit meiner Soldaten wenig. Wichte waren Bewohner der Anderswelt und konnten sich unsichtbar machen, obwohl sie eigentlich nicht zu den Geistern zählten. Sie waren zu siebt, alle ganz in Grau gekleidet und mit langen, bleichen Gesichtern. Im Großen und Ganzen sahen sie aus wie Menschen oder Feine. Licht flackerte, als sie uns mit Energieblitzen unter Beschuss nahmen. Wichte waren noch stärker mit der Magie verbunden als die Feinen, und herkömmliche Waffen richteten wenig gegen sie aus. Man musste sie mit Magie zur Strecke bringen. Unglücklicherweise taugte die Sturmmagie, die ich von meinem Vater geerbt hatte, noch nicht für richtig harte Attacken. Das Gleiche galt für die Magie meiner Wachleute. Von speziellen Kampfmagiern einmal abgesehen, waren die meisten Krieger magiemäßig eher schwach auf der Brust; darum hatten sie sich ja einen Beruf von der robusten Sorte ausgesucht.
Die Silberprojektile in meiner Glock mussten eigentlich mit den Wichten fertig werden. Bloß gab es da ein Problem. Meine Wachen hatten die Reihen um mich geschlossen – und um Nia, die einzige Zivilistin hier. Ich lief Gefahr, meine eigenen Soldaten zu treffen.
»Lasst mich durch!«, rief ich. »Damit ich schießen kann!«
Die Wachen ignorierten mich und brüllten nur noch lauter: »Die Königin! Schützt die Königin!«
Fluchend gelang es mir, einen Arm hinauszuschieben und einen Wicht in die Brust zu treffen. Es brachte ihn nicht um, richtete aber ernsten Schaden an. Nahebei riss ein Kirschbaum seine Wurzeln aus der Erde und griff den verwundeten Wicht an. Das war Shayas Werk. Bevor sie für mich die Regierungsarbeit übernommen hatte, war sie Kriegerin gewesen.
Noch während des Kampfes wurde mir klar, worum es bei diesem Überfall ging. Die Wichte hatten es auf mich abgesehen, und zwar nicht aus Mordgier – aber aus Gier schon. Dabei gingen sie nicht gerade koordiniert vor; sie versuchten jeder einfach nur, als Erster an mich heranzukommen. Wer es schaffte, sollte mich kriegen.
Mir wurde speiübel, und eine alte, vertraute Furcht stieg in mir auf. Ich kam mit Gehirnerschütterungen klar, mit Knochenbrüchen und was einem in meinem Gewerbe noch so zustoßen konnte. Aber mit Vergewaltigung konnte ich nicht fertig werden. Nur drohte sie mir ständig, seit meine halbfeine Abstammung bekannt geworden war. Mein Vater, den man ehrfürchtig den Sturmkönig nannte, war ein despotischer Kriegsherr gewesen – mit einem magischen Potenzial, wie es die Anderswelt selten gesehen hatte. Und mit dem Ehrgeiz, die Menschenwelt zu unterwerfen. Er war verdammt nahe herangekommen, aber dann hatte mein Stiefvater Roland ihn besiegt. Unglücklicherweise war nach dem Tod des Sturmkönigs eine Prophezeiung aufgetaucht, der zufolge sein Enkelsohn sein Werk zu Ende führen würde. Entsprechend heiß begehrt war ich bei den männlichen Bewohnern der Anderswelt, die an die Vision des Sturmkönigs glaubten. Und entsprechend eilig hatte Jasmine es, selbst schwanger zu werden.
Ich steckte die Knarre weg, zückte meinen dicht mit Edelsteinen besetzten Zauberstab und fing einfach an, die Wichte in die Unterwelt zu verbannen. Endstation Tod. So ackerten die Soldaten und ich jeder auf seine Art vor sich hin, bis plötzlich Ruhe war. Die Wichte waren tot oder weg.
Sofort wollten die anderen wissen, ob mit mir alles in Ordnung war – ganz schön albern angesichts der Tatsache, dass etliche bluteten und zwei noch nicht wieder aufgestanden waren.
»Nun hört schon auf!«, fauchte ich. »Kümmert euch lieber um eure Kameraden!«
Zu meiner Erleichterung lebten sie alle noch. So leicht waren Feine in ihrer Welt nicht totzukriegen. Sie wurden sehr alt und hielten viel aus. Einer der Wachsoldaten verfügte über Heilmagie und flickte die Truppe wieder zusammen. Das dauerte seine Zeit. Als wir endlich weiterkonnten, warf Shaya einen Blick zur Sonne und runzelte die Stirn.
»Wir werden uns verspäten.«
Ich dachte an Kiyo. Dann dachte ich an Maiwenn, die selbst mit ihrem prallen Bauch noch aussah wie eine goldene Göttin. Zu spät zu ihrer schicken Babyparty zu kommen und unter ihrem kühlen Blick die Etikette zu verletzen – also da wollte ich doch lieber reiten, wie ich noch nie geritten war.
Bloß ging das mit unseren Verwundeten leider nicht. Am Ende teilten wir uns gefrustet auf, und die Unverletzten versuchten, die verlorene Zeit wieder einzuholen. Binnen Kurzem wechselten wir ins Weidenland und wurden vom eiskalten Wetter gepeitscht. Der Winter ging gerade zu Ende, die Schneeschmelze hatte bereits eingesetzt, aber die Kälte war trotzdem ein Schock. Wir ritten entschlossen die Straße hinunter. Endlich waren wir dort.
Aber immer noch zu spät. Maiwenns Diener fanden es gar nicht toll, wie mitgenommen wir aussahen, aber sie brachten mich zu einem Zimmer, wo ich mich waschen und umziehen konnte. Nia fiel fast in Ohnmacht, als Shaya und ich kaum mehr als eine Katzenwäsche machten. Dank ihrer Magie hatte Nia ein Händchen dafür, andere herauszuputzen und zu frisieren; sie war so eine Art magische Kosmetikerin. Dass ich so gut wie nie auf ihre Dienste zurückgriff, machte sie fertig. Ich konnte sehen, dass sie darauf brannte, irgendwas Tolles mit meinen Haaren anzustellen, aber ich schüttelte den Kopf.
»Keine Zeit. Beeil dich. Ich trage es offen.«
Brav – wenn auch mit heruntergezogenen Mundwinkeln – griff sie zu Magie und Bürste und sorgte für seidenschimmernden Fall meiner Haare, dann nahm sie einen Teil mit einer Haarspange hoch und stibitzte aus einer Vase ein paar Margeriten, die sie in die Spange steckte. Durch die magische Aufladung würde die Frisur stundenlang halten. Ich legte großzügig Veilchenparfum auf, damit es eventuellen Schweißgeruch überdeckte, und los ging es.
Shaya und ich kamen eindeutig als Letzte. Der Ballsaal war gerammelt voll. Ich seufzte laut.
»Das macht nichts«, sagte Shaya leise. »Ihr seid eine Königin. Von Euch erwartet man exzentrisches Verhalten. Lasst Euch Eure Verlegenheit nicht anmerken.«
»Können wir uns nicht einfach unbemerkt reinschleichen?«
Bevor sie antworten konnte, baute sich ein Herold in der Tür auf und verkündete mit einer Stimme, die dafür geschaffen war, über laute Menschenmengen hinwegzutragen: »Ihre Majestät, Königin Eugenie Markham, genannt Odile Dark Swan, Tochter von Tirigan dem Sturmkönig, Beschützerin des Dornenlands, Liebling der dreifachen Mondgöttin.«
Dutzende von Gesichtern wandten sich uns zu.
Ich seufzte erneut und beantwortete mir die Frage selbst. »Anscheinend nicht.«
KAPITEL 3
Sobald ich erst einmal aufhörte, wegen der ganzen Aufmerksamkeit zu hyperventilieren, wurde mir sofort klar, dass Nia recht gehabt hatte mit dem Kleid.
Wie immer hatten sich die Feinen zurechtgemacht, als würden sie auf eine Renaissance-Themenparty gehen, bei der Ecstasy serviert wurde. Satin, Samt, Seide. Sogar hier und da ein bisschen Leder. Schmuck in Massen und viel nackte Haut. Das funkelnde Geschmeide blendete förmlich, die Stoffe leuchteten satt und lebhaft.
Ich trug ein leichtes Sommerkleid im Vintage-Look. Es war aus braunem Krepp mit einem Muster aus winzigen gelben Blüten, hatte eine Empire-Taille und einen anschmiegsamen Rock, der mir bis zum Knie ging. Die Schnürbänder des Oberteils wurden im Nacken geknotet, und der Großteil meines Rückens war nackt, wodurch ich umso besser meine Tattoos zeigen konnte: einen Vollmond mit einem Frauengesicht darin auf meinem Nacken und eine Reihe Veilchen in der Nierengegend. Die Farbe des Kleides machte sich toll mit dem rötlichen Braunton meiner Haare.
In der Menschenwelt wäre der schäbig-schicke Folklorestil richtig trendy, aber wenn man sich an einem Ort, der an die Kulisse eines aufwendigen Mittelalterfilms erinnerte, wie eine Magd anzog, dann sah man eben leider … na ja, wie eine Magd aus.
»Oh mein Gott«, flüsterte ich Shaya zu, während wir den Saal durchquerten. »Ich bin total falsch angezogen.«
»Kein Wort mehr!«, fauchte sie und ließ sich ausnahmsweise die Bestürzung anmerken, die sie in meiner Nähe wahrscheinlich ständig verspürte. »Ihr seid die Königin des Dornenlands. Ihr habt einen der mächtigsten Könige der Glanzvollen vernichtet. Ihr dürft Euch kleiden, wie Ihr wollt; also benehmt Euch auch so.«
Ich verkniff mir eine Antwort und baute darauf, dass sie mit ihrem harten, aber herzlichen Spruch recht hatte. Tatsächlich kostete es mich schon genug Überwindung, mich nicht an ihrer Hand festzuhalten wie ein Kind. Meine mangelnde Erfahrung auf gesellschaftlichem Parkett machte es zu einem Krampf, mit so viel Aufmerksamkeit klarzukommen. Shaya hatte versprochen, an meiner Seite zu bleiben und aufzupassen, dass ich in kein Fettnäpfchen trat, aber davon wurde meine Angst auch nicht kleiner. Ich versuchte, ihren Rat zu beherzigen, und gab mich ganz arrogant und unbekümmert über mein Erscheinungsbild.
»Als Erstes müsst Ihr zu Maiwenn gehen«, flüsterte Shaya. »Anschließend werden sich die meisten von selbst vorstellen. Ihr habt große Neugierde geweckt, und dies ist Euer erster öffentlicher Auftritt seit der Ergreifung des Throns.«
»Alles klar. Maiwenn zuerst.«
Die Weidenkönigin befand sich anscheinend mitten in einer Traube von Feinen. Wir gingen dorthin. Unterwegs begrüßte man mich mit einem Nicken, einem Knicks oder einer Verneigung. Es waren auch ein paar Monarchen anwesend, also Gleichrangige, aber alle anderen Adligen standen rangmäßig unter mir. Einige grüßten mich. Ich hatte sie wohl letzten Frühling auf einem Ball kennengelernt. Die meisten murmelten einfach nur höflich: »Eure Majestät.«
Wir kamen bei Maiwenns Zirkel von Bewunderern an. Ich wollte eigentlich stehen bleiben, aber die Menge teilte sich vor uns, sodass Shaya und ich uns in der vordersten Reihe wiederfanden.
Maiwenn saß auf einem mit Schnitzwerk verzierten Thron, dessen Schwünge mit Gold akzentuiert waren. Sie selbst war auch golden mit ihrer schimmernden gebräunten Haut und den langen Haaren, die aussahen wie hingegossenes Sonnenlicht. Ein Gewand aus blaugrünem Samt – diese Farbe hatten auch ihre Augen – stellte auf sehr vorteilhafte Weise ihre mütterlichen Rundungen zur Schau. Doch am meisten, fand ich, schmückte sie die eindrucksvolle Gestalt von Kiyo, der neben ihr stand und eine Hand auf die Rückenlehne ihres Throns gelegt hatte. Er trug heute Abend Feinenkleidung, die er auch problemlos unter Menschen hätte tragen können: schlichte schwarze Hosen und ein langärmeliges weißes Seidenhemd. Bevor er sich wieder dem Mann zuwandte, mit dem Maiwenn gerade sprach, sah er mich aus seinen warmen dunklen Augen kurz an. Für einen Moment loderte Hitze zwischen uns, und mir fuhr es wie elektrischer Strom durch den Körper, als ich an letzte Nacht dachte.
»… besten Wünsche für Euch und Euer Kind, Eure Majestät«, sagte der Mann gerade. »Dies ist wahrlich ein freudiges Ereignis; mögen die Götter Euch mit Glück und Gesundheit segnen.«
Seine Worte hallten in mir nach. Kiyo zufolge ging es hierbei weniger darum, das Ungeborene zu beschenken, als vielmehr um eine Glückszeremonie. Die Feinen wurden nicht oft schwanger, und Geburten waren risikobehaftet. Die Kindersterblichkeit war hoch. Alter Volksglaube besagte, dass ein solches Fest mit einer großen Zahl an Glückwünschenden das Kind mit Glück durchdringen und so sein Wohlergehen sicherstellen würde.
Der Mann beendete seinen Sermon und bedeutete einem Diener, das Geschenk zu bringen. Der Diener hielt ihm eine goldene Schatulle von der Größe einer Schuhschachtel hin, die der Adlige mit schwungvoller Geste öffnete. Einige Umstehende brachen in Ah- und Oh-Rufe aus, und ich reckte den Hals, weil ich auch etwas sehen wollte. Edelsteine funkelten rot.
»Dies ist mein Geschenk für Euren Sohn oder Eure Tochter: die prächtigsten Rubine meines Landes, geschnitten, geschliffen und poliert bis zur Vollendung.«
Ich blinzelte und sah mich um. War ich die Einzige, die dieses Geschenk albern fand? Was zum Teufel sollte ein Säugling mit einem Haufen Rubine anfangen? An ihnen ersticken? Diese Dinger brauchten definitiv eine Warnung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren. Doch ich war allein mit dieser Ansicht; alle konnten sich kaum einkriegen über das wertvolle Geschenk. Nur Kiyos Lippen umspielte ein winziges Lächeln. Er konnte sich meine Meinung wohl denken.
Der Mann zog sich zurück, und alle Augen wandten sich mir zu. Wir waren als Letzte gekommen, aber sich vordrängeln zu dürfen gehörte anscheinend zu meinen Privilegien. Ich trat vor, wie Shaya mich instruiert hatte, und gab Maiwenn einen Wangenkuss. Sie erwiderte ihn.
»Eugenie, wie schön, Euch wiederzusehen.«
Das besagte auch ihre Miene. Ich weiß nicht, ob es geschauspielert war oder nicht, aber sie zählte zu den Leuten, die einem jederzeit den Eindruck vermitteln konnten, dass man ihnen wirklich am Herzen lag. Bestimmt war ihre Freundlichkeit zum größten Teil ehrlich empfunden, aber wenn man unsere jeweilige Beziehung zu Kiyo bedachte, konnte ich doch nicht die Einzige sein, die unsicher war.
Unvermittelt sah ich die beiden plötzlich im Bett vor mir, er dunkel und sie hell. Ich fragte mich, ob er bei ihr auch so wild gewesen war wie bei mir. Und ob es ihr gefallen hatte.
Ich schob das lebhafte Bild beiseite und versuchte, ihr Lächeln zu erwidern. »Danke für die Einladung. Verzeiht meine Verspätung.«
Sie winkte ab. »Ihr wart doch nicht verpflichtet zu kommen. Umso mehr freue ich mich, dass Ihr da seid.«
Ich hatte keine so eleganten Sätze auf Lager und machte es lieber schlicht. »Ich … ich freue mich für Euch. Ich drücke Euch und dem Baby die Daumen, dass alles gut läuft.«
Ich sah zu Shaya, die meinen Rucksack hielt. Sie gab ihn mir, und da fiel mir auf, dass jetzt mehr Leute zusahen und in ihren Augen die neugierige Frage stand, was die halbmenschliche Königin wohl schenken würde. Unsere Dreiecksbeziehung war kein Geheimnis; solche Dinge verbreiteten sich unter den Feinen dermaßen schnell, da konnten die Klatschblätter der Menschenwelt nicht mithalten.
Ich holte einen Teddy hervor und hielt ihn Maiwenn hin. Sie nahm ihn und strich mit verblüfftem Gesicht über seinen weichen schwarzbraunen Plüsch. Ich hatte ganz schön was für das Stofftier hingeblättert. Es war irgendeine Designermarke, auf die Vorstadtmütter mit Geld angeblich gerade ganz heiß waren.
»Es ist, ähm, ein Spielzeug«, erklärte ich und kam mir prompt blöd vor. Die Feinen waren zwar nicht auf der Höhe der Zeit, aber darauf wären sie nun wirklich allein gekommen.
»Es ist schön«, sagte sie und fuhr die Nähte entlang. »Mit solcher Handwerkskunst können wir nicht mithalten. Vielen Dank.«
»Ach, und außerdem … Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich noch mitbringen könnte, das das Baby nicht schon von Euch bekommt. Also habe ich stattdessen in seinem Namen eine Spende an eine Wohltätigkeitsorganisation für Kinder gemacht. Beziehungsweise werde ich das tun, sobald klar ist, wie es heißt.«
Maiwenn sah mich verblüfft an. Der Teddy war vergessen. »Das verstehe ich nicht.« Die um uns Versammelten anscheinend auch nicht, ihren neugierigen Gesichtern nach zu schließen.
»Ich, ähm, habe einer Gruppe Geld gegeben, die damit kranken Kindern hilft. Sie versorgen damit die Kinder …«, ich suchte nach etwas, das Feinen einleuchtete, »… und zwar zu Ehren Eures Kindes.«
Reine Freude stand in ihrem schönen Gesicht, und das war eindeutig nicht geschauspielert. Sie hatte das Geschenk begriffen, und es gefiel ihr.
»Das ist sehr großherzig«, erklärte Kiyo ihr. Der glühende Blick, mit dem er mich bedachte, deutete darauf hin, dass er schon einige Ideen hatte, wie er sich für das Geschenk bedanken konnte.
Sie legte ihre Arme um den Teddy und presste ihn an ihren üppigen Busen, während ihr Blick nachdenklich ins Leere ging. »Solch freundliches Tun … im Namen des Kindes …« Sie sah mich wieder an aus ihren strahlenden Augen. »Ein solches Tun kann nur das Wohlwollen der Götter bringen. Ich danke Euch, Eugenie.«
Nachdenkliches Murmeln erhob sich hinter uns. Wir tauschten noch einige Floskeln aus, dann machte ich Platz für die nächsten Glückwünschenden.
»War das in Ordnung so?«, fragte ich Shaya beim Weggehen.
»Absolut.« Es klang ein bisschen spöttisch. »Ich hatte meine Zweifel an Eurem Geschenk, aber jetzt glaube ich, dass Ihr diesen Brauch besser versteht als wir.« Sie wurde leiser. »Oh, da ist Katrice, die Vogelbeerkönigin. Sie kommt direkt auf uns zu.«
Ich sah interessiert auf, weil ich das Vogelbeerland schon so oft durchquert hatte. Katrice sah nach menschlichen Maßstäben aus wie fünfzig, was bedeutete, dass sie sich durchaus einiger Jahrhunderte rühmen konnte. Ihr dichtes schwarzes Haar war von wenig Silber durchzogen, und ihre dunklen Augen schimmerten wach und klug. Ein Kleid aus rotem und weißem Satin verhüllte ihre füllige Figur.
»Ach, schau an! Da ist sie endlich! Die Dornenkönigin! Mein liebes Kind, Ihr habt Euch auf unseren Zusammenkünften viel zu rar gemacht.« Sie umarmte mich und gab mir einen Wangenkuss. Er war ein bisschen feuchter als Maiwenns. Von ihrer Art verdattert, erwiderte ich die Geste. Rosenduft umfing mich.
»Es … es ist schön, Euch kennenzulernen.«
»Wie reizend von Euch! Sieh sie dir an, Marlin. Ist sie nicht reizend?«
Sie ergriff einen Mann beim Arm, der mit seinen schütteren grauen Flaumhaaren ungefähr doppelt so alt wirkte. Sein Blick deutete darauf hin, dass er noch nicht ganz auf dem Fest angekommen war.
»Was?«, fragte er.
Katrice hob die Stimme. »Reizend. Ist sie nicht REIZEND?«
»Aber gern«, murmelte er und sah links an mir vorbei.
»Herzog Marlin, der Gemahl der Königin«, flüsterte Shaya.
»Nun seht sie euch an, seht sie euch doch an!« Katrice kriegte sich gar nicht mehr ein. »Wie hat ein Persönchen wie Ihr nur Aeson töten können? Hm? Da wäre der alte Sturmkönig Tirigan aber stolz gewesen.«
Mir wurde ganz anders bei der Erwähnung meines Vaters und meines tödlichen Kampfes mit Aeson. Katrice merkte es nicht, sondern winkte hektisch einem jungen Mann, der in der Nähe vorbeiging. Er hatte ein schmales, gut aussehendes Gesicht und rabenschwarze Haare, die er in einem Pferdeschwanz trug. Auch er war in Rot und Weiß gekleidet, und mir fiel wieder ein, dass ich einmal die Flagge des Vogelbeerlandes gesehen hatte: ein Vogelbeerbaum vor rot-weißem Hintergrund. Ein patriotisches Völkchen anscheinend.
»Schatz! Schatz! Komm, ich stelle dich der Dornenkönigin vor.« Mit einem Lächeln eilte er an ihre Seite und neigte höflich den Kopf. »Dies ist mein Sohn Leith. Leith, Königin Eugenie.«
Er nahm meine Hand und küsste sie formvollendet, wie es Sitte war. »Sehr erfreut, Eure Majestät.«
»Ebenso.«
Ich musterte ihn neugierig, da es meine erste Begegnung mit einem Prinzen der Anderswelt war. Wegen der erwähnten Fortpflanzungsprobleme war ich bisher nur Monarchen begegnet, die keine Kinder hatten – von der schwangeren Maiwenn einmal abgesehen. Sie tendierten dazu, Alleinherrscher zu sein.
Er sah so nett und freundlich aus, dass ich gern mit ihm geplaudert hätte – auch weil er anscheinend nicht vorhatte, mir an die Wäsche zu gehen. Bloß war ich nicht besonders gut darin, den Anfang zu machen. Katrice nahm es mir ab.
»Ist sie nicht schön, Leith? Ich sagte gerade, dass ich kaum glauben kann, dass sie den alten Aeson getötet hat. Unfassbar, oder? Wie hieß es noch, meine Liebe? Ihr hättet ihn ertränkt?«
Ich räusperte mich unbehaglich. »Ähm, nein, eigentlich nicht. Ich habe quasi alles Wasser aus seinem Körper herbeigerufen, und da hat es ihn zerrissen.«
»Oh!« Sie schlug die Hände aneinander, als wäre es das Wunderbarste, das sie je gehört hatte. »Oh! Oh! Ist das nicht faszinierend? Und so einfallsreich!«
Leith, der mein Unbehagen zu bemerken schien, sagte rasch: »Mutter, ich bin mir sicher, dass die Dornenkönigin gern über Angenehmeres reden würde. Dies ist nicht der rechte Ort für Gespräche über den Tod.«
Ich schenkte ihm ein dankbares Lächeln. Wir gingen tatsächlich zu alltäglicheren Themen über, und ich stellte fest, dass er sich weit besser auf das Führen eines zwanglosen Gesprächs verstand als seine Mutter. »Ich habe bemerkt, wie Ihr die Rubine angesehen habt«, neckte er mich. »Meint Ihr etwa, das Kind wüsste damit nichts anzufangen?«
Ich verzog das Gesicht. »Vielleicht können sie seine Krippe damit schmücken. Oder ein Mobile daraus basteln. Sind derartige Geschenke üblich?«
»Ich fürchte, ja.« Er schmunzelte immer noch. »Wie Ihr gesagt habt, gibt es nicht viel, das das Baby nicht schon von Maiwenn bekommt. Den meisten dieser Adligen geht es mehr darum, die Königin zu erfreuen … deshalb all die sinnlosen Geschenke.«
»Aber Leith«, schalt ihn seine Mutter. »Das ist ja lächerlich. Ich bin mir sicher, dass Maiwenns Kind von dem Glasgeschirr, das wir mitgebracht haben, restlos hingerissen sein wird.«
Als ich uns schließlich entschuldigte, küsste Leith mir wieder die Hand und sprach so leise, dass Katrice es nicht hören konnte.
»Ich möchte mich für sie entschuldigen. Sie überlegt sich nicht immer, was sie sagt.«
Ich schmunzelte. »Ist schon gut. Sie ist eine Königin. Sie darf das.«
Lauter und förmlicher fügte er hinzu: »Ich hoffe, Ihr kommt uns einmal besuchen. Mutter würde Euch liebend gern an unserem Hof empfangen.«
»Sicher. Demnächst einmal.« Ich gab mir Mühe, die Höflichkeit zu erwidern. »Ihr solltet uns auch einmal besuchen kommen. Allzu oft bin ich nicht da, aber wenn, dann seid Ihr jederzeit willkommen.«
Er strahlte; Katrice ebenfalls, und sie blieb zur Abwechslung einmal stumm. »Vielen Dank, Eure Majestät. Nur zu gern. Ich habe Aufregendes gehört über Euer Land. Man sagt, es sei sehr wild. Wild, doch schön.«
Als wir weitergingen, lachte Shaya leise. »Herrje, Ihr wisst gar nicht, was Ihr getan habt.«
Ich starrte sie an. »Was denn? Ich finde, ich habe das ganz gut hingekriegt, zumal diese Frau in einer Tour geplappert hat.«
»Lasst Euch von ihrer Oberfläche nicht täuschen. Sie ist klüger, als Ihr denkt. Und stark. Ihr Sohn leider nicht.«
»Leith? Was meinst du? In magischer Hinsicht?«
Sie nickte. »Seine Magie ist praktisch nicht vorhanden. Er wird ihr Königreich nicht erben können.«
»Puh …« Angesichts der Tatsache, dass Feine extrem langlebig waren, hatte ich mir nie viele Gedanken über Erbschaftsdinge gemacht. »Aber er kam mir ziemlich kompetent vor. Sehr intelligent.«
»Das ist er auch. Und wie. Man könnte ihn als Erfinder bezeichnen. Er hat sich Dinge ausgedacht, die ihr Königreich revolutioniert haben – und sich langsam auch in den anderen Ländern verbreiten. Gerade erst hat er eine Technik entwickelt, Text in Bücher zu stempeln, wie Euer Volk es tut. Das wird die Kosten für Schreiber enorm senken.«
»Eine Art Druckerpresse? Wow.« Wer weiß, vielleicht war Leith ja so eine Art Elfenversion von Gutenberg. Cool. Vielleicht marschierte die Anderswelt gerade auf die industrielle Revolution zu. »Und das zählt nichts in Sachen Regieren?«
»Nein.« Shaya klang in keiner Weise mitfühlend. Magische Kraft war der wichtigste Maßstab für den Wert eines Feinen; darum hatte mein mieser Vater ja ein solches Ansehen genossen. Es hatte auf mich abgefärbt, jedenfalls bei Leuten, die überzeugt waren, dass ich ihm eines Tages gleichkommen würde. »Genialität allein reicht nicht aus, um den Thron zu erben oder das Land an sich zu binden. Aber mit einer starken Gemahlin an seiner Seite würden seine Chancen steigen.«
Ich stolperte fast über meine eigenen Füße, als mir klar wurde, was sie da sagte. »Wie jetzt? Mit mir, meinst du?«
»Nach ihrer Einschätzung wärt Ihr eine gute Partie. Voller starker Magie und bereits Herrscherin über ein Königreich. Dass Ihr menschliches Blut habt und Kinder kriegen könnt, macht Euch überaus attraktiv … die Rolle, die Ihr in der Prophezeiung spielt, gleich zweimal.«
»Herrgott noch mal. Ihr Leute seid verrückt!«
Meine Bestürzung machte ihr anscheinend richtig Spaß. »Wie ich gesagt habe, Katrice ist klug. Sie hat nicht gelogen, als sie meinte, dass sie Euch schon lange kennenlernen wollte. Das Zusammentreffen eben war kein Zufall. Als Ihr Leith eingeladen habt, Euch zu besuchen, ging für sie ein Traum in Erfüllung. Wartet’s nur ab, er steht bald vor Eurer Tür.«
»Kann man bei euch denn nicht einfach nur Freunde sein? Warum muss jeder Kerl, der mir über den Weg läuft, gleich ein potenzieller Partner sein? Klar, Leith ist nett, und gut sieht er auch aus, aber ich meine … jetzt mal im Ernst.«
Eigentlich hätte es mich gar nicht weiter überraschen dürfen. Die Feinen hatten eine wesentlich lockerere Sexualmoral als die Menschen, wie einige Paare in den Saalecken gerade auch demonstrierten, darum betrachteten sie jede Begegnung als mögliche Romanze. In Anbetracht der nicht gerade romantischen Annäherungsversuche der Wichte vorhin hätte ich froh sein müssen, dass Leith auf so zivilisierte Weise um meine Zuneigung warb. Aber ich fand das alles nur ermüdend.
Shaya stellte mich im Laufe des Nachmittags noch anderen Adligen vor. Ich konnte sie kaum auseinanderhalten, sondern lächelte und nickte nur vor mich hin, während ich davon träumte, zu Hause mit Kiyo im Bett zu liegen. Gegen Ende des Festes fesselte dann doch noch ein Neuankömmling meine Aufmerksamkeit.
Das Auffälligste an ihm war die dunkle Hautfarbe – eine Seltenheit unter den hellhäutigen Feinen in diesem Teil der Anderswelt. Das schwarze Haar umrahmte sein Gesicht mit einer Flut schwarzer Zöpfchen, was perfekt mit dem burgunderroten Umhang kontrastierte. Er warf den Umhang mit großer Geste beiseite und verneigte sich tief über meine Hand.
»Eure Majestät«, sagte er mit leichtem französischen Akzent. »Es ist mir eine Freude und eine Ehre. Die Erzählungen über Eure Schönheit werden Euch nicht gerecht. Ich bin Girard de la Colline.«
Ich nahm seinen Handkuss mit Erstaunen entgegen. »Ihr müsst von sehr weit her kommen.«
Was die Geografie betraf, entsprach die Anderswelt unserer Welt. Die hiesigen Bewohner gleich neben Arizona sprachen Spielarten des amerikanischen Englisch. Ich fragte mich, ob die heutigen Herrscher wohl eine indianische Version der Feinen verdrängt hatten.
»Eine überaus lohnenswerte Reise, wenn man dafür in Eurer Nähe weilen kann; aber wenn es Euch danach verlangt, wäre es mir eine Ehre, Euch eines Tages von meinem Heimatland zu erzählen. Seine Schönheit ist groß genug, um einen Mann zum Weinen zu bringen, wenngleich ich mir habe sagen lassen, dass die schreckliche Schönheit Eures Landes ebenfalls geeignet ist, Männer zum Weinen zu bringen – aus anderen Gründen.«
Ich lachte. »Vermutlich. Wer ihm Respekt entgegenbringt, kann darin überleben; wer nicht … eben nicht.«
»Das klingt ganz nach seiner Königin.« Er neigte den Kopf. »Ich habe außerdem ein wenig Talent mit Metallarbeiten, falls Ihr je etwas anfertigen lassen möchtet. Ich lebe derzeit im Vogelbeerland, nehme aber jederzeit gern einen Auftrag an, falls Ihr etwas benötigt.«
Ich dankte ihm für sein Angebot und erklärte, ich würde es mir einmal durch den Kopf gehen lassen. Wir gingen weiter. »Sehr sympathisch«, sagte ich zu Shaya. »Aber lass mich raten … er will mich auch bloß umwerben und mir ein Kind machen?«
»Ach, er hätte gewiss nichts dagegen, aber darauf zielt er derzeit nicht ab. Er ist wirklich ein recht begnadeter Kunsthandwerker – es fließt sogar ein bisschen Menschenblut in seinen Adern, sodass er den Kontakt mit Eisen verträgt. Aber ein Mann wie er … nun, er ist ein Höfling. Er mischt sich unter den Adel und hofft, Verbindungen herzustellen, die ihm dabei helfen können, eines Tages selbst ein Königreich zu regieren.«
»Was, meine liebe Shaya, eine sehr freundliche Umschreibung dafür ist, dass es sich um einen schönrednerischen Speichellecker handelt, der alles tun würde, um seine hochgesteckten politischen Ziele zu erreichen. Was jedoch seine künstlerische Begabung betrifft, so stimme ich dir zu. Wir sollten ihn wirklich eine anständige Krone für unsere liebe Freundin, die Dornenkönigin, anfertigen lassen, zur Festigung ihres Titels.«
Diese sanfte, lakonische Stimme fuhr mir mitten ins Herz, und ich erstarrte. Langsam wandte ich mich um und blickte in ein grünes Augenpaar mit langen Wimpern, in dessen Pupillen goldene und haselnussbraune Flecken tanzten. Die langen feuerroten Haare, die sein Gesicht umrahmten, konnten sich mit den Herbstbäumen seines Königreichs messen.
Dorian, der König des Eichenlands.
»Eure Majestät!«, rief Shaya erfreut und machte einen Hofknicks vor ihm. »Wie geht es Euch? Wie ergeht es Euren Ländereien?«
Dorian schmunzelte und versetzte ihr einen zärtlichen Stüber unters Kinn. »Hast du Angst, dass mein Haushalt auseinanderfällt ohne dich? Ich gebe zu, er läuft nicht mehr ganz so rund wie früher, aber uns bleibt nichts anderes übrig, als zurechtzukommen. Deine neue Herrin bedarf deiner Dienste zweifelsohne mehr als ich, also will ich um ihretwillen gern noch ein Weilchen länger leiden.«
Er sah mich bedeutungsvoll an. Ich sagte nichts. Shaya sah zwischen uns hin und her, und von ihrer glücklichen Miene blieb nichts übrig. »Wenn Eure Majestäten mich entschuldigen würden, ich besorge Erfrischungen. Ich bin gleich wieder zurück.«
Das bezweifelte ich sehr, aber sie verschwand, bevor ich noch protestieren konnte. Ich wäre ihr am liebsten gefolgt, bloß ging das nicht.