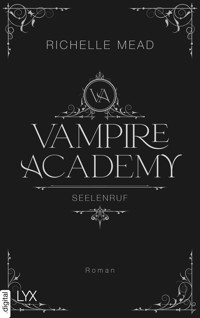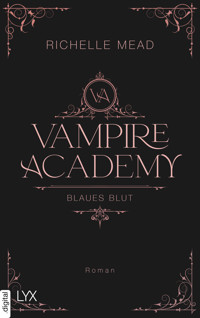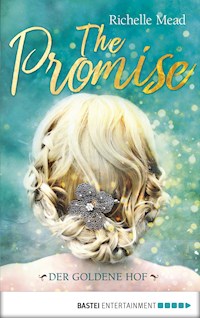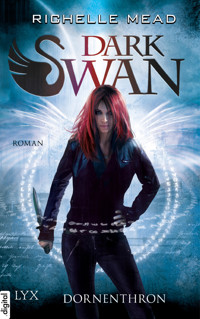11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Vampire-Academy-Reihe
- Sprache: Deutsch
Rose Hathaways Leben wird niemals wieder wie früher sein. Der Angriff auf die Akademie St. Vladimir hat die gesamte Welt der Moroi erschüttert und viele Todesopfer gefordert. Doch noch schlimmer ist das Schicksal derjenigen, die von den Strigoi verschleppt wurden. Unter den Vermissten befindet sich auch Rose' Geliebter Dimitri. Rose muss sich entscheiden: Will sie ihre beste Freundin Lissa beschützen, wie sie es einst geschworen hat, oder die Akademie verlassen und den Mann suchen, den sie liebt? Und wird sie ihn retten können, wenn sie ihn gefunden hat?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 723
Veröffentlichungsjahr: 2011
Sammlungen
Ähnliche
Richelle Mead
Blutschwur
Roman
Ins Deutsche übertragenvon Michaela Link
Im Gedenken an meine Großmutter, eine beherzte Dame aus dem Süden und die beste Köchin, die ich je gekannt habe.
Prolog
Als ich in der neunten Klasse war, musste ich einmal einen Aufsatz über ein Gedicht schreiben. Eine der Zeilen lautete: „Wenn deine Augen nicht offen wären, würdest du den Unterschied zwischen Träumen und Wachen nicht kennen.“ Damals hatten mir diese Worte eigentlich nichts gesagt. Schließlich gab es einen Jungen in der Klasse, den ich gern hatte, wie konnte man da von mir erwarten, meine Aufmerksamkeit einer literarischen Analyse zu widmen? Jetzt, drei Jahre später, verstand ich das Gedicht vollkommen.
Denn in letzter Zeit schien mir mein Leben wirklich, als wäre es nur ein Traum. An manchen Tagen glaubte ich aufzuwachen und festzustellen, dass die jüngsten Ereignisse in meinem Leben gar nicht wirklich geschehen waren. Ich konnte eigentlich nur eine Prinzessin in einem verzauberten Schlaf sein. Und dieser Traum – nein, dieser Albtraum – würde jetzt jeden Moment enden, und ich würde endlich meinen Prinzen und mein Happy End bekommen.
Doch es war kein glückliches Ende in Sicht, zumindest nicht in absehbarer Zukunft. Und mein Prinz? Nun, das war eine lange Geschichte. Mein Prinz war in einen Vampir verwandelt worden – in einen Strigoi, um genau zu sein. In meiner Welt gibt es zwei verschiedene Arten von Vampiren, die sich vor den Menschen verborgen halten. Die Moroi sind lebende Vampire, gute Vampire, die über Elementarmagie verfügen und niemals töten, wenn sie sich das Blut nehmen, das sie für ihr Überleben brauchen. Die Strigoi hingegen sind untote Vampire, unsterblich und widernatürlich, die sinnlos töten, wenn sie Nahrung aufnehmen. Moroi werden geboren; Strigoi werden geschaffen – mit Gewalt oder aus freien Stücken – und sind böse.
Und Dimitri, der Mann, den ich liebte, war gegen seinen Willen zu einem Strigoi gemacht worden. Er wurde während einer Schlacht verwandelt, einer dramatischen Rettungsmission, an der auch ich teilgenommen hatte. Strigoi hatten an meiner Schule Moroi und Dhampire in ihre Gewalt gebracht und sie vom Schulgelände entführt, und wir hatten sie, um unsere Leute zu retten, zusammen mit noch einigen anderen verfolgt. Dhampire sind halb Vampire und halb Menschen – ausgestattet mit der Stärke und Robustheit eines Menschen und den schnellen Reflexen und scharfen Sinnen eines Moroi. Dhampire werden zu Wächtern ausgebildet, zu elitären Leibwächtern, die die Moroi beschützen. Genau das bin ich. Und genau das war Dimitri.
Nach seiner Verwandlung galt er für den Rest der Moroi-Welt als tot. Und bis zu einem gewissen Maß war er das ja auch. Jene, die zu Strigoi wurden, empfanden keine Güte mehr und hatten jedes Gefühl für ihr vorheriges Leben verloren. Das war so, selbst wenn sie nicht aus freien Stücken verwandelt worden waren. Sie wurden genauso böse und grausam wie alle Strigoi. Die Person, die sie einst waren, existierte nicht mehr, und, ganz ehrlich, es wäre viel angenehmer gewesen, sich vorzustellen, dass sie in den Himmel oder in das nächste Leben eingegangen wären, als sich auszumalen, wie sie nachts auf die Pirsch gingen und ihre Opfer jagten. Aber ich hatte Dimitri weder vergessen, noch konnte ich akzeptieren, dass er im Grunde tot war. Er war der Mann, den ich liebte, der Mann, mit dem ich so dermaßen gut harmonisierte, dass ich schon nicht mehr sagen konnte, wo ich aufhörte und er anfing. Mein Herz weigerte sich, ihn gehen zu lassen – selbst wenn er rein technisch gesehen ein Ungeheuer war, war er trotzdem noch immer irgendwo dort draußen. Und ich erinnerte mich noch sehr gut an eines unserer Gespräche. Wir waren uns beide einig gewesen, dass wir lieber tot sein wollten – wirklich und wahrhaftig tot –, denn als Strigoi auf dieser Welt wandeln zu müssen.
Und nachdem ich meine Trauer um das verlorene Glück beendet hatte, gelangte ich zu dem Schluss, dass ich mich an seine Wünsche halten sollte. Auch wenn er selbst nicht länger daran glaubte. Ich musste ihn finden. Ich musste ihn töten und seine Seele aus diesem dunklen, unnatürlichen Zustand befreien. Ich wusste, der Dimitri, den ich mal geliebt hatte, hätte es so gewollt. Es ist allerdings gar nicht so einfach, einen Strigoi zu töten. Sie sind irrsinnig schnell und stark. Und sie kennen keine Gnade. Ich hatte schon einige von ihnen erledigt – ziemlich verrückt für jemanden, der gerade erst achtzehn geworden war. Aber ich wusste, dass der Kampf mit Dimitri sowohl physisch als auch emotional meine größte Herausforderung darstellte.
Tatsächlich machten sich die emotionalen Konsequenzen bereits bemerkbar, sobald ich meine Entscheidung getroffen hatte. Denn bei der Verfolgung von Dimitri warteten einige grundlegende Veränderungen auf mich (und dabei zählte ich die Tatsache, dass ein Kampf mit ihm höchstwahrscheinlich zum Verlust meines eigenen Lebens führen konnte, noch nicht einmal mit). Ich ging noch zur Schule und stand gerade mal ein paar Monate vor meinem Abschluss, und danach würde ich eine richtige Wächterin sein. Jeder Tag, den ich in der St.-Vladimir-Akademie verblieb – eine entlegene, gut bewachte Schule für Moroi und Dhampire –, bedeutete, dass ein weiterer Tag verstrich, an dem Dimitri sich noch dort draußen befand, in einem Zustand, den er nie gewollt hatte. Ich liebte ihn zu sehr, um das zuzulassen. Also musste ich die Schule vorzeitig abbrechen, mich unter die Menschen mischen und die Welt, in der ich fast mein ganzes Leben verbracht hatte, hinter mir lassen.
Wenn ich wegging, bedeutete das außerdem, dass ich noch etwas anderes zurücklassen musste – oder vielmehr eine Person: meine beste Freundin Lissa, die mit vollem Namen Vasilisa Dragomir hieß. Lissa war eine Moroi, die letzte einer königlichen Linie. Ich sollte nach meinem Abschluss als ihre Leibwächterin fungieren, und meine Entscheidung, Dimitri zu jagen, hatte meine Zukunft an ihrer Seite so ziemlich zunichtegemacht. Doch ich hatte keine andere Wahl.
Abgesehen von unserer Freundschaft unterhielten Lissa und ich eine wirklich einzigartige Verbindung. Jeder Moroi spezialisiert sich auf einen bestimmten Typus Elementarmagie – Erde, Luft, Wasser oder Feuer. Bis vor Kurzem glaubte man, dass es nur die Magie dieser vier Elemente gab. Dann entdeckten wir die eines fünften: die Magie des Geistes.
Das war Lissas Element, aber da es auf der Welt nur so wenige Geistbenutzer gab, wussten wir kaum etwas darüber. Größtenteils schien dieses Element mit psychischen Kräften zusammenzuhängen. Lissa konnte in erstaunlichem Maße Zwang ausüben und beinahe jedem ihren Willen aufzwingen. Außerdem war sie in der Lage, andere zu heilen, und das ist genau der Punkt, an dem die Dinge zwischen uns ein bisschen seltsam wurden. Technisch gesehen bin ich nämlich bei dem Autounfall gestorben, der ihre ganze Familie das Leben gekostet hat. Ohne es zu bemerken, hatte Lissa mich damals aus der Welt der Toten zurückgeholt und damit ein übernatürliches Band zwischen uns geschaffen. Seither war ich mir ihrer Existenz und ihrer Gedanken stets bewusst. Ich konnte erkennen, was sie dachte, und spüren, wenn sie in Schwierigkeiten steckte. Außerdem hatten wir herausgefunden, dass ich Geister sehen konnte, die diese Welt noch nicht verlassen hatten. Das beunruhigte mich allerdings etwas, und ich bemühte mich ständig, diese Gabe auszublenden. Das ganze Phänomen wurde in der knappen Aussage zusammengefasst, ich sei „schattengeküsst“.
Unser besonderes Band – das der Schattengeküssten zu der Geistesbenutzerin, die sie aus dem Schattenreich zurückgeholt hatte – machte mich zur idealen Kandidatin, um Lissa zu beschützen, da ich immer sofort wusste, wenn sie in Schwierigkeiten war. Ich hatte versprochen, sie mein Leben lang zu beschützen, doch dann hatte Dimitri – der hochgewachsene, umwerfende, leidenschaftliche Dimitri – alles verändert. Ich stand vor der schrecklichen Entscheidung, Lissa weiterhin zu beschützen oder Dimitris Seele zu befreien. Mich zwischen den beiden entscheiden zu müssen hatte mir das Herz gebrochen und mir einen tiefen Schmerz in der Brust und reichlich Tränen beschert. Mein Abschied von Lissa war qualvoll gewesen. Seit dem Kindergarten waren wir beste Freundinnen, und mein Aufbruch war ein Schock für uns beide. Um fair zu sein, muss ich sagen, dass sie es nicht einmal kommen gesehen hatte. Denn meine Romanze mit Dimitri hatte ich geheim gehalten. Er war mein Lehrer gewesen, sieben Jahre älter als ich und ebenfalls dazu auserkoren, ihr Wächter zu sein. Als ihre beiden zukünftigen Wächter hatten er und ich uns natürlich besonders große Mühe gegeben, gegen unsere Gefühle anzukämpfen, wohl wissend, dass wir uns mehr auf Lissa als auf alles andere konzentrieren mussten und dass wir wegen unserer Schüler-Lehrer-Beziehung außerdem eine Menge Ärger bekommen konnten.
Aber der ständige Verzicht auf Dimitri – obwohl ich dem zugestimmt hatte – führte dazu, dass sich in mir ein unausgesprochener Groll gegen Lissa aufbaute. Wahrscheinlich hätte ich mit ihr darüber reden und ihr die Frustration über mein durchgeplantes Leben erklären sollen. Irgendwie schien es mir unfair, dass Lissa lieben und leben konnte, wie sie wollte, während ich mein eigenes Glück immer würde opfern müssen, um ihren Schutz zu gewährleisten. Sie war jedoch meine beste Freundin, und ich konnte den Gedanken nicht ertragen, sie zu kränken. Lissa war besonders verletzbar, denn die Benutzung von Geist hatte die unangenehme Nebenwirkung, Leute in den Wahnsinn zu treiben. Also hatten sich meine Gefühle so lange in mir aufgestaut, bis sie schließlich explodierten, und ich die Akademie – und Lissa – für immer hinter mir ließ.
Einer der Geister, die ich gesehen hatte – Mason, ein Freund, der von Strigoi getötet worden war –, berichtete mir, dass Dimitri in seine Heimat Sibirien zurückgekehrt war. Masons Seele hatte kurz darauf Frieden gefunden und diese Welt verlassen, ohne mir noch irgendwelche Hinweise darauf zu geben, wo genau sich Dimitri in Sibirien aufhalten könnte. Also hatte ich einfach blindlings dorthin reisen müssen und einer Welt von Menschen und einer Sprache, die ich nicht kannte, getrotzt, um das Versprechen einzuhalten, das ich mir selbst gegeben hatte.
Nachdem ich einige Wochen allein unterwegs gewesen war, hatte ich es endlich bis nach Sankt Petersburg geschafft. Ich suchte noch immer, quälte mich noch immer – war jedoch fest entschlossen, ihn zu finden, obwohl mir gleichzeitig davor graute. Denn wenn ich diesen irrwitzigen Plan tatsächlich in die Tat umsetzte, wenn es mir wirklich gelang, den Mann zu töten, den ich liebte, würde das bedeuten, dass Dimitri die Welt wirklich und wahrhaftig verlassen hätte. Und ich war mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich in einer solchen Welt weiterleben konnte.
Nichts von alldem kommt mir real vor. Wer weiß? Vielleicht ist es das auch nicht. Vielleicht geschieht das Ganze in Wirklichkeit jemand anderem. Vielleicht habe ich mir alles auch bloß eingebildet. Vielleicht werde ich bald aufwachen und feststellen, dass mit Lissa und Dimitri alles wieder in Ordnung ist. Wir werden alle zusammen sein, und er wird mich anlächeln und im Arm halten und mir sagen, dass alles gut sein wird. Vielleicht war es wirklich nur ein Traum.
Aber das glaube ich nicht.
1
Ich wurde verfolgt.
Schon irgendwie lustig, wenn man bedachte, dass ich während der letzten Wochen ständig andere verfolgt hatte. Aber wenigstens war es kein Strigoi. Das hätte ich bereits gewusst. Da ich schattengeküsst war, besaß ich neuerdings die Fähigkeit, die Untoten zu spüren – bedauerlicherweise durch Anfälle von Übelkeit. Trotzdem wusste ich das Frühwarnsystem meines Körpers zu schätzen und war erleichtert, dass mein Verfolger heute Nacht zumindest kein irre schneller, irre bösartiger Vampir war. Gegen solche hatte ich in letzter Zeit schon oft genug gekämpft, und jetzt wünschte ich mir zu Abwechslung mal einen freien Abend.
Ich musste also davon ausgehen, dass mein Verfolger wie ich ein Dhampir war, wahrscheinlich einer aus dem Klub. Allerdings verhielt sich diese Person wesentlich unvorsichtiger, als ich es von einem Dhampir erwartet hätte. Ich konnte seine Schritte auf dem Pflaster der dunklen Seitenstraßen deutlich hören, und einmal bekam ich sogar flüchtig eine schattenhafte Gestalt zu Gesicht. Trotzdem, wenn man meine übereilten Taten heute Nacht bedachte, handelte es sich höchstwahrscheinlich um einen Dhampir.
Das Ganze hatte schon früher am Abend in der Nachtigall angefangen. Das war jedoch nicht der richtige Name des Klubs, sondern eine Übersetzung. Der eigentliche Name war etwas Russisches, doch den konnte ich beim besten Willen nicht aussprechen. Zu Hause in Amerika war die Nachtigall unter den reichen Moroi, die ins Ausland reisten, wohlbekannt, und jetzt verstand ich auch, warum. Ganz gleich, wie spät es war, die Leute kleideten sich dort immer, als befänden sie sich auf einem fürstlichen Ball. Und, nun ja, mit den elfenbeinfarbenen Wänden voller goldener Schnörkeleien und Zierleisten erinnerte das ganze Lokal irgendwie an das alte zaristische Russland. Es ähnelte in gewisser Weise dem Winterpalast, einer königlichen Residenz aus der Zeit, als Russland noch von Zaren regiert worden war. Gleich nach meiner Ankunft in Sankt Petersburg hatte ich den Palast besichtigt.
In der Nachtigall glitzerten kunstvolle, mit echten Kerzen ausgestattete Kronleuchter und beleuchteten die goldene Einrichtung, sodass das ganze Lokal trotz des schummrigen Lichts hell funkelte. Es gab einen großen Speisesaal, darin mit Samt verhängte Tische und Sitznischen, außerdem eine Lounge und einen Barbereich. Spät am Abend würde dort eine Band spielen und die Tanzfläche sich mit Paaren füllen.
Nachdem ich vor einigen Wochen in der Stadt angekommen war, hatte ich mich mit der Nachtigall zunächst gar nicht abgegeben. Ich war so arrogant gewesen zu glauben, ich könnte problemlos Moroi finden, die mir den Weg zu Dimitris Heimatstadt in Sibirien weisen würden. Ohne auch nur den kleinsten Hinweis darauf, wo Dimitri sich in Sibirien aufhalten könnte, war die Reise in die Stadt, in der er aufgewachsen war, meine einzige Chance, näher an ihn heranzukommen. Nur dass ich nicht wusste, wo diese Stadt lag. Darum versuchte ich, Moroi zu finden, die mir weiterhelfen könnten. Es gab in Russland eine ganze Anzahl von Dhampir-Städten und -kommunen, aber kaum welche in Sibirien, was in mir die Hoffnung weckte, dass die meisten einheimischen Moroi seinen Geburtsort bestimmt kennen müssten. Bedauerlicherweise stellte sich aber heraus, dass die Moroi, die in den Städten der Menschen lebten, sehr gut darin waren, sich zu verstecken. Ich klapperte alle Plätze ab, von denen ich dachte, dass dort wahrscheinlich Moroi zu finden wären, doch ich hatte keinen Erfolg. Und ohne diese Moroi bekam ich keine Antworten.
Also fing ich an, den Klub zu überwachen, was gar nicht so leicht war. Für eine Achtzehnjährige war es sogar recht schwierig, sich in einem der elitärsten Klubs der Stadt aufzuhalten, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Doch schon bald fand ich heraus, dass teure Kleider und hinreichend große Trinkgelder eine Menge dazu beitrugen, dort zurechtzukommen. Die Kellner kannten mich inzwischen, und falls sie meine Anwesenheit im Klub für seltsam hielten, so sagten sie es nicht und gaben mir mit Freuden den Ecktisch, um den ich immer bat. Wahrscheinlich dachten sie, ich sei die Tochter irgendeines Magnaten oder Politikers. Woher ich auch kommen mochte, ich hatte jedenfalls das nötige Kleingeld, um mich dort aufzuhalten, und das war alles, was sie interessierte.
Trotzdem waren meine ersten Abende in dem Klub ziemlich entmutigend gewesen. Die Nachtigall mochte ein elitärer Treffpunkt für Moroi gewesen sein, aber es wurde auch von Menschen besucht. Zuerst hatte es für mich sogar so ausgesehen, als seien Menschen die einzigen Gäste. Im Laufe des Abends füllte sich das Lokal, aber wenn ich die voll besetzten Tische und die Bar absuchte, konnte ich keinen Moroi entdecken. Dann bemerkte ich eine Frau mit langem platinblondem Haar, die mit ein paar Freunden die Lounge betrat. Einen Moment lang stockte mir der Atem. Die Frau hatte mir zwar den Rücken zugewandt, aber sie sah Lissa so ähnlich, dass ich davon überzeugt gewesen war, aufgespürt worden zu sein. Seltsamerweise hatte ich nicht gewusst, ob ich deswegen froh oder entsetzt sein sollte. Ich vermisste Lissa so sehr, gleichzeitig wollte ich nicht, dass sie in meine gefährliche Reise verwickelt wurde. Dann hatte sich die Frau umgedreht. Es war nicht Lissa gewesen. Sie war nicht einmal eine Moroi, nur ein Mensch. Langsam hatte meine Atmung sich wieder normalisiert.
Endlich, vor etwa einer Woche, hatte ich Glück. Eine Gruppe von Moroi-Frauen war zu einem späten Mittagessen hereingekommen, begleitet von zwei Wächtern, einem männlichen und einem weiblichen, die pflichtschuldig und still am Tisch saßen, während ihre Schützlinge bei einigen Gläsern Champagner schwatzten und lachten. Diese Wächter zu umgehen war besonders knifflig gewesen. Für jene, die wussten, wonach sie suchen mussten, waren Moroi leicht zu erkennen: größer als die meisten Menschen, blass und ultraschlank. Außerdem hatten sie so eine komische Art zu lächeln und mit den Lippen ihre Reißzähne zu verbergen. Wir Dhampire mit unserem menschlichen Blut wirkten … nun ja, menschlich.
Zumindest für das ungeübte menschliche Auge sah ich so aus. Ich war ungefähr einen Meter siebzig groß, und während Moroi zu unwirklichen Laufsteg-Model-Körpern neigten, war ich athletisch gebaut und hatte einen üppigen Busen. Gene meines unbekannten türkischen Vaters und zu viel Zeit in der Sonne hatten mir eine leichte Bräune beschert, die ziemlich gut zu meinem langen, fast schwarzen Haar und meinen gleichermaßen dunklen Augen passte. Aber jene, die in der Moroi-Welt aufgewachsen waren, konnten mich bei genauerer Betrachtung als Dhampir entlarven. Ich bin mir nicht sicher, woran es lag – vielleicht irgendein Instinkt, der uns zu unseresgleichen zog und die Mischung von Moroi-Blut erkannte.
Nichtsdestoweniger war es von entscheidender Wichtigkeit, dass diese Wächter mich für einen Menschen hielten, damit ich sie nicht in Alarmbereitschaft versetzte. Ich saß also auf der anderen Seite des Raums in meiner Ecke, stocherte in einer Portion Kaviar herum und tat so, als wäre ich in mein Buch vertieft. Nur der Vollständigkeit halber, ich finde Kaviar widerwärtig, aber es schien ihn überall in Russland zu geben, vor allem in den netten Lokalen. Das und Borschtsch – eine Art Rote-Bete-Suppe. In der Nachtigall aß ich fast nie ganz auf, was ich bestellt hatte, und ging anschließend ausgehungert zu McDonald’s, auch wenn sich die russischen McDonald’s-Restaurants ein wenig von denen unterschieden, mit denen ich aufgewachsen war. Trotzdem, ein Mädchen muss schließlich essen.
So wurde das Ganze zu einem Test meiner Fähigkeiten, die Moroi zu betrachten, wenn ihre Wächter gerade nicht hinschauten. Zugegeben, die Wächter hatten tagsüber wenig zu befürchten, da im hellen Sonnenlicht keine Strigoi unterwegs sein würden. Aber es lag in der Natur eines jeden Wächters, alles zu beobachten, und sie ließen ihre Blicke ständig durch den Raum wandern. Da ich aber die gleiche Ausbildung genossen hatte und ihre Tricks kannte, gelang es mir, die Moroi unbemerkt auszuspionieren.
Die Frauen kamen recht häufig in den Klub, meistens spätnachmittags. Das Leben in St. Vladimir verlief nach einem nächtlichen Zeitplan, aber Moroi und Dhampire, die unter Menschen lebten, hielten sich entweder an einen Tageslichtzeitplan oder an etwas dazwischen. Für eine Weile hatte ich mit dem Gedanken gespielt, an sie heranzutreten – oder sogar an ihre Wächter. Irgendetwas hielt mich zurück. Wenn jemand wissen würde, wo eine Stadt voller Dhampire zu finden war, dann wären es männliche Moroi. Viele von ihnen besuchten Dhampir-Städte in der Hoffnung, leichte Dhampir-Mädchen aufzureißen. Also nahm ich mir vor, noch eine Woche abzuwarten, ob hier auch irgendwelche Männer vorbeikamen. Falls nicht, wollte ich herausfinden, was für Informationen die Frauen mir geben konnten.
Vor einigen Tagen waren dann endlich zwei Moroi-Männer aufgetaucht. Sie neigten dazu, sich erst später am Abend einzufinden, wenn die richtigen Partygänger kamen. Die Männer waren etwa zehn Jahre älter als ich und sahen auffallend gut aus, sie trugen Designeranzüge und Seidenkrawatten. Ihre Haltung verriet Macht und Einfluss, und ich hätte viel Geld darauf gewettet, dass sie von königlichem Geblüt waren – vor allem, da jeder von ihnen mit einem eigenen Wächter kam. Die Wächter waren immer dieselben: junge Männer, die Anzüge trugen, um nicht aufzufallen, die aber trotzdem den Raum sorgfältig im Auge behielten, wie es eben in der Natur aller Wächter liegt. Und immer waren da auch Frauen – viele Frauen. Die beiden Moroi flirteten auf Teufel komm raus und hatten es auf alle anwesenden Frauen abgesehen – selbst auf Menschenfrauen, die sie jedoch niemals mit nach Hause nahmen. Das ist ein Tabu, das in unserer Welt noch immer fest verankert ist. Die Moroi hatten sich jahrhundertelang von den Menschen fernhalten müssen, aus Furcht vor Entdeckung durch eine Rasse, die so groß und mächtig geworden war.
Das hieß allerdings nicht, dass die Männer allein nach Hause gingen. Irgendwann im Laufe des Abends tauchten für gewöhnlich auch Dhampir-Frauen auf – jeden Abend andere. Sie trugen tief ausgeschnittene Kleider und Unmengen von Make-up, sie tranken viel und lachten über alles, was die Männer sagten – was vermutlich nicht einmal besonders witzig war. Keine dieser Frauen hatte das Haar jemals hochgesteckt, aber hin und wieder drehten sie den Kopf so zur Seite, dass ihre Hälse entblößt wurden und man die dunkelblauen Flecken erkennen konnte. Sie waren Bluthuren – Dhampire, die einen Moroi beim Sex ihr Blut trinken lassen. Auch das war ein Tabu – obwohl es insgeheim dennoch geschieht.
Ich wünschte mir, einen der Moroi-Männer allein zu erwischen, abseits der wachsamen Augen seiner Wächter, sodass ich ihn befragen konnte, aber es war unmöglich. Die Wächter ließen ihre Moroi niemals unbeaufsichtigt. Ich versuchte sogar, ihnen zu folgen, aber wann immer die Gruppe den Klub verließ, verschwanden sie sofort in einer Limousine – und machten es mir damit unmöglich, ihnen zu Fuß zu folgen. Es war frustrierend.
Schließlich hatte ich beschlossen, mich heute Abend der ganzen Gruppe zu nähern und eine Entdeckung durch die Dhampire zu riskieren. Ich wusste nicht, ob tatsächlich jemand von zu Hause nach mir suchte, oder ob es die Gruppe überhaupt interessieren würde, wer ich war. Wahrscheinlich nahm ich mich selbst viel zu wichtig. Es lag definitiv im Bereich des Möglichen, dass sich niemand um eine entlaufene Schulabbrecherin scherte. Aber wenn tatsächlich jemand nach mir suchte, war meine Beschreibung zweifellos weltweit unter den Wächtern bekannt gemacht worden. Obwohl ich inzwischen achtzehn war, hätte ich es einigen Leuten durchaus zugetraut, mich an den Haaren zurück nach Amerika zu schleifen. Doch ich konnte auf keinen Fall zurückkehren, solange ich Dimitri nicht gefunden hatte.
Dann, gerade als ich darüber nachdachte, wie ich die Moroi ansprechen sollte, verließ eine der Dhampir-Frauen den Tisch, um zur Theke zu gehen. Die Wächter beobachteten sie natürlich, schienen sich aber keine Sorgen um ihre Sicherheit zu machen und waren mehr auf die Moroi fixiert. Die ganze Zeit über hatte ich gedacht, es wäre das Beste, mithilfe der Moroi-Männer an Informationen über ein Dorf voller Dhampire und Bluthuren zu kommen, aber was konnte besser sein, als gleich eine Bluthure nach diesem Ort zu fragen?
Ich schlenderte lässig durch den Raum an die Bar, als wollte ich mir ebenfalls einen Drink holen. Während die Frau auf den Barkeeper wartete, stand ich daneben und beobachtete sie aus den Augenwinkeln. Sie war blond und trug ein langes silbernes Paillettenkleid. Schwer zu sagen, ob mein schwarzes Etuikleid aus Satin daneben geschmackvoll oder eher langweilig wirkte. All ihre Bewegungen – selbst die Art, wie sie dastand – waren anmutig wie die einer Tänzerin. Der Barkeeper hatte mit anderen Gästen zu tun, und ich wusste, das hieß jetzt oder nie. Ich beugte mich zu ihr.
„Sprechen Sie Englisch?“
Sie zuckte überrascht zusammen und sah mich an. Sie war älter, als ich erwartet hatte; sie hatte ihr Alter geschickt unter dem Make-up verborgen. Sie taxierte mich schnell mit ihren blauen Augen und erkannte mich als Dhampir. „Ja“, sagte sie wachsam. Selbst das eine Wort wurde mit schwerem Akzent gesprochen.
„Ich suche nach einer Stadt … einer Stadt, wo viele Dhampire leben, draußen in Sibirien. Wissen Sie, wovon ich spreche? Ich muss diese Stadt finden.“
Wieder musterte sie mich, aber ich konnte ihre Miene unmöglich deuten. So wenig ihr Gesicht verriet, hätte sie genauso gut eine Wächterin sein können. Vielleicht war sie irgendwann im Laufe ihres Lebens zu einer solchen ausgebildet worden.
„Tun Sie’s nicht“, sagte sie schroff. „Lassen Sie’s gut sein.“ Sie wandte sich ab und richtete ihren Blick auf den Barkeeper, der gerade einen blauen, mit Kirschen dekorierten Cocktail mixte.
Ich berührte sie am Arm. „Ich muss diese Stadt finden. Da ist ein Mann …“ Die Worte blieben mir im Halse stecken. So viel zu meiner sachlichen Befragung. Allein der Gedanke an Dimitri genügte, dass mir das Herz in der Kehle pochte. Wie sollte ich das bloß dieser Frau erklären? Dass ich einem vagen Hinweis folgend den Mann suchte, den ich auf der ganzen Welt am meisten liebte – einen Mann, der in einen Strigoi verwandelt worden war und den ich jetzt töten musste? Selbst in diesem Moment konnte ich mir die Wärme seiner braunen Augen und die Berührung seiner Hände genau vorstellen. Wie sollte ich nur tun, wozu ich einen ganzen Ozean überquert hatte?
Konzentrier dich, Rose. Konzentrier dich.
Die Dhampir-Frau sah mich wieder an. „Er ist es nicht wert“, sagte sie. Offensichtlich hatte sie mich missverstanden. Zweifellos hielt sie mich für ein liebeskrankes Mädchen auf der Suche nach irgendeinem Typen – was ja gewissermaßen auch zutraf. „Sie sind zu jung … Für sie ist es noch nicht zu spät, all das zu vermeiden.“ Mochte ihr Gesicht auch leidenschaftslos sein, in ihrer Stimme lag eine tiefe Traurigkeit. „Gehen Sie und fangen Sie etwas anderes mit Ihrem Leben an. Halten Sie sich von diesem Ort fern.“
„Sie wissen, wo die Stadt ist!“, rief ich aus, zu aufgeregt, um ihr zu erklären, dass ich nicht dort hingehen wollte, um eine Bluthure zu werden. „Bitte – Sie müssen es mir sagen. Ich muss dorthin!“
„Gibt es ein Problem?“
Sowohl sie als auch ich drehten uns um und blickten in das grimmige Gesicht eines Wächters. Die Dhampir-Frau war sicher nicht ihre oberste Priorität, aber sie würden auf jeden Fall bemerken, wenn sie von jemandem schikaniert würde. Der Wächter war nur wenig älter als ich, und ich schenkte ihm ein süßes Lächeln. Zwar mochten meine Brüste nicht wie bei dieser anderen Frau beinahe aus dem Kleid hüpfen, aber ich wusste, dass der kurze Rock meine Beine ungemein vorteilhaft zur Geltung brachte. Dagegen war doch gewiss nicht einmal ein Wächter immun, oder? Nun, er anscheinend schon. Seine harte Miene zeigte deutlich, dass meine Reize ihn kaltließen. Aber ich schätzte, dass ich mein Glück genauso gut bei ihm versuchen und ihn einfach nach ein paar Informationen fragen könnte.
„Ich versuche, eine Stadt in Sibirien zu finden, eine Stadt, in der Dhampire leben. Kennen Sie sie?“
Er zuckte mit keiner Wimper. „Nein.“
Wunderbar. Beide stellten sich quer. „Ja, na ja, vielleicht weiß Ihr Boss etwas?“, fragte ich geziert und hoffte, wie eine angehende Bluthure zu klingen. Wenn die Dhampire nicht reden wollten, würde es womöglich einer der Moroi tun. „Vielleicht wünscht er ein wenig Gesellschaft und würde gerne mit mir reden.“
„Er hat bereits Gesellschaft“, antwortete der Wächter gelassen. „Mehr braucht er nicht.“
Ich hörte nicht auf zu lächeln. „Sind Sie sicher?“, schnurrte ich. „Vielleicht sollten wir ihn selber fragen.“
„Nein“, erwiderte der Wächter. In diesem einen Wort hörte ich die Herausforderung und den Befehl: Zieh dich zurück!Er würde nicht zögern, es mit jedem aufzunehmen, der eine mögliche Bedrohung für seinen Herrn darstellen könnte – selbst wenn es sich um ein niederes Dhampir-Mädchen handelte. Ich spielte mit dem Gedanken, es noch weiter zu versuchen, beschloss dann jedoch schnell, die Warnung ernst zu nehmen und mich tatsächlich zurückzuziehen.
Ich zuckte sorglos die Achseln. „Sein Pech.“
Ohne weitere Worte ging ich lässig zurück zu meinem Tisch, als sei die Zurückweisung keine große Sache. Doch während der ganzen Zeit hielt ich den Atem an und erwartete halb, dass der Wächter mich an den Haaren aus dem Klub schleifen würde. Das passierte allerdings nicht. Aber als ich meinen Mantel holte und etwas Kleingeld auf den Tisch legte, sah ich, dass er mich mit wachsamem, berechnendem Blick beobachtete.
Ich verließ die Nachtigall mit derselben gleichgültigen Haltung und trat hinaus auf die belebte Straße. Es war Samstagabend, und in der näheren Umgebung gab es jede Menge anderer Klubs und Restaurants. Partygänger füllten die Straßen, einige so herausgeputzt wie die Gäste der Nachtigall, während andere in meinem Alter und eher lässig gekleidet waren. Endlose Menschenschlangen vor den Klubs, laute, von starken Bässen begleitete Tanzmusik. Restaurants mit gläsernen Fronten zeigten elegante Gäste und üppig gedeckte Tische. Während ich, umgeben von russischen Gesprächen, durch die Menge ging, widerstand ich dem Verlangen, hinter mich zu schauen. Ich wollte keinen weiteren Verdacht erregen, falls dieser Dhampir mich noch beobachtete.
Doch als ich in eine stille Seitenstraße einbog, eine Abkürzung zurück zu meinem Hotel, konnte ich hinter mir leise Schritte hören. Ich hatte den Wächter anscheinend so sehr beunruhigt, dass er mir folgte. Nun, ich würde auf keinen Fall zulassen, dass er mir zuvorkam. Ich mochte kleiner sein als er – und ein Kleid und hochhackige Schuhe tragen –, aber ich hatte schon gegen einige Männer gekämpft, darunter auch Strigoi. Ich konnte mit diesem Burschen fertig werden, vor allem, wenn ich das Überraschungsmoment auf meiner Seite hatte. Nachdem ich mich mittlerweile so lange in diesem Viertel aufgehalten hatte, kannte ich seine Winkel und Wege sehr gut. Ich beschleunigte meinen Schritt und huschte um ein paar Ecken, bis ich in einer dunklen, verlassenen Gasse landete. Unheimlich, ja, aber sie bot eine gute Möglichkeit für einen Hinterhalt, wenn ich mich in einem Türrahmen versteckte. Leise stieg ich aus meinen hochhackigen Schuhen. Sie waren schwarz mit hübschen Lederriemchen, aber nicht gerade ideal für einen Kampf, es sei denn, ich wollte jemandem mit dem Absatz ein Auge ausstechen. Das war eigentlich gar keine schlechte Idee. Aber ganz so verzweifelt war ich nicht. Da es tagsüber geregnet hatte, war das Pflaster unter meinen nackten Füßen ohne die Schuhe empfindlich kalt.
Ich brauchte jedoch nicht lange zu warten. Einige Sekunden später hörte ich die Schritte und sah den langen Schatten meines Verfolgers auf dem Boden. Er blieb stehen, suchte nach mir. Also wirklich, dachte ich, dieser Bursche war extrem unvorsichtig. Kein Wächter, der jemanden verfolgte, wäre dabei so offensichtlich vorgegangen. Er hätte sich unauffälliger bewegen und sich nicht so leicht verraten sollen. Vielleicht war die Wächterausbildung hier in Russland nicht so gut wie die, mit der ich aufgewachsen war. Nein, das konnte nicht sein. Nicht wenn man bedachte, wie Dimitri sich seiner Feinde entledigt hatte. In der Akademie galt er als ein Gott.
Mein Verfolger ging noch einige Schritte weiter, und das war der Moment, in dem ich aktiv wurde. Ich sprang mit erhobenen Fäusten aus meinem Versteck. „Okay“, rief ich. „Ich wollte nur einige Fragen stellen, also verschwinden Sie, sonst …“
Ich erstarrte. Vor mir stand nicht der Wächter aus dem Klub.
Sondern ein Mensch.
Ein Mädchen, nicht älter als ich und ungefähr gleich groß, mit kurzem dunkelblondem Haar und einem marineblauen Trenchcoat, der ziemlich teuer aussah. Darunter trug sie eine schicke Anzughose und Lederstiefel, die genauso kostspielig wirkten wie der Mantel. Noch verblüffender war jedoch die Tatsache, dass ich sie kannte. Ich hatte sie zweimal in der Nachtigall mit Moroi-Männern reden sehen. Da ich annahm, dass sie einfach eine von den Frauen war, mit denen die Moroi gern flirteten, hatte ich prompt das Interesse an ihr verloren. Welchen Nutzen konnte ein Mensch schon für mich haben?
Ihr Gesicht lag zum Teil im Schatten, aber selbst in der schlechten Beleuchtung konnte ich ihre verärgerte Miene erkennen. Das war nicht ganz das, was ich erwartet hatte. „Du bist es, nicht wahr?“, fragte sie. Apropos Verblüffung. Ihr Englisch klang genauso amerikanisch wie mein eigenes. „Du bist diejenige, die überall in der Stadt eine Spur von Strigoi-Leichen hinterlässt. Ich habe dich heute Abend im Klub gesehen und wusste gleich, dass du es gewesen sein musst.“
„Ich …“ Mehr kam mir nicht über die Lippen, denn ich hatte keine Ahnung, wie ich reagieren sollte. Ein Mensch, der beiläufig über Strigoi sprach? So etwas hatte es noch nie gegeben. Das war noch erstaunlicher, als hier draußen tatsächlich einem Strigoi über den Weg zu laufen. Ich hatte noch nie zuvor etwas Derartiges erlebt. Doch meine Verblüffung schien sie überhaupt nicht zu kümmern.
„Hör mal, so etwas kannst du einfach nicht machen, okay? Weißt du, wie nervig es ist, mich darum zu kümmern? Diese Hospitanz ist schon schlimm genug, auch ohne dass du solch ein Chaos veranstaltest. Die Polizei hat übrigens die Leiche gefunden, die du im Park liegen gelassen hast. Du kannst dir nicht einmal vorstellen, an wie vielen Strippen ich ziehen musste, um das zu vertuschen.“
„Wer … wer bist du?“, fragte ich endlich. Es stimmte. Ich hatte wirklich eine Leiche im Park zurückgelassen, aber im Ernst, was hätte ich denn sonst tun sollen? Ihn in mein Hotel zurückschleppen und dem Pagen erzählen, mein Freund habe zu viel getrunken?
„Sydney“, sagte das Mädchen erschöpft. „Mein Name ist Sydney. Ich bin die für dieses Gebiet eingeteilte Alchemistin.“
„Die was?“
Sie seufzte laut, und ich war mir ziemlich sicher, dass sie die Augen verdrehte. „Natürlich. Das erklärt alles.“
„Nein, eigentlich nicht“, erwiderte ich, nachdem ich endlich die Fassung zurückgewonnen hatte. „So wie ich das sehe, bist du hier diejenige, die eine Menge zu erklären hat.“
„Ach, auch noch frech. Hat man dich hergeschickt, um mich zu testen? Oh Mann. Das ist es.“
Ich wurde langsam wütend. Es gefiel mir gar nicht, zurechtgewiesen zu werden. Erst recht nicht von einem Menschen, der es so klingen ließ, als sei es etwas Schlechtes, Strigoi zu töten.
„Hör mal, ich weiß nicht, wer du bist oder wieso du über diese Dinge Bescheid weißt, aber ich werde nicht hier stehen und …“
Übelkeit überkam mich, und ich spannte mich an, wobei ich mit der Hand unverzüglich nach dem silbernen Pflock griff, den ich stets in der Manteltasche bei mir hatte. Sydney stellte noch immer diese verärgerte Miene zur Schau, aber jetzt war diese angesichts der abrupten Veränderung meiner Körperhaltung mit Verwirrung gemischt. Sie war scharfsinnig, das musste ich ihr lassen.
„Was ist los?“, fragte sie.
„Du wirst dich gleich noch um eine weitere Leiche kümmern müssen“, sagte ich, gerade in dem Moment, als der Strigoi sie angriff.
2
Sydney anzugreifen und nicht mich war ganz schlechter Stil von dem Strigoi. Ich war schließlich die Bedrohung; er hätte mich zuerst ausschalten müssen. Aufgrund unserer Positionierung stand Sydney ihm jedoch im Weg, sodass er sich ihrer entledigen musste, bevor er an mich herankommen konnte. Er packte sie an den Schultern und riss sie an sich. Er war schnell – das waren sie immer –, aber ich hatte heute Nacht einen richtig guten Lauf.
Ein gezielter Tritt beförderte ihn gegen die Wand des Nachbargebäudes und befreite Sydney aus seinem Griff. Er ächzte bei dem Aufprall und sackte überrascht und benommen zu Boden. Es war nicht leicht, einem Strigoi zuvorzukommen, nicht bei ihren blitzschnellen Reflexen. Ohne sich weiter um Sydney zu kümmern, konzentrierte er seine Aufmerksamkeit auf mich; seine roten Augen funkelten wütend, und die zurückgezogenen Lippen entblößten seine Reißzähne. Er sprang mit übernatürlicher Geschwindigkeit vom Boden hoch und stürzte sich auf mich. Ich wich ihm aus und versuchte einen Boxhieb, dem er seinerseits auswich. Sein nächster Schlag traf mich am Arm, und ich stolperte, konnte gerade so mein Gleichgewicht halten. Mit der rechten Hand umklammerte ich noch immer meinen Pflock, aber ich wartete auf eine günstige Gelegenheit, um seine Brust zu treffen. Ein kluger Strigoi hätte sich so ausgerichtet, dass der direkte Weg zu seinem Herzen unzugänglich blieb. Dieser Mann machte seine Sache allerdings nur so lala, und wenn ich lange genug am Leben blieb, würde ich wahrscheinlich eine günstige Gelegenheit bekommen.
In diesem Moment sprang Sydney heran und schlug ihm auf den Rücken. Es war kein besonders kräftiger Schlag, aber er verblüffte den Strigoi. Das war die Gelegenheit. Ich sprintete, so schnell ich konnte, und warf mich mit meinem ganzen Gewicht auf ihn. Als wir gegen die Wand krachten, durchbohrte mein Pflock sein Herz. So einfach war das. Das Leben – das untote Leben oder was auch immer – entwich aus ihm. Er hörte auf, sich zu bewegen. Sobald ich mich davon überzeugt hatte, dass er tot war, riss ich den Pflock heraus und sah zu, wie sein Körper zu Boden sackte.
Genau wie bei den anderen Strigoi, die ich in letzter Zeit getötet hatte, erlebte ich einen Augenblick surrealer Gefühle. Was wäre gewesen, wenn es Dimitri gewesen wäre? Ich versuchte, mir Dimitris Gesicht bei diesem Strigoi vorzustellen, versuchte, mir bildlich vorzustellen, er läge vor mir. Mein Herz krampfte sich zusammen. Für den Bruchteil einer Sekunde war das Bild da. Dann – verschwunden. Es war nur ein x-beliebiger Strigoi.
Sofort rief ich mir ins Gedächtnis, dass ich mich um einige wichtige Dinge zu kümmern hatte. Ich musste nach Sydney sehen. Selbst bei einem Menschen meldeten sich meine Beschützerinstinkte. „Bist du okay?“
Sie nickte, wirkte erschüttert, aber davon abgesehen war sie unversehrt. „Gute Arbeit“, sagte sie. Sie hörte sich an, als versuche sie mit aller Macht, selbstbewusst zu klingen. „Ich habe nie … ich habe noch nie mit angesehen, wie einer von ihnen getötet wurde …“
Ich konnte mir nicht vorstellen, wie sie etwas Derartiges hätte beobachten sollen, andererseits verstand ich auch nicht, wieso sie überhaupt etwas von diesen Dingen wusste. Sie machte auf mich den Eindruck, als stünde sie unter Schock, daher griff ich nach ihrem Arm, um sie wegzuführen. „Komm, lass uns hier verschwinden und irgendwo hingehen, wo mehr Leute sind.“ Die Tatsache, dass Strigoi in der Nähe der Nachtigall herumlungerten, schien mir weniger abwegig, je länger ich darüber nachdachte. Gab es einen besseren Ort, sich an die Moroi heranzumachen, als einen ihrer Treffpunkte? Obwohl die meisten Wächter hoffentlich genug Verstand besaßen, um ihre Schützlinge von solchen Gassen fernzuhalten.
Der Vorschlag zu verschwinden riss Sydney aus ihrer Benommenheit. „Was?“, rief sie. „Du willst ihn auch einfach liegen lassen?“
Ich warf die Hände hoch. „Was erwartest du von mir? Ich könnte ihn vermutlich hinter diese Mülleimer zerren und ihn dann von der Sonne zu Asche verbrennen lassen. So mache ich es normalerweise.“
„Genau. Und was ist, wenn jemand auftaucht, um den Müll rauszustellen? Oder wenn jemand durch eine dieser Hintertüren kommt?“
„Ich kann ihn ja wohl kaum wegschleppen. Oder soll ich ihn in Brand setzen? Ein Vampirbarbecue würde bestimmt eine gewisse Aufmerksamkeit erregen, meinst du nicht auch?“
Sydney schüttelte verärgert den Kopf und ging zu dem Leichnam hinüber. Sie zog eine Grimasse, blickte auf den Strigoi hinab, griff in ihre große Lederhandtasche und zog eine kleine Phiole daraus hervor. Mit einer geschickten Bewegung träufelte sie deren Inhalt über den Leichnam und trat dann schnell zurück. Wo die Tropfen den Toten getroffen hatten, begann sich gelber Rauch zu kräuseln. Der Nebel bewegte sich langsam nach außen und breitete sich horizontal statt vertikal aus, bis er den Strigoi vollkommen einhüllte. Dann zogen sich die Schwaden immer weiter zusammen, bis nur noch ein faustgroßer Ball übrig blieb. Binnen weniger Sekunden war der Rauch restlos abgezogen und ließ ein unauffälliges Häufchen Staub zurück.
„Gern geschehen“, sagte Sydney entschieden, wobei sie mich immer noch missbilligend ansah.
„Was zum Teufel war das?“, rief ich.
„Mein Job. Kannst du mich bitte das nächste Mal anrufen, wenn so etwas passiert?“ Sie wandte sich ab und wollte gehen.
„Warte! Ich kann dich nicht anrufen – ich habe keine Ahnung, wer du bist.“
Sie drehte sich zu mir um und strich sich eine blonde Strähne aus dem Gesicht. „Wirklich? Du meinst es ernst, nicht wahr? Ich dachte, wenn ihr euren Abschluss macht, würde man euch allen von uns erzählen.“
„Oh, tja. Komische Sache … Ich habe, äh, nämlich keinen Abschluss gemacht.“
Sydneys Augen weiteten sich. „Du hast eins von diesen … Dingern … überwältigt, aber nie deinen Abschluss gemacht?“
Ich zuckte die Achseln, und sie schwieg einige Sekunden lang.
Schließlich seufzte sie abermals und sagte: „Ich schätze, wir müssen reden.“
Und ob wir das mussten. Die Begegnung mit ihr war das Seltsamste, was mir seit meiner Ankunft in Russland passiert war. Ich wollte wissen, warum sie dachte, ich hätte mich mit ihr in Verbindung setzen sollen, und wie sie diesen Strigoi-Leichnam aufgelöst hatte. Und als wir wieder auf belebte Straßen zurückkehrten und zu einem Café ihrer Wahl gingen, kam mir ein neuer Gedanke: Wenn sie über die Welt der Moroi Bescheid wusste, bestand die Möglichkeit, dass sie vielleicht auch wusste, wo Dimitris Dorf zu finden war.
Dimitri. Da war er wieder, tauchte einfach in meinen Gedanken auf. Ich hatte zwar keine Ahnung, ob er sich wirklich irgendwo in der Nähe seiner Heimatstadt herumtrieb, aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich ansonsten keinerlei Anhaltspunkte. Wieder überkam mich dieses unheimliche Gefühl. Mein Verstand überblendete Dimitris Gesicht mit dem des Strigoi, den ich soeben getötet hatte: bleiche Haut, rot geränderte Augen …
Nein, ermahnte ich mich streng. Schieb diese Gedanken jetzt erst mal beiseite. Keine Panik. Bis ich vor dem Strigoi Dimitri stand, würde ich die größte Kraft aus der Erinnerung an den Dimitri, den ich liebte, ziehen, mit seinen dunkelbraunen Augen, seinen warmen Händen, seinen leidenschaftlichen Umarmungen …
„Bist du okay … äh, wie immer du heißt?“
Sydney sah mich seltsam an, und mir wurde bewusst, dass wir vor einem Restaurant stehen geblieben waren. Ich wusste nicht, welchen Ausdruck mein Gesicht zeigte, aber er musste wohl eigenartig genug gewesen sein, um selbst ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Bisher hatte ich nämlich den Eindruck gehabt, dass sie so wenig wie möglich mit mir sprechen wollte.
„Ja, ja, alles bestens“, antwortete ich schroff und setzte meine Wächtermiene auf. „Und ich bin Rose. Das ist das Lokal?“
So war es. Das Restaurant war hell und fröhlich, wenn auch meilenweit entfernt von der Opulenz der Nachtigall. Wir ließen uns in einer Sitznische aus schwarzem Leder – womit ich Kunstleder meine – nieder, und ich stellte zu meinem Entzücken fest, dass die Speisekarte auf Russisch und mit englischen Übersetzungen sowohl russische als auch amerikanische Gerichte anzubieten hatte. Als ich gebratenes Huhn entdeckte, fing ich fast an zu sabbern. Mein Hunger war riesig, weil ich im Klub nichts gegessen hatte, und der Gedanke an frittiertes Fleisch war nach Wochen voller Kohlgerichte und sogenannter McDonald’s-Burger einfach zu verführerisch.
Eine Kellnerin kam an unseren Tisch, und während ich nur auf die Speisekarte zeigte, bestellte Sydney in fließendem Russisch. Hm, diese Sydney steckte voller Überraschungen. Angesichts ihrer forschen Art erwartete ich, dass sie mich sofort verhören würde, aber nachdem die Kellnerin gegangen war, blieb Sydney still, spielte nur mit ihrer Serviette herum und vermied jeden Blickkontakt. Das war echt merkwürdig. Sie fühlte sich in meiner Nähe ganz offensichtlich unwohl. Trotz des Tisches zwischen uns konnte sie scheinbar gar nicht genug Abstand halten. Doch ihre frühere Entrüstung war nicht gespielt gewesen, und sie hatte nachdrücklich darauf bestanden, dass ich ihren Regeln – um was auch immer es sich dabei handeln mochte – folgen müsse.
Nun, sie mochte sich zieren, aber ich zögerte nie, mich in unbehagliche Themen zu stürzen. Im Grunde war das sogar mein Markenzeichen.
„Also, bist du bereit, mir zu erzählen, wer du bist und was hier eigentlich los ist?“
Sydney schaute auf. Jetzt, da wir uns in hellerer Umgebung befanden, konnte ich erkennen, dass ihre Augen braun waren. Außerdem fiel mir auf, dass sie auf dem unteren Teil ihrer linken Wange eine interessante Tätowierung hatte. Die Tinte sah aus wie Gold – so etwas hatte ich noch nie zuvor gesehen – und formte ein kunstvolles Muster aus Blumen und Blättern, das nur dann wirklich zu sehen war, wenn sie den Kopf auf bestimmte Weise neigte und das Gold das Licht auffing.
„Das habe ich dir schon gesagt“, erwiderte sie. „Ich bin Alchemistin.“
„Und ich habe dir gesagt, dass ich nicht weiß, was das ist. Ist das ein russisches Wort?“ Es klang eigentlich nicht danach.
Ein schwaches Lächeln umspielte ihre Lippen. „Nein. Ich gehe davon aus, dass du auch von Alchemie noch nie etwas gehört hast, oder?“
Ich schüttelte den Kopf, und sie stützte das Kinn auf die Hand und richtete den Blick wieder auf den Tisch. Dann schluckte sie, als würde sie sich wappnen, und schließlich kam ein ganzer Schwall Worte über ihre Lippen. „Damals, im Mittelalter, gab es Leute, die davon überzeugt waren, dass sie – wenn sie nur die richtige Formel oder Magie finden würden – Blei in Gold verwandeln könnten. Natürlich konnten sie es nicht. Das hielt sie jedoch nicht davon ab, alle möglichen anderen mystischen und übernatürlichen Dinge zu erforschen, und irgendwann fanden sie dann tatsächlich etwas Magisches.“ Sie runzelte die Stirn. „Vampire.“
Ich dachte an meine Unterrichtsstunden zum Thema Moroi-Geschichte zurück. Tatsächlich fing unseresgleichen im Mittelalter an, sich vom Menschen zu lösen, sich zu verstecken und abzusondern. In jener Zeit wurden Vampire wirklich zu einem Mythos, soweit es den Rest der Welt betraf, und selbst die Moroi wurden für Ungeheuer gehalten, die gejagt werden mussten.
Sydney bestätigte meine Gedanken. „Und das war die Zeit, da die Moroi begannen, sich von den Menschen fernzuhalten. Sie hatten zwar ihre Magie, doch die Menschen waren ihnen zahlenmäßig überlegen, mit steigender Tendenz. Und so ist es auch heute noch.“ Dieser Umstand entlockte ihr ein halbes Lächeln. Die Fortpflanzung der Moroi war oft schwierig, während es den Menschen nur allzu leichtzufallen schien. „Und die Moroi schlossen ein Abkommen mit den Alchemisten. Wenn die Alchemisten den Moroi und Dhampiren und ihren Gesellschaften halfen, sich vor den Menschen zu verbergen, würden die Moroi uns die hier geben.“ Sie berührte die goldene Tätowierung.
„Was ist das?“, fragte ich. „Abgesehen vom Offensichtlichen.“
Sie strich sanft mit den Fingerspitzen darüber und machte sich nicht die Mühe, ihren Sarkasmus zu verbergen, als sie antwortete. „Mein Schutzengel. Es ist echtes Gold und“, sie verzog das Gesicht und ließ die Hand sinken, „Moroi-Blut, belegt mit der Magie der Elemente Wasser und Erde.“
„Was?“ Ich kreischte fast, und einige Leute im Restaurant drehten sich nach mir um. Sydney sprach weiter, und ihre Stimme war viel leiser – und sehr verbittert.
„Ich bin nicht gerade begeistert darüber, aber es ist unsere ‚Belohnung‘ dafür, dass wir euch helfen. Das Wasser und die Erde binden es an unsere Haut und verleihen uns einige Eigenschaften der Moroi, nun, einige wenige. Ich werde eigentlich nie krank. Und ich werde ein langes Leben haben.“
„Klingt doch ganz gut, oder?“, bemerkte ich unsicher.
„Vielleicht für manche Leute. Aber wir haben keine Wahl. Diese ‚Laufbahn‘ liegt in der Familie – sie wird immer weitergereicht. Wir müssen alles über Moroi und Dhampire lernen. Wir nutzen verschiedene Beziehungen unter den Menschen, die es uns erlauben, euch zu decken, da wir uns natürlich viel freier bewegen können als ihr. Wir kennen Tricks und Techniken, um die Leichen von Strigoi verschwinden zu lassen – wie diesen Trank, den du gesehen hast. Doch als Gegenleistung wollen wir so wenig wie möglich mit euch zu tun haben – was der Grund ist, warum man den meisten Dhampiren erst von uns erzählt, nachdem sie ihren Abschluss gemacht haben. Und Moroi erfahren es so gut wie gar nicht.“ Sie brach abrupt ab. Scheinbar war die Lektion vorbei.
Mir schwirrte der Kopf. Ich hatte so etwas nie, niemals für möglich gehalten. Moment mal. Oder vielleicht doch? Bei meiner Ausbildung war es zum größten Teil um die körperlichen Aspekte des Daseins eines Wächters gegangen: Wachsamkeit, Kampf etc. Doch vereinzelt hatte ich vage Andeutungen über Menschen gehört, die halfen, Moroi zu verstecken oder aus unheimlichen und gefährlichen Situationen herauszuholen. Ich hatte nie viel darüber nachgedacht oder auch nur den Ausdruck Alchemist gehört. Wäre ich in der Schule geblieben, hätte ich das vielleicht.
Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, diese Frage nicht zu stellen, aber das hätte meinem Wesen komplett widersprochen. „Warum behaltet ihr den Zauber für euch? Warum teilt ihr ihn nicht mit der Menschheit?“
„Weil seine Macht einen weiteren Aspekt besitzt. Sie hindert uns daran, in irgendeiner Weise über eure Art zu sprechen, die euch gefährden oder bloßstellen könnte.“
Ein Zauber, der sie am Sprechen hinderte … das klang verdächtig nach Zwang. Alle Moroi konnten ein wenig Zwang benutzen, und die meisten konnten auch einen Teil ihrer Magie in Gegenstände fließen lassen, um ihnen bestimmte Eigenschaften zu verleihen. Moroi-Magie hatte sich im Laufe der Jahre verändert, und mittlerweile galt diese Form der Einflussnahme als etwas Unmoralisches. Ich vermutete, dass diese Tätowierung ein sehr, sehr alter Zauber war, der die Jahrhunderte überdauert hatte.
Während ich im Geiste noch einmal alles durchging, was Sydney gesagt hatte, schossen mir weitere Fragen durch den Kopf. „Warum … warum wollt ihr euch von uns fernhalten? Ich meine, nicht dass ich jetzt unbedingt deine allerbeste Freundin werden will oder so …“
„Weil es unsere Pflicht Gott gegenüber ist, den Rest der Menschheit vor den bösen Kreaturen der Nacht zu beschützen.“ Geistesabwesend berührte sie mit der Hand etwas an ihrem Hals. Es wurde größtenteils von ihrer Jacke verdeckt, aber der offene Kragen gab für einen kurzen Moment den Blick auf ein goldenes Kreuz frei.
Meine anfängliche Reaktion darauf war Unbehagen, da ich nicht sehr fromm war. Tatsächlich fühlte ich mich in Gegenwart Strenggläubiger nie besonders wohl. Erst dreißig Sekunden später traf mich die volle Bedeutung ihrer letzten Worte.
„Moment mal, bitte“, rief ich entrüstet. „Redest du von uns allen – Dhampiren und Moroi? Wir sind alle böse Kreaturen der Nacht?“
Sie ließ die Hand von dem Kreuz sinken und antwortete nicht.
„Wir sind nicht wie Strigoi!“, blaffte ich.
Ihr Gesicht blieb ausdruckslos. „Moroi trinken Blut. Und Dhampire sind ihre unnatürlichen, mit Menschen gezeugten Sprösslinge.“
Niemand hatte mich je zuvor als unnatürlich bezeichnet, bis auf das eine Mal, als ich Ketchup auf die Tacos gestrichen hatte. Aber mal ehrlich, was hätte ich denn anderes tun sollen, nachdem uns die Salsasoße ausgegangen war? „Moroi und Dhampire sind nicht böse“, erklärte ich Sydney. „Schon gar nicht wie Strigoi.“
„Das ist wahr“, räumte sie ein. „Strigoi sind noch böser.“
„He, so hatte ich das nicht …“
In diesem Augenblick kam unser Essen, und das gebratene Huhn lenkte mich beinahe von meiner Entrüstung ab, mit einem Strigoi verglichen zu werden. Im Wesentlichen zögerte das Brathuhn meine unmittelbare Reaktion auf ihre Behauptungen aber nur hinaus. Ich biss in die goldene Knusperhaut und schmolz förmlich dahin. Sydney hatte sich einen Cheeseburger und Pommes frites bestellt und knabberte eher zaghaft an ihrem Essen.
Nachdem ich ein ganzes Hühnerbein verputzt hatte, war ich schließlich imstande, den Streit wieder aufzunehmen. „Wir sind ganz und gar nicht wie Strigoi. Moroi töten nicht. Du hast keinen Grund, Angst vor uns zu haben.“ Noch mal, ich war absolut nicht scharf darauf, mit Menschen vertraulich zu werden. Niemand von uns war das. Besonders nicht angesichts der Tatsache, dass Menschen dazu neigten, besonders schießwütig zu sein und mit allem herumzuexperimentieren, was sie nicht verstanden.
„Jeder Mensch, der von euch erfährt, wird unweigerlich auch von den Strigoi erfahren“, entgegnete sie. Sie spielte mit ihren Pommes, ohne sie tatsächlich zu essen.
„Das Wissen um die Strigoi könnte die Menschen doch befähigen, sich vor ihnen zu schützen.“ Warum zur Hölle spielte ich hier eigentlich des Teufels Advokaten?
Sie ließ die Fritte, mit der sie ohnehin nur herumgespielt hatte, wieder auf ihren Teller fallen. „Vielleicht. Aber es gibt viele Menschen, die der Gedanke an Unsterblichkeit in Versuchung führen würde – selbst um den Preis, einem Strigoi zu dienen, wenn sie dafür als Gegenleistung in eine böse Kreatur der Nacht verwandelt werden. Du wärst überrascht, wie viele Menschen darauf anspringen, wenn sie von Vampiren erfahren. Die Unsterblichkeit besitzt eine enorme Anziehungskraft – trotz des Bösen, das damit einhergeht. Unzählige Menschen, die von Strigoi erfahren, würden in der Hoffnung, irgendwann verwandelt zu werden, versuchen, ihnen zu dienen.“
„Das ist doch Wahnsinn …“ Ich verstummte. Im vergangenen Jahr hatten wir Beweise dafür gefunden, dass Menschen Strigoi geholfen hatten. Strigoi konnten silberne Pflöcke nicht berühren, aber Menschen konnten es sehr wohl, und einige hatten diese Pflöcke benutzt, um die Moroi-Magie zu zerstören. War diesen Menschen etwa Unsterblichkeit versprochen worden?
„Und das“, fuhr Sydney fort, „ist der Grund, warum es das Beste ist, wenn wir einfach dafür sorgen, dass niemand von euch erfährt. Ihr seid da draußen – ihr alle –, daran lässt sich nun mal nichts ändern. Ihr zieht euer Ding durch, um euch der Strigoi zu entledigen, und wir ziehen unser Ding durch und retten den Rest meiner Art.“
Ich nagte an einem Hühnerflügel und versuchte, mich nicht über ihre Andeutung aufzuregen, dass sie ihre Art auch vor Leuten wie mir retten müsse. In mancher Hinsicht ergaben ihre Worte durchaus einen Sinn. Es war unmöglich, dass wir uns stets unsichtbar durch die Welt bewegten, und – ja, dem konnte ich zustimmen – es war notwendig, dass irgendjemand Strigoi-Leichen entsorgte. Und Menschen, die mit Moroi zusammenarbeiteten, waren dafür perfekt geeignet. Sie wären imstande, sich freier in der Welt zu bewegen, insbesondere wenn sie die Art von Kontakten und Beziehungen hatten, auf die Sydney immer wieder anspielte.
Ich erstarrte mitten im Kauen, weil mir meine früheren Gedanken wieder einfielen, als ich mit Sydney hierhergelaufen war. Ich würgte den letzten Bissen hinunter und trank von meinem Wasser. „Ich habe noch eine Frage. Hast du Kontakte in ganz Russland?“
„Bedauerlicherweise“, sagte sie. „Wenn wir Alchemisten achtzehn werden, schickt man uns auf eine Hospitanzreise, um in unserem Handwerk eigene Erfahrungen zu sammeln und alle möglichen Beziehungen zu knüpfen. Ich wäre lieber in Utah geblieben.“
Das war fast noch verrückter als alles andere, was sie mir erzählt hatte, aber ich wollte nichts überstürzen. „Was genau sind das für Beziehungen?“
Sie zuckte die Achseln. „Wir verfolgen die Aktivitäten vieler Moroi und Dhampire. Wir stehen außerdem mit diversen hochrangigen Regierungsvertretern in Kontakt – unter Menschen und Moroi. Wann immer ein Vampir von einem Menschen beobachtet wird, sind wir zur Stelle und kennen normalerweise irgendein hohes Tier, das wiederum jemanden schmieren kann oder dergleichen … So wird alles schön unter den Teppich gekehrt.“
Die Aktivitäten vieler Moroi und Dhampire verfolgen. Jackpot. Ich beugte mich vor und senkte die Stimme. Alles schien von diesem einen Augenblick abzuhängen.
„Ich suche nach einem Dorf … einem Dhampir-Dorf im tiefsten Sibirien. Den Namen kenne ich nicht.“ Dimitri hatte den Namen nur ein einziges Mal erwähnt, und ich hatte ihn vergessen. „Das Dorf liegt irgendwo in der Nähe von … Omm.“
„Omsk“, korrigierte sie mich.
Ich richtete mich auf. „Kennst du es?“
Sie antwortete nicht sofort, aber ihre Augen verrieten sie. „Vielleicht.“
„Du kennst es und musst mir sagen, wo es ist. Ich muss dorthin.“
Sie verzog das Gesicht. „Willst du eine … eine von denen werden?“
Also wussten Alchemisten auch über Bluthuren Bescheid. Keine Überraschung. Wenn Sydney und ihre Verbündeten alles andere über Vampire wussten, würden sie natürlich auch das wissen.
„Nein“, sagte ich hochmütig. „Ich muss nur jemanden finden.“
„Wen?“
„Jemanden.“
Das entlockte ihr beinahe ein Lächeln. Ihre braunen Augen hatten einen nachdenklichen Ausdruck angenommen, während sie an einer Pommes knabberte. Sie hatte nur zweimal von ihrem Cheeseburger abgebissen, und die Dinger wurden rasend schnell kalt. Am liebsten hätte ich ihn einfach selbst gegessen, aus Prinzip.
„Ich bin gleich wieder da“, sagte sie plötzlich. Sie stand auf und ging in eine stille Ecke des Cafés. Dort zog sie aus ihrer magischen Handtasche ein Handy hervor, wandte dem Raum den Rücken zu und rief jemanden an.
Ich hatte inzwischen mein ganzes Hühnchen vertilgt und bediente mich an ihren Pommes frites, da es immer weniger danach aussah, als hätte sie noch irgendetwas damit vor. Während ich aß, grübelte ich über die vor mir liegenden Möglichkeiten nach und fragte mich, ob es wirklich so einfach sein konnte, Dimitris Stadt zu finden. Und sobald ich dort ankäme … würde es dann auch noch so einfach sein? Würde er dort draußen in den Schatten leben und Jagd auf Moroi machen? Und wenn ich ihm gegenüberstand, konnte ich ihm wirklich meinen Pflock ins Herz rammen? Dieses unerwünschte Bild tauchte wieder vor mir auf, Dimitri mit roten Augen und …
„Rose?“
Ich blinzelte. Ich war total weggetreten gewesen. Sydney war wieder da. Sie ließ sich auf ihren Platz mir gegenüber gleiten. „Also, es sieht so aus …“ Sie hielt inne und musterte ihren Teller. „Hast du welche von meinen Pommes gegessen?“
Ich hatte keinen Schimmer, woher sie das wissen konnte, da es doch so ein riesiger Haufen war. Ich hatte kaum eine Delle hinterlassen. Weil ich vermutete, dass mein Frittendiebstahl als weiterer Beweis dafür angesehen werden würde, dass ich eine böse Kreatur der Nacht war, sagte ich aalglatt: „Nein.“
Sie runzelte kurz die Stirn, dachte nach und sagte dann: „Ich weiß, wo diese Stadt liegt. Ich war schon einmal dort.“
Ich richtete mich auf. Verdammte Scheiße. Nach all diesen Wochen hatte das Suchen nun bald ein Ende. Sydney würde mir sagen, wo ich diese Stadt fand, und ich konnte endlich dort hinfahren und versuchen, dieses schreckliche Kapitel meines Lebens abzuschließen.
„Danke, ich danke dir so sehr …“
Sie hob eine Hand, um mich zum Schweigen zu bringen, und da erst fiel mir auf, wie unglücklich sie aussah.
„Aber ich werde dir nicht sagen, wo sie liegt.“
Mir klappte der Unterkiefer herunter. „Was?“
„Ich werde dich selbst dort hinbringen.“
3
„Moment mal, bitte – was?“, rief ich.
Das gehörte nicht zu meinem Plan. Das gehörte ganz und gar nicht zu meinem Plan. Ich versuchte doch, mich so unauffällig wie möglich durch Russland zu bewegen. Außerdem gefiel mir der Gedanke überhaupt nicht, jemanden im Schlepptau zu haben – schon gar nicht jemanden, der mich zu hassen schien. Ich wusste auch nicht, wie lange die Reise nach Sibirien dauern würde – einige Tage wahrscheinlich –, und ich fand die Vorstellung ziemlich unangenehm, mir während der ganzen Fahrt von Sydney anhören zu müssen, was für ein unnatürliches, böses Wesen ich sei.
Ich schluckte meine Gefühle hinunter und versuchte es mit vernünftiger Argumentation. Schließlich bat ich hier um einen Gefallen. „Das ist wirklich nicht nötig“, sagte ich und zwang mich zu einem Lächeln. „Es ist nett von dir, mir das anzubieten, aber ich will dir keine Unannehmlichkeiten machen.“
„Nun“, erwiderte sie trocken, „das lässt sich leider nicht vermeiden. Und ich bin auch nicht nett. Es ist nicht einmal meine Entscheidung. Es ist ein Befehl von meinen Vorgesetzten.“
„Es klingt trotzdem, als wäre es furchtbar lästig für dich. Warum verrätst du mir nicht einfach, wo die Stadt ist, und pfeifst auf deine Befehle?“
„Offensichtlich kennst du die Leute nicht, für die ich arbeite.“
„Muss ich auch nicht. Ich widersetze mich ständig allen Autoritäten. Es ist gar nicht so schwer, wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat.“
„Ach ja? Und wie funktioniert dann die Suche nach diesem Dorf?“, fragte sie spöttisch. „Hör mal, wenn du dorthin willst, ist das die einzige Möglichkeit.“
Na ja – es war nur dann die einzige Möglichkeit, mein Ziel zu erreichen, wenn ich Sydney als Informationsquelle benutzte. Ich konnte ja immer noch weiter in der Nachtigall nachforschen … aber ich hatte schon so lange gebraucht, um von dort aus eine Spur zu finden. In der Zwischenzeit saß Sydney mit der Information, die ich brauchte, direkt vor meiner Nase.
„Warum?“, fragte ich. „Warum musst du auch hinfahren?“
„Das kann ich dir nicht sagen. Fazit: Sie haben es mir befohlen.“
Entzückend. Ich musterte sie und versuchte herauszufinden, was hier vor sich ging. Warum zum Henker sollte sich irgendjemand – insbesondere Menschen, die mit der Moroi-Welt zu tun hatten – dafür interessieren, wohin ein einziger Dhampir-Teenager ging? Ich glaubte nicht, dass Sydney irgendwelche fiesen Hintergedanken hatte – es sei denn, sie war eine sehr, sehr gute Schauspielerin. Doch die Leute, denen sie unterstellt war, verfolgten offensichtlich eine gewisse Absicht, und es gefiel mir nicht, jemandem in die Hände zu spielen. Gleichzeitig brannte ich natürlich darauf, diese Sache hinter mich zu bringen. Jeder Tag, der verstrich, war ein weiterer Tag, an dem ich Dimitri nicht fand.
„Wann können wir aufbrechen?“, fragte ich schließlich. Sydney, so sagte ich mir, war doch wohl eher eine Büromaus. Sie hatte bisher jedenfalls kein echtes Geschick darin gezeigt, mich aufzuspüren. Bestimmt würde es nicht allzu schwierig werden, sie unterwegs abzuschütteln, sobald wir Dimitris Stadt nahe genug waren.
Meine Antwort schien sie irgendwie zu enttäuschen, beinahe so, als hätte sie gehofft, ich würde ablehnen, und sie wäre dann vom Haken. Sie wollte mich ebenso wenig begleiten, wie ich sie bei mir haben wollte. Schließlich öffnete sie ihre Handtasche, nahm ihr Handy wieder heraus, hantierte ein paar Minuten lang damit herum und ermittelte die Abfahrtzeiten passender Zugverbindungen. Sie präsentierte mir den Fahrplan für den nächsten Tag.
„Ist das okay für dich?“
Ich betrachtete das Display und nickte. „Ich weiß, wo dieser Bahnhof ist. Ich werde dort sein.“
„In Ordnung.“ Sie stand auf und warf etwas Kleingeld auf den Tisch. „Wir sehen uns dann morgen.“ Sie marschierte los und drehte sich nach einigen Schritten noch einmal zu mir um. „Oh, und du kannst den Rest meiner Pommes haben.“
Nach meiner Ankunft in Russland war ich zunächst nur in Jugendherbergen abgestiegen. Ich hatte zwar genug Geld, um anderswo unterzukommen, aber ich hatte niemanden auf mich aufmerksam machen wollen. Außerdem stand Luxus für mich zu keiner Zeit an erster Stelle. Seit ich jedoch in die Nachtigall