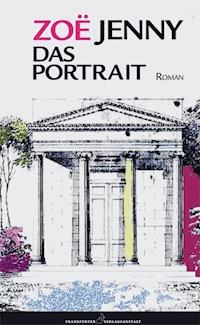Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Debütromane in der FVA
- Sprache: Deutsch
Jo, die Protagonistin des Romans, hat gerade ihr Abitur gemacht. Kurz entschlossen entscheidet sie sich, zu ihrer Mutter in das südliche Land zu reisen, in dem diese mit ihrem neuen Mann lebt. 12 Jahre haben sie sich nicht gesehen, die Annäherung erweist sich als schwierig. Ganze zwei Jahre, viel länger als sie geplant hatte, bleibt sie schließlich in dem Haus von Alois, dem schwermütigen Maler. Als dieser bei einem Autounfall stirbt und ihre Mutter sich im Blütenstaubzimmer einschließt, so, als wolle sie sich lebendig begraben, ist es Jo, die sie retten kann. Doch zu größerer Nähe kommt es nicht. Desillusioniert und abgestoßen von den Lebenslügen der Erwachsenen vollzieht Jo Schritt für Schritt die Trennung. Wie eine Schlangenhaut wirft sie die Welt ihrer Kindheit ab. In kurzen, glasklaren Sätzen entsteht das Lebensbild einer jungen Frau von heute. Mit nur wenigen Federstrichen zeichnet die Autorin Orte und Unorte für echte und inszenierte Leidenschaften und besticht dabei durch ihre Bilder, die von überraschender und treffsicherer Schärfe sind. "Es geht um die Unbehaustheit, um die Grundstimmung der Verlorenheit - um meine Generation", so die 23jährige Autorin in einem Interview. Das Blütenstaubzimmer kann als ein geglückter literarischer Entwurf einer neuen Generation gelten, als literarischer Zugang zu der Welt der jungen Menschen im ausgehenden Jahrtausend. Zoë Jenny gewann 1997 beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt für ihren Roman das 3sat-Stipendium. Noch im gleichen Jahr folgten weitere Auszeichnungen: der Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung und der aspekte-Literaturpreis des ZDF. Das Blütenstaubzimmer, ihr literarisches Debut, erreichte bisher eine verkaufte Gesamtauflage von über 100.000 Exemplaren und wurde in 26 Sprachen übersetzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Titelseite
Impressum
Kapitel I
Kapitel II
Zoë Jenny
Das Blütenstaubzimmer
Roman
Frankfurter Verlagsanstalt
9. Auflage, 90. Tausend 1998
© Frankfurter Verlagsanstalt GmbH, Frankfurt am Main 1997
Alle Rechte vorbehalten
Schutzumschlag- und Einbandgestaltung: Bertsch & Holst
Herstellung: Katja Holst
eISBN: 978-3-627-02181-8
Mehr über Zoë Jenny unter:
http://www.frankfurter-verlagsanstalt.de
I
Als meine Mutter ein paar Straßen weiter in eine andere Wohnung zog, blieb ich bei Vater. Das Haus, in dem wir wohnten, roch nach feuchtem Stein. In der Waschküche stand eine Druckmaschine, auf der mein Vater tagsüber Bücher druckte. Immer, wenn ich vom Kindergarten nach Hause kam, ging ich zu ihm in die Waschküche, und wir stiegen gemeinsam in die Wohnung hinauf, wo wir unser Mittagessen kochten. Abends vor dem Einschlafen stand er neben meinem Bett und zeichnete mit einer glühenden Zigarette Figuren ins Dunkel. Nachdem er mir heiße Milch mit Honig gebracht hatte, setzte er sich an den Tisch und begann zu schreiben. Im rhythmischen Gemurmel der Schreibmaschine schlief ich ein, und wenn ich aufwachte, konnte ich durch die geöffnete Tür seinen Hinterkopf sehen, ein heller Kranz von Haaren im Licht der Tischlampe, und die unzähligen Zigarettenstummel, die, einer neben dem anderen, wie kleine Soldaten den Tischrand säumten.
Da die Bücher, die mein Vater verlegte, nicht gekauft wurden, nahm er eine Stelle als Nachtfahrer an, damit er tagsüber weiterhin die Bücher drucken konnte, die sich erst im Keller und auf dem Dachboden und später überall in der Wohnung stapelten.
Nachts fiel ich in einen unruhigen Schlaf, in dem die Träume zerstückelt an mir vorbeischwammen wie Papierschnipsel in einem reißenden Fluß. Dann das klirrende Geräusch, und ich war hellwach. Ich blickte an die Decke zu den Spinnengeweben empor und wußte, daß mein Vater jetzt in der Küche stand und den Wasserkessel auf den Herd gesetzt hatte. Sobald das Wasser kochte, ertönte ein kurzes Pfeifen aus der Küche, und ich hörte, wie Vater den Kessel hastig vom Herd nahm. Noch während das Wasser tropfenweise durch den Filter in die Thermoskanne sickerte, zog der Geruch von Kaffee durch die Zimmer. Darauf folgten rasch gedämpfte Geräusche, ein kurzer Moment der Stille; mein Atem begann schneller zu werden, und ein Kloß formte sich in meinem Hals, der seine volle Größe erreicht hatte, wenn ich vom Bett aus sah, wie Vater, in seine Lederjacke gehüllt, leise die Wohnungstür hinter sich zuzog. Ein kaum hörbares Klack, ich wühlte mich aus der Bettdecke und stürzte ans Fenster. Langsam zählte ich eins, zwei, drei; bei sieben sah ich, wie er mit schnellen Schritten die Straße entlangging, eingetaucht in das dumpfe Gelb der Straßenlaterne; bei zehn war er stets beim Restaurant an der Ecke angelangt, wo er abbog. Nach weiteren Sekunden, in denen ich den Atem anhielt, hörte ich den Motor des Lieferwagens, der laut ansprang, sich entfernend immer leiser wurde und schließlich ganz verstummte. Dann lauschte ich in die Dunkelheit, die langsam, ein ausgehungertes Tier, aus allen Ecken kroch. In der Küche knipste ich das Licht an, setzte mich an den Tisch und umklammerte die noch warme Kaffeetasse. Suchte den Rand nach den braunen, eingetrockneten Flecken ab, das letzte Lebenszeichen, wenn er nicht mehr zurückkehrte. Allmählich erkaltete die Tasse in meinen Händen, unaufhaltsam drang die Nacht herein und breitete sich in der Wohnung aus. Sorgfältig stellte ich die Tasse hin und ging durch den schmalen hohen Gang in mein Zimmer zurück.
Vor dem Fensterrechteck, aus dem ich zuvor meinen Vater beobachtet hatte, hockte jetzt das Insekt, das mich böse anglotzte. Ich setzte mich auf die äußerste Kante des Bettes und ließ es nicht aus den Augen. Jederzeit konnte es mir ins Gesicht springen und seine knotigen, pulsierenden Beine um meinen Körper schlingen. In der Mitte des Zimmers tobten Fliegen um die Glühbirne. Ich starrte in das Licht und auf die Fliegen, und aus den Augenwinkeln beobachtete ich das Insekt, das schwarz und regungslos vor dem Fenster kauerte.
Nach und nach wickelte mich Müdigkeit ein wie warmes Fell. Ich strengte mich an, zwischen den nur noch halb geöffneten Augenlidern die einzelnen Fliegen zu unterscheiden, doch sie schlossen sich mehr und mehr zu einem in der Luft schwirrenden Kreis. Das Insekt kicherte, und ich spürte seine Fühler langsam über den Boden auf meine vom Bett hängenden Füße zukriechen. Ich rannte in die Küche und hielt den Kopf unter das kalte Wasser. Meine Blase war angeschwollen und schmerzte. Ich traute mich nicht, auf die Toilette zu gehen, die auf dem Zwischenstock lag, weil das Licht im Treppenhaus nach kurzer Zeit ausging. Ich spürte das Insekt, das sich in meinem Zimmer regte und nur darauf wartete, mich im dunklen Treppenhaus zu überfallen. In der Küche auf und ab gehend, begann ich die Lieder vor mich hin zu summen, die wir im Kindergarten gelernt hatten. Nur wenige Lieder konnte ich auswendig, weshalb ich sie immer wieder anders zusammensetzte. Mit dem Anschwellen des Schmerzes in der Blase wurde auch meine Stimme lauter, von der ich inständig hoffte, sie trüge mich aus meinem Körper heraus. Schließlich blieb ich vor dem Küchenschrank stehen und pinkelte in ein Gefäß, das ich zwischen die Beine klemmte. Sobald das Morgenlicht durch das Küchenfenster schimmerte, zog sich das Insekt in seine ferne Welt zurück. Die Dunkelheit wurde langsam verschluckt. Erschöpft ging ich in mein Zimmer zurück und wühlte mich in die Bettdecke. Um sieben Uhr läutete das Telefon. Es war Vater, der von unterwegs anrief, um mich zu wecken.
Manchmal blieb die Nacht draußen. Im Fensterrechteck spiegelten sich dann die Köpfe, die zur Stimme von Mick Jagger hin und her wackelten. Ich saß auf den Knien einer Frau und half ihr, die Flasche mit den vier Rosen auf dem Etikett an den Mund zu setzen.
Wenn sie den Kopf lachend nach hinten warf, lief der Alkohol aus den Mundwinkeln und rann in feinen Linien über die gepuderten Wangen. Am meisten lachte sie, wenn Vater in seinem wilden Tanz, bei dem er sich mit fliegenden Armen um sich selbst drehte, über einen Stapel Papier oder Bücher stolperte; dann prustete sie den Alkohol aus ihren aufgeblasenen Backen angenehm kühl über mein Gesicht. »Willst du ein Geheimnis wissen?« fragte ich sie und nahm ihr die Flasche vom Mund.
»Ein Geheimnis?« Sie gluckste. Schob das Wort wie eine Süßigkeit im Mund herum.
»Geheimnisse mag ich«, sagte sie und drückte dem jungen Mann neben ihr einen Kuß auf die Wange. »Komm, ich zeig dir eines«, sagte ich. Ihre Hand lag warm und willenlos in der meinen, als ich sie durch das von Büchern und Flaschen verbaute Arbeitszimmer meines Vaters führte. In meinem Zimmer ließ sie sich aufs Bett plumpsen und setzte die Flasche wieder an den Mund, während ich die Zeichnungen unter dem Kleiderschrank hervorholte.
»Was ist das?« Sie schaute mit großen wäßrigen Augen auf die schwarzen Kleckse.
»Das Insekt. Es kommt immer nachts, wenn ich alleine bin, und frißt meinen Schlaf.«
»Ahh ja?« Sie blickte mich mit gerunzelter Stirn an; ich nahm ihr die Zeichnungen aus den Händen und versteckte sie wieder unter dem Schrank.
»Glaubst du an Gott?« fragte ich.
Aber als ich mich umdrehte, war sie bereits auf den Boden gesunken, die leere Flasche im Arm. Ich beugte mich über sie und versuchte sie vorsichtig wach zu rütteln. Sie bewegte sich nicht mehr, nur ihre rosa Augendeckel zuckten aufgeregt im Schlaf. Aus dem Arbeitszimmer meines Vaters drang noch immer Musik und lautes Gelächter. Ich löschte das Licht. Heute würde sich das Insekt nicht trauen. Und falls es doch noch kommen sollte, lag neben meinem Bett ein Körper, felsig und schwer.
Eines Nachts hatte mein Vater einen Unfall. Er war am Steuer eingeschlafen und gegen einen Baum gefahren. Er hatte einen Schock erlitten und lag zwei Wochen mit Fieber im Bett. Ich steckte das Telefon aus, zog die Vorhänge vor den Fenstern zu, und wenn es an der Tür klingelte, ignorierten wir es. Sowieso nur einer, der Geld will, sagte mein Vater müde und drehte sich auf die andere Seite. Im Kindergarten meldete er mich krank; paß auf, daß dich niemand sieht, sagte er zu mir, wenn ich zum Laden an der Ecke ging, um Zigaretten und Sandwiches zu holen. Ich schlüpfte in die zu große Windjacke, die uns mit anderen Kleidern von einem wohltätigen Amt zugeschickt worden war, zog die Kapuze über den Kopf und rannte die Straße hinunter zum Laden.
Das Tageslicht sickerte durch die gelben Vorhänge, und wenn es draußen sehr schön war, lagen matte Sonnenstreifen auf der Bettdecke. Diese Strahlen haben einen weiten Weg hinter sich, sagte Vater, sie ruhen sich jetzt bei uns aus. Ich holte Nico und Florian, meine einzigen und besten Freunde, und setzte sie in einen Sonnenstreifen. Ich glaube, sie wollen eine Reise machen, sagte ich. Nico, ein blauer Schnuller, der vom vielen Daraufherumkauen schon ganz abgewetzt war, saß auf dem rechten, Florian, ein gelber Schnuller, auf dem linken Fuß meines Vaters. In jeder Hand einen Schnuller, hüpfte ich über die Bettdecke, überquerte Täler, Berge und Seen zwischen den Stoffalten und landete schließlich auf dem Kopf meines Vaters, einem Labyrinth aus dunklen Haaren. Wir müssen nie mehr hinausgehen, sagte ich zu ihm, wir haben alles hier, die Sonne und die Berge, die Seen und die Täler. Ich ging in die Küche und in mein Zimmer und zog auch dort die Vorhänge zu. Von meinem Fenster aus sah ich die Kinder der Nachbarschaft auf den Knien am Boden herumrutschen und bunte Glaskugeln in die Vertiefung des gußeisernen Schachtdeckels rollen. Spiel mit ihnen, hatte Vater immer gesagt, wenn ich, auf dem Wäschetrockner sitzend, ganze Tage in der Waschküche verbrachte und zuschaute, wie das Papier von den Druckwalzen eingesogen und unten frisch bedruckt wieder ausgespuckt wurde. Aber ich bin nicht zu ihnen hinausgegangen, sondern habe sie vom Fenster meines Zimmers aus beobachtet. Die Mädchen kicherten schadenfroh, wenn ein Junge nicht richtig zielte, die Kugel dann auf die Straße rollte und durch ein Abflußgitter fiel. Zur Strafe wurden die Mädchen auf den Rücken gelegt, und die Jungen spuckten ihnen der Reihe nach von oben ins Gesicht. Wenn es regnete, verschwanden sie alle zusammen durch die dicke Glastür ins gegenüberliegende Haus. Die graue Fassade wurde vom Regen fast schwarz. Die erleuchteten Fenster darin waren wie friedliche kleine Inseln. Erst dann wäre ich gerne bei ihnen gewesen und beneidete sie, in einem dieser Lichter zu sein.
Eines Nachmittags beschloß ich, mit Nico und Florian eine Schiffsreise zu machen. Wir gehen auf ein Schiff, eines, wie Sindbad es hatte, erklärte ich Vater, holte alle Decken und Kissen, die ich in der Wohnung fand, baute aus ihnen einen Hügel auf seinem Bett und setzte mich in die Mitte. Vater, eine Riesenkrake, breitete seine Arme um den Deckenhügel, und das Schiff sank auf und nieder, bis es im tobenden Sturm krachend kippte und wir am Boden lagen, Kissen und Decken wild zerstreut. Wieder einmal hatten wir den Sturm besiegt. Kaum war der Sturm abgezogen, läutete es an der Tür. Eine Frau mit rotblonden Haaren stöckelte das Treppenhaus herauf, in unsere Wohnung hinein und verschwand mit meinem Vater in der Küche.
Ich sammelte die Kissen und Decken ein, unser vom Sturm zertrümmertes Schiff, und lauschte der fremden lauten Stimme hinter der geschlossenen Küchentür.
Bald darauf mietete mein Vater für die Frau ein leerstehendes Zimmer im oberen Stockwerk. Dort hatte sie auf dem Boden neben der Matratze die Bücher mit den Sternen aufgereiht. Ihr Finger fuhr über die glänzende schwarze Seite. Hier ist der Große Bär und hier der Drachen, sagte sie zu mir; aber ich sah keinen Bären und keinen Drachen; nur wild hingestreute weiße Punkte auf dunklem Grund. Wenn sie nicht mit gekreuzten Beinen und geschlossenen Augen auf der Matratze saß, hockte sie rauchend in der Küche mit Männern, die aufmerksam ihrem Gekreische zuhörten. Eliane lachte nicht; sie kreischte, und ihr Gesicht wurde rot dabei. Ich verabscheute sie, wenn sie so in der Küche saß, und auch die Männer, die mich an sich zogen und meine langen Haare berührten.
»Richtige Spaghettihaare«, sagten sie dann und grinsten.
»Laß meine Haare in Ruhe, Arschloch«, fauchte ich und riß mich los.
»Wo hat sie dieses Wort nur wieder her?« wunderten sie sich gespielt, brüllten wieder los und freuten sich an Elianes rotem Gesicht. Viel lieber sah ich sie stumm auf der Matratze in ihrem Zimmer sitzen.
»Wenn man meditiert, vergißt man alles um sich herum, man denkt nichts mehr«, sagte sie.
»Weiß man nicht einmal mehr seinen eigenen Namen?«
»Nicht einmal den, und man vergißt einfach alles, auch wo man sich im Augenblick befindet.«
»Aber wo ist man dann?«
»Im Nichts«, sagte sie ernst.
»Was ist im Nichts?«
»Muß jeder selbst rausfinden.«
Als ich zur Tür hereinkam, sah sie aus wie eine Statue. Die sonst gerötete Haut, die sich um ihre Backenknochen spannte, war bleich und wächsern. Der geschlossene Mund eine Festung, ich hätte Angst davor haben können. Aber ihre nervös zuckenden Wimpern verrieten sie. Ich hielt ihr meinen Handrücken unter die Nase und fühlte auf der Haut ihren zögernden, ängstlichen Atem.
»Ich weiß, daß du weißt, daß ich hier bin«, sagte ich. Ihre Augen schlugen auf, der Mund spitzte sich zu einer winzigen dunklen Öffnung, dann knallte sie mir eine Ohrfeige und stellte mich vor die Tür. Von da an blieb die Tür zu ihrem Zimmer verschlossen.
Als mein Vater sie schließlich geheiratet hatte, saß sie immer öfter in der Küche. Ich sah sie Orangen schälen, rauchen, bergeweise Nüsse essen. Auf dem Tisch waren immer mehrere Hügel Nußschalen, dazwischen standen Gläser und riesige überquellende Aschenbecher. Diese flogen ab und zu ins Arbeitszimmer meines Vaters. Eliane wirbelte dann ihren rotblonden Kopf herum und stapfte brüllend durch die Wohnung. Nach einem dieser Anfälle, wie Vater ihre Wutausbrüche in verständnisvollem Ton zu bezeichnen pflegte, schenkte er ihr ein Computerspiel in Taschenformat. Ein Feuerwehrmann mußte mit dem Schlauch in ein brennendes Haus eindringen und durch geschickte Sprünge den herunterfallenden Dachziegeln ausweichen. Eliane saß damit stundenlang ruhig in der Küche. Ich vergaß sie, und irgendwann war sie verschwunden. Sie hinterließ einen Slip mit blauen Blümchen und ein ausgetrocknetes Deodorant, das ich beim Wischen unter dem Küchenschrank fand. Ein Jahr später kam eine Karte. Eine Fotografie von einem weißen Sandstrand und vornübergebeugten Palmen: Gruß aus dem fröhlichen Spanien. Eliane. Ich fragte mich, ob sie jetzt vielleicht mit gekreuzten Beinen unter diesen Palmen säße und sich einbildete, nicht da zu sein.
Die Sonntage verbrachte ich bei meiner Mutter. Abends stand sie mit aufgestecktem Haar vor dem großen Spiegel und fuhrwerkte mit Stiften und Schwämmchen in ihrem Gesicht herum. Ich reichte ihr die Döschen und Fläschchen, die auf dem Fensterbrett standen, und schraubte die wertvoll aussehenden Blumen und tropfenförmigen Verschlüsse von den Parfümflaschen. Sobald der Babysitter kam, löste sie ihr Haar, das sich braun und duftend über ihrem Rücken auffächerte, und verschwand in die Nacht hinaus. Später weckte mich ihr Wimmern aus dem Schlaf, und ich tastete mich im Dunkeln zu ihrem Bett. Sie lag unter der farbigen Blumendecke, geschüttelt von mir unbegreiflichen geheimnisvollen Schmerzen. Von ihrem Gesicht sah ich nur ein Dreieck aus Nasenspitze und Mund, der Rest lag unter ihren weißen Händen begraben. Nach einer Weile schlug sie die Decke zurück, und ich kroch hinein in das salzigwarme Bett.
Einmal in der Woche holte sie mich mittags von der Schule ab. Von weitem sah ich sie neben dem Eisentor stehen, und ich rannte über den Schulhof auf sie zu. Sie nahm mich an der Hand, und wir gingen zusammen in die Stadt. In den Umkleidekabinen, die nach Schweiß und Plastik rochen, packte sie einige Kleider in die große Schultertasche, die anderen legte sie wieder in die Regale zurück. Sobald sie an der Kasse ein paar Socken oder ein T-Shirt bezahlt hatte, streichelte sie meinen Kopf, wie man frischgeborene Kätzchen streichelt, und die Verkäuferinnen, die uns durchs Schaufenster nachschauten, klatschten entzückt in die Hände. Das waren Tage, an denen es haufenweise Schokoladenkuchen gab und das Gesicht meiner Mutter weich und fröhlich war. Im Restaurant, während ich aus einem Trinkhalm meinen Sirup schlürfte, griff meine Mutter immer wieder in die Tasche, nach dem Stoff, ihr Mund stand leicht offen, und die Augen waren riesengroß, als sei es kaum zu ertragen, und ich wußte, sie war glücklich. Zu Hause entfernte sie mit der Schere die Preisetiketten von den Kleidern, hängte sie sorgfältig an den Kleiderständer und rollte ihn langsam und mit dem erhobenen Kopf einer Königin, die vor ihr Reich tritt, ins Zimmer.
Immer wieder wartete ich nach Schulschluß stundenlang vor dem Eisentor auf sie. Aber sie kam nicht mehr. Ich fragte Vater, ob mit ihr etwas geschehen sei, aber er schüttelte den Kopf und schwieg.
Doch nach einigen Wochen stand sie wieder da, küßte mich aufs Haar und hieß mich ins Auto steigen. Diesmal fuhren wir nicht in die Stadt, und ich freute mich. Sie parkte an einem Waldweg. Ich übersprang die Lücken zwischen den Zacken, die die Räder eines Traktors in die von der Hitze brüchige Erde gestoßen hatten. Das helle Kleid meiner Mutter bauschte sich wolkig um ihren Körper, und ich ahnte, daß sie gleich etwas Wichtiges sagen würde. Aber sie schwieg, den ganzen Weg, bis die Spuren des Traktors immer undeutlicher wurden und wir auf einer Wiese standen. Meine Mutter legte sich hin, ich legte mich neben sie auf die trockene Erde und spürte neben mir ihren glatten, pochenden Hals. Sie sagte, daß sie einen Mann, Alois, getroffen habe, den sie liebe, so wie sie einmal meinen Vater geliebt habe, und daß sie mit ihm fortgehen werde, für immer. Überall, wo ich hinsah, waren diese gelben und roten Blütenköpfe, die einen Duft ausströmten, der mich schwindlig und müde machte. Ich drehte mich zur Seite; das Ohr auf den Boden gepreßt, hörte ich ein Summen und Knistern, als bewege sich da etwas tief unter der Erde, während ich ihren weit entfernten Mund weiterreden sah und ihre Augen, die in den Himmel schauten, der wie eine greifbare blaue Scheibe über uns schwebte.
II
Außer ein paar ausgemergelten Katzen, die sich fauchend um die herumliegenden Abfälle streiten, sind die Gassen um die Mittagszeit leergefegt. Der Wind trägt den Geruch der von der Hitze erwärmten Pisse durch die Häuserreihen, vermischt mit dem Geruch von Desinfektionsmitteln und Tomatensauce, der aus den geöffneten Küchenfenstern dringt. Teller werden scheppernd auf Tische geknallt, die Stimme eines Kindes dringt aus einem Hauseingang.
Hinter dem Bankgebäude liegt der Park. Dort sitzen Mütter mit Thermoskannen und belegten Broten auf den Bänken und schauen ihren in den Sandkästen spielenden Kindern zu. Heute ist der Park leer, und ich gehe wie immer auf den Musikpavillon zu, in dem wahrscheinlich nie gespielt wird, auch sonntags nicht, denn er ist mit Brettern zugenagelt. Ich setze mich daneben auf eine Bank und warte, bis es Zeit ist, Lucy abzuholen.