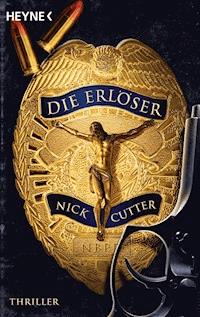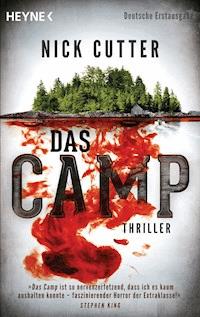9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Little Heaven – ein kleines, einsam gelegenes Bergdorf im Hinterland von New Mexico. Die Einwohner sind rechtschaffen und arbeiten hart. Doch ein Schatten liegt über Little Heaven. Das Böse ist zurückgekehrt – und einmal entfesselt, scheint niemand es besiegen zu können. Während ein verborgener religiöser Kult seine Fänge ausbreitet, machen sich drei Abenteurer auf, die Mächte des namenlosen Schreckens zum Kampf zu fordern …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 816
Ähnliche
Das Buch
Sie sind ein ungleiches Trio, eine verschworene Gemeinschaft; drei Glücksritter und Abenteurer: Micah Shughrue, Minerva Atwater und Ebenezer Elkins, genannt der »Englishman«. Zusammen haben sie viel erlebt, darunter Dinge, die sie am liebsten vergessen würden, Dinge, über die man nach Einbruch der Dunkelheit besser nicht mehr spricht.
Eines Tages wendet sich die junge Ellen an sie. Ellens Neffe ist offenbar in das kleine, abgelegene Städtchen Little Heaven verschleppt worden, wo ein geheimer religiöser Kult regiert. Der Auftrag für Ebenezer und seine Gesellen ist einfach: Sie sollen den Jungen finden und wieder zurückholen.
Doch als die drei in Little Heaven ankommen, passieren seltsame, beunruhigende Dinge. In den Wäldern finden sich überall seltsame rituelle Zeichen, und über allem thront unheilvoll der schwarze Schatten eines gigantischen Monolithen, des Black Rock.
Misstrauen und Paranoia greifen unter den Bewohnern um sich. Mehrere Kinder verschwinden. Ebenezer, Micah und Minerva geraten mehr und mehr in eine Spirale des Wahnsinns. Das Böse ist nach Little Heaven gekommen. Das Böse will sie alle … und schließlich müssen unsere Helden erkennen, dass alle Fluchtwege aus Little Heaven abgeschnitten sind.
Der Autor
Nick Cutter ist das Pseudonym eines preisgekrönten Autors, der bereits mehrere Kurzgeschichten und Romane schrieb. Cutter tritt an, um frisches Blut in das Genre des zeitgemäßen Horrors zu pumpen. Er lebt in Toronto, Kanada.
NICK CUTTER
DAS BÖSE
THRILLER
Aus dem Englischenvon Frank Dabrock
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Die Originalausgabe LITTLE HEAVEN erschien 2017bei Gallery Books, An Imprint of Simon & Schuster, Inc., New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Vollständige deutsche Erstausgabe 03/2019
Copyright © 2017 by Craig Davidson
Copyright © 2019 der deutschsprachigen Ausgabeby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Sven-Eric Wehmeyer
Umschlagillustration: animagic / Splitter GmbH & Co KG, Dirk Schulz
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN: 978-3-641-21211-7V001
www.heyne.de
Da war ein Haus aus Dämmerung gemacht. Gemacht aus Blütenstaub und Regen, und das Land war uralt und ewig. Die Hügel hatten alle Farben, und die Ebene leuchtete von bunten Tonerden und Sand.
– N. SCOTT MOMADAY
PROLOG
ENTFÜHRT
1980
1
Ein altes Sprichwort besagt: Das Böse stirbt nicht, es schläft nur. Und wenn das Böse erwacht, geschieht das beinahe lautlos.
Selbst Insekten können schreien.
Und das tat die kleine Blattlaus, wenn auch in einer Tonlage, die zu hoch für das menschliche Ohr war. Die Laus knabberte an den Wurzeln einer Kaktuspflanze, die in New Mexico am Rande der Wüste stand. Das Insekt war so klein, dass man es mit bloßem Auge kaum erkennen konnte.
So fing alles an. So fing es wieder an.
Während sich die Blattlaus an dem Zucker in den Wurzeln labte, schlängelte sich aus den tiefsten Tiefen der Erde etwas empor und schlüpfte in ihren Körper. Bestimmt hatte sie Schmerzen, aber sie brachte nichts weiter als diesen leisen Schrei hervor.
Die Laus krabbelte von der Wurzel durch den lockeren Sand zu einem der fleischigen Kaktusblätter hinauf. Dort traf sie auf eine Honigameise, die von ihrem Honigtau fraß.
Für einen kurzen Moment berührten sich ihre Fühler, und was auch immer in die Laus eingedrungen war, schlüpfte geräuschlos in den Körper der Ameise.
Mit einem leisen Zischen platzte der Körper der Blattlaus auseinander.
Die Honigameise huschte durch das gelbliche Licht der Nachmittagssonne zurück zu ihrem Hügel und verschwand im Eingangsloch. Kurz darauf strömten Scharen wild zappelnder Ameisen aus dem Hügel.
Wie abmarschbereite Soldaten stellten sie sich in Reih und Glied auf und rückten entschlossen vorwärts, bis sie an das Erdloch einer Wühlmaus gelangten. Zu Tausenden und Abertausenden krabbelten sie in das Loch, worauf ein qualvolles Quieken zu hören war.
Im selben Moment kam die Maus aus dem Loch hervorgeschossen. Sie hüpfte zitternd umher, und ihre Haut kräuselte sich. Dann drehte sie sich ein paar Mal wild im Kreis, richtete sich auf und flitzte ins trockene Gras. Hin und wieder blieb sie stehen, knabberte an ihrer Haut und leckte das Blut ab. Schließlich lief ihr eine Wüstenspitzmaus über den Weg, und einen Augenblick später ertönte ein stumpfsinniges Kreischen, schmerzerfüllt und verwirrt.
Irgendwann traf die Wüstenspitzmaus auf ein Opossum, das wiederum auf einen Eselhasen traf, der kreischend im Maul eines Kitfuchses landete. Winselnd schlug der Fuchs um sich und stürzte in die Höhle einer Wieselkatzenfamilie. Erneut hallten Schreie über die öde Sandfläche.
Dann wurde es Nacht, und in der Dunkelheit wankte etwas aus der Höhle. Der Mond erleuchtete seinen merkwürdig gestauchten Körper, der im fahlen Licht feucht schimmerte. Es atmete durch zahlreiche Mäuler, und aus einem wulstigen, blutverschmierten Fellknäuel starrte ein Bündel Augen hervor. Die Kreatur hatte zu viele Beine, die wie der Balg eines Akkordeons zusammengequetscht waren, sodass sie sich wie ein Krebs fortbewegte. Lautlos schleppte sich das Ungetüm über den Sand, während es mit seinen vier Schnauzen die Witterung aufnahm.
Auf einem Felsen hockte ein einsamer Wolf und ließ seinen Blick über die Ebene wandern. Er war schon alt und mit Narben übersät, und vor langer Zeit hatte er bei einem Kampf um sein Revier ein Ohr verloren – einen Kampf, den er wie alle anderen gewonnen hatte. Er sah, wie eine Gestalt in sein Sichtfeld wankte. Dieses Ding bewegte sich nicht wie die anderen Tiere. Es bewegte sich, als wäre es verletzt. Trotzdem sagte ihm sein Jagdinstinkt: Nein, nein, nein – dieses Ding war nicht verletzt. Es war … etwas anderes.
Der Wolf trottete den Felsen hinab, um es sich genauer anzusehen. Er war zwar wachsam, aber er hatte keine Angst. Falls dieses Wesen Schmerz empfand, falls es bluten konnte, würde der Wolf es in Stücke reißen.
Er verspürte keine Furcht, weil er am Ende der Nahrungskette stand. In seinem langen Leben war er kein einziges Mal einem Tier begegnet, das ihm ebenbürtig war.
Ein paar Stunden später schleppte sich das Ding, das inzwischen sehr viel größer war, zu einer dunklen Sandfläche. Die Bäume, die auf dem schwarzen, öligen Erdreich wuchsen, waren knorrig und gekrümmt und schienen sich mit unbeugsamem Lebenswillen gegen ihr Leid zu stemmen.
Eifrig begann das Ding zu graben. Nach und nach wurde das Loch größer und tiefer und der Sand immer dunkler, bis er schimmerte wie Vulkangestein, als wäre er mit Teer durchtränkt.
Schließlich stieß das Ding auf etwas, das in der unnatürlichen Dunkelheit begraben war. Mit seinen zahlreichen Schnauzen schnüffelte es daran, während es keuchte und quiekte.
Plötzlich bewegte sich dieses Etwas. Zitternd stieß es einen Schwall Luft aus, und mit wilden Bewegungen krabbelte die Kreatur rückwärts aus dem Loch.
Irgendwo am weiten Himmel ertönte der Schrei eines Raubvogels.
2
Als Petty Shughrue mitten in der Nacht erwachte, hatte sie Gänsehaut am ganzen Körper.
Pet. Meine süße kleine Pet.
Sie setzte sich auf. Durch die Ritzen in den Wänden des Bauernhauses pfiff der Wind.
Komm zu mir, Pet. Komm und sieh, komm und sieh …
Die Stimme klang einladend und lieblich. Aber in ihr schwang noch etwas anderes mit. Etwas Verdorbenes und Anstößiges, als würde einen vom Grund eines Tümpels das Gesicht eines toten Mannes anstarren.
Pet, meine Pet, oh meine wunderschöne Pet …
Sie hob ihre Beine aus dem Bett, und die Piniendielen unter ihren nackten Füßen fühlten sich kalt an. Sie trug das Nachthemd, das ihre Mutter für sie genäht hatte, als sie noch zu klein dafür gewesen war. In dieser Hinsicht war ihre Mutter ihr stets zwei Schritte voraus – es war typisch für sie, Petty ein neues Nachthemd zu nähen, bevor sie aus dem alten herausgewachsen war. Inzwischen hatte sich ihre Mutter verändert, aber Petty behielt sie lieber so in Erinnerung.
Ihre Kehle brannte vor Durst, und sie ging in die Küche, vorbei an dem Stützbalken, wo ihr Vater an jedem ihrer Geburtstage mit einem Filzstift ihre aktuelle Größe einzeichnete. Pettys Füße strichen über den Boden – merkwürdig, normalerweise wurde ihr Vater jedes Mal von den knarzenden Holzdielen wach; er hatte einen so leichten Schlaf, dass das Geräusch eines Spatzen, der auf dem Fensterbrett landete, ausreichte, um ihn aufzuwecken. Manchmal dachte Petty, dass er überhaupt nicht schlief. Dass er nur die Augen schloss und so tat.
Von irgendwoher, weit entfernt – wie der Gesang am Rand eines Traumes –, hörte sie die Melodie einer Flöte.
Ich warte, mein Kind …
Sie trat ins Freie. Die Nacht war kühl, und das Gras unter ihren Füßen fühlte sich weich an. Der Mond wurde von einer schmalen, dunklen Wolke zerschnitten. Petty lief zur Wasserpumpe und stellte den Eimer unter das Rohr. Die Pumpe gab ein Quietschen von sich, als sie den Hebel hin und her bewegte. Das Wasser plätscherte in den Eimer, wo es silbern schimmerte … aber es sah nicht aus wie Wasser. Es war zu dickflüssig und roch leicht nach Kupfer.
Meine Pet, oh meine Pet, so süß wie sonnengewärmter Honig …
Sie tauchte eine Schöpfkelle in den Eimer und hob sie an ihre Lippen, obwohl sich tief in ihrem Innern etwas dagegen sträubte.
Nein nein tu’s nicht trink es nicht das ist …
Das Wasser schmeckte nach Salz und Metall. Wie geschmolzenes Eisen, dachte sie. Sie trank mehr davon. Das tat gut, obwohl es ihren Durst nicht löschte. Im Gegenteil, sie wurde noch durstiger davon.
Zu ihrer Linken krabbelte etwas herum. Beunruhigt drehte sie sich in die Richtung der Bewegung.
Irgendetwas stand dort. Stand? Nein, es kauerte. Riesig und unförmig, wie ein Haufen Steine, der mit einem Leinentuch bedeckt war. Die einzelnen Teile schienen sich unabhängig voneinander zu bewegen, und die ganze Masse zischte und stieß ein leises Quieken und Knurren hervor. Aus seiner Flanke ragte der Kopf eines Wolfes – als hätte man ihn getötet, enthauptet und den Kopf an der Seite befestigt … aber Petty vermutete, dass der Kopf irgendwie zu diesem Ding gehörte und zusammen mit dem Rest dieser aberwitzigen Ansammlung eine Einheit bildete.
Der fleischgewordene Albtraum wankte näher, und Petty fröstelte am ganzen Körper.
Hinter diesem grauenvollen Etwas stand noch etwas anderes. Eine längliche, spindeldürre Gestalt, die weitgehend an einen Menschen erinnerte. Sie sah aus, als hätte man einen menschlichen Körper zum Schmelzen gebracht und wie ein Karamellbonbon in die Länge gezogen.
Obwohl die Gestalt nichts sagte, konnte Petty die grimmige, lakonische Bösartigkeit spüren, die sie verströmte – gleichzeitig machte sie auf das Mädchen einen gelangweilten Eindruck, als wäre sie all der schrecklichen Dinge, die sie gesehen und getan hatte, längst überdrüssig. Petty hatte das Gefühl, dass dieses Ding vollkommen, durch und durch, abgrundtief böse war und deshalb tun musste, was es schon immer getan hatte, wie sehr es sich dabei auch langweilen mochte.
»Meine Pet«, sagte es. »Mein süßer kleiner Fratz …«
Es hob etwas an seine Lippen. Eine aus einem Knochen geschnitzte Flöte.
Und als es zu spielen begann, blieb Petty keine andere Wahl, als ihm zu folgen.
TEIL I
DER RUFDESSCHWARZENFELSENS
1980
1 DER LÖWE IM WINTER
Als Micah Henry Shughrue erwachte, umhüllte ihn tiefe Dunkelheit; es war, als hätte man die Schwärze unzähliger Nächte über ihm ausgebreitet. Sie drang in Mund und Augenhöhlen, erfüllte seine Nasenlöcher und lastete schwer auf seiner Brust.
Er setzte sich auf, während ein Gefühl unsagbarer Furcht durch seine Eingeweide jagte – eine Woge des Grauens durchflutete seinen Körper, als würde eine Horde kranker Ratten durch seine Adern huschen. Er streckte die Hand nach seiner Frau aus. Die Knochen unter Ellens dünner Haut waren zart wie die eines Vogels. Sie atmete ruhig und gleichmäßig.
Micah griff nach dem Glasauge in der Schüssel auf dem Nachttisch. Er nahm es zum Schlafen immer heraus, aber er wollte nicht, dass Petty ihn ohne sah – das Gewebe in der leeren Augenhöhle war hart wie Schweinsleder. Er drückte das Auge in die Höhle und sagte: »Ich schau mal nach Pet.«
Ellen antwortete nicht. Sie sagte nie etwas. Ihre Augen waren zwar geöffnet – das waren sie inzwischen so gut wie immer –, aber sie wurden von den feuchten Wattepads unter ihren Lidern verdeckt.
Im Schlafanzug stieg Micah aus dem Bett. Das Schlafzimmer ihrer Tochter ging von der Küche ab. Es herrschte Stille, als er sich seinen Weg durch das Haus bahnte. Vorsichtig öffnete er die Tür zum Zimmer seiner Tochter. Er spürte sofort, dass sie nicht da war. In der dichten Dunkelheit war niemand.
Keuchend stand Micah da, während sein verbliebenes Auge sich langsam an die Finsternis gewöhnte. Die Bettdecke war an einer Ecke zurückgeschlagen, als wäre seine Tochter aus dem Bett gestiegen, um etwas Wasser zu trinken – so, wie sie das im Sommer manchmal tat, wenn das Haus von bleierner Hitze erfüllt war. Eines Abends hatte er sie bei der Pumpe angetroffen, der Saum ihres Nachthemds feucht vom Wasser. Er hatte mit ihr geschimpft, denn er wollte nicht, dass sie es sich zur Gewohnheit machte, nachts nach draußen zu gehen. Aber das Wasser aus der Pumpe sei kühler, hatte sie gesagt, es sei sehr viel besser als das lauwarme Zeug aus dem Wasserhahn in der Küche.
»Pet?«, sagte er jetzt, obwohl er sich fast sicher war, dass er keine Antwort bekommen würde. Für ihn stand fest, dass seine Tochter verschwunden war.
Seit dem Tag ihrer Geburt hatte er sich vor diesem Moment gefürchtet.
Micah eilte durch das Haus, doch seine Tochter war nicht da. Als sein Blick auf die offene Küchentür fiel, verkrampfte er am ganzen Körper. Er trat ins Freie. Im Schein des Mondes erstreckten sich endlos flache Felder, und vor dem Horizont zeichnete sich die Hügelkette der Black Montains ab.
»Pet?«, rief er. »Pet?«
Der Wind umspielte seine Fußknöchel. Schließlich kehrte Micah ins Haus zurück. Dort schlüpfte er in seine Stiefel, zog seinen Staubmantel an und ging wieder nach draußen.
Er ließ seinen Blick über die Felder wandern, die im Mondlicht silbern schimmerten. Dahinter, einige Kilometer entfernt, erhoben sich mehrere flache Hügel, die im Sommer mit leuchtend hellen Kermesbeeren überzogen waren. Die Scheunentür stand offen – hatte er vergessen, sie zu schließen? Er überquerte das Feld und trat durch die Tür. Er tastete sich seinen Weg zwischen den zitternden Pferden hindurch und kletterte die Leiter zum Heuboden hinauf.
Der Koffer lag noch dort, wo er ihn abgestellt hatte, bedeckt mit einer dicken Pferdehaardecke. Er hatte seit Jahren keinen Blick darauf geworden. Darin befanden sich die Habseligkeiten aus seinem früheren Leben. Und dieses Kapitel blieb am besten für immer geschlossen.
Das Innere des Koffers roch nach Waffenöl und getrocknetem Blut. Er nahm beide Pistolen heraus. Es fühlte sich gut an, sie in den Händen zu halten. Als wären die beiden Waffen Brüder oder Schwestern, als würde er nach Hause zurückkehren.
Es handelte sich um zwei umgebaute Exemplare. Micah hatte die russischen Tokarews für Patronen vom Kaliber .45 aufgebohrt und die Läufe auf zehn Zentimeter abgefeilt. Außerdem hatte er die Visiere abgeschliffen – sie waren aus kurzer Entfernung nutzlos und konnten sich beim Ziehen der Waffen verhaken. Eine der beiden Pistolen hatte einen Perlmuttgriff, die andere einen aus Sandelholz. Er lud die beiden Pistolen und steckte sie in die Taschen seines Staubmantels.
Ich hätte nicht schlafen dürfen, dachte er. Ich hätte wachsam bleiben müssen.
Fünfzehn Jahre. Das war eine lange Zeit, um auf jemanden aufzupassen. Verdammt lang, wie abgebrüht man auch sein mochte. Man kann, während man schläft, versuchen, ein Auge offen zu halten und auf die Menschen, die man liebt und umsorgt, aufzupassen … aber jeder muss irgendwann mal schlafen.
Er hatte es kommen sehen, nicht wahr? Etwas, das sich um seine Familie herum zusammenbraute – es fühlte sich so ähnlich an wie die donnernden Hufe einer Herde herangaloppierender Pferde. Es war unvermeidlich gewesen. Genauso gut hätte er versuchen können, vor sich selbst davonzulaufen. Man kann dem Teufel kein Schnippchen schlagen. Wenn man Glück hat und ein wenig verrückt ist, kann man die Begegnung mit ihm eine Weile hinauszögern, aber am Ende wird er einen aufspüren.
Von einem Kiefernzweig hing ein Stofffetzen. Das Kohlblumen-Muster darauf war vom Waschen ausgeblichen. Der Fetzen stammte von Pettys Nachthemd.
Micah lief über einen Teppich aus braunen Kiefernadeln zwischen die Bäume. Sein Körper schmerzte. Seine Knie brannten, und seine Arme waren schwer und langsam. Das Alter verwandelt uns alle in ein Bild des Jammers. Es gab nicht die geringste Spur – da war kein Blut, Gott sei Dank, und die nackten Füße seiner Tochter würden keine Abdrücke hinterlassen. Sein Herz pochte heftig, und er achtete darauf, wo er hintrat, während er das gesunde Auge halb geschlossen hatte, als würde er gleich wieder einschlafen. Die Furcht, die er beim Aufwachen verspürt hatte, die Furcht, die ihm beim Anblick des leeren Bettes seiner Tochter einen Stich versetzt hatte, war jetzt verflogen. Er verfluchte seine eigene Gelassenheit – jene Eigenschaft, die ihn früher von seinen Konkurrenten unterschieden hatte. Aber jetzt empfand er sie als Schwäche.
Bedeutet mir meine Tochter so wenig, dass ich keine echte Panik verspüre? Welcher andere Vater würde unter diesen Umständen so reagieren?
Er kam an eine Lichtung. Im Mondschein stand eine Gestalt, so schwarz, als hätte man ihren Körper aus der Nacht gestanzt. Sie rührte sich nicht, aber Micah sah, dass ihre Augen – es waren so viele – auf ihn gerichtet waren, erfüllt von einer Mischung aus bösartigem Spott und einem Anflug von Mitleid; es war der Blick einer Otter, die eine Feldmaus fixierte.
»Gib sie zurück«, sagte Micah.
Das schwarze Etwas trottete vorwärts. Es schien, als würde sein Körper vor Vergnügen zittern. Die Gestalt verbreitete einen strengen Geruch, der Micah an jene Nacht vor vielen Jahren erinnerte, als er in einem Hotel in Carson City von einem Kratzen hinter den Wänden geweckt worden war. Aus einem daumennagelgroßen Loch in einer Ecke waren unzählige Rossameisen – die größten, die er je gesehen hatte – hervorgeströmt und hatten sich wie brodelnder dunkler Sirup über den Putz ausgebreitet. Von ihnen war derselbe trockene, faulige Gestank ausgegangen, den er jetzt riechen konnte – nach Metall und Essig und irgendwie vulgär.
Das Ding gab ein heiseres Glucksen von sich. Versuchte es, etwas zu sagen? Es hüpfte und wirbelte umher, während sich seine Körperteile in sämtliche Richtungen bewegten. Die Haare auf Micahs Arm richteten sich auf. Ihn überkam ein starkes Déjà-vu-Gefühl, und ihm wurde schlecht. Das hier war schon einmal passiert. Dennoch kam es ihm vor wie ein Traum, wie etwas, das sich in einer Fantasiewelt zugetragen hatte – an einem fernen Ort, vor langer, langer Zeit.
»Gib sie zurück«, wiederholte er.
Das Ding stieß ein zähes Rasseln hervor; vielleicht versuchte es zu lachen. Sein Kopf oder vielmehr einer seiner Köpfe neigte sich zur Seite – zu weit, als wäre der Hals gebrochen, als hätte er unter dem Gewicht des rundlichen Schädels nachgegeben …
… doch Micah wusste, dass es kein Kopf war. Menschen und Tiere hatten Köpfe, und dieses Ding war weder das eine noch das andere. Es war sehr lange her, dass Micah es mit einer derartigen Kreatur zu tun gehabt hatte. Beim Anblick ihrer zitternden Umrisse fühlte er sich entsetzlich müde, als wären seine Knochen mit Blei gefüllt.
Das Ding schüttelte sich, und man hätte fälschlicherweise annehmen können, dass es so etwas wie Freude zum Ausdruck brachte; sein geriffelter, speckiger Körper zitterte. Warum sprach Micah überhaupt mit ihm? Er wusste bereits, wo Petty war – oder in Bälde sein würde. Er spuckte auf die braunen Kiefernnadeln und griff nach seinen beiden Pistolen.
»Wofür zum Henker brauche ich dich überhaupt?«
Mit einem lauten Knall blitzten die Waffen in seinen Händen auf, und die Kugeln durchsiebten die Kreatur. Teile ihres Körpers wurden fortgerissen und in die Dunkelheit geschleudert. Die Kreatur sackte zu Boden und versuchte, auf Micah zuzukriechen oder sich auf ihn zu werfen, während sie sich mit gewundenen Bewegungen ruckartig vorwärtsschleppte. Micah hielt inne, denn das Schießpulver brannte in seiner Nase. Dann legte er genau an und jagte dem Ding die verbliebenen vier Kugeln in seine zahlreichen Schädel. Das Ding zuckte zusammen und bäumte sich auf. Dann rührte es sich nicht mehr.
Micah lud seine Pistolen nach. Die eine steckte er in seine Tasche, und mit der anderen in der Hand ging er auf das Ding zu.
Es verströmte einen fauligen Geruch, während es bäuchlings dalag und ein merkwürdiges Brummen von sich gab. Das Wesen sah so ähnlich aus wie die Kreaturen, mit denen Micah es vor einigen Jahren zu tun gehabt hatte. Es war aus den Körperteilen unterschiedlicher Tierarten zusammengesetzt, seine Knochen standen schräg ab, und das entblößte Fettgewebe schimmerte buttergelb im Mondlicht. Micah konnte den verschrumpelten Kopf einer Wieselkatze ausmachen, der mit dem Panzer eines Gürteltiers verwachsen war. Außerdem sah er Körperteile von Vögeln, Fischen und Schlangen – und einen Streifen gelbbraunen Fleisches, das früher vielleicht den Schädel eines unglückseligen Wanderers bedeckt hatte. Das faltige Geflecht aus Gewebe und Fell war mit Maden und Eiterbeulen übersät.
An einer Seite hing der Kopf eines Wolfes herunter. Seine Augen waren herausgesaugt worden und hatten sich mit den zahlreichen ausdruckslosen Augen in der Mitte der Brust verbunden.
Micah hatte keine Ahnung, wie diese Ungetüme zustande kamen. Er kannte sie lediglich als Handlanger seines früheren Widersachers. Allerdings hatte er keinerlei Vorstellung davon, was für einen bösartigen Geist ihre Körper beherbergten. Das Brummen wurde lauter, und die Masse aus verunstaltetem Fleisch zog sich zusammen. Micah trat zurück. Einer der Schädel der Kreatur – ohne Augen, ohne Gesichtszüge, er war nichts weiter als eine aufgedunsene Blase aus Fell und Gewebe – blähte sich auf und drohte zu platzen …
Dann brach er auseinander, und unzählige Insekten strömten daraus hervor. Rüsselkäfer und Borkenkäfer, Hirschzecken, Tausendfüßler, blinde Motten und Marienkäfer mit schwarz verfärbten Flügeln. Das Ding fiel in sich zusammen, während die Insekten mit zappelnden Beinen und Panzern und zuckenden Fühlern aus dem Körper krabbelten …
Irgendwo in der Nacht, weit entfernt und gedämpft, war der Klang einer Flöte zu hören.
2 DIE AUFTRAGSKILLERIN
Im Grunde war Selbstmord lediglich eine Frage des Willens. Man musste nur die nötige Entschlossenheit aufbringen. Den Mut, seine Seele in die Dunkelheit zu befördern. War man dazu nicht in der Lage … tja, dann atmete man einfach weiter.
Minerva Atwater saß am Schreibtisch ihres Motelzimmers in einem Kaff namens Ludo in Nevada und hoffte, dass der Mann, mit dem sie verabredet war, sie umbringen würde.
Das Motel war ein Drecksloch. Entsprechend heruntergekommen war ihr Zimmer. Immerhin blieb sich das Motel bis in sämtliche Details treu. Der orangefarbene Wollteppich war mit Brandlöchern übersät, und eine vorwitzige Kakerlake huschte wie ein wandelndes Stück Schorf über die Decke. Eigentlich konnte Minerva sich etwas Besseres leisten, aber dieses Zimmer entsprach ihrer momentanen Gemütslage.
Auf dem Schreibtisch stand eine Schachtel mit einem Spritzen-Set aus dem frühen zwanzigsten Jahrhundert. Damals wurden noch keine Einweg-Nadeln hergestellt. Sie hatte es in einem Antiquitätenladen in Sedona, Arizona gefunden. Minerva vermutete, dass solch ein Set damals von wohlhabenden Morphiumkonsumenten benutzt wurde – von Hirnchirurgen oder Bankdirektoren. Auf dem Kupferüberzug waren die Initialen G. P. G. eingraviert. Wer zum Henker kaufte eine Drogenspritze mit Monogramm?
Die Spritze aus glänzendem Stahl mit einer dicken Nadel war fünf Zentimeter lang. Der Besitzer des Antiquitätenladens hatte sie ihr für zwanzig Dollar verkauft. Er meinte, sie habe einen guten Blick für solche Dinge.
Einen guten Blick für Spritzen?, hatte sie gedacht. Na klar, sicher doch.
Auf dem Schreibtisch lagen außerdem sieben oder acht Thermometer. Sie hatte sie am selben Tag zuvor in einer Drogerie gekauft. Jedes war mit Quecksilber gefüllt. Sie musste an eine Geschichte denken, die ihr Vater ihr über die fahrenden Händler im Wilden Westen erzählt hatte, die Quecksilber als Stärkungsmittel verkauften. Unter albernen Namen wie Lairds Jungbrunnen. Diese Quacksalber behaupteten, dass Frauen davon rosige Wangen und rote Lippen bekämen. Was völliger Schwachsinn war. Sich das Gesicht mit Quecksilber einzureiben war in etwa so wirkungsvoll wie das Gurgeln mit Ponypisse – aber das brachte einen wenigstens nicht um.
Minny hingegen wollte sterben. Das war so ungefähr das Einzige, was sie noch wollte.
Sie legte einen Plastiklöffel auf den Tisch und zerbrach darüber eines der Thermometer. Knackend splitterte das Glas, und das Quecksilber lief auf den Löffel. Mit den anderen Thermometern tat sie dasselbe und zog mit der Spritze das Quecksilber auf. Dann wickelte sie sich oberhalb des Ellbogens einen Schnürsenkel um den Arm, nahm eines der Enden zwischen die Zähne und zurrte ihn fest. Da sie dünne Arme hatte, musste sie nicht besonders kräftig ziehen, bis eine Vene hervortrat.
Früher hatten die Leute über sie getuschelt. Das Mädchen ist so dürr, es könnte in einem Gewehrlauf ein Bad nehmen. Oder: Die sieht aus wie eine Schlange auf Stelzen. Es war jedoch lange her, dass sie zum letzten Mal so etwas zu hören bekommen hatte. Merkwürdig, aber sie vermisste diese Sprüche.
Sie stach mit der Nadel in eine dicke Vene. Ihre Haut kräuselte sich, und die Spitze bohrte sich hinein. Bei ihrem ersten Versuch hatte sie versucht, das Quecksilber zu schlucken, aber davon war ihr lediglich schwindelig geworden, und sie hatte sich übergeben. Nein, es war das Beste, sich das Zeug direkt in die Blutbahn zu jagen.
Sie holte tief Luft – sie spürte, wie der leicht metallische Geschmack des Giftes ihre Kehle wärmte – und nahm ihre Pistolen aus einem Kästchen. Sie ließ sie in die Halfter links und rechts von ihrem Brustkorb gleiten und bedeckte sie mit ihrem langen Staubmantel.
Vielleicht klappte es heute Nacht. Sie flehte zu Gott. Gott oder wer auch immer von dort oben auf ihr unbedeutendes Leben herabschaute, auf die gesamte Menschheit, auf all unsere verzweifelten Bemühungen.
Bitte, dachte sie, hab Erbarmen mit mir. Nur ein wenig. Habe ich das etwa nicht verdient?
Der Wind, der die Vorhänge an den Seiten des offenen Fensters umspielte, trug die Antwort zu ihr ins Zimmer.
Oh nein, mein Kind. Du hast längst noch nicht genug gelitten.
In der Motelbar waren kaum Gäste. Ein Kronleuchter, der aus einem Hirschgeweih gefertigt war, tauchte den Raum in ein schummriges Licht, und es lief »Boogie Oogie Oogie« von A Taste of Honey. Auf Stühlen in unterschiedlichen Ecken des Raums hockten zwei Säufer in stiller Verzweiflung vor ihren Drinks, und an der Bar saß ein dritter Mann. Er war völlig betrunken und rauchte Zigarre.
»Whiskey«, sagte sie, und der Barkeeper brachte ihr ein Glas.
»Lassen Sie die Flasche da«, sagte Minerva. »Oogie Oogie.«
Der Barkeeper war ein kräftiger Mann mit Schnauzbart und trug altmodische Ärmelhalter. Er sah aus wie ein Vollidiot, und das hätte sie ihm beinahe auch gesagt.
Sie spürte, wie er sie verstohlen musterte. Vor ihm stand eine groß gewachsene Frau von tuberkulöser Schlankheit, mit hellen Augen und kurz geschorenem dunklen Haar. Aber wenn er genauer hingesehen hätte – wenn er ihr direkt in die Augen geblickt hätte, die so anders waren als die der Fünfzig-Cent-Huren, die er zweifelsohne feilbot –, dann hätte er … nun ja, es gesehen. Wie hinter den goldenen Iris ihrer Augen, die sich wie die Sekundenzeiger einer Uhr im Kreis drehten, etwas zuckend rotierte.
Aber er schaute nicht allzu genau hin – kein Mann tat das je –, denn Minervas Blick hatte eine vernichtende Wirkung; er nahm im Innern eines Menschen Besitz von etwas Kostbarem und ließ es wie Cellophanpapier über einer offenen Flamme zusammenschrumpfen, bis derjenige das Gefühl hatte, dass seine Brust in sich zusammenfiel.
Minny trank ihren Whiskey, dann noch einen und noch einen. Unablässig schüttete sie den Fusel in sich hinein. Sie fühlte sich gut – das heißt, eigentlich fühlte sie sich wie vertrocknete Eulenscheiße. Das Quecksilber jagte munter durch ihren Körper. Es tat ziemlich weh, aber sie hatte schon Schlimmeres erlebt. Sie hoffte, genug Whiskey in sich hineinschütten zu können, um die Schmerzen zu betäuben, ohne sich dabei zu übergeben.
Falls ich das schaffe, dachte sie, müsste jeder dahergelaufene Trottel in der Lage sein, mir mit einer billigen Knarre eine Kugel direkt zwischen die Augen zu jagen.
Minny hatte schon früher versucht, sich umzubringen. Das erste Mal, als … mein Gott, wann war das gewesen? Auf einem Armenfriedhof nah der mexikanischen Grenze. Sie hatte einen Mann getötet, vielleicht auch zwei oder drei. Wie auch die anderen Männer waren sie mit einem verstörten Gesichtsausdruck gestorben, als wären sie Zeugen eines grausamen Racheaktes geworden. Anschließend hatte Minny sich auf einen Grabstein gehockt und sich den Lauf ihres Colt M1911 unters Kinn gehalten. Sie hatte den Hahn gespannt, und obwohl sie fest entschlossen gewesen war, wusste sie – bevor sie überhaupt den Abzug gedrückt hatte –, dass es nicht klappen würde.
So funktionierte das nicht. Der Vertrag war mit Blut geschrieben – ihrem, dem des Engländers und dem von Micah Shughrue. Mit ihrem Blut und dem jenes bösartigen Wesens, das ihnen dieses Angebot unterbreitet hatte.
So etwas lässt sich nicht rückgängig machen. Du kannst eine Vereinbarung nicht brechen, die durch jede deiner Adern fließt.
Trotzdem hatte sie den Abzug gedrückt. Was konnte es schon schaden? Hah! Ihr Körper hob sich wie ein Segel im Wind in die Höhe … Irgendwann in jener Nacht kam sie wieder zu sich, vielleicht war es auch am nächsten Abend. Der Mond schien auf die Grabsteine herab. Ihre Haare waren mit Blut verklebt und steckten voller getrockneter weißer Klumpen. Sie wusste sofort, dass es sich um Teile ihres Gehirns handelte. Aber es ging ihr gut. Sie war unversehrt. Sie trug nichts weiter davon als eine münzgroße Narbe oben auf dem Kopf, wo ihr Scheitel verlief, bevor sie ihr Haar abrasiert hatte.
Sie hatte auch auf andere Weise versucht, sich umzubringen, klar. Mit Tabletten. Und sie hatte versucht, sich aufzuhängen und mit einem Rasiermesser die Pulsadern aufzuschlitzen. Eines Nachts hatte sie einem Mann achtzig Dollar dafür bezahlt, dass er sie hinter einem Pornokino niederstach. Er wirkte wie jemand, der für achtzig Dollar dazu bereit wäre, obwohl er es vielleicht auch umsonst getan hätte. Es war nicht viel Überzeugungsarbeit nötig gewesen, und sie wurden sich schnell einig. Er hatte bloß gelächelt und angefangen, ihr ein Filetiermesser mit Elfenbeingriff in Bauch und Brust zu rammen. Sie spürte einen brennenden Schmerz, während das Messer ihren Körper seitlich aufschlitzte und die weichen Muskeln zerfetzte. Der Mann konnte mit einem Messer umgehen; vielleicht hatte er Erfahrung als Metzger. Sie stöhnten beide auf: sie vor Schmerzen und weil mit jedem Stoß die Luft aus ihren Lungen wich, er vor Anstrengung. Minny hatte sich mit ihren Händen auf den Schultern des Mannes abgestützt, um nicht zurückzuweichen und ihm die Aufgabe zu erleichtern. Sie hatte in die hellen Elsteraugen des Mannes gestarrt, während ihr Blut auf den ölverschmierten Beton spritzte, bis sie dankbar in die Dunkelheit hinabglitt …
Als sie wieder zu sich kam, war der Mann tot. Sein Hals war so weit aufgeschlitzt, dass Minny seine durchtrennte Luftröhre sehen konnte. Abgesehen von ein paar Kratzern auf dem Bauch war sie unversehrt. Sie hatte die Leiche des Mannes hinter einen Müllcontainer gezerrt und ihn neben einer Kiste voller vergilbter Pornoheftchen mit Titeln wie Alte Knacker und Je oller, desto doller liegen lassen. Es hatte mal wieder nicht geklappt.
Aber heute Nacht … ja, heute würde es anders laufen. Sie konnte sich nicht selbst umbringen und auch niemanden damit beauftragen. Es musste organisch geschehen, auf faire Weise. Sie musste den Kampf verlieren. Nun, sie war keine schlechte Verliererin. Heute Nacht würde sie sich auf korrekte Weise töten lassen.
Auf »Boogie Oogie Oogie« folgte »I’m Your Boogie Man« von KC and the Sunshine Band. War sie in einen halbherzigen Themenabend geraten? Minerva kippte sich einen weiteren Whiskey in den Rachen. In diesem Moment kam eine Frau aus der Herrentoilette, gefolgt von einem zynisch wirkenden Geschäftsmann, der sich gerade die Hose hochzog.
Die Frau versetzte Minny mit dem Ellbogen einen Stoß.
»Wie wär’s, Sportsfreund – Lust auf ’ne Nummer?«
Minny wandte sich in ihre Richtung, worauf die Hure zurückwich.
»Oh, Scheiße«, sagte sie und zog dabei die Vokale in die Länge. Sie war völlig zugedröhnt. »Ich dachte, du wärst ein Kerl.«
Die Frau lachte fies. Ihre Hände waren voller Pusteln, und man hatte ihr mehrfach die Nase gebrochen. »Na wenn schon«, sagte sie mehr zu sich selbst als zu Minerva. »Wär’ nicht mein erstes Mal mit ’ner Braut.« Sie wackelte mit den Hüften. »Na, was sagst du?«
»Ich glaub kaum«, hauchte Minny. »Um ehrlich zu sein, ich würde lieber Katzenscheiße fressen.«
»Dann lass ich dich jetzt mal allein«, lallte die Hure ungerührt und tänzelte an der Bar entlang zu dem Säufer mit der Zigarre.
In diesem Moment hörte Minny das Motorengeräusch eines Pick-ups, und kurz darauf wischte Scheinwerferlicht über die staubigen Fenster der Bar. Sie kippte einen weiteren Whiskey herunter.
Quietschend öffnete sich die Eingangstür in ihren rostigen Scharnieren. Gefolgt vom Geräusch klappernder Stiefel.
»Hat man dich geschickt?«
Minerva drehte sich langsam um. Sie war betrunken, und ihr war schwindelig und übel. Na bestens.
»Ja«, sagte sie und rülpste. »Ich bin allein.«
Der Mann sah aus wie die anderen Männer. Hager, ledrige Haut, wettergegerbtes Gesicht. Ein harter Bursche, der durch die schrecklichen Dinge, die er getan hatte, noch härter geworden war. Ein Mann, der kein Problem mit seiner Vergangenheit hatte. Allerdings wusste Minerva nicht, ob er seine Taten bereute – Taten, die die Aufmerksamkeit ihrer Auftraggeber erregt und zu diesem Treffen geführt hatten. Aber das war ihr eigentlich auch egal. Wahrscheinlich fühlte er sich wie ein Fuchs, den man in einem Schafsgehege losgelassen hatte – warum sollte man ihm also vorwerfen, dass er das tat, was ihm im Blut lag? Und wer weiß? Vielleicht war er tatsächlich ein Fuchs. Dumm nur, dass sie der Wolf war.
»Die Frau mit der Knarre«, sagte der Mann. »Ich hab schon von dir gehört, aber ich dachte, dich gibt es gar nicht. Ich dachte, das wäre nur eine Gruselgeschichte.«
»Du wirst bald merken, dass ich sehr real bin«, sagte Minny.
Der Mann hatte einen kalten Blick, wie all die anderen auch. Doch am Ende waren die Männer jedes Mal von kindlicher Furcht erfüllt, ohne Ausnahme.
Er lächelte. »Ich habe gehört, dass auf meinen Kopf zwanzig Riesen Belohnung ausgesetzt sind.«
Minny schüttelte den Kopf. Ihr Gehirn hatte sich in eine schwere Bleimasse verwandelt. »Du bringst fünf Riesen pro Ohr ein, wenn ich Glück habe.«
»Das ist nicht übel«, sagte der Mann voller Stolz angesichts der Summe.
»Ich hab schon mehr kassiert.«
Das Lächeln wich aus seinem Gesicht. »Da bin ich mir sicher. Aber wie wär’s, wenn du mich lebend schnappst – kriegst du dann nicht mehr?«
»Hab ich nicht gefragt«, sagte Minny.
Der Mann schloss den Mund. »Und wenn ich einfach so mitkomme?«
»Willst du das?«
Der Mann schüttelte den Kopf.
»Das erspart mir das Feilschen«, lallte Minny.
»Schau dich doch bloß mal an!«, sagte der Mann. »Du bist voll wie eine Haubitze!«
Minny musste über diese seltsame Redewendung lachen. Dann richtete sie das Wort an die anderen Leute in der Bar. »Ihr verschwindet jetzt lieber. Und denkt nicht mal daran, die Polizei zu verständigen. Das wird noch früh genug passieren.«
Artig verließen die Gäste die Bar. Obwohl Minny nicht mehr so gut sehen konnte, erkannte sie hinter dem Vorderfenster der Bar mehrere Umrisse. Im Schein der Parkplatzlaternen funkelten Gewehrläufe.
»Du hast Unterstützung mitgebracht.«
»Ich weiß über dich Bescheid«, sagte der Mann ruhig. »Du hast ein unverschämtes Glück.«
Es ist kein Glück, wenn man nichts weiter will, als zu sterben, mein Sohn.
»Was hältst du davon, wenn wir uns im Guten trennen?«, sagte der Mann. »Jeder geht seiner Wege. Es gibt noch andere Belohnungen, oder? Andere Männer.«
»Das einzige Mal, dass ich einem Mann in den Rücken geschossen habe, war, weil er abgehauen ist.« Sie hielt ihm die offenen Handflächen hin. »Es gibt Dinge, vor denen ein Mann nicht davonlaufen kann, mein Junge. Es tut mir leid, aber heute Abend ist für dich hier Endstation.«
Der Mann öffnete seine Bomberjacke aus Leder. In seinem Gürtel, über einer Schnalle mit dem Südstaaten-Adler, steckte eine Pistole.
»Ich bin nicht dein Junge, du Miststück. Ich werde dich töten«, sagte er. »Du bist gleich tot wie eine Biberfellmütze.«
Dieser Schwachkopf war ein wahrer Quell altmodischer Redewendungen. Statt zu lachen, wurde Minny schwindelig. Ihr war schlecht, ihre Eingeweide pulsierten, und sie hatte die Augen zusammengekniffen. Tot wie eine Biberfellmütze? Wirklich putzig. Ich mag deine Art. Junge.
Minerva ließ ihre Pistolen, wo sie waren. Sie hatte die Arme verschränkt. Die Hand des Mannes auf dem Griff seiner Pistole zuckte.
Hoffentlich bist du ein guter Schütze, betete sie. Jag mir eine Kugel ins Herz und eine in den Kopf. Damit wären die Bedingungen der Vereinbarung erfüllt. Alles schön fair und endgültig.
Aber dann passierte es – genau in diesem Moment –, obwohl sie mit aller Macht dagegen ankämpfte.
Den Fokus nannte sie das.
Es war ein natürlicher Vorgang. Jeder ihrer Sinne schärfte sich. Ihr Blick auf die Welt weitete und verengte sich gleichermaßen – sie konnte alles sehen, bis ins kleinste Detail. Den Schweiß auf der Stirn des Mannes, jeden einzelnen Tropfen. Die Rundungen der Kieferknochen von den Männern hinter dem Fenster, ihre angespannten Finger am Abzug der Schrotflinten. Es war, als würde sie durch eine Lupe schauen. Und innerhalb dieses Blickfelds konnte sie sich mit traumwandlerischer Sicherheit blitzschnell bewegen, während alle um sie herum wie Ameisen in einer Masse Sirup umherzappelten.
Der Mann griff nach seiner Pistole – zu langsam, dermaßen beschissen langsam.
Verpass mir eine Kugel! Schnell! Nimm das Ding in deine verdammte Hand!
Mit schwindelerregender Geschwindigkeit griff Minerva nach ihren Waffen. Im nächsten Moment lagen ihre Finger auf den Colts – ich hätte sie mit Sekundenkleber im Halfter befestigen sollen –, und die Läufe schnellten mit einer flüssigen Bewegung in die Höhe. Die Pistolen erzitterten, als die Kugeln aus ihren Mündungen zischten und den Burschen direkt in Herz und Kopf trafen, sodass er nach hinten geschleudert wurde, bevor er überhaupt seine Waffe gezogen hatte.
Minny fuhr herum. Sie kämpfte jetzt nicht mehr dagegen an und überließ dem Dämon in ihrer Blutbahn das Kommando. Im Fenster erschienen mehrere gleichmäßige Löcher, als die Kugeln das Glas durchschlugen und sich in die Männer dahinter bohrten. Jeder Schuss war absolut tödlich; die Kugeln drangen in die weiche Masse ihrer hervorgetretenen Augen ein und traten in einem klebrigen, rosafarbenen Schwall am Hinterkopf wieder aus.
Inzwischen ließ der Fokus wieder nach. Wie ein verstohlener Dieb ergriff diese Fähigkeit Besitz von Minerva, erledigte ihren schmutzigen Job und machte sich wieder aus dem Staub.
Ihr Gegner war durch die Tür geschleudert worden, und seine Stiefel ragten in die Höhe. Minny stieß einen verzweifelten Schrei aus.
Verdammt noch mal. Ich bin es leid. Verdammt noch mal. Lass mich sterben.
Der Wind, der zwischen den Stiefeln des toten Mannes umherwirbelte, trug die Antwort zu ihr herüber.
Du sollst leiden. Leiden, wie du mich hast leiden lassen …
Minerva stieß mit der Schulter die Tür auf und wankte ins Freie. Der Schädel des Toten schimmerte im Mondlicht, seine Kopfhaut war zerfetzt, und aus seinem Gehirn strömte lilafarbener Schaum. Seine weit aufgerissenen Augen, deren Hornhaut im Tod milchig geworden war, starrten in den Himmel.
… oder du kommst zu mir, mein Kind, sagte die Stimme spöttisch. Du weißt doch noch, wo du mich findest, oder? Lass uns wie Geschäftsleute einander Auge in Auge gegenübertreten und eine Abmachung treffen.
Sie erschauerte bis ins Mark. Als würde die braune Flüssigkeit in ihren Knochen zu Eis gefrieren, kalt wie Raureif auf einem Gebirgspass.
Komm zu mir, mein Mädchen. Wozu die Spielchen? Lass uns diese albernen Spielchen beenden.
Sie lief von der Stimme fort – aber das war nicht möglich, denn sie kam aus allen Himmelsrichtungen. Das Flüstern in ihrem Kopf stammte von jemandem, dessen Namen sie nicht auszusprechen wagte.
3 DER GÄRTNER
Der Mann, den die Bewohner der Stadt als den Gärtner kannten, betrat mit einem Skorpion in einem Einmachglas das Glory.
An anderen Orten war der Mann unter einem anderen Namen bekannt gewesen. Als English Bill (obwohl er nicht William hieß) oder einfach als der Engländer. Wieder andere hatten ihn als den Flüsternden Tod kennengelernt. Und für einige hatte er überhaupt keinen Namen gehabt, für sie war er nichts weiter als ein Schatten gewesen, der ihr Umfeld verdunkelte, bevor er ihnen die Lichter ausknipste.
Aber die Bewohner von Old Ditch, einer heruntergekommenen Industriestadt an der Grenze zwischen Kalifornien und Arizona, kannten ihn als den Gärtner. Wenn jemand darauf bestand, dass er ihm seinen richtigen Namen nannte – was manchmal vorkam, denn die Leute in einer Kleinstadt finden es verdächtig, wenn jemand keinen Namen hat –, antwortete er mit Elton, was genauso wenig sein richtiger Name war wie William. Auf der Post, die ihm zugestellt wurde, standen wiederum oft andere Namen, aber keiner davon war sein eigener.
Für die Bewohner von Old Ditch war er jedenfalls der Gärtner. Die Tatsache, dass er schwarz war, war in dieser Hinsicht von Vorteil – im Süden war es nicht ungewöhnlich, Schwarze mit ihrer Berufsbezeichnung und nicht mit ihrem Geburtsnamen anzureden. Als Koch oder Bäcker oder eben als Gärtner. Obwohl das verletzend war, meinten die Leute es nicht böse. Es war einfach üblich. Jeder fand das mehr oder weniger in Ordnung. Selbst der Gärtner hatte sich inzwischen damit abgefunden. Einige Jahre zuvor hätte er das nicht so einfach hingenommen und demjenigen, der sich weigerte, ihn mit seinem Vornamen oder der von ihm gewünschten Anrede anzusprechen, möglicherweise die Zunge herausgeschnitten.
Der Gärtner war auf die übliche Weise zu seinem Namen gekommen. Er war Gärtner. Damals, bei seiner Ankunft in Old Ditch, liefen die Geschäfte bei Rawlston Paperworks bestens; die Bäume in den umliegenden Wäldern wurden gefällt, zerkleinert, zu blütenweißen Papierbögen ausgerollt und an die Elfenbeintürme in der akademischen Welt, die Wall Street und an Tante-Emma-Läden im ganzen Land ausgeliefert. Die Ehefrauen der Geschäftsführer engagierten ihn, damit er sich um ihre Blumen und Beete kümmerte, während sie sich auf ihrer weiß getünchten Veranda Luft zufächelten und Sachen sagten wie »Gute Arbeit, mein Junge, wirklich gute Arbeit«. Sie nannten ihn Junge, obwohl er nicht selten älter war als sie. Er kümmerte sich auch um das Grundstück der Missionskirche und sorgte dafür, dass im Frühling die Ringelblumen und Löwenmäulchen und bis zum Herbst die orangefarbenen Prunkwinden und Pfingstrosen in voller Blüte standen. In der kühleren Jahreszeit kehrte er die Kirche und erledigte für den Pastor hin und wieder ein paar Aufträge. Er führte ein angenehmes und beschauliches Leben … zumindest tagsüber.
Das Glory, eine Bar am Ende der armseligen Hauptstraße, war leer, als der Gärtner sie an diesem Tag betrat. Es war kurz nach zwölf, eine reichlich unpassende Uhrzeit, um einen Ort aufzusuchen, an dem Alkohol ausgeschenkt wurde. Viele der Gebäude, die die Durchfahrtsstraße in Old Ditch säumten, standen leer, und ihre Türen waren vernagelt. Rawlston Paperworks hatte sich die Wälder einverleibt und den Laden dichtgemacht, um in einen anderen Landstrich mit unberührter Natur weiterzuziehen, und die Stadt dem Verfall überlassen.
Der Gärtner humpelte zum Tresen und nahm unter einem Werbeplakat für filterlose Camel-Zigaretten Platz; es zeigte einen übergewichtigen Polizisten, der rauchend gegen die Tür seines Streifenwagens lehnt, während sich die Sonne in seiner Fliegersonnenbrille spiegelte. Have a REAL cigarette – have a CAMEL, lautete der Slogan. Der Gärtner konnte seine Reflexion in dem mit lebenden und toten Fliegen übersäten Spiegel hinter der Bar sehen. Seine Haare, die er früher lang und glatt getragen hatte, waren kurz geschoren und an einigen Stellen grau. Seine dunkle Haut war weißlich verfärbt, da es in letzter Zeit ungewöhnlich heiß gewesen war und er sich mit Karbolseife gewaschen hatte, die seine Haut austrocknete. Er stellte das Glas mit dem Skorpion auf dem Tresen ab.
»Whiskey«, sagte er.
Der Barkeeper war ein gottesfürchtiger Mann namens Clayton Suggs. Er hatte die Bar und ihre Bestände vor einem Jahr für ein Taschengeld gekauft – doch schnell wurde ihm klar, dass man ihn über den Tisch gezogen hatte. Inzwischen war der alte Besitzer über alle Berge und lachte sich wahrscheinlich ins Fäustchen. Suggs hätte höchstens etwas Geld verdienen können, wenn er die Holzeinrichtung der Bar verkauft hätte, aber niemand war daran interessiert, denn die Papierfabrik hatte längst ihre Zelte abgebrochen.
»Ein bisschen früh für die harten Sachen, finden Sie nicht?«, sagte Suggs.
»Ich habe seit fünfzehn Jahren keinen Tropfen angerührt. Aber irgendwann werden wir alle schwach, Mr. Suggs.« Der Gärtner sprach mit einem leichten englischen Akzent, den er vor vielen Jahren mit über den Atlantik gebracht hatte. »Machen Sie sich keinen Kopf deswegen.«
Suggs runzelte die Stirn. Es war nicht so, dass er etwas gegen Schwarze in seiner Bar hatte. In der Not frisst der Teufel fliegen, und wenn jemand Geld auf der Tasche hatte, war er willkommen. Allerdings kannte er den Gärtner nur flüchtig – er hatte ihn hin und wieder in einem der Gärten der Stadt gesehen –, und außerdem wirkte er nie richtig gesund. Er humpelte stark und zog seinen lahmen Fuß wie einen Fluch hinter sich her. Der Körper unter seinem Overall war ausgemergelt, und seine zarten Handgelenke und Fußknöchel wirkten merkwürdig weiblich. Suggs vermutete, dass sein schlechter Gesundheitszustand von den verweichlichten britischen Genen herrührte. Suggs fand, dass alle Engländer leichenblass aussahen. Und jetzt gerade wirkte der Gärtner besonders blutleer, als wäre ein Schwarm Vampirfledermäuse über ihn hergefallen. Mehr noch, er wirkte … gehetzt. Seine Augen waren tief eingesunken, als hätte er etwas so Schreckliches gesehen, dass sie sich in seinen Schädel zurückgezogen hatten.
Dennoch hatte Suggs auch stets die Stärke gespürt, die unter der Oberfläche des Mannes schlummerte. Einen Zorn, eine gefährliche Bösartigkeit, die er im Zaum zu halten versuchte. In Old Ditch ging es inzwischen rauer zu als früher; die Stadt wurde von Männern bevölkert, die einer Leiche die Pennys von den Augen klauen würden … Aber niemand hatte dem Gärtner je etwas angetan. Instinktiv spürten die Männer, dass sie das nicht unbeschadet überstehen würden.
Suggs stellte die Whiskeyflasche auf den Tresen. »Jetzt steht sie in Reichweite, Meister, aber ich werde Ihnen garantiert nichts einschenken.«
»Sehr gut. Ich soll die Menge selbst bestimmen. Cura te ipsum.«
»Hä?«, sagte Suggs.
»Arzt, heile dich selbst.«
Der Gärtner goss sich einen großzügigen Schluck Whiskey ein, und Suggs nahm sich vor, ihm das Doppelte zu berechnen. Sein Blick fiel auf den Skorpion. Er war zwanzig Zentimeter lang und schwarz wie die Nacht. Seine Scheren stießen gegen den Glasbehälter.
»Ich habe keine Ahnung, warum Sie dieses Vieh mitgebracht haben«, sagte Suggs.
»Tja.« Der Gärtner nickte. »Jetzt ist es nun mal hier.«
»Und es bleibt in dem verdammten Glas«, sagte Suggs.
»Fünfzehn Jahre«, sagte der Gärtner mehr zu sich selbst als zu Suggs. »Das ist eine lange Zeit ohne Alkohol. Währenddessen ist es mir sehr viel besser ergangen.«
»Dann nehme ich die Flasche jetzt weg. Damit es auch so bleibt.«
Der Gärtner warf Suggs einen Blick zu. Der Barbesitzer bekam einen trockenen Mund und wich innerlich vor den dunklen Löchern in den Augen des Schwarzen zurück.
»Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sich dazu durchringen könnten, sie stehen zu lassen, Mr. Suggs. Das wäre Balsam für meine geschundene Seele.«
Der Gärtner nahm einen Schluck von seinem Whiskey und schüttelte sich.
»Sagen Sie, Mr. Suggs – haben Sie mit diesem Gesöff den Lack von Ihrem alten Wagen entfernt?«
»Ich habe keinen Wagen mehr«, sagte Suggs steif. »Der gehört jetzt der Bank.«
Der Gärtner schraubte den Deckel vom Glasbehälter und legte ihn auf die Seite. Der Skorpion krabbelte über den Rand und hielt fünf Zentimeter vor der Hand des Gärtners inne; sie lag mit der Innenseite nach unten auf dem Tresen.
»Was zum Henker ist in Sie gefahren?«, sagte Suggs.
»Haben Sie je das Gesicht des Teufels gesehen?«, fragte der Gärtner ruhig.
Urplötzlich verspürte Suggs das starke Bedürfnis, sich zu erleichtern. Er wollte nicht mehr in dieser Bar zusammen mit diesem Mann sein.
»Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die Leute glauben, sie hätten den Teufel gesehen.« Der Gärtner trommelte mit den Fingern auf den Tresen. Der Skorpion bäumte sich auf, bereit zuzustechen. »Sie haben den Teufel in den Gesichtern böser Menschen gesehen und beim Anblick ermordeter Frauen und Kinder. Aber sie haben keine Ahnung, wie der Teufel tatsächlich aussieht und was für schreckliche Dinge er tut.«
Der Gärtner sprach jetzt in einem atemlosen, gedankenverlorenen Tonfall. Seine Finger trommelten weiter …
Der Skorpion schoss hervor und rammte seinen Stachel in den Handrücken des Gärtners. Falls er das Gesicht verzog, bekam Suggs es nicht mit. Der Körper des Skorpions spannte sich, während er sein Gift in die Hand pumpte. Mit der anderen Hand nahm der Gärtner das Whiskeyglas und leerte es in einem Zug.
»Mr. Suggs, Ihr Whiskey ist so schlecht, dass ich nicht weiß, was schlimmer ist: die Plörre hier zu trinken« – er hielt das leere Glas in die Höhe – »oder das hier zu ertragen.« Er tippte mit dem Glas auf den Panzer des Skorpions. Es klirrte, als würde jemand einen Toast ausbringen.
Der Gärtner goss mit der freien Hand erneut Whiskey in das Glas. Der Skorpion zwickte ihn mit seinen Scheren in die andere Hand, und sie begann zu bluten.
»Er hat Sie vergiftet«, sagte Suggs mit heiserer Stimme.
Der Gärtner schloss die Augen und hob das Glas an seine Lippen. Der Fusel brannte in seiner Kehle. Der Stachel des Skorpions war von seiner Haut umschlossen, und das Tier versuchte vergeblich, ihn herauszuziehen – das Gewebe war geschwollen, und es steckte darin fest.
Eine Fehleinschätzung, die man sowohl bei Menschen als auch bei Tieren beobachten kann, dachte der Gärtner. Das Bedürfnis zu töten ist manchmal so stark, dass sie sich überschätzen und dabei ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen.
Der Gärtner hatte den Bürgern von Old Ditch viele Jahre treue Dienste geleistet. Manchmal auch im Verborgenen. Vor vier Jahren hatten zwei armselige Herumtreiber, die Brüder Horace und Eldred Bilks, im alten Fairfax-Motel eine Prostituierte vergewaltigt. Zuvor hatten sie ein paar Tage die Stadt unsicher gemacht. Offensichtlich hatte das Mädchen eine flapsige Bemerkung über Eldred Bilks Hasenscharte gemacht, der bei diesem Thema keinen Spaß verstand. Eldred, der jüngere und brutalere der beiden Brüder, hatte die Frau daraufhin an der Anhängerkupplung seines Pick-ups befestigt und sie fünfhundert Meter weit über eine Schotterstraße geschleift; dabei hatte sie sich ihre Ellbogen und eine Kniescheibe gebrochen. Sie war einundzwanzig und vor dem Zwischenfall eine echte Schönheit gewesen.
Der Gärtner pflanzte gerade Stiefmütterchen vor einem Haus etwa einen Block entfernt, als aus dem Fairfax Schreie drangen. Ein paar Minuten später ertönte Reifenquietschen – die Brüder hatten sich aus dem Staub gemacht. Dann fuhr mit heulender Sirene ein Krankenwagen vorbei. Allerdings sah er kein Polizeiauto, und er wusste, dass auch keines kommen würde. Der Sheriff, ein wehleidiger Wicht namens Gorse Ellson, hatte keine rechte Lust auf die Art von Gewalt, zu der die Brüder fähig waren. Es ist nur eine Hure, würde Ellson sich sagen. Was soll ich mich ihretwegen verletzen lassen?
Bei dieser Vorstellung gingen dem Gärtner finstere Gedanken durch den Kopf. Die Frau besuchte regelmäßig den Gottesdienst in der Missionskirche. Ihre Seele war rein, auch wenn ihr Körper es nicht war.
Der Gärtner lief zu seiner kleinen Wohnung und entfernte eine lose Bodendiele unter seinem Bett. Darunter befanden sich drei Pistolen: zwei deutsche Mauser in einem Buchenholzkasten und eine kleinere Paterson. Vor einigen Jahren war er mit den Waffen und kaum mehr nach Old Ditch gekommen. Sie stellten die einzige Verbindung zu seinem alten Leben dar. Einmal im Jahr holte er sie heraus, um sie zu reinigen und zu ölen, dann verstaute er sie wieder unter dem Brett. Aber an jenem Tag steckte er eine der Mausers ein und befestigte die Paterson mit einem Stück Draht an seiner Achsel. Dann zog er seinen Filzmantel an und machte sich auf den Weg.
Er besaß zwar kein Auto, hatte allerdings früher hin und wieder mal einen Wagen kurzgeschlossen – das hatte er damals, in der gar nicht guten alten Zeit gelernt, als er noch ein kriminelles Dasein fristete. Hinter dem Waschsalon fand er einen unverschlossenen Dodge Dart. Es war ein Kinderspiel.
Am Abend fand er die Bilks-Brüder an einem Flüsschen anderthalb Kilometer außerhalb von Old Ditch. Ihr Wagen parkte am Ende einer zerfurchten Uferfläche unter den ausladenden Ästen einer Eiche. Der Gärtner wartete bis Anbruch der Dunkelheit, bevor er zu ihnen hinüberschlich. Im Schein des herbstlichen Vollmonds konnte er einen Körper ausmachen, der zusammengerollt neben einem flackernden Feuer lag. Seine Muskeln spannten sich, er griff nach der Pistole …
Da hörte er außerhalb seines Blickfelds ein Geräusch – ein Schnalzen, wie Reiter es von sich geben, um ein widerspenstiges Pferd anzutreiben. Der Gärtner fuhr herum und erspähte den jüngeren der beiden Brüder, Eldred, der in der Astgabel eines Baumes hockte und einen Revolver auf seine Brust gerichtet hatte.
»Sieh mal einer an«, sagte er. »Wenn das nicht der Nigger-Krüppel ist.«
Der Gärtner verfluchte sich selbst; als er noch jünger war, hatte man ihn nicht so leicht in einen Hinterhalt locken können. In diesem Moment kam der andere Bruder zu sich und lief zu Eldred hinüber. Ihre Augen funkelten gierig; sie waren wie zwei grausame Jungen, die einen Vogel mit gebrochenen Flügeln gefunden hatten.
»Ich hab dich in der Stadt gesehen«, sagte Horace, der wachsamere der beiden Brüder. »Für ein paar Cent mähst du den Rasen, nicht wahr?«
»Ja, das stimmt«, sagte der Gärtner in seinem sanften britischen Tonfall, was die beiden Brüder überraschte. »Aber ich komme nicht in dieser Funktion zu euch.«
»Was zum Henker soll das heißen?«, fragte Eldred.
»Sei still«, sagte Horace zu seinem Bruder; er hatte jetzt die Augen zusammengekniffen. »Sag schon, in welcher Funktion bist du hier?«
»Ich komme als Todesengel, Horace Bilks. Ja«, fuhr er fort, als er ihre erstaunten Blicke sah, »ich kenne eure Namen. Aber für die werdet ihr bald keine Verwendung mehr haben. Ich werde euch töten, Horace. Dich und Eldred.«
Die beiden Brüder lachten … bis etwas im Blick des Gärtners sie zum Schweigen brachte. Sie hatten gedacht, dass sie es mit einem Krüppel mittleren Alters zu tun hatten. Aber so langsam dämmerte ihnen, dass jemand völlig anderes vor ihnen stand – jemand, der gelernt hatte, sein wahres Gesicht zu verbergen.
»Ihr seid ein paar armselige Vertreter unserer Spezies«, sagte der Gärtner. »Ich weiß nicht, warum ihr so geworden seid. Es ist einem Menschen egal, ob ein tollwütiger Hund früher mal ein braver Hund war. Er weiß nur, dass er die Tollwut hat und erledigt werden muss.«
Erledigt. Auf diese Weise hatte der Gärtner früher sein blutiges Geschäft betrachtet. Mit der Leidenschaftslosigkeit eines Postboten. Ein Postbote beförderte Briefe in Briefkästen, und der Gärtner hatte früher Menschen in Särge befördert.
»Das gefällt uns aber ganz und gar nicht«, sagte Horace spöttisch.
Der Gärtner öffnete seinen Mantel, um ihm die Mauser zu zeigen, die auf seiner rechten Seite im Hosenbund steckte. Mit funkelnden Augen neigte Horace Bilks den Kopf Richtung Waffe, sodass die Knorpel in seinem Hals knackten.
»Sag mir, Nigger«, fragte Eldred mit beiläufiger Gehässigkeit, »überfällst du mit diesem Metallklumpen Tankstellen? Denn wir sind keine Tankstelle.«
»Du versuchst, mit deinen Witzen deine Angst zu überspielen«, sagte der Gärtner. »Ich kann deinen Angstschweiß riechen.«
Eldred hob die Pistole in seiner Hand und zielte dem Gärtner zwischen die Augen. »Ich werde dich töten«, sagte er frei heraus.
»Wirst du wie ein Ehrenmann handeln?«, fragte der Gärtner. »Wirst du dich fair verhalten? Wie deine Vorfahren? Wie jene großartigen Männer, die dieses verlassene Fleckchen Erde besiedelt haben?«
»Moment mal, willst du … willst du mich zum Duell auffordern?« Eldred stieß ein bellendes Lachen aus. »Was glaubst du, in welchem Jahr wir leben, du alter Knacker?«
»Das ist echt altmodisch«, sagte Horace. »Du solltest allerdings wissen, dass mein Bruder und ich alles gemeinsam tun.«
»Zum Beispiel eine Frau vergewaltigen und verstümmeln«, sagte der Gärtner.
»Aber sicher doch, vor allem das«, sagte Horace. »Ich will damit sagen, dass du schneller als Eldred und ich ziehen musst.«
Der Gärtner ließ sich nicht aus der Ruhe bringen.
»Okey-dokey.« Horace knackte mit seinen Fingerknöcheln; ihm gefiel ihr kleines Spielchen.
»Du hast heute das letzte Mal Rasen gemäht, Nigger«, sagte Eldred.
»Seid ihr mit eurem Schöpfer im Reinen?«, fragte der Gärtner die beiden. »Ich gebe euch gerne ein wenig Zeit, um euren Frieden mit ihm zu machen.«
»Nicht nötig«, sagte Horace. »Du wirst gleich deinen letzten Atemzug tun.«
Der Gärtner nickte ruhig. »Was haltet ihr davon, wenn wir bis drei zählen?«
Die beiden Brüder standen nebeneinander, die Hände über dem Knauf ihrer Pistolen. Der Schweiß auf ihrer Stirn funkelte wie Diamantenstaub.
Die rechte Hand des Gärtners ruhte über seiner Mauser …
… während seine linke auf der anderen Seite durch einen Schlitz seines Mantels verstohlen zu der versteckten Pistole wanderte.
»Wer soll zählen?«, fragte der Gärtner.
»Dir gebührt die Ehre, alter Mann«, sagte Eldred. »Kannst du überhaupt so weit zählen?«
»Eins …«, begann der Gärtner.
Er feuerte die Paterson zweimal ab. Die Kugeln zerfetzten seinen Mantel und durchbohrten im Abstand eines Sekundenbruchteils die beiden Brüder. Sie wankten hin und her, stießen aneinander und schlugen mit den Köpfen zusammen. Blitzschnell zog der Gärtner die Mauser und leerte die ganze Trommel; er war ein beidhändig tödlicher Schütze. Eine Kugel riss Eldred Bilks den Kiefer weg und wirbelte ihn durch den Staub. Der Junge sackte zu Boden, während seine violette Zunge wie eine Schlange aus dem frischen Loch in seinem Gesicht hing. Sein Bruder starb etwas würdevoller.
Der Gärtner hatte diesen Trick früher häufiger angewandt. Das war nicht fair, aber eine junge Frau über Schotterstraßen zu schleifen war auch nicht fair.
An jene Nacht – als er die Bilks-Brüder getötet hatte – musste der Gärtner jetzt denken, während er in Clayton Suggs’ Bar mit dem Stachel des Skorpions in seiner Hand saß. Er hatte in seinem Leben viele Menschen getötet; einige hatten es mehr, andere weniger verdient. Er fühlte sich bei dem Gedanken nicht wohl, aber er konnte diese Taten nicht ungeschehen machen.
»Es gibt eine Religionsgemeinschaft von Mönchen, welche die Geißelung zur Kunstform erhoben haben.« Der Gärtner schaute Suggs mit zusammengekniffenen Augen an; aufgrund des Giftes und des Whiskeys konnte er nur noch verschwommen sehen. »Kennen Sie den Ausdruck, Mr. Suggs? Geißelung?«
Suggs musste schlucken. »Nein.«
Der Gärtner schenkte sich von dem Whiskey nach. Diesmal nahm er das Glas mit der Hand, in der der Skorpion steckte, und hob sie an den Mund. Der Skorpion zappelte, und seine Scheren klapperten, aber der Gärtner nahm einen Schluck, ohne mit der Hand zu zittern.
»Sie peitschen sich selbst aus, wissen Sie?«, sagte er. »Mit kurzen, mehrschwänzigen Peitschen, an deren Enden Metallkappen angebracht sind. Sie laufen durch die Straßen, während sie Psalme murmeln und sich die Haut in Fetzen schlagen. Die Rinnsteine sind rot vor Blut. Sie tun Buße, Mr. Suggs. Um ihre von der Sünde beschmutzten Körper zu reinigen. Auf diese Weise sollen ihre Sünden durch das Fleisch entweichen.«
»Ihr Hals«, sagte Suggs beklommen. »Er ist stark geschwollen. Sie bekommen bestimmt kaum noch Luft.«
»Buße zu tun ist ein sehr menschliches Bedürfnis, Mr. Suggs. Aber ich fürchte, es ist zwecklos. Jeder Mensch tut in seinem Leben Dinge, die er nicht wiedergutmachen oder vor denen er nicht davonlaufen kann. Man kann zwar den Rest seines Lebens dafür bezahlen oder davonlaufen, aber man wird diese Taten nie hinter sich lassen. Der Preis für diese Taten ist zu hoch.«
Der Gärtner griff über den Tresen und packte Suggs’ Handgelenk. Der Barbesitzer starrte auf die Finger des Gärtners hinunter, die fest und dunkel wie Vulkangestein waren und sich in seine Haut bohrten. Das war alles, was er tun konnte, um nicht aufzuschreien.
»Verstehen Sie, Mr. Suggs? Sehen Sie das nicht auch so?«
Als der Gärtner ihn wieder losließ, stürzte Clayton Suggs aus dem Glory. Und der Gärtner ließ ihn gehen. Vielleicht rannte er zur Apotheke und kehrte mit einem Gegengift zurück. Aber der Stich des Skorpions reichte bei Weitem nicht aus, um den Gärtner zu töten. Es gab andere Dinge, schreckliche Dinge, die einen Menschen langsam töteten – im Laufe eines ganzen Lebens oder vielleicht auch darüber hinaus.
Er wünschte, Suggs wäre nicht gegangen. Er wollte ihm von dem Traum erzählen, den er letzte Nacht gehabt hatte. Einem Traum, von dem er in den vergangenen fünfzehn Jahren Nacht für Nacht heimgesucht wurde. Am Morgen erwachte er jedes Mal mit brennender Haut, während das Grauen langsam von ihm abfiel.
In diesem Traum sah er das Gesicht Gottes. Das war sein Wunsch gewesen – das war der Deal, den er mit dem Wesen getroffen hatte, das sich in dem schwarzen Felsen versteckt hielt.
Zeig mir das Gesicht Gottes.
Und der Gärtner sah es. Jedes Mal, wenn er seine verdammten Augen schloss.