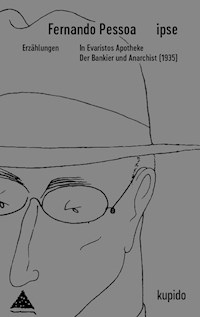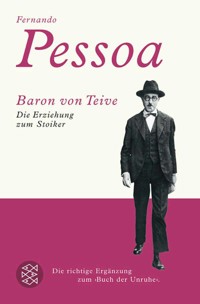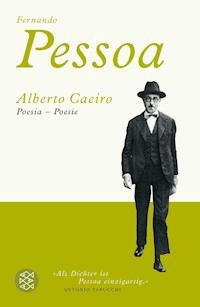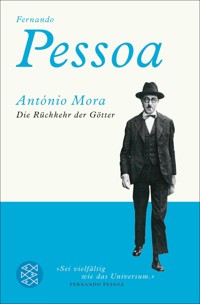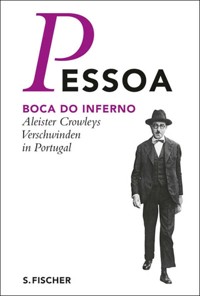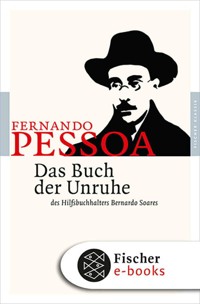
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon. Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK. »Vielleicht ist es mein Schicksal, ewig ein Buchhalter sein zu müssen, und Dichtung und Literatur sind ein Schmetterling, der sich auf meinem Kopf niederläßt und mich um so lächerlicher erscheinen läßt, je größer seine Schönheit ist.« Eine der faszinierendsten Gestalten der modernen Literatur war Fernando Pessoa. Aus seinen Träumen schuf er zahlreiche reale und literarische Persönlichkeiten, darunter den Hilfsbuchhalter Bernardo Soares. Dessen Aufzeichnungen reflektieren das zutiefst Rätselhafte der menschlichen Existenz. »Sein Werk ist ein Schritt auf das Unbekannte zu. Es ist eine Passion« (Octavio Paz).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 823
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Fernando Pessoa
Das Buch der Unruhe des Hilfsbuchhalters Bernardo Soares
Roman
Herausgegeben von Richard Zenith
Aus dem Portugiesischen übersetzt und revidiert von Inés Koebel
FISCHER E-Books
Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon.
Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur.
Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK.
Inhalt
Vorwort
In Lissabon gibt es eine kleine Anzahl Restaurants oder Eßlokale, mit einem schlichten Schankraum und im Stockwerk darüber einem Eßraum, der so gediegen und hausbacken wirkt wie ein Restaurant in einer Ortschaft ohne Bahnanschluß. In diesen, außer an Sonntagen, wenig besuchten Speiseräumen trifft man häufig auf sonderbare Gestalten, ausdruckslose Gesichter, Abseitige des Lebens.
Der Wunsch nach Ruhe und die mäßigen Preise machten mich während einer bestimmten Zeit meines Lebens zum Stammgast eines solchen Lokals. Wenn ich dort gegen sieben zu Abend aß, begegnete ich fast immer einem Menschen, dessen Aussehen mich anfänglich nicht, mit der Zeit aber zusehends interessierte.
Der Mann war ungefähr dreißig Jahre alt, schlank und eher groß als klein, übertrieben nach vorn gebeugt, wenn er saß, weniger wenn er stand, und mit einer gewissen Nachlässigkeit, doch nicht nachlässig gekleidet. Seinem blassen, ausdruckslosen Gesicht konnte auch die Leidensmiene keinen stärkeren Ausdruck verleihen, und es war schwer festzustellen, welche Art Leiden sie verbarg – es schienen ihrer mehrere zu sein, Entbehrungen, Ängste und jenes der Gleichmut entstammende Leid, das wiederum aus einem Übermaß an Leid rührt.
Er aß stets mäßig zu Abend und rauchte anschließend selbstgedrehte Zigaretten. Er beobachtete die anwesenden Gäste überaus aufmerksam, nicht mißtrauisch, sondern mit besonderem Interesse, doch nicht, als suche er sie zu erforschen, sondern als interessiere er sich für sie, ohne sich ihr Verhalten oder ihr Aussehen sonderlich einprägen zu wollen. Erst diese Eigenheit weckte mein Interesse für ihn.
Ich begann, ihn mir genauer anzusehen. Ich bemerkte, daß ein gewisser Ausdruck von Intelligenz in unbestimmt-bestimmter Weise seine Züge belebte. Doch verhüllte Niedergeschlagenheit, die Starre kalter Angst, so konstant seine Miene, daß es schwierig wurde, darüber hinaus einen anderen Wesenszug zu entdecken.
Zufällig hörte ich von einem Kellner des Restaurants, daß er kaufmännischer Angestellter in einem nahe gelegenen Unternehmen war.
Eines Tages kam es auf der Straße unter unseren Fenstern zu einem Zwischenfall: Zwei Kerle prügelten sich. Wer sich gerade im Speiseraum aufhielt, lief an die Fenster, so auch ich und der Mann, von dem ich rede. Ich richtete beiläufig einen Satz an ihn, und er antwortete mir in gleicher Weise. Seine Stimme klang matt und zaghaft, wie die von Menschen, die nichts erwarten, weil es vollkommen nutzlos ist, etwas zu erwarten. Vielleicht aber war es auch gänzlich verfehlt, meinem abendlichen Restaurantgefährten diese Bedeutung beizumessen.
Seither – ich weiß nicht warum – grüßten wir einander. Eines schönen Tages, als wir uns möglicherweise durch den absurden Umstand nähergekommen waren, daß wir beide um halb zehn zum Abendessen erschienen, kamen wir wie nebenbei ins Gespräch. Er fragte mich, ob ich schriftstellerisch tätig sei, was ich bejahte. Ich erzählte ihm von der Zeitschrift Orpheu[1], die kurz zuvor erschienen war. Er lobte sie, lobte sie ausführlich, was mich zugegebenermaßen erstaunte. Ich erlaubte mir, ihm meine Verwunderung zu bekunden, denn die Kunst derer, die für Orpheu schreiben, erreicht nur wenige. Er erwiderte, vielleicht gehöre er zu diesen wenigen. Im übrigen, fügte er hinzu, habe ihm die Orpheu-Lektüre nichts eigentlich Neues gebracht: Schüchtern deutete er an, da er nicht wisse, wohin er gehen noch was er tun solle, weder Freunde zu besuchen habe noch Interesse am Bücherlesen, pflege er die Abende in seinem Zimmer, in dem er zur Untermiete wohne, ebenfalls schreibend zu verbringen.
Er hatte seine zwei[2] Zimmer – und dies ging zwangsläufig auf Kosten einiger unentbehrlicher Dinge – mit einem gewissen fast luxuriösen Stil eingerichtet. Sein Augenmerk galt insbesondere den Stühlen – mit Armlehnen, tief und weich –, Vorhängen und Teppichen. Dieses Interieur habe er sich geschaffen, sagte er, »um die Würde des Überdrusses aufrechtzuerhalten«. In einem modern eingerichteten Zimmer verwandelt sich der Überdruß in Mißbehagen, in körperlichen Schmerz.
Nichts hatte ihn jemals gezwungen, irgend etwas zu tun. Seine Kindheit war einsam gewesen. Er hatte sich nie einer Menschenmenge angeschlossen; nie eine Hochschule[3] besucht; sich nie einer Gruppe zugesellt. Bei ihm war das seltsame Phänomen eingetreten, das bei so manchen – recht besehen vielleicht bei allen eintritt: seine Vorstellungen und Instinkte – allesamt auf Trägheit und Absonderung ausgerichtet – hatten den zufälligen Umständen seines Lebens Form gegeben.
Nie mußte er sich mit den Anforderungen von Staat und Gesellschaft auseinandersetzen. Den Anforderungen seiner eigenen Instinkte wich er aus. Nichts hatte ihn je einem Freund oder gar einer Geliebten zugeführt. Ich war der einzige, mit dem er in gewisser Weise vertraut geworden war. Doch – wenngleich ich immer hinter der Maske einer fremden Persönlichkeit gelebt habe, nämlich der seinen, und vermutete, daß er mich niemals als wahrhaften Freund betrachten würde – war mir stets bewußt, daß er jemanden an sich ziehen würde, um ihm das Buch zu hinterlassen, das er in der Tat hinterließ. Auch wenn es mich anfangs, als ich dessen gewahr wurde, schmerzte, sah ich schließlich alles unter dem einzigen eines Psychologen würdigen Gesichtspunkt und finde Gefallen an dem Gedanken, daß ich auf ebendiese Weise sein Freund wurde und mich nun dem Ziel widme, zu dem er mich an sich gezogen hatte: der Veröffentlichung seines Buches.
Sogar in dieser Hinsicht – die Feststellung ist seltsam – konnten die Umstände, indem sie jemanden meines Charakters seinen Weg kreuzen ließen, ihm helfen und waren zu seinem Vorteil.
Fernando Pessoa
Autobiographie ohne Ereignisse
Vermittels dieser Eindrücke ohne Zusammenhang und ohne den Wunsch nach Zusammenhang erzähle ich gleichmütig meine Autobiographie ohne Fakten, meine Geschichte ohne Leben. Es sind meine Bekenntnisse, und wenn ich in ihnen nichts aussage, so weil ich nichts zu sagen habe.
Fragment 12
1
9. 3. 1930
Ich wurde zu einer Zeit geboren, in der die Mehrheit der jungen Leute den Glauben an Gott aus dem gleichen Grund verloren hatte, aus welchem ihre Vorfahren ihn hatten – ohne zu wissen warum. Und weil der menschliche Geist von Natur aus dazu neigt, Kritik zu üben, weil er fühlt, und nicht, weil er denkt, wählten die meisten dieser jungen Leute die Menschheit als Ersatz für Gott. Ich gehöre jedoch zu jener Art Menschen, die immer am Rande dessen stehen, wozu sie gehören, und nicht nur die Menschenmenge sehen, deren Teil sie sind, sondern auch die großen Räume daneben. Deshalb habe ich Gott nie so weitgehend aufgegeben wie sie und niemals die Menschheit als Ersatz akzeptiert. Ich war der Ansicht, daß Gott, obgleich unbeweisbar, dennoch vorhanden sein und also auch angebetet werden könne, daß aber die Menschheit, da sie eine rein biologische Vorstellung ist und nichts anderes bedeutet als eine Gattung von Lebewesen, der Anbetung nicht würdiger sei als irgendeine andere Gattung von Lebewesen. Dieser Menschheitskult mit seinen Riten von Freiheit und Gleichheit erschien mir stets wie ein Wiederaufleben jener alten Kulte, in denen Tiere Götter waren oder die Götter Tierköpfe trugen.
Da ich also weder an Gott noch an eine Summe von Lebewesen glauben konnte, verblieb ich wie andere Außenseiter in jener Distanz zu allem, die man gemeinhin Dekadenz nennt. Dekadenz bedeutet den vollständigen Verlust der Unbewußtheit; denn die Unbewußtheit ist das Fundament des Lebens. Wenn das Herz denken könnte, stünde es still.
Was bleibt jemandem, der wie ich lebendig ist und doch kein Leben zu haben versteht – ebenso wie den wenigen Menschen meiner Art –, anderes übrig als der Verzicht als Lebensweise und die Kontemplation als Schicksal? Da wir weder wissen noch wissen können, was religiöses Leben ist, weil wir weder mit der Vernunft Glauben haben noch an die Abstraktion Mensch glauben können und nicht einmal wissen, was wir für uns selbst mit ihr anfangen sollen, blieb uns als Motiv für unsere Seele nur die ästhetische Betrachtung des Lebens. Und so ergeben wir uns, fühllos für das Feierliche aller Welten, gleichgültig gegenüber dem Göttlichen und Verächter des Menschlichen, der absichtslosen Empfindung, ohne daß dies einen Sinn hätte, und pflegen sie in einem verfeinerten Epikureertum, wie es unseren Gehirnnerven zugute kommt.
Indem wir von der Naturwissenschaft nur ihr zentrales Prinzip behalten, daß alles schicksalhaften Gesetzen unterworfen ist, auf die man nicht unabhängig reagieren kann, weil reagieren schon hieße, sie hätten unsere Reaktion bewirkt; indem wir außerdem feststellen, daß dieses Gebot mit dem anderen, älteren vom göttlichen Verhängnis der Dinge übereinstimmt, verzichten wir auf die Anstrengung wie Schwächlinge auf athletische Ertüchtigung und beugen uns über das Buch der Empfindungen mit dem großen Skrupel gefühlter Gelehrsamkeit.
Indem wir nichts ernst nehmen und unsere Empfindungen als die einzig gewisse Wirklichkeit betrachten, finden wir bei ihnen Zuflucht und erforschen sie wie große unbekannte Länder. Und wenn wir nicht nur Sorgfalt auf die ästhetische Betrachtung, sondern auch auf den Ausdruck ihrer Methoden und Ergebnisse verwenden, dann, weil die Prosa oder Verse, die wir schreiben, ohne fremdes Verständnisvermögen überzeugen oder fremden Willen bewegen zu wollen, nur wie das laute Vorsichhinsprechen eines Lesenden sind, das dazu beiträgt, dem subjektiven Genuß der Lektüre volle Objektivität zu verschaffen.
Wir wissen wohl, daß jedes Werk zwangsläufig unvollkommen und daß von unseren ästhetischen Betrachtungen die unsicherste diejenige ist, aus der heraus wir schreiben. Unvollkommen jedoch ist alles, es gibt keinen noch so schönen Sonnenuntergang, der nicht noch schöner sein könnte, keine uns Schlaf verschaffende Brise, die uns nicht einen noch ruhigeren Schlaf verschaffen könnte. Und so werden wir, gleichbleibende Betrachter von Bergen und Statuen, die Tage genießen wie die Bücher und alles vor allem zu dem Zweck erträumen, es unserer inneren Substanz anzuverwandeln, und dazu Beschreibungen und Analysen erstellen, die, wenn sie erst einmal vorliegen, zu fremden Dingen werden, die wir genießen können, als stellten sie sich mit dem Verlöschen des Tages ein.
Das ist keine pessimistische Vorstellung wie die de Vignys, für den das Leben ein Gefängnis war, in dem er zum Zeitvertreib Stroh flocht. Pessimist sein heißt etwas tragisch nehmen, eine übertriebene, unbequeme Haltung. Wir besitzen, soviel steht fest, keinen Wertbegriff, den wir auf das Werk, das wir schaffen, anwenden könnten. Wir schaffen es, soviel ist sicher, um uns zu beschäftigen, aber nicht wie der Gefangene, der Stroh flicht, um sein Schicksal zu vergessen, sondern wie das junge Mädchen, das Kissen bestickt, um sich zu beschäftigen – und weiter nichts.
Ich betrachte das Leben als eine Herberge, in der ich verweilen muß, bis die Postkutsche des Abgrunds eintrifft. Ich weiß nicht, wohin sie mich bringen wird, denn ich weiß nichts. Ich könnte diese Herberge als ein Gefängnis betrachten, weil ich gezwungen bin, in ihr zu warten; ich könnte sie auch als einen Ort der Geselligkeit ansehen, weil ich hier anderen Menschen begegne. Doch bin ich weder ungeduldig noch gewöhnlich. Ich überlasse die ihrer Neigung, die sich in ihr Zimmer einschließen, träge aufs Bett sinken und dort schlaflos warten, so wie ich auch die ihrem Treiben überlasse, die sich in den Salons unterhalten, aus denen Stimmen und Musik zu mir dringen und mich angenehm berühren. Ich setze mich an die Tür und berausche mich mit Aug und Ohr an den Farben und Tönen der Landschaft und singe langsam, für mich allein, undeutlich Lieder, die ich während des Wartens komponiere.
Für uns alle werden der Abend und die Postkutsche kommen. Ich genieße die Brise, die mir vergönnt ist, und die Seele, die man mir gab, um sie zu genießen, und ich hinterfrage nicht weiter noch suche ich. Wenn das, was ich ins Buch der Reisenden schreibe, eines Tages von anderen gelesen wird und sie während ihrer Rast unterhält, soll es gut sein. Lesen sie es aber nicht und finden kein Vergnügen daran, ist es auch gut.
2
Ich muß wählen, was ich verabscheue: das Träumen, das meinem Verstand verhaßt ist, oder das Handeln, das meiner Sensibilität zuwider ist; das Handeln, zu dem ich nicht geboren bin, oder das Träumen, zu dem niemand geboren ist.
Da ich beides verabscheue, wähle ich keines; weil ich aber mitunter entweder träumen oder handeln muß, vermische ich das eine mit dem anderen.
3
Ich liebe die Stille langer Sommerabende in der Unterstadt, und insbesondere dort, wo sie im größten Gegensatz zum lärmenden Tagesgewühl steht. Die Rua do Arsenal, die Rua da Alfândega und all die traurigen Straßen, die sich am Ende der Rua da Alfândega ostwärts ziehen, die lange, unterbrochene Linie der stillen Kais, sie alle trösten mich mit ihrer Schwermut, wenn ich mich an diesen Abenden in ihr Labyrinth der Einsamkeit begebe. Ich erlebe dann eine Zeit vor der meinen; genieße es, mich als Zeitgenosse Cesário Verdes[4] zu fühlen und in mir nicht nur andere Verse als die seinen zu tragen, sondern auch genau jenen Stoff, aus dem sie entstanden. Und gehe ich dort, bis es dunkel wird, begleitet mich ein Lebensgefühl, ähnlich dem dieser Straßen. Bei Tage sind sie erfüllt von einem Treiben, das nichts besagt; bei Nacht sind sie erfüllt von einem fehlenden Treiben, das ebenfalls nichts besagt. Bei Tage bin ich nichts, bei Nacht bin ich ich selbst. Es besteht kein Unterschied zwischen mir und den Straßen in der Umgebung der Alfândega, abgesehen davon, daß sie Straßen sind und ich Seele, was in Anbetracht des Wesens der Dinge vielleicht unwesentlich ist. Es gibt ein gleiches, weil abstraktes Schicksal für Menschen und Dinge – eine gleichermaßen gleichgültige Bezeichnung in der Algebra des Geheimnisses.
Doch da ist auch noch etwas anderes … In diesen langsamen, leeren Stunden steigt die Traurigkeit meines gesamten Seins von meiner Seele auf in meinen Geist, das bittere Bewußtsein, daß alles eine Empfindung von mir und zugleich etwas Äußerliches ist, das zu verändern nicht in meiner Macht steht. Ach, wie oft entstehen meine eigenen Träume nur als Dinge, nicht um mir die Wirklichkeit zu ersetzen, sondern um mir zu sagen, wie sehr sie ihr gleichen, da ich sie ebenfalls ablehne und sie außerhalb von mir erscheinen, wie die Elektrische, die gerade um die Kurve am Ende der Straße biegt, oder die Stimme des öffentlichen Ausrufers, der ich weiß nicht was in den Abend verkündet, das sich gegen die Monotonie der Dämmerung abhebt wie ein arabischer Gesang, wie ein plötzlicher Fontänenstrahl.
Künftige Paare schlendern vorbei, Näherinnen gehen zwei und zwei vorüber, junge Männer eilen zu irgendeinem Vergnügen, von allem befreite Ruheständler rauchen auf ihrem täglichen Spaziergang, vor der einen oder anderen Tür stehen gedankenverloren und müßig die Ladenbesitzer. Langsam nachtwandeln Rekruten – kräftige und schmächtige Burschen – in bald lautstarken, bald mehr als lärmenden Gruppen. Zuweilen erscheinen auch ganz normale Leute. Automobile sind hier zu dieser Tageszeit selten, klingen für mich wie Musik. In meinem Herzen herrscht ein beklemmender Friede, und meine Ruhe ist Resignation.
All dies geschieht, und nichts von alledem sagt mir etwas, alles ist meinem Schicksal fremd und sogar dem Schicksal selbst – Unbewußtheit, Flüche ohne Sinn und Verstand, als werfe der Zufall Steine, Echos unbekannter Stimmen – kollektiver Salat des Lebens.
(Veröffentlicht in der Zeitschrift Solução Editora2 und 4, 1929)
4
… und bei der Erhabenheit all meiner Träume, Hilfsbuchhalter in Lissabon!
Doch der Gegensatz zerreibt mich nicht – er befreit mich; und die Ironie, die in ihm liegt, ist mein Lebenssaft. Was mich herabsetzen sollte, hisse ich als mein Banner; und das Lachen, mit dem ich über mich lachen sollte, ist ein Fanfarensignal, mit dem ich eine Morgenröte, in der ich mich selbst erfinde, erschaffe und grüße.
Die nächtliche Seligkeit, groß zu sein, ohne etwas zu sein! Die ernste Herrlichkeit des unbekannten Glanzes … Und mit einem Mal spüre ich die Erhabenheit des Mönchs in der Einsamkeit, des Eremiten in der Einöde, der weiß, daß Christus in den Steinen anwesend ist und in weltabgeschiedenen Höhlen.
Und an meinem Tisch in diesem absurden, schäbigen Zimmer schreibe ich namenloser kleiner Angestellter Worte, die die Rettung meiner Seele sind, und vergolde mich mit dem unmöglichen Sonnenuntergang über hohen, weiten, fernen Bergen, mit meiner Statue, dem Ersatz für die Freuden des Lebens, und meinem Ring des Verzichts, unerschütterliches Juwel ekstatischer Verachtung, an meinem Apostelfinger.
5
Vor mir, auf der Schräge des alten Schreibpults, liegen aufgeschlagen die beiden großen Seiten des schweren Hauptbuches, von dem ich mit müden Augen und einer noch müderen Seele aufblicke. Jenseits dieser Nichtigkeit reiht das Geschäft bis zur Rua dos Douradores die regelmäßigen Regale, die regelmäßigen Angestellten, die menschliche Ordnung und die Ruhe des Alltags. Das Geräusch des Vielfältigen brandet an die Fensterscheibe, und dieses vielfältige Geräusch ist ebenso alltäglich wie die Stille neben den Regalen.
Mit neuen Augen sehe ich die beiden weißen Seiten vor mir, in die meine sorgfältigen Zahlen die Bilanzen der Firma eingetragen haben. Und insgeheim lächelnd, denke ich, daß das Leben, das diese Seiten mit ihren Stoffbezeichnungen und Geldbeträgen beinhalten, mit ihren leeren Stellen und ihren mit dem Lineal und in Schönschrift ausgeführten Strichen auch die großen Seefahrer, die großen Heiligen, die Dichter aller Epochen mit einschließt, lauter Leute ohne Buchführung, die weitläufige, verstoßene Nachkommenschaft all derer, die den Wert der Welt ausmachen.
Wenn ich einen Stoff eintrage, von dem ich nicht weiß, wie er beschaffen ist, öffnen sich mir die Tore des Indus und Samarkands, und die Dichtung Persiens, die weder mit dem einen noch mit dem anderen Ort zu tun hat, ist mir mit ihren Vierzeilern, deren dritter Vers reimlos ist, eine ferne Stütze für meine Unruhe. Doch mir unterläuft kein Fehler, ich schreibe, addiere, die Buchhaltung wird fortgeführt und von einem Angestellten dieses Büros brav zum Abschluß gebracht.
(Veröffentlicht in der Zeitschrift Solução Editora4, 1929)
6
Ich habe so wenig vom Leben erbeten, und selbst dieses wenige hat das Leben mir versagt. Einen Streif Sonnenlicht, eine Zeit auf dem Land, ein bißchen Ruhe und einen Bissen Brot, daß mich die Erkenntnis meiner Existenz nicht zu sehr belaste, daß ich nichts von den anderen erwarte, noch sie von mir. Selbst dies wurde mir verweigert, so als verweigere jemand ein Almosen, nicht weil er kein gutes Herz hätte, sondern um den Mantel nicht aufknöpfen zu müssen.
Traurig schreibe ich in meinem stillen Zimmer, allein, wie ich immer gewesen bin, allein, wie ich immer sein werde. Und ich frage mich, ob meine offenbar so unbedeutende Stimme nicht die Substanz Tausender Stimmen verkörpert, den Hunger Tausender Leben, sich mitzuteilen, die Geduld von Millionen Seelen, wie die meine dem alltäglichen Schicksal unterworfen, dem unnützen Traum, der aussichtslosen Hoffnung. In solchen Augenblicken schlägt mein Herz schneller, denn ich bin mir seiner bewußt. Ich lebe mehr, denn ich lebe größer. Ich spüre in meiner Person eine religiöse Kraft, eine Art Gebet, etwas, das einer Wehklage gleicht. Doch der Widerspruch steigt herab aus meinem Verstand … Ich sehe mich im vierten Stock in der Rua dos Douradores, bin müde bei mir und nicht bei mir; betrachte auf dem halbbeschriebenen Blatt das Leben ohne Fülle und Schönheit und den schlechten, aber erschwinglichen Zigarettentabak auf dem fleckigen Löschpapier. Ich hier, in diesem vierten Stock, und das Leben befragen!, sagen, was die Seelen der anderen fühlen!, Prosa schreiben wie Genies und Berühmtheiten! Ich, hier – so! …
7
Heute habe ich mir während einer jener plan- und würdelosen Träumereien, die einen Großteil der geistigen Substanz meines Lebens ausmachen, vorgestellt, ich sei für immer frei von der Rua dos Douradores, von Chef Vasques, von Buchhalter Moreira, von allen Angestellten, von dem Dienstmann, dem Laufburschen und der Katze. Ich erfuhr im Traum meine Befreiung, als hätten sich mir südliche Meere mit wunderbaren Inseln zur Entdeckung dargeboten. Die Erholung schlechthin, die künstlerische Vollendung, die geistige Erfüllung meines Seins!
Aber, während ich mir dies in meiner bescheidenen Mittagspause im Kaffeehaus vorstellte, trübte mit einem Mal ein unangenehmes Gefühl diesen Traum: Ich spürte, daß es mir schwerfiele. Ja, ich sage das, als befände ich mich tatsächlich in dieser Situation: Es fiele mir schwer. Chef Vasques, Buchhalter Moreira, Kassierer Borges, all diese braven Kerle, der vergnügte Laufbursche, der die Briefe auf die Post bringt, der dienstbare Gehilfe, die anschmiegsame Katze – sie alle sind Bestandteil meines Lebens geworden; ich könnte all dies nicht mehr ohne Tränen verlassen, ohne die Einsicht, daß ein Teil von mir, ob ich es wollte oder nicht, bei ihnen allen zurückbliebe, daß eine Trennung von ihnen einem halben Tod gleichkäme.
Angenommen, ich sagte wirklich morgen allen Lebewohl und legte meine Rua-dos-Douradores-Gewandung ab, was täte ich dann? Denn etwas anderes müßte ich doch tun? Was für ein anderes Gewand legte ich mir zu? Denn ich müßte mir doch wohl ein anderes zulegen?
Wir alle haben einen Chef Vasques; für die einen ist er sichtbar, für die anderen unsichtbar. Für mich heißt er wirklich Vasques und ist ein gesunder, umgänglicher Mann, der dann und wann barsch, aber nie nachtragend ist, auf seinen Vorteil bedacht, aber im Grunde gerecht – mit einem Sinn für Gerechtigkeit, wie er vielen großen Genies und vielen wunderbaren menschlichen Zivilisationsprodukten, rechten wie linken, abgeht. Für andere mag die Eitelkeit, das Verlangen nach größerem Reichtum, nach Ruhm, nach Unsterblichkeit beherrschend sein … Ich ziehe den Menschen Vasques vor, meinen Chef, der in schwierigen Stunden umgänglicher ist als alle abstrakten Chefs der Welt.
Ein Freund, Teilhaber einer Firma, die dank ihrer Geschäftsbeziehungen zu allen staatlichen Stellen floriert, sagte neulich zu mir, da er annahm, ich verdiente zuwenig: »Sie werden ausgebeutet, Soares.« Das rief mir in Erinnerung, daß dem so ist, da wir alle aber im Leben ausgebeutet werden müssen, frage ich mich, ob es nicht weniger schlimm ist, von Herrn Vasques, dem Tuchhändler, ausgebeutet zu werden als von Eitelkeit, Ruhm, Verachtung, Neid oder dem Unmöglichen.
Manche beutet Gott selbst aus, sie sind die Propheten und Heiligen in der Leere dieser Welt.
Und ich ziehe mich – wie in ein Heim, das anderen gehört – in das fremde Haus, das weitläufige Büro in der Rua dos Douradores zurück. Ich lehne mich an meinen Schreibtisch wie an ein Bollwerk gegen das Leben. Ich empfinde Zärtlichkeit, bis hin zu Tränen, für meine Geschäftsbücher, in die ich schreibe, für das alte Tintenfaß, dessen ich mich bediene, für den gebeugten Rücken Sérgios, der ein Stück von mir entfernt Warenbegleitpapiere ausfertigt. Ich liebe all dies, vielleicht, weil ich sonst nichts zum Lieben habe – oder vielleicht auch deshalb, weil nichts die Liebe einer Seele wert ist und wir diese Liebe, sofern wir sie aus Sentimentalität dennoch geben wollen, ebensogut meinem kleinen Tintenfaß zuteil werden lassen können wie der großen Gleichgültigkeit der Sterne.
8
Chef Vasques. Oftmals stehe ich unerklärlicherweise im Bann von Chef Vasques. Was bedeutet mir dieser Mann, abgesehen davon, daß er mich gelegentlich daran hindert, zu den Tageszeiten meines Lebens Herr über meine Zeit zu sein? Er behandelt mich gut, er zeigt sich liebenswürdig, wenn er mit mir spricht, ausgenommen in den brüsken Augenblicken unbekannter Besorgnis, in denen er zu niemandem freundlich ist. Aber warum beschäftigt er mich? Ist er ein Symbol? Ist er ein Grund? Was ist er?
Chef Vasques. Ich erinnere mich seiner bereits in der Zukunft mit jener Sehnsucht, von der ich weiß, daß ich sie künftig empfinden werde. Ich werde friedlich in einer kleinen Wohnung, in der Umgebung von diesem oder jenem, eine Ruhe genießen, in der ich nicht zustande bringen werde, was ich auch heute nicht zustande bringe, und werde, um es weiterhin nicht zustande gebracht zu haben, nach anderen Ausreden suchen als jene, hinter denen ich mich heute verstecke. Oder aber ich bin in einem Armenhaus untergebracht, beglückt über meine endgültige Niederlage, dicht an dicht mit dem Auswurf all jener, die sich für Genies hielten und doch nur träumende Bettler waren, zusammen mit der namenlosen Schar derer, denen sowohl die Kraft zum Siegen fehlte als auch zum uneingeschränkten Verzicht, um kampflos zu siegen. Wo ich auch sein werde, ich werde Chef Vasques vermissen, das Büro in der Rua dos Douradores, und die Eintönigkeit des Alltags wird für mich wie die Erinnerung an all die Lieben sein, die mir nie zuteil wurden, oder an die Triumphe, die mir nicht vergönnt sein sollten.
Chef Vasques. Ich sehe ihn heute von dieser Zukunft aus, so wie ich ihn heute von hier aus sehe – mittelgroß, untersetzt, grob in Grenzen, mit Anwandlungen von Herzlichkeit, offen und verschmitzt, barsch und liebenswürdig – Chef, einmal abgesehen von seinem Geld, auch mit seinen behaarten, langsamen Händen, mit Adern wie kleine farbige Muskeln, einem fleischigen, aber nicht fetten Nacken, das Gesicht unter dem dunklen, allzeit frisch gestutzten Bart gerötet und zugleich angespannt. Ich sehe ihn, ich sehe seine Gesten, energisch und abgemessen, seine Augen, die innen äußere Dinge denken, ich bin so verstört wie bei den Gelegenheiten, bei denen ich ihm mißfalle und meine Seele sich über sein Lächeln freut; ein breites, menschliches Lächeln, wie der Beifall einer Menschenmenge.
Vielleicht weil ich in meiner Nähe keine überragendere Persönlichkeit kenne als Chef Vasques, beschäftigt diese im Grunde alltägliche, ja sogar gewöhnliche Gestalt häufig meine Gedanken und lenkt mich von mir selber ab. Ich glaube an Symbole. Ich glaube oder glaube fast, daß irgendwo in einem fernen Leben dieser Mann eine für mich bedeutsamere Rolle gespielt hat, als er sie heute spielt.
9
Ja, ich begreife! Chef Vasques ist das Leben. Das Leben, eintönig und notwendig, gebieterisch und unbekannt. Dieser banale Mensch verkörpert die Banalität des Lebens. Er ist alles für mich, von außen betrachtet, weil das Leben alles für mich ist, von außen betrachtet.
Und wenn das Büro in der Rua dos Douradores für mich das Leben verkörpert, so verkörpert mein zweites[5] Stockwerk, in dem ich in eben dieser Rua dos Douradores wohne, für mich die Kunst. Jawohl, die Kunst, die in derselben Straße wohnt wie das Leben, jedoch an einem anderen Ort, die Kunst, die das Leben erleichtert, ohne daß es deshalb leichter würde zu leben, die so eintönig ist wie das Leben selbst, nur an einem anderen Ort. Jawohl, diese Rua dos Douradores umfaßt für mich den gesamten Sinn der Dinge, die Lösung aller Rätsel, abgesehen davon, daß manche Rätsel unlösbar sind.
10
Und so bin ich – ein belangloser, sensibler Mensch – fähig zu heftigen, verzehrenden Impulsen, bösen wie guten, edlen wie niedrigen, nie aber zu einem dauerhaften Gefühl, nie zu einer Emotion, die fortwirkte und in die Substanz der Seele einginge. Alles in mir neigt dazu, weiterzugehen und etwas anderes zu werden; es ist eine Ungeduld der Seele mit sich selbst wie mit einem lästigen Kind; eine wachsende, immer gleiche Unruhe. Alles fesselt mich und nichts hält mich. Ich achte auf alles und träume beständig; ich bemerke jedes noch so winzige Mienenspiel meines Gesprächspartners, nehme die kleinste Veränderung in seiner Stimme wahr, und während ich ihn höre, höre ich ihm nicht zu, sondern denke an etwas anderes, am allerwenigsten aber erinnere ich mich an das, was gesagt wurde, von mir und von ihm. So sage ich jemandem stets aufs neue, was ich ihm bereits mehrfach gesagt habe, oder stelle ihm eine Frage, die er mir bereits beantwortet hat; und doch kann ich mit vier photographischen Worten die Gesichtsmuskeln beschreiben, mit denen er mir sagte, woran ich mich nicht mehr erinnere, oder den Augenausdruck, mit dem er aufnahm, was ich mich nicht erinnern kann, ihm gesagt zu haben. Ich bin zwei, und beide halten Abstand – siamesische Zwillinge, die nicht miteinander verwachsen sind.
11
Litanei
Wir verwirklichen uns nie.
Wir sind zwei Abgründe – ein Brunnen, der in den Himmel schaut.
12
Ich beneide – bin mir aber dessen nicht wirklich sicher – all jene, über die man eine Biographie schreiben kann oder die ihre eigene Biographie schreiben können. Vermittels dieser Eindrücke ohne Zusammenhang und ohne den Wunsch nach Zusammenhang erzähle ich gleichmütig meine Autobiographie ohne Fakten, meine Geschichte ohne Leben. Es sind meine Bekenntnisse, und wenn ich in ihnen nichts aussage, so weil ich nichts zu sagen habe.
Was schon könnte man an Lohnenswertem oder Nützlichem bekennen? Was uns widerfahren ist, ist entweder allen widerfahren oder uns allein; in dem einen Fall ist es nichts Neues, im anderen unbegreiflich. Wenn ich schreibe, was ich empfinde, dann weil ich auf diese Weise das Fieber meines Empfindens senke. Was ich bekenne, ist nicht von Bedeutung, denn nichts ist von Bedeutung. Ich mache Landschaften aus dem, was ich empfinde. Mache Ferien von meinen Gefühlen. Ich begreife ohne weiteres, daß Frauen aus Kummer sticken und Strümpfe stricken, weil es Leben gibt. Meine alte Tante legte endlose Abende lang Patiencen. Meine Patiencen sind meine Gefühlsbekenntnisse. Ich deute sie nicht, wie jemand Karten legt, um sein Schicksal zu erfahren. Ich prüfe sie nicht, denn in den Patiencen besitzen die Karten keinen eigentlichen Wert. Ich wickle mich auf wie ein vielfarbiger Strang oder mache mich zu einem jener Fadenspiele, wie sie Kinder auf ihren gespreizten Fingern weben und von Hand zu Hand weiterreichen. Ich achte nur darauf, daß der Daumen nicht die ihm zugedachte Schlinge verfehlt. Dann drehe ich die Hände um, und das Muster verändert sich. Und ich beginne von vorn.
Leben heißt Strümpfe häkeln, nach fremden Vorgaben. Dabei aber sind die Gedanken frei, und alle verzauberten Prinzen können sich in ihren Gärten ergehen, zwischen den Maschen, die der Widerhaken der Elfenbeinnadel eine um die andere aufnimmt. Häkelwerk der Dinge … Zwischenräume … Nichts …
Was, im übrigen, kann ich von mir erwarten? Eine erschreckende Schärfe meiner Wahrnehmungen und das deutliche Bewußtsein zu fühlen … Einen scharfen Verstand, der mich zerstört, und eine Fähigkeit zu träumen, die nichts als ein Ablenken ist … Einen erloschenen Willen und eine Überlegung, die ihn einwiegt, als wäre er ein lebendiges Kind … Ja, Häkelwerk …
13
Die Erbärmlichkeit meiner Verfassung wird nicht geringer durch diese Worte, mit denen ich Satz um Satz das Zufallsbuch meines Nachsinnens gestalte. Nichtig bestehe ich fort auf dem Grund jedes Ausdrucks wie unlösliches Pulver auf dem Grund eines Glases, aus dem man nur Wasser getrunken hat. Ich schreibe meine Literatur wie ich Buch führe – sorgfältig und gleichgültig. Angesichts des weiten Sternenhimmels und des Rätsels vieler Seelen, der Nacht des unbekannten Abgrunds und des chaotischen Nichtverstehens – angesichts all dessen sind meine Eintragungen in das kleine Kassenbuch und das, was ich auf dieses Seelenpapier schreibe, gleichermaßen auf die Rua dos Douradores beschränkte Dinge und winzig im Vergleich zu den großen, millionenfach im Universum vorhandenen Räumen.
All dies ist Traum und Blendwerk, und es hilft wenig, den Traum als Eintrag oder lohnende Prosa zu verstehen. Warum sollte es nützlicher sein, von Prinzessinnen zu träumen als von der Tür zum Büro? Alles, was wir wissen, ist unsere Wahrnehmung, und alles, was wir sind, ist eine uns fremde Wahrnehmung, ein Melodram, in dem wir durch unsere Empfindung Darsteller, Zuschauer, ja unsere eigenen Götter sind, mit Bewilligung des Stadtrats.
14
Selbst wenn wir wissen, daß ein nie zustande kommendes Werk schlecht sein wird, ein nie begonnenes ist noch schlechter! Ein zustande gekommenes Werk ist zumindest entstanden. Kein Meisterwerk vielleicht, aber es existiert, wenn auch kümmerlich wie die Pflanze im einzigen Blumentopf meiner gebrechlichen Nachbarin. Diese Pflanze ist ihre Freude, und hin und wieder auch die meine. Was ich schreibe und als schlecht erkenne, kann dennoch die eine oder andere verwundete, traurige Seele für Augenblicke noch Schlechteres vergessen lassen. Ob es mir nun genügt oder nicht, es nützt auf irgendeine Art, und so ist das ganze Leben.
Überdruß, der nichts anderes bewirkt als das Vorgefühl noch größeren Überdrusses; die Qual schon der morgigen Qual, sich heute gequält zu haben – wie wirr, ohne Nutzen noch Wahrheit, wie wirr …
… wo, zusammengekauert auf der Bank einer Eisenbahnstation, meine Verachtung im Mantel meiner Mutlosigkeit schläft …
… die Welt der Traumbilder, aus denen sich mein Wissen und mein Leben gleichermaßen zusammensetzen …
Weder lastet auf mir der Zweifel dieser Stunde, noch hält er sich in mir. Ich verspüre Hunger nach der Ausdehnung der Zeit, möchte bedingungslos ich sein.
15
Schritt für Schritt habe ich jene innere Landschaft erobert, die von Geburt an die meine war. Stück für Stück habe ich dem Sumpf abgefordert, in dem ich hilflos festhing. Ich habe mein unendliches Sein geboren, mich mit Zangen mir selbst entrissen.
16
Ich träume zwischen Cascais und Lissabon. Ich bin nach Cascais gefahren, um für Chef Vasques die Steuer auf ein Haus zu bezahlen, das er in Estoril besitzt. Im voraus genoß ich das Vergnügen, unterwegs zu sein: eine Stunde hin, eine Stunde zurück, und unterdessen der immer wechselnde Anblick des großen Flusses und seiner Mündung in den Atlantik. In Wirklichkeit aber verlor ich mich auf der Hinfahrt in abstrakte Betrachtungen und sah, ohne zu sehen, die Wasserlandschaften, auf die ich mich gefreut hatte, und jetzt, auf der Rückfahrt, verliere ich mich mit dem Festhalten dieser Empfindungen. Ich wäre nicht imstande, auch nur das kleinste Detail dieser Reise, die kleinste sichtbare Wegstrecke zu beschreiben. Diese Zeilen sind mir dank des Vergessens und des Widerspruchs gelungen. Ich weiß nicht, ob dies besser oder schlechter ist als das Gegenteil, von dem ich ebensowenig weiß, was es ist.
Der Zug wird langsamer, fährt ein in den Bahnhof Cais do Sodré. Ich bin in Lissabon angekommen, doch zu keinem abschließenden Gedanken.
17
Vielleicht ist es an der Zeit, und ich sollte die einmalige Anstrengung unternehmen und mein Leben betrachten. Ich sehe mich inmitten einer unermeßlichen Wüste. Ich rede von dem, was ich gestern, literarisch gesprochen, war und versuche mir zu erklären, wie ich dahin gekommen bin.
18
Gelassen und mit nicht mehr als einem Lächeln in der Seele betrachte ich mein Leben, für immer auf diese Rua dos Douradores begrenzt, auf dieses Büro, dieses Milieu, diese Menschen. Ein Einkommen, das mir Essen und Trinken sichert, eine Behausung verschafft und einen geringen Spielraum in der Zeit, um zu träumen, zu schreiben und – zu schlafen, was könnte ich mehr von den Göttern erbitten oder vom Schicksal erwarten?
Ich hatte ehrgeizige Pläne und hochtrabende Träume – doch die hatten auch der Dienstmann oder die Näherin, denn Träume hegen alle Leute: was uns unterscheidet, ist die Kraft, sie zu verwirklichen, oder das Schicksal, das sie für uns verwirklicht.
In Träumen bin ich dem Dienstmann und der Näherin gleich. Von ihnen unterscheidet mich nur, daß ich schreiben kann. Ja, das ist ein Akt, eine mir eigene Wirklichkeit, die mich von ihnen unterscheidet. In der Seele bin ich ihresgleichen.
Ich weiß wohl, es gibt Inseln im Süden und große kosmopolitische Leidenschaften, und […]
Hätte ich die Welt in der Hand, tauschte ich sie, dessen bin ich sicher, gegen eine Fahrkarte zur Rua dos Douradores ein.
Vielleicht ist es mein Schicksal, ewig Buchhalter zu bleiben, und Dichtung und Literatur sind nur ein Schmetterling, der sich auf meinen Kopf niedersetzt und mich um so lächerlicher erscheinen läßt, je größer seine Schönheit ist.
Ich werde Sehnsucht nach Herrn Moreira verspüren, aber was sind Sehnsüchte angesichts großer Beförderungen?
Ich weiß genau, daß der Tag, an dem ich oberster Buchhalter des Hauses Vasques & Co. werde, einer der großen Tage meines Lebens sein wird. Ich weiß es mit einem bitteren, ironischen Vorgefühl, doch auch mit dem geistigen Vorzug der Gewißheit.
19
In der Sandbucht am Meer, inmitten der nahen Wälder und Wiesen, stieg aus der Ungewißheit des nichtigen Abgrunds die Unbeständigkeit brennenden Verlangens auf. Man müßte dort nicht wählen zwischen den Weizenfeldern und den vielen [sic], und die Entfernung setzte sich fort zwischen den Zypressen.
Der Zauber vereinzelter oder durch Gleichklang verbundener Wörter, mit inneren Resonanzen und voneinander abweichenden und zugleich übereinstimmenden Bedeutungen, der Glanz von Sätzen, eingebunden in die Bedeutungen anderer Sätze, Bosheit der Spuren, Hoffnung der Wälder und die Stille der Teiche, nichts sonst, auf den Gütern der Kindheit meiner Ausflüchte … So, zwischen den hohen Mauern der absurden Kühnheit, zwischen den Baumreihen und dem Schrecken über Vergehendes, würde ein anderer als ich traurige Lippen gestehen hören, was sie drängenderen verweigern. Nie mehr, auch wenn die Ritter zurückkämen auf der Straße, die man von der Mauerkrone aus sah, würde Ruhe einkehren in den Herrensitz der Allerletzten, mit seinem lanzenklirrenden, unsichtbaren Hof, noch würde man sich eines anderen Namens erinnern auf dieser Seite der Straße, bis auf den einen, den der Maurin aus dem Märchen, die des Abends das Kind, das später starb, mit Lebendigem und Wundersamem bezauberte.
Leise, wie eine Erinnerung an Kommendes, hallte zwischen den Furchen im Gras der Zug der letzten Verlorenen nach, ihre Schritte öffneten ein Nichts in dem bewegten Grün. Alt waren jene, die kommen sollten, und jung nur jene, die niemals kämen. Die Trommeln rollten an den Wegrand, die Trompeten hingen nutzlos in ermatteten Händen, die sie hätten fallen lassen, hätten sie noch die Kraft gehabt.
Doch kaum war der Zauber gebannt, erklangen erneut die erstorbenen Schreie, und man sah die Hunde unschlüssig in den Alleen. Alles war so absurd wie die Trauer um einen Tod, und Prinzessinnen aus fremden Träumen spazierten einher, frei, ungehindert, auf ewig.
20
Immer wieder sehe ich mich in meinem von Umständen bedrängten Leben, kaum will ich mich von ihnen befreien, unversehens von neuen Umständen gleicher Art umzingelt, als herrsche in dem ungewissen Gespinst der Dinge entschieden Feindschaft gegen mich. Ich reiße von meinem Hals eine Hand, die mich erstickt. Und sehe, daß meine eigene Hand, die soeben die andere wegriß, mir zugleich mit der Geste der Befreiung eine Schlinge um den Hals gelegt hat. Vorsichtig entferne ich die Schlinge und stranguliere mich fast mit eigenen Händen.
21
Ob es nun Götter gibt oder nicht, wir sind ihre Knechte.
22
Mein Bild, so wie ich es in Spiegeln sah, ist meiner Seele allzeit verbunden. Ich konnte nur krumm und schwächlich werden, und bin es, selbst in meinen Gedanken.
Alles an mir erinnert an einen Prinzen: ein schillernder Farbdruck im abgegriffenen Album eines kleinen Jungen, seit langem unwiederbringlich tot.
Mich lieben heißt Mitleid mit mir haben. Eines Tages, gegen Ende der Zukunft, wird jemand ein Gedicht über mich schreiben, vielleicht beginne ich erst dann, in meinem Reich zu regieren.
Gott heißt, wir existieren, und das ist nicht alles.
23
Absurdes
Verwandeln wir uns in Sphinxe, wenn auch in falsche, bis wir an den Punkt gelangen, an dem wir nicht mehr wissen, wer wir sind. Im übrigen sind wir falsche Sphinxe und wissen nicht, was wir wirklich sind. Wir können mit dem Leben einzig im Einklang sein, wenn wir mit uns selbst im Mißklang sind. Das Absurde ist das Göttliche.
Theorien aufstellen, sie mit Geduld und auf ehrliche Weise durchdenken, nur um sie anschließend zu verwerfen – handeln und unser Handeln durch Theorien rechtfertigen, die es verurteilen. Sich einen Weg durch das Leben bahnen und dann, während wir diesem Weg folgen, entgegen diesem Weg handeln. Gesten vollziehen und Haltungen einnehmen in bezug auf etwas, das wir nicht sind, das wir nicht sein wollen und von dem wir auch nicht möchten, daß andere denken, wir seien es.
Bücher kaufen, um sie nicht zu lesen; Konzerte besuchen, weder um Musik zu hören, noch um zu sehen, wer sich dort sehen läßt; lange Spaziergänge machen, weil wir des Laufens müde sind, und Tage auf dem Land verbringen, nur weil uns das Landleben langweilt.
24
Heute spürte ich mit jeder Faser meines Körpers jene alte Angst, die bisweilen übermächtig wird, und konnte in dem Restaurant oder Eßlokal, dessen erster Stock mir die Grundlage für mein Weiterleben bietet, weder ordentlich essen noch wie gewöhnlich trinken. Als der Ober bei meinem Fortgehen bemerkte, daß ich die Weinflasche nur halb geleert hatte, drehte er sich nach mir um und sagte: »Bis bald, Herr Soares, und gute Besserung!«
Beim Fanfarenstoß dieses einfachen Satzes wurde mein Herz so leicht, als hätte plötzlich der Wind einen verhangenen Himmel freigeblasen. Und ich erkannte klar wie nie zuvor, daß mir die Kaffeehaus- und Restaurant-Kellner, die Friseure und die Dienstmänner an den Straßenecken eine spontane, natürliche Sympathie entgegenbringen, die ich mich nicht rühmen kann, von denen zu erhalten, die mit mir auf unzutreffenderweise so genanntem vertrauten Fuße stehen.
Auch der freundliche Umgang kennt feine Unterschiede.
Manche regieren die Welt, andere sind die Welt. Zwischen einem amerikanischen Millionär, einem Cäsar, Napoleon oder Lenin und einem sozialistischen Dorfbürgermeister gibt es keinen Unterschied in der Qualität, sondern nur in der Quantität. Wir stehen unter ihnen, wir, die Gestaltlosen, der hitzköpfige Dramatiker William Shakespeare, der Schulmeister John Milton, der vagabundierende Dante Alighieri, der Dienstmann, der mir gestern eine Nachricht zustellte, oder der Friseur, der mir Witze erzählt, und der Kellner, der mir soeben die Freundlichkeit erwies, gute Besserung zu wünschen, weil ich meinen Wein nur zur Hälfte getrunken habe.
25
Bei diesem Farbdruck ist nichts zu machen. Ich betrachte ihn unverwandt und weiß nicht, ob ich ihn sehe. In dem Schaufenster sind noch andere, und dann dieser. Er thront in der Mitte und versperrt mir die Sicht auf die Treppe.
Sie preßt den Frühling an ihren Busen und betrachtet mich unverwandt mit traurigen Augen. Sie lächelt mit papiernem Glanz, und ihre Wangen sind von schönstem Rot. Der Himmel hinter ihr ist hellblau, wie gewirkt. Ihr Mund fein gezeichnet, fast klein, und über seinem Postkartenausdruck blicken ihre Augen mich unverändert leidvoll an. Der Arm, der die Blumen hält, erinnert mich an einen anderen Arm. Das Kleid oder die Bluse öffnet sich zu einem bestickten Dekolleté. Die Augen sind wirklich traurig: Sie betrachten mich aus der Tiefe ihrer lithographischen Wirklichkeit, spiegeln eine Wahrheit wider. Sie ist mit dem Frühling gekommen. Ihre traurigen Augen sind groß, aber das ist es nicht. Ich gebe meinen Füßen einen Ruck und reiße mich von dem Schaufenster los. Überquere die Straße, drehe mich um in ohnmächtiger Empörung. Sie hält noch immer den Frühling fest, den man ihr in den Arm gelegt hat, und ihre Augen sind traurig wie alles, was mir nicht vergönnt ist im Leben. Aus der Ferne wirkt das Bild farbiger. Sie trägt ein dunkelrosa Band um ihr hochgestecktes Haar; ich hatte es nicht bemerkt. In menschlichen Augen – selbst auf einem Farbdruck – liegt etwas Schreckliches: das unvermeidliche Anzeichen eines Bewußtseins, der heimliche Schrei, der von einer Seele zeugt. Mühsam erhebe ich mich aus meinem feuchten Schlaf, schüttle wie ein Hund die dunkle Nebelnässe ab. Und als nähmen sie Abschied von etwas anderem, übersehen diese zutiefst lebenstraurigen Augen dieses metaphysischen Farbdrucks, den wir von Ferne betrachten, mein Weggehen und betrachten mich unverwandt, als wüßte ich etwas von Gott. Unter der Abbildung ist ein Kalender, oben und unten von zwei schwarzen, leicht gewölbten und schlecht gemalten Leisten gerahmt. Zwischen diesem Oben und Unten seiner Begrenzung, über der mit einer altmodischen Vignette kunstvoll verzierten Jahreszahl 1929, die den unvermeidlichen 1. Januar verdeckt, lächeln mich ironisch die traurigen Augen an.
Seltsam, woher ich dieses Gesicht bereits kenne. Hinten in meinem Büro hängt in einer Ecke ein ebensolcher Kalender, mein Blick hat ihn oft gestreift. Doch aufgrund eines Geheimnisses, das in dem Farbdruck liegt oder in mir, drücken die Augen der Doppelgängerin im Büro keinen Schmerz aus. Es handelt sich um einen Farbdruck (der auf Glanzpapier sein verblassendes Dasein über dem Kopf des Linkshänders Alves verschläft), und nichts weiter.
Über all dies lachte ich am liebsten, doch verspüre ich großes Unbehagen. Und in meiner Seele die Kälte einer plötzlichen Krankheit. Mir fehlt es an der Kraft, mich gegen eine solche Absurdität aufzulehnen. Welchem Fenster zu welchem Geheimnis Gottes könnte ich mich ungewollt genähert haben? Wohin führt das Schaufenster vor dem Treppenabsatz? Was hat es auf sich mit den Augen auf dem Farbdruck? Mich fröstelt fast. Unwillkürlich sehe ich auf zu der Ecke im Büro, wo der echte Farbdruck hängt. Ich kann meinen Blick nicht mehr lösen von dort.
26
Jeder Gemütsbewegung eine Persönlichkeit zuordnen, jedem Seelenzustand eine Seele.
Sie kamen um die Wegbiegung, eine Schar junger Mädchen. Singend gingen sie dahin, und ihre Stimmen klangen glücklich. Wer sie waren, weiß ich nicht. Ich hörte ihnen eine Zeitlang von weitem zu, ohne selbst etwas zu empfinden. Doch Kummer ergriff mein Herz.
War es ihre Zukunft? Ihre Unbewußtheit? Waren wirklich sie es?, oder – wer weiß – vielleicht nur ich?
27
Literatur, eine mit dem Denken vermählte Kunst und eine Verwirklichung ohne den Makel der Wirklichkeit, scheint mir das Ziel, dem alles menschliche Bestreben gelten sollte, wenn es denn wahrhaft menschlich und nicht allzu tierhaft wäre. Ich glaube, eine Sache in Worte fassen heißt ihr die Kraft bewahren und den Schrecken nehmen. Felder sind grüner in der Beschreibung als in ihrem Grün. Beschreibt man Blumen mit Sätzen, die sie im Bereich des Imaginären definieren, sind ihre Farben von einer Dauer, die ihr zelluläres Leben nicht hergibt.
Sich bewegen heißt leben, sich in Worte fassen heißt überleben. Nichts im Leben ist weniger wirklich, weil es gut beschrieben wurde. Kleinkarierte Kritiker pflegen zu betonen, ein Gedicht in hymnischen Rhythmen besage letztlich doch nur, daß der Tag schön ist. Doch in Worte fassen, daß der Tag schön ist, ist schwierig, zudem vergeht auch der schöne Tag. Mithin müssen wir den schönen Tag in einem wortreichen, blühenden Gedächtnis bewahren und auf diese Weise die Felder oder Himmel der leeren, vergänglichen äußeren Welt mit neuen Blumen oder neuen Sternen übersäen.
Alles ist, was wir sind, und alles wird für jene, die in der Vielfalt der Zeit nach uns kommen, so sein, wie wir es uns intensiv vorgestellt haben, das heißt wie wir es, unsere Vorstellungskraft verkörpernd, wahrhaft gewesen sein werden. Ich glaube nicht, daß die Geschichte mit ihrem großen verblichenen Panorama mehr ist als eine Abfolge von Deutungen, ein verworrener Konsens geistesabwesender Zeugen. Romanciers sind wir alle, und wir erzählen, wenn wir sehen, denn sehen ist so komplex wie alles übrige.
Ich habe in diesem Augenblick so viele grundlegende Gedanken, so viele wahrhaft metaphysische Dinge zu sagen, daß ich mich mit einem Male müde fühle und beschließe, nicht weiterzuschreiben, nicht weiterzudenken, sondern geschehen zu lassen, daß mir das Wortfieber Schlaf schenkt und ich mit geschlossenen Augen alles, was ich gesagt haben könnte, wie eine Katze streichele.
28
Ein Hauch von Musik oder Traum, irgend etwas, das beinahe fühlen läßt, irgend etwas, das kein Denken erlaubt.
29
Nachdem die letzten Regentropfen nur noch zögernd von den Dächern fielen und das Blau des Himmels sich zusehends auf der gepflasterten Straßenmitte spiegelte, klangen die Fahrzeuge mit einem Mal anders, höher und fröhlicher, und das Aufgehen der Fenster hin zum Nicht-Vergessen der Sonne war vernehmbar. An der nächsten Ecke der schmalen Straße ertönte der laute Lockruf des ersten Losverkäufers, und die Schläge, mit denen man die Nägel in die Kisten aus dem Laden gegenüber trieb, hallten durch den lichten Raum.
Es war ein unklarer Feiertag, gesetzlich, aber kaum beachtet. Ruhe und Arbeit lagen eng beieinander, und ich hatte nichts zu tun. Ich war früh aufgestanden und ließ mir Zeit, mich für das Dasein zu rüsten. Ich ging im Zimmer auf und ab und träumte hoch, zusammenhanglose, unverwirklichbare Dinge – Gesten, die ich unterlassen, unmögliche Vorhaben, die ich blindlings ausgeführt hatte, lange, intensive Gespräche, die stattgefunden hätten, hätten sie denn stattgefunden. Und in dieser Träumerei ohne Größe noch Ruhe, in diesem Verweilen ohne Hoffnung noch Zweck vergeudeten meine Schritte den freien Vormittag, und meine lauten leisen Worte hallten vielfach wider im Kloster meiner kargen Abgeschiedenheit.
Betrachtete ich meine menschliche Gestalt mit Abstand, war sie lächerlich wie alles Menschliche, dem man näherkommt. Ich trug – über der schlichten Kleidung des aufgegebenen Schlafes – einen alten Überzieher, der mir für diese morgendlichen Nachtwachen dient. Meine alten Pantoffeln waren löchrig, insbesondere der linke. Die Hände in den Taschen dieses postumen Aufzugs durchmaß ich die Avenida meines winzigen Zimmers mit langen, entschiedenen Schritten und erfüllte mir mit meiner nutzlosen Träumerei einen Traum, wie ihn alle hegen.
Durch die offene Frische meines einzigen Fensters hörte ich noch immer die von den Dächern fallenden regenschweren Tropfen. Der Regen war abgezogen, und ein Hauch Frische war geblieben. Der Himmel war von einnehmender Bläue, und die Wolken, die der besiegte oder erschöpfte Regen zurückgelassen hatte, gaben bei ihrem Rückzug Richtung Castelo de São Jorge die rechtmäßigen Wege des gesamten Himmels frei.
Dies war die Gelegenheit, fröhlich zu sein. Doch etwas bedrückte mich, eine unbekannte Sehnsucht, ein unbestimmtes, nicht einmal schwaches Verlangen. Vielleicht brauchte es seine Zeit, um sich lebendig zu fühlen. Und als ich mich hoch oben zum Fenster hinauslehnte und auf die Straße sah, ohne die Straße zu sehen, fühlte ich mich plötzlich wie einer dieser nassen Lappen, mit denen man Schmutz beseitigt und die man anschließend zum Trocknen ans Fenster legt, dann aber zusammengeknäuelt auf der Fensterbank vergißt, die sie ihrerseits zusehends beschmutzen.
30
Ich gestehe, traurig oder auch nicht, daß ich ein trockenherziger Mensch bin. Ein Adjektiv bedeutet mir mehr als ein wirkliches Weinen der Seele. Mein Meister Vieira[6] [ …]
Doch bisweilen bin ich ein anderer, dann weine ich Tränen, heiße Tränen wie Menschen, die keine Mutter haben und nie hatten; und meine Augen, die von diesen toten Tränen brennen, brennen im Innern meines Herzens.
Ich entsinne mich nicht meiner Mutter. Sie starb, als ich ein Jahr alt war.[7] Alles Harte und Zerrissene meines Gemüts rührt von dem Fehlen dieser Wärme und von der nutzlosen Sehnsucht nach Küssen, an die ich mich nicht erinnere. Ich bin ein künstliches Wesen. Ich erwachte immer an fremden Brüsten, auf Umwegen gezärtelt.
Ach, die Sehnsucht nach dem Anderen, der ich hätte sein können, zerreißt und erschreckt mich! Welch ein Anderer wäre ich wohl, hätte man mir jene Zärtlichkeit gegeben, die aus dem Bauch kommt und in Küssen Ausdruck findet auf einem Kindergesichtchen?
Vielleicht hat der Schmerz, kein Sohn gewesen zu sein, wesentlich Anteil an meiner emotionalen Gleichgültigkeit. Wer mich als Kind an sein Gesicht drückte, konnte mich nicht an sein Herz drücken. Bis auf sie, die fern war, in einem Grab – sie, die mir gehört hätte, hätte es das Schicksal gewollt.
Später erzählte man mir, meine Mutter sei hübsch gewesen, und es heißt, als man dies erzählte, hätte ich nichts darauf erwidert. Ich war schon reif an Körper und Seele, doch auf Gefühle verstand ich mich nicht, und ihr Ausdruck ließ mich noch nicht an andere, schwer vorstellbare Seiten denken.
Mein Vater, der weit weg lebte, legte Hand an sich, als ich drei war, ich habe ihn nie gekannt.[8] Ich weiß noch immer nicht, weshalb er weit weg lebte. Ich habe mich nie bemüht, es herauszufinden. Ich erinnere mich an die Nachricht von seinem Tod als ein ernstes Schweigen während der folgenden, ersten Mahlzeiten. Ich weiß noch, daß man mich von Zeit zu Zeit ansah. Ich erwiderte diese Blicke und begriff dumpf. Aß darauf manierlicher weiter, für den Fall, daß man mich, ohne daß ich es bemerkte, weiterhin ansah.
All das bin ich, ob ich will oder nicht, in den dunklen Tiefen meiner verhängnisvollen Sensibilität.
31
Die Uhr, hinten im Haus, das wie ausgestorben wirkt, da alle schlafen, schlägt langsam vier helle Schläge zur vierten Stunde der Nacht. Ich schlafe noch immer nicht und erwarte auch nicht, es noch zu können. Ohne daß etwas meine Aufmerksamkeit fesselte und mich so vom Schlaf abhielte oder auf meinem Körper lastete und mich daher nicht zur Ruhe kommen ließe, liege ich hier im starren Schweigen meines mir fremden Körpers im Dunkel, einsamer noch durch das schwache Mondlicht der Straßenlaternen. Ich bin außerstande zu denken, so schläfrig bin ich; ich bin außerstande zu fühlen, so fehlt mir der Schlaf.
Alles um mich her ist ein abstraktes, nacktes Universum nächtlicher Verneinungen. Teils übermüdet, teils unruhig rühre ich mit dem Empfinden meines Körpers an die metaphysische Kenntnis vom Geheimnis der Dinge. Bisweilen erlahmt meine Seele, dann treiben formlose Einzelheiten des alltäglichen Lebens an der Oberfläche meines Bewußtseins, und ich führe in meinem schlaflosen Dämmerzustand Buch. Ein andermal erwache ich aus dem Halbschlaf, und vage poetische, unfreiwillig farbige Bilder ziehen in lautlosem Spiel durch meine geistesabwesenden Gedanken. Meine Augen sind nicht ganz geschlossen. Meinen matten Blick umflort von fern ein Licht; es kommt von den brennenden Laternen, unten, am Rand der verlassenen Straße.
Aufhören, einschlafen, dieses Zwischenbewußtsein ersetzen durch bessere, melancholische Dinge, heimlich dem zugeraunt, der mich nicht kennt! … Aufhören, fließen, flink wie ein Flüßchen, Ebbe und Flut eines weiten Meeres, an Küsten sichtbar in einer Nacht, in der man wirklich schlafen kann! … Aufhören, unerkannt und äußerlich sein, sich bewegende Zweige in entlegenen Alleen, sanftes Blätterfallen, mehr am Geräusch als am Fall wahrgenommen, ein hohes, schmales Meer aus Fontänen in der Ferne und all das Unbestimmte nächtlicher Parks, verloren in einem endlosen Gewirr, natürliche Labyrinthe der Finsternis …! Aufhören, endlich aufhören zu sein, doch als etwas anderes überleben, als Seite eines Buches, als eine Strähne aufgelösten Haars, als das Schwingen der Kletterpflanze nahe dem halboffenen Fenster, als belanglose Schritte auf dem feinen Kies der Wegbiegung, als letzter hoher Rauch des einschlafenden Dorfes, als vergessene Peitsche des Fuhrmanns am morgendlichen Wegrand … Widersinn, Verwirrung und Verlöschen – alles, nur nicht das Leben …
Und ich schlafe auf meine Weise, ohne Schlaf noch Ruhe, dieses vegetative Leben der Phantasie, und unter meinen ruhelosen Augenlidern treibt wie der stille Schaum eines schmutzigen Meeres der ferne Widerschein der stummen Straßenlaternen.
Ich schlafe und schlafe nicht.