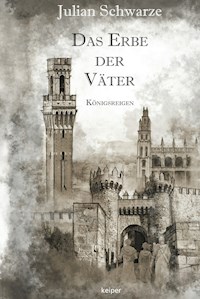
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: edition keiper
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Diese Geschichte beginnt in einer Zeit der Umbrüche. Während im Südwesten der Quaranenreiche die Sangloren herrschen, stehen den Stadtstaaten im nördlichen Osten Statthalter vor. Zwar regiert ein König all diese vereinten Teilreiche, doch kaum jemand weiß von der Krankheit, die ihn schwächt. Aus Angst, dass beim Tod des Königs ein Thronfolgekrieg entstehen könnte, macht sich der Lehrmeister Tandûn von Amosthal mit seiner Schülerin auf den Weg, um in den entlegenen Bergen nach einem Sohn der Göttin Helemâs zu suchen. Dieser stand einst im Dienste einer unbestechlichen Gemeinschaft, um den Frieden in den Quaranenreichen zu wahren. Jetzt soll er seinen Schutz über drei junge Menschen stellen, die nicht ungleicher sein könnten: Marbana, die wissbegierige Schülerin des Lehrmeisters Tandûn von Amosthal; Simon, ein schüchterner Tempelschüler, und Timus, der turniererprobte Sohn des Sanglors von Hêmen. Das Misstrauen zwischen den drei jungen, unfreiwilligen Gefährten ist groß. Können sie ihre Kräfte noch rechtzeitig einen, bevor die Thronanwärter ihre Intrigen umsetzen können und Krieg in den Quaranenreichen ausbricht?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Julian R. Schwarze
Das Erbe der VäterKönigsreigen
Ein Fantasy-Roman
www.editionkeiper.at
1. Auflage September 2020
© edition keiper, Graz 2020
Layout und Satz: textzentrum graz
Lektorat: Maria Ankowitsch
Cover und Landkarte: Lena Huber
Autorenfoto: Oskar Polak
eISBN 9783903322226
Inhalt
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Epilog
Personen- und Ämterliste
Danksagung
Über den Autor
Prolog
Wie einst mein Ahne, der sich Romanus der Schreiber nannte, bin auch ich durch die Ländereien gereist, habe Königinnen und Könige, Adelsherren, Gelehrte, Soldaten, Handwerker, Händlerinnen, Bauern und auch die Liebesdienerinnen getroffen. Sie alle erzählten mir ihre Geschichten, ihre Erfahrungen, Ängste, Sorgen und Hoffnungen. Einzelne Schicksale, ineinander verflochten wie die Fäden eines Stoffes, die wirr und ohne erkenntlichen Sinn das Leben eines einfachen Knechtes im Südwesten mit jenem einer Adelsherrin im Nordosten verbanden – durch Blutlinie, Bündnisse, Schwüre, Freundschaft oder den Dienst an einer weitvernetzten Gemeinschaft. Oder sie teilten dieselbe Idee, den gemeinsamen Glauben an die Götter, an Gerechtigkeit. Man bekämpfte denselben Feind, ohne voneinander zu wissen, aus unterschiedlichen Gründen, mit unterschiedlichen Mitteln.
Hätte der gesellschaftliche Stand, das alltägliche Leben einer Königin von jenem einer Magd kaum unterschiedlicher sein können, so war ihnen die Trauer gemein, wenn ein Freund, ein Geliebter oder Ehemann verstarb. Die Tränen kamen aus derselben Quelle.
Ich war in den kleinen Dörfern in den eisigen Bergen, zog über weite Felder, durch dichte Wälder, war auf den Höfen der Sangloren geladen, nächtigte mit Reisenden an Lagerfeuern, beschlief Liebesdienerinnen in den großen Städten für ein paar Kupferlinge und lebte in den Zeltstätten der Soldaten bei Feldzügen.
Ob ich im Königreich der vereinten Quaranenreiche und Stadtstaaten oder in den Wüstenprovinzen jenseits des Salzigen Sees war, all diese Menschen, mit denen ich sprach, teilten dieselben Sorgen. Sie alle richteten ihr Handeln danach aus, den nächsten Tag zu erleben, ungewiss darüber, ob er Segen brachte oder das Verderben – den gesellschaftlichen Absturz, eine Krankheit, den Verlust von Besitz, eines Körpergliedes, des Verstandes oder gar des Lebens.
Ich spielte in den Wirren dieser Geschichten keine Rolle, war nie ein Teil dieses Geflechtes, entschied nie über das Leben oder den Tod eines Mannes, änderte nie den Verlauf der wohl vorbestimmten Ereignisse. Dennoch denke ich, dass durch die Zeit meine Arbeit als einzige von Bedeutung zu sein scheint. Ich bin der Beobachter, der Zuhörer, der Erzähler und nun auch der Schreiber. Wenn mein Werk nicht entsteht, nicht überdauert, will alles Erlebte, Gefühlte und Gedachte nie gewesen sein.
Man sagt, die Sieger diktieren die Geschichte, berichten von ihren Errungenschaften, um für ihre Grausamkeiten Recht zu schaffen. Doch dies soll hier nicht geschehen – ich war nie einem Herrn verpflichtet.
Ich lebte als Erzähler, bot dem Publikum eine Geschichte, von der ich glaubte, dass es sie hören wollte. Manch einer mochte sie, manch einer schenkte mir Wein ein, bot mir Brot, einen Platz für die Nacht oder brachte gar meinen Beutel zum Klingeln. Andere hingegen schmähten meine Erzählungen, beschimpften mich oder bezeichneten mich als einen Lügner. Ihnen stand es frei zu gehen – und so werde ich auch jene nicht dazu anhalten, die meine Schriften nicht lesen wollen.
Nun bin ich alt. Lange habe ich der Unterhaltung meiner Gefährten gedient, weshalb ich anfing, die vielen Erzählungen der Menschen niederzuschreiben, auf dass auch in späterer Zeit ein Publikum, geplagt von alltäglichen Sorgen, der trübsinnigen Gegenwart entrissen werden kann und die Fantasie die Gedanken in eine fremde Welt reisen lässt.
Es sei mir verziehen, dass ich meine Geschichte mit zwei Freunden beginne, die einander vermutlich nie begegnet waren. Und doch hatten sie derselben Idee gedient, dieselben Ideale verfolgt, die einst von einer Bruderschaft – den Söhnen der Göttin Helemâs – verkörpert worden waren.
Das Geschehen beginnt in einer Zeit der Umbrüche, ohne dass deren Ausmaß den Bürgern des Königreichs bewusst war – auch ich hatte damals die Bedeutung der jüngsten Ereignisse nicht im Geringsten erahnt.
Während im Südwesten in den Quaranenreichen die Sangloren herrschten, standen den Stadtstaaten im nördlichen Osten Statthalter vor. Der König, welcher das vereinte Reich von seinem Palast in der Königsstätte aus regierte, war nicht annähernd so bedeutend, wie es die Größe seines beherrschten Gebietes vermuten lässt. Er war eine repräsentative Figur, die einzig in Kriegszeiten uneingeschränkt mächtig war. In der anhaltenden Friedenszeit hingegen spielte er keine Rolle für den Alltag der Bewohner in den fernen Quaranenreichen, sodass kaum ein Bürger von der Krankheit wusste, die den gealterten König schwächte – anders als sein Tod, der das Reich erschüttern und jedes einzelne Leben betreffen würde.
Von seinem Tod wussten zu Beginn dieser Geschichte jedoch nur wenige – auch ich nicht –, und diejenigen, die eingeweiht waren, unternahmen alles, um diese Nachricht geheim zu halten. Palastwachen wurden bestochen, eingesperrt oder ermordet ebenso wie die Diener, Heilkundigen und Priester, die man auch die Tempelwächter des Timerus nannte.
Mit dem Wissen, dass der König eines schwachen Geschlechts bald sterben und nur einen unmündigen Sohn sowie eine Witwe hinterlassen würde, die zwar ihrer Stellung wegen begehrt, aber beim Volk verachtet war, schmiedeten die hohen Adelsmänner, Statthalter und einflussreichen Tempelwächter Pläne für einen neuen Thronerben. Man wollte Verbündete gewinnen, sandte Quarandore mit Botschaften und Bündnisverträgen aus. Doch von Bedeutung waren allen voran nur die Hohen Sangloren, die als Einzige bei der Königswahl stimmberechtigt waren. Unter ihnen gab es einen Mann, der besonderen Einfluss genoss. Bargodon von Milang stand nicht nur dem reichsten Quaranenreich vor; wer ihn als Verbündeten wusste, würde auch die Königswahl für sich gewinnen.
Die Angst, dass der Kampf um die Thronfolge das Reich spalten würde, trieb den Lehrmeister Tandûn von Amosthal nun an, nach Westen zu reisen, wo in den Bergen einstige Söhne der Göttin Helemâs zurückgezogen lebten. Wegen Eidbruches verstoßen, lebten diese Männer abgeschieden von ihren einstigen Wirkungsstätten, um durch die Selbstgeißelung Gnade bei der Göttin Helemâs zu erlangen, auf dass diese Krieger nach ihrem Tod die Ewige Halle betreten dürften. Tandûn von Amosthal wollte in Begleitung seiner Schülerin diese Männer zurückgewinnen, sie abermals eine unbestechliche Gemeinschaft bilden lassen, die durch ihre Einsätze und den Kontakt zu den Sangloren den Frieden und die politische Stabilität in den Quaranenreichen wahren könnte. Doch auch er hatte die Machtgier und Durchtriebenheit seiner Feinde unterschätzt. Er wusste nicht, dass es längst zu spät war, um den Thronfolgekrieg aufzuhalten.
1. Kapitel
Mit mürrischem Blick starrte er aus der kleinen Fensternische, während der Regen schier unermüdlich auf das Dach prasselte. Bereits drei volle Tage waren vergangen, in denen das vom Himmel kommende Nass nicht aufgehört hatte, die Böden aufzuweichen. Das Dorf schien ausgestorben zu sein, kaum eine Seele verließ das trockene Heim, außer um auf den verschlammten Wegen watend sich Brennholz zu besorgen oder Nahrung beim Priester zu erbetteln.
Er selbst hatte einzig für die Gebete am geweihten Altar, wo auch die Opfergaben dargeboten wurden, seine Hütte verlassen – oder um sich seiner Exkremente zu entledigen. Etwas schien an ihm zu nagen. Zweifellos war dieses unnatürliche Wetter eine Strafe Talimas’ des Weinenden, des Herrn über die Winde, Regenfälle, Wolken und den Sonnenschein. Vermutlich belegte er das gesamte Dorf mit diesem Fluch, um einzig ihn, den Narren, wie sie ihn hier in den Bergen seit jeher nannten, abzustrafen.
Er verstand sich als Sohn der Helemâs, der Wächterin der Heimlosen und Tributin der Armen. Sie hatte auch über ihn gewacht, der weder heimlos noch verarmt war, dafür sollte er als ein Mitglied der Bruderschaft sich jener annehmen, die des Schutzes bedurften. Dieser Aufgabe hatte er sich bereits vor geraumer Zeit abgewendet, hatte seine Brüder verlassen und war in die Berge gegangen, wo er sich bei den Bewohnern eines entlegenen Dorfes seinen Frieden erhoffte. Zu viele Menschen hatten ihn einst angefleht, für zu viele Menschen hatte er vergebens Recht gesprochen. Doch weder die Sangloren, die hohen Adelsherren, noch der König, in diesem Land oder in den benachbarten Ländereien, waren willens, sich der Armut anzunehmen oder gar einen Bürger von Rang wegen eines Vergehens an Besitzlosen anzuklagen, während jene, denen er seinen Gehorsam geschworen hatte, selbst an dem Kampf um Macht und Reichtum beteiligt waren.
Es war gewiss! Nun wird über ihn gerichtet werden, sein Wunsch nach Ruhe, seine Feigheit gesühnt. Und sollte er nicht aus diesem Dorf fliehen, so würde seine Anwesenheit hier all die unschuldigen Seelen verdammen, den Zorn der Götter erwecken und Talimas würde mit einem Unwetter all die Hütten, Höfe und selbst den geweihten Altar zerstören und die Fluten würden ihre Überreste in das Tal hinabschwemmen.
Lautes Poltern riss ihn aus den Gedanken. Ein verzweifeltes Stöhnen entwich seiner Kehle, als er sich der Tür zuwandte.
»Narr, mach auf!«, rief die junge Stimme des Sohnes eines jener Bauern, dessen Hof am oberen Ende des weitläufigen Dorfes lag. Der Narr sah sich verunsichert um, griff nach dem kleinen Dolch, der stets neben der Tür an einem Riemen hing, und öffnete den Eingang einen Spalt. Sogleich wurde er von dem kräftigen Jungen beiseitegeschoben, der eintrat und seinen Mantel leise fluchend ausschüttelte. »Wenn doch bloß diese Kälte nicht wäre!«
Verwirrt schloss der Narr wieder die Tür und musterte seinen Gast. Er mochte den Jungen, zwar hatten sie nicht viel miteinander zu tun, doch war jener es gewesen, der ihn bei seiner Ankunft vor all den Jahren aufgenommen hatte, ihm Essen, Trinken und einen Schlafplatz im Stall angeboten hatte.
»Vater schickt mich. Zwei Fremde wurden gefunden. Sie waren auf dem Weg ins Dorf.«
»Dem Weg … auf dem Weg herauf?«, grummelte der Narr nachdenklich. Zu dieser Jahreszeit wagten nur besonders kühne Fremde den Weg zum Dorf hinauf. Es war gewiss! Sie schickten nach ihm. Sie, die Wächter des Tempels des Timerus, des höchsten aller Götter. Oder waren es die Schergen des Königs? Auch vor ihnen war er in die Berge geflohen. Oder gar Krieger der Bruderschaft, die er verlassen hatte?
»Zwei Fremde?«, murmelte der Narr leise.
»Ja, sie sind vom Unwetter überrascht worden. Vater versucht mit einigen Männern, ihnen zu helfen.«
Sie waren seinetwegen gekommen! Er brachte die Dorfbewohner nur weiter in Gefahr, wenn er bliebe. Es gab nur einen Weg, er musste fliehen!
»Gehen … nicht verweilen in meinem Haus!«, keuchte er und packte seinen Gast an den Schultern. »Geh … hilf … hilf den anderen!«
»Wovor fürchtest du dich? Sind sie deinetwegen gekommen?« Verunsichert trat Jophur zurück und betrachtete den Narren mit besorgtem Blick.
»Geh!« Der Narr wollte nicht weitersprechen, auch wusste er nicht, was er hätte sagen können, er wusste selbst nicht so recht, wie er mit all dem umgehen sollte. Kaum war der Junge hinausgestürzt, raffte er schnell sein wenig Hab und Gut zusammen, packte den Dolch, seine Pfeife, etwas Tabak, eine kleine Schriftensammlung, einen Beutel mit Kupferlingen und wickelte einige der Kleidungsfetzen in der einzigen Decke, die er besaß, ein. Wehmütig sah er sich in der Hütte um, die er vor Jahren selbst erbaut hatte. Zwar war er stets der Fremde geblieben, doch war dies in all der Zeit seine Heimat geworden.
Er wollte bereits gehen, nur schnell diesen Ort verlassen, als seine Beine ihm nicht länger gehorchen wollten. Er blieb stehen, starr. Mit pochendem Herzen wandte er sich um und blickte die Truhe an, die unberührt, von einer Staubschicht überzogen, in der Ecke stand. Eine kleine geschnitzte Holzfigur, ein Bildnis der Göttin Helemâs, stand darauf.
Fluchend näherte er sich der Truhe. Er hatte sich geschworen, sie nicht mehr zu öffnen, mit einem Schloss das zu versiegeln, was darin lag, doch kein Schmiedemeister war die steilen Wege zu ihm heraufgekommen und auch der ungeschickte Dorfschmied war nicht fähig gewesen, ein sicheres Schloss anzufertigen – schließlich besaßen die Dorfbewohner auch nichts, was man hätte verschließen müssen. So war die Truhe unverschlossen geblieben.
Der Narr legte hastig die kleine Holzfigur beiseite, ehe er den Deckel anhob und ins Innere der Lade blickte. Darin lagen seine alte Kleidung, ein edler Mantel aus Tierhäuten mit einem Kettenhemd darunter, gepanzerte Handschuhe, eine verstärkte Hose, Stiefel mit Stahlüberzug und sogar ein Helm. Doch nichts davon rührte er an, einzig das Schwert, das obenauf lag, von einer schlichten Scheide geschützt. Es hatte keine lange Klinge, da er meist die Waffe unter dem Mantel verborgen getragen hatte und sie nicht selten in engen, verdreckten Gassen großer Städte zum Einsatz gekommen war. Einst war der Inhalt der Truhe seine Rüstung gewesen, die unter seinesgleichen seinen Rang verriet, doch hatte er sich von diesem Weg damals, als er in die Berge gekommen war, abgewandt.
Schnell befestigte er das Schwert an seinem Gürtel und verließ ohne einen weiteren Blick die kleine Hütte, um draußen sogleich im Schlamm der aufgeweichten Pfade zu versinken.
Marbana hielt das Bündel, welches ihr Lehrmeister ihr übergeben hatte, fest gegen die Brust gedrückt. Ihre Schultern schmerzten unter der Last der Riemen, die an einem Holzgestell befestigt waren, wo all ihr Proviant, die Ausrüstung und eine zusätzliche Decke festgezurrt waren.
Es war noch zur heißen Jahreszeit gewesen, als sie und ihr Lehrmeister aufgebrochen waren. Was oder wen sie suchten, wusste das Mädchen nicht, doch sie folgte ihm stillschweigend von Stadt zu Stadt. Am vergangenen Tag waren sie in die strömenden Regenmassen gekommen, welche ihnen den steilen Pfad den Berg hinauf erschwerten. Da der Lehrmeister an seinen alten Tagen litt, trug sie von der gemeinsamen Ausrüstung, was sie zusätzlich schultern konnte. Alles andere musste zurückgelassen werden.
»Herr, Ihr seht erschöpft aus!«, rief sie ihrem Lehrmeister zu, der wenige Schritte vor ihr keuchend stehen geblieben war und nun zu seiner Schülerin zurückblickte.
»Der Regen wird nicht nachlassen, wir müssen weiter, bevor die Nacht heranbricht!« Dann wandte er sich um und stapfte weiter, auf seinen Stab gestützt.
Es wurde immer düsterer, die Sicht verschlechterte sich. Wie sehr der Abend herangebrochen war, war schwer auszumachen.
»Meister, wir können nicht weiter, bald wird es zu dunkel sein!« Marbana hatte den alten Mann eingeholt und zwang ihn, stehen zu bleiben. »Ihr seid zu erschöpft!«, tadelte sie.
Tandûn von Amosthal blickte mit seinen hellen Augen das Mädchen an, auf welches er so stolz war. Er selbst hatte es die Schrift und die Zahlenlehre gelehrt. Wenn man es betrachtete, sah man nur eine junge Frau, vielleicht sogar schon im heiratsfähigen Alter, mit verfilzten Haaren, meist schmutzigem Gesicht und von der Arbeit dreckigen Händen. Man würde in Marbana eine Magd vermuten, doch niemals die ausgezeichnete Schwertkriegerin, die sich auch in der Heilkunst verstand und über einen wachen Verstand verfügte. Wusch man ihr den Schlamm von Gesicht und Händen, würde man ihre wahre Schönheit erkennen, mit den bernsteinfarbenen Augen und den haselnussbraunen Haaren.
Zwar wollte er seiner Schülerin widersprechen, doch musste er sich eingestehen, dass sie recht hatte. Der Weg war zu gefährlich, um ihn bei Dunkelheit fortzusetzen, und so blieb ihnen nichts anderes übrig, als nach einem halbwegs geschützten Platz für die Nacht Ausschau zu halten. Nicht viel weiter standen einige hohe Bäume nahe dem Weg dicht beieinander. Gegen ihren Stamm gelehnt, waren er und seine Begleiterin zumindest vor dem direkten Regen geschützt.
»Herr, schon seit so vielen Tagen reisen wir von Stadt zu Stadt, haben die Einöden durchquert und wollen nun die hohen Berge erklimmen. Warum? Was sucht Ihr?«
Tandûn von Amosthal schwieg lange, ehe er sprach. »Einst haben sich so manche Krieger zusammengerottet und sich unter dem Schutz der Göttin Helemâs gegen die Sangloren, die Adelsherren und Könige gestellt. Sie alle haben geschworen, Gehorsam zu leisten. Diesen Schwur haben jedoch einige von ihnen gebrochen.«
»Warum haben sich diese Krieger gegen ihre Herren gestellt?«
»Sie waren keineswegs Feinde der Herrschaftsmächte. Sie waren nur stets um den Schutz der Wehrlosen bemüht. Es war ein Ideal, dem viele Männer gefolgt waren, genoss man doch hohes Ansehen beim niederen Volk. Aber diese Bruderschaft wuchs stetig, zu viele Männer – auch Frauen – schlossen sich ihr an. Manche waren radikal, sie nützten ihr Amt, um zu töten oder Rache an den Adelsfamilien zu nehmen. Die Söhne der Helemâs wurden sehr mächtig und waren kaum noch zu kontrollieren. Die Anführer handelten nach eigenen Interessen, machtgierig waren sie geworden. Der König sah sich also zum Handeln gezwungen. Er verbannte unzählige Krieger der Bruderschaft, veranstaltete Schauhinrichtungen und verhängte einen Bann über all jene Anhänger, die sich in die Machenschaften des Königshauses einmischten oder die an Gerichtsprozessen teilnahmen, um für angeklagte Bürger eine Verteidigungsrede zu übernehmen. Doch es gab noch eine weitere Macht, die gegen diese Männer und Frauen vorgehen wollte: die Wächter des Tempels des Timerus. Diese Priester waren von jeher die Feinde der Bruderschaft. Sie verstanden sich als die alleinigen Schützlinge der Götter, einzig sie sollten die Verbindung zwischen dem Volk und den Göttern darstellen. Diese Tempelwächter, wie sich diese Priester nennen, versprachen eine hohe Belohnung für jeden Bürger, der einen Krieger der Bruderschaft an den Tempel auslieferte, wo jene verurteilt, eingesperrt oder hingerichtet wurden.«
»Warum haben manche dieser … Söhne der Helemâs … den Schwur gebrochen? Waren sie nun gegen das Volk, das sie beschützen wollten?«
Tandûn von Amosthal lächelte matt. »Jene, die den Schwur gebrochen haben, waren der langen Kämpfe leid. Sie hassten das Morden, die Plünderungen und die Verfolgungen. Einst lebten sie inmitten der Städte, hatten Familien, doch viele von ihnen mussten fliehen, sich verstecken. Es war kein Leben mehr, das sie führten, der Freiheit und des Ansehens beraubt. Andere waren enttäuscht von den Oberen, wie ihre Anführer genannt wurden, welche ihre Krieger für persönliche Rachefeldzüge einsetzten, anstatt dem Volk zu dienen.« Der Lehrmeister schloss die Augen und atmete tief durch. »Sie brachen ihren Schwur, der die Wehrlosen schützen sollte, um ihren eigenen Frieden zu finden. Doch nun ist die Zeit gekommen, um den Schwur zu erneuern, nun, da das Volk ihre Hilfe mehr denn je benötigt.«
Marbana hatte noch Fragen, zu begierig war sie darauf, mehr zu erfahren, wo doch all die Zeit über ihr Lehrmeister in Schweigen gehüllt war, aber Tandûn erhob lediglich die Hand und gab damit unmissverständlich zu verstehen, kein weiteres Wort mehr zu sprechen.
Ein Beben riss das Mädchen aus dem Schlaf. Der Berghang über ihnen schien zum Leben erwacht zu sein. Es donnerte und grollte. Schnell rüttelte Marbana ihren Lehrmeister wach, der keine langen Erklärungen benötigte, um die Gefahr zu erkennen. Auf der Stelle machten sich die beiden auf, um in der erdrückenden Finsternis den Weg zurück zum Pfad zu finden, von wo aus sie hastig weiter bergauf eilten, in der Hoffnung, jenseits des Hanges zu kommen, der geräuschvoll drohte, in einer Mure abzugehen. Der Regen hatte nicht nachgelassen, Wasser strömte ihnen nun entgegen, gefährdete sie bei jedem Schritt und sie fürchteten abzurutschen und den Hang hinabzustürzen.
Marbana hatte das Holzgestell mit all ihrem Proviant zurückgelassen. Das Bündel mit den wertvollen Schriften hatte sie sich um die Brust geschnürt, um mit beiden Armen ihren Lehrmeister zu stützen, der kaum Kraft hatte, mit seinen zerschlissenen Schuhen Halt zu finden. Ein heftiger Wind setzte nun zu allem Unheil auch noch ein und peitschte ihnen die schweren Regentropfen ins Gesicht. Ein jeder Laut wurde von einem Geheul verschluckt, von dem man sagte, es sei das Fluchen des Gottes Talimas. Kriechend erreichten die beiden entgegen aller Hoffnung eine kleine Höhle, die ihnen Schutz vor Wind und Regen bot.
Während sie ihren Lehrmeister an einer trockenen Stelle im hinteren Bereich absetzte und ein Dankgebet aussprach, bemerkte Marbana das Zittern des alten Mannes. Sie hörte seinen keuchenden Atem und das leise Flüstern, das kaum zu verstehen war.
Entsetzt starrte sie in das Dunkel. Tandûn von Amosthal war mit ihr nicht selten bei höheren Adelsmännern gewesen, um sich erkrankter Familienmitglieder anzunehmen. Schon so oft hatte sie erlebt, wie ältere Männer, von den Jahren geschwächt, an kalten Regentagen erkrankten und wenige Zeit später mit zittrigen Leibern verstarben. Doch all ihr Wissen über die Heilkunst, all ihre Erfahrung mit dem Tod war nun nichtig und vergessen. Niemals durfte ihrem Lehrmeister selbiges widerfahren, niemals! Es war ihre Pflicht, ihn zu beschützen, ihn vor Gefahren zu bewahren! All die Jahre über waren sie gemeinsam umhergezogen, er war ihr ein Vater gewesen. Niemals würde sie sich verzeihen, wenn hier in dieser Dunkelheit alles ein Ende fände.
Sie stürmte hinaus, zurück in den Regen, und rannte stolpernd den Pfad weiter hinauf, bis ihre Kräfte nachließen.
Sie erwachte mit hämmernden Schmerzen. Stimmen waren in der Nähe zu vernehmen. Eine Hand tastete nach ihren Wangen, ihrer Stirn und presste ein feuchtes Tuch darauf.
»Was … wo…«, stammelte sie.
»Ruhig, beruhige dich!«, antwortete eine sanfte Stimme.
Erschrocken riss Marbana ihre Augen auf und starrte ihr Gegenüber an. Sofort überkam sie ein schwindelerregendes Gefühl und dröhnender Schmerz pochte in ihrem Kopf. Sie blinzelte, ehe sie klar sehen konnte. Ein Mann in ärmlicher, beschmutzter Kleidung und mit dichtem Vollbart stand über sie gebeugt und drückte mit seinen Händen das Mädchen an dessen Schultern behutsam auf die Holzliege zurück.
»Wo bin ich? Was ist geschehen?«, keuchte sie verwirrt und blinzelte mehrfach, um die hellen Flecken vor den Augen loszuwerden.
»Wir haben dich gefunden, du bist bei diesem Unwetter dem Pfad gefolgt.« Neben dem Bärtigen erschien nun ein jüngerer Mann, ebenfalls in ärmliche Bekleidung gehüllt.
»Mein Meister!«
»Dein Meister?« Die beiden Männer warfen sich einen unsicheren Blick zu. »Ist noch jemand mit dir gegangen?«
»Mein Meister!«, schrie Marbana panisch. »Er braucht Hilfe!«
Sogleich versuchte der Bärtige das Mädchen zu beruhigen. »Wo ist dein Meister?« Er wandte sich an den anderen. »Schnell, lauf hinauf ins Dorf und hole Hilfe!«
»Der Regen …«, maulte der andere.
»Lauf!«, rief ihm der Bärtige zu, ehe jener protestieren konnte. Er richtete sich wieder an das Mädchen. »Wo ist dein Meister?«, wiederholte er seine Frage.
»Wir waren unten in der Höhle, er …« Sie brauchte nicht weiterzusprechen, ihr Blick verriet, was sie dachte, was sie fühlte, was sie wusste.
»Bleib hier und warte, ich werde zur Höhle gehen und deinen Meister suchen.« Der Bärtige schenkte dem Mädchen ein aufmunterndes Lächeln, griff nach einer weiteren Decke, die er über die Kranke legte, zog sich den Mantel über, der neben der Tür hing, und verließ die kleine Hütte, um im nächsten Augenblick vom strömenden Regen durchnässt zu werden.
Ihr war heiß. Schweiß sammelte sich auf ihrer Stirn, ein Hitzeschwall überkam sie, während ihre Beine sogleich von einem Frösteln gepackt wurden, das sich bis über die Hüfte in den Rücken zog. Stimmen sprachen gedämpft unweit ihrer Bettstätte. Kerzenschein blendete sie, als sie die Lider öffnete und versuchte, die Umrisse ihrer Umgebung auszumachen.
Jemand saß neben ihr, tupfte ihr mit einem feuchten Tuch die Stirn, fühlte ihre Wangen und Handgelenke. Dem langen Rock nach zu urteilen, war es eine Frau, die sich vorbeugte, im Schein der Kerze war ihr langes, leicht ergrautes Haar, das zu einem Zopf zurückgebunden war, zu sehen. Ein erleichtertes Lächeln, wenn auch von besorgter Miene begleitet, zeichnete sich auf ihrem Gesicht ab.
»Wir waren voller Sorge!«, sagte die Frau mit einer überraschend tiefen Stimme.
»Wo ist mein Meister?«, fragte das Mädchen schwach, wohl ahnend, wie die Antwort lauten würde. Es bedurfte keiner Worte, um die traurige Nachricht zu überbringen. Sogleich brach Marbana in Tränen aus, ein erneutes Zucken überkam ihren Körper.
Der Narr starrte mit einem Seufzen gen Himmel und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Endlich hatte der Regen aufgehört. Die Wolken hatten sich verzogen und ein endloses Blau freigegeben, welches für diese Jahreszeit selten in den Bergen war. Zweifellos war Talimas, der Gott der Winde, Regenfälle, Wolken und des Sonnenscheins, mit seinem Entschluss, das Dorf verlassen zu haben, zufrieden und hatte, kaum war er hinter den hochgelegenen Feldern im Wald verschwunden, die Regenströme eingestellt und schließlich den Himmel freigegeben. Trotz des Wissens, die erbosten Götter wohlgesonnen gestimmt zu haben, klammerte sich die Angst, welche ihn erfasst hatte, wie eine eiserne Kralle um das Herz des Narren. Es konnte nicht lange dauern, bis die Fremden das Dorf erreicht haben würden, um alsgleich festzustellen, dass er weitergezogen war.
Wer auch immer seine Verfolger waren, egal ob Tempelwächter, Schergen des Königs, Mitglieder der Bruderschaft oder gar Krieger der Adelsfamilien, sie hatten alle die Macht, ihn zu bändigen, ihn mit einem weiteren Fluch zu bannen, ihn mitzunehmen oder gar zu töten. Er war ihnen ausgeliefert. Trotz seiner Schwertkünste würde er nicht gegen ihre Stärke ankommen können. Denn zweifellos waren es erfahrene Krieger, die den Pfad in das entlegene Bergdorf inmitten der noch kalten Jahreszeit wagten. Es waren Krieger, die wussten, wer er war, wozu er einst fähig gewesen war, und die es nicht zu unterschätzen galt. Doch ihn hatten die Jahre des Friedens geschwächt. Einzig zur Jagd hatte er seinen Dolch und den Bogen in Händen gehalten. Sein Schwert hingegen war all die Zeit unberührt geblieben.
Nach der kurzen Rast, die er genützt hatte, um wieder zu Atem zu kommen, setzte er seinen Weg fort, weiter in den Wald hinein.
Marbana verließ erstmals die kleine, stickige Hütte, in der sie die vergangenen Tage gelegen hatte, und blickte zur strahlenden Sonne hinauf. Mit einem tiefen Atemzug sog sie die frische Luft ein. Der Schmerz über den Verlust ihres Meisters saß tief und schien ihr Herz zu zersprengen. Sie wollte schreien, weinen, doch weder sammelte sich eine Träne in ihren Augen, noch wollte ein Wort, nicht einmal ein einziger Klang, ihrer Kehle entspringen. Mit hängenden Schultern hob sie den Kopf und blickte sich um. Die Hütte, in der sie von der Fremden gepflegt worden war, stand abseits eines kleinen Dorfes. Einzig Frauen, begleitet von Kindern, eilten mit Körben, in denen Stroh, Holz, Äpfel, Rüben, Wasserkrüge und Brotlaibe lagen, von ihrem Heim zu den anderen Häusern. Die Männer waren vermutlich auf der Jagd oder in den Werkstätten weiter im Inneren des verstreuten Dorfes.
»Dir scheint es besser zu gehen!« Ein Mann in schwarzer Kutte trat langsam auf sie zu. Tiefe Falten im Gesicht gaben sein Alter preis. Seine schwarzblauen Augen strahlten Friedlichkeit und Geduld aus, der schmale Mund war zu einem Lächeln geformt, die Arme hatte er zum Gruß ausgebreitet. »Wir können uns leider nur selten eines Besuchs von Leuten jenseits der Berggrenzen erfreuen.« Als das Mädchen nicht antwortete, sondern nur verunsichert den alten Mann anstarrte, strich sich der Fremde entschuldigend über die Brust. »Es ist an mir, mich vorzustellen. Ich bin Varen, der Priester dieses Dorfes.«
Noch immer blieb das Mädchen in Schweigen gehüllt.
»Ich habe deinen Meister bereits zu unserem geweihten Altar gebracht. Ich dachte mir, du wärst bei der Opferung gerne dabei.«
Marbana nickte stumm, wandte sich vom Priester ab und blickte in die Ferne, aus der sie vor einigen Tagen gekommen waren. Von irgendwo hinter irgendwelchen Bergen zumindest.
»Erlaube mir die Frage – was ist der Grund eures Erscheinens? Man verläuft sich nicht zufällig auf diesen Pfad, der vom Tal heraufführt.«
»Ich wünschte, mein Lehrmeister hätte mir den Grund genannt«, antwortete sie mit schwacher Stimme. Ihr war egal, warum sie gekommen waren. So sehr sie in den vergangenen Tagen darauf gebrannt hatte, zu erfahren, warum der Meister mit ihr den weiten Weg auf sich genommen hatte, so sehr erschien es ihr nun nichtig. Sie wünschte ihn sich einfach nur zurück. Sie vermisste seine knappen Anweisungen, das schmale Lächeln auf seinen Lippen, den Blick in seinen Augen, der bis in ihre Seele vordringen konnte. Sie vermisste seine Ratschläge, die selten einen Sinn ergaben, seine unendliche Geduld, die er hatte, wenn sie etwas erlernen musste, sein zurückgehaltenes Kichern, wenn sie versuchte, aus den alten Büchern in der alten Sprache vorzulesen, und die meisten Worte falsch aussprach, sodass sie oft eine neue Bedeutung ergaben.
Tandûn von Amosthal war zweifellos nicht der gesprächigste Wegbegleiter gewesen, doch hätte sie sich einen Menschen aussuchen können, der an ihrer Seite weilen sollte, so wäre es ihr Lehrmeister gewesen, von dessen unerschöpflichem Wissen sie jeden Tag mehr erlernt hatte. Warum war er nur so stur gewesen? Warum hatten sie nicht gewartet? Das letzte Dorf im Tal zu verlassen, war zu gefährlich gewesen. Hatten sie denn einen Grund gehabt, so bald hier in die Berge hinaufzusteigen?
Der Priester trat näher an sie heran und legte seine Hand behutsam auf ihre Schulter. »Komm, wir sollten die Seele deines Meisters aus dessen Körper befreien. Sie ist schon zu lange an das Leblose gebunden, Horodius der Ewige wird seine aufsteigende Seele erwarten.«
Gemeinsam schritten sie den kurzen Weg ins Zentrum des Bergdorfes hinauf. Jeder Dorfbewohner warf ihr misstrauische Blicke zu. Alle begannen zu tuscheln, einige verschwanden in ihren Hütten, andere hüllten ihre Häupter in Tücher oder verschränkten gar die Arme vor der Brust, um sie wütend anzustarren.
»Sie geben mir die Schuld für das Unwetter«, sprach das Mädchen, ohne darauf zu achten, ob es gehört werden konnte.
»Verzeih ihnen«, antwortete der Priester mit bedacht leiser Stimme. »Hier in den Bergen glaubt man, den Göttern näher zu sein als in den tiefgelegenen Städten. Umso härter trifft uns die Strafe eines Gottes, wenn wir dessen Groll auf uns gezogen haben.«
Sie erreichten einen runden Platz auf einer Anhöhe, in dessen Mitte ein großer steinerner Altar stand. Über dem Altar war ein Gestell aus Holz aufgebaut, auf das Tandûn von Amosthal gebettet war. Langsam traten sie näher und blieben wenige Schritte von dem Leichnam entfernt stehen. Marbana hatte noch nie zuvor einer Opferung beigewohnt, nun trat sie verlegen von einem Fuß auf den anderen. Eine Mauer hatte sich wie eine Blockade in ihrem Inneren aufgebaut, die weder Schmerz noch Trauer zuließ. Mit emotionslosem, leerem Blick starrte sie ihren einstigen Lehrmeister an, der über noch so viel Wissen verfügt hatte, das er nun nicht mehr seiner Schülerin weitergeben konnte.
Ihre ganze Familie war ihr genommen worden, doch die Leere der Einsamkeit war von Tandûn gefüllt gewesen, der ihr ein Vater gewesen war. Sie konnte sich kaum noch an ihre Mutter erinnern, nicht an Geschwister und auch nicht an einen leiblichen Vater. Einzig ihr Lehrmeister hatte sie großgezogen, solange sie zurückdenken konnte. Er hatte sie alles gelehrt, all ihre Fähigkeiten beherrschte sie dank ihm. Bei jedem Schmerz war er ihr beigestanden. Zwar hatte sie sich oft ein tröstendes Wort gewünscht, vielleicht auch eine zärtliche Geste, eine Umarmung, die sie nie empfangen hatte, aber er war treu an ihrer Seite geblieben und sie hatte stets Trost in seiner Gegenwart gefunden. Doch nun war auch er ihr genommen. Und nichts schien diese Leere jemals wieder füllen zu können.
Der Priester berührte ihren Arm und riss das Mädchen aus seinen Gedanken. Marbana sah auf und erkannte den Bärtigen, der sie im strömenden Regen gefunden und aufgenommen hatte. Neben ihm ging die Frau einher, die sie gepflegt hatte. Ihnen folgte der junge Bursche, der vom Bärtigen fortgeschickt worden war, um Hilfe zu holen. Die drei kamen näher, verneigten sich vor dem Altar, legten ihre Hand aufs Herz und sprachen ein leises Gebet. Dann stellten sie sich neben den Priester und schwiegen mit gesenkten Häuptern.
Varen berührte das Mädchen erneut an der Hand und reichte ihm einen silbernen Dolch. Es bedurfte keiner weiteren Worte, um zu wissen, was zu tun war. Marbana trat langsam auf den Altar zu, wo ihr Lehrmeister mit geschlossenen Augen auf dem Gestell lag, unter dem trockenes Heu gesammelt war.
Der Erzählung nach musste der Körper eines jeden Toten geopfert werden, auf dass die Seele von den reglosen Gebeinen getrennt werde, um zu Horodius dem Ewigen aufsteigen zu können. Noch nie zuvor hatte Marbana über alte Riten und den Glauben im Allgemeinen nachgedacht. Ihr Lehrmeister hatte sie gelehrt, ihre Vernunft zu gebrauchen, doch hatte auch er die Macht oder gar die Götter selbst nie infrage gestellt. Nun hielt sie den silbernen Dolch in Händen und blickte zu jenem Mann hinab, der ihr ein Vater gewesen war – und es immer bleiben würde. Sie beugte sich vor, küsste seine blasse, kalte Stirn, ehe sie den Dolch an seiner Brust ansetzte und mit zusammengepressten Zähnen die Klinge in das Herz bohrte. Sogleich brach sie in Tränen aus und sackte auf die Knie. Ein lautloser Schrei entglitt ihrer Kehle.
Der Priester trat an das Mädchen heran und überreichte ihm eine Fackel. Noch war die Opferung nicht vollzogen, der Körper musste verbrannt werden, damit die Seele mit dem Rauch auch sicher aufsteigen konnte. Mit schmerzendem Herzen entzündete das Mädchen das Heu unter dem Gestell und legte anschließend die Fackel auf die Kleidung des alten Mannes, die mit geweihter Flüssigkeit getränkt war, auf dass der Körper auch vollständig in Feuer aufging.
Sie saß in der Hütte auf einem Bett, die Beine angezogen, und starrte bei der kleinen Luke hinaus ins Freie. Es war später Nachmittag, die Sonne war bereits hinter der Bergspitze verschwunden. Die Tür wurde aufgeschoben und der Bärtige trat zusammen mit seiner Frau und dem Priester ein. Sie warfen dem Mädchen einen besorgten Blick zu, dann deuteten sie ihm stumm, zum Tisch zu kommen, wo sie sich eben niederließen.
»Du sagtest, nicht zu wissen, weshalb ihr hergekommen wart?«, fragte der Priester mit auffordernder Stimme, als das Mädchen sich zu ihnen auf die Eckbank gesellte.
»Mein Lehrmeister war auf der Suche.«
»Auf der Suche wonach?« Jegliches Mitgefühl oder etwa Besorgnis war aus den Augen des Bärtigen gewichen, der nun die Fremde mit strengem Blick musterte.
Als das Mädchen nicht antwortete, legte der Priester ein Bündel auf den Tisch. »Dies hattest du bei dir.«
Marbana wusste nur zu gut, was darin war. Es war die Schriftensammlung, erst jetzt wurde ihr das Abhandensein bewusst. Hastig griff sie danach und drückte die Sammlung an ihre Brust, als würde das Bündel eine Wärme ausstrahlen, welche die Kälte aus dem Körper trieb, die Muskeln lockerte und alles Misstrauen weichen ließ. Das Mädchen beugte sich vor und musterte die drei Dorfbewohner abschätzend.
»Mein Lehrmeister sprach von Männern, die geflohen sind. Einzelnen Männern, die als Fremde an den entlegensten Orten leben.«
Der Bärtige wechselte einen schnellen Blick mit dem Priester, dann starrten sie wieder das Mädchen an. »Was wollte dein Meister von dem Narren?«
»Dem Narren?«, fragte Marbana überrascht. Tandûn hatte nie einen Namen genannt.
»Der Narr ist vor einigen Jahren zur kalten Zeit in unser Dorf gekommen. Er verbrachte sieben Tage und Nächte am geweihten Altarsplatz, ehe er das erste Wort an unseren Dorfältesten richtete. Er bat um einen Platz in einer Scheune, dafür werde er jagen und seinen Dienst an der Dorfgemeinde leisten. An jenem Tag, an dem wir dich gefunden haben, ist der Narr jedoch verschwunden.«
Marbana sah einen nach dem anderen an. Sie wusste, dass ihr Lehrmeister zweifellos den Narren gesucht haben musste, doch konnte sie sich nicht erklären, weshalb. Hastig breitete sie das Bündel, das von mehreren Stofffetzen umgeben war, auf dem Tisch aus. Im Inneren lagen unzählige kleine Briefe, mit Namen versehen, teils noch versiegelt. Während die anderen ihr gespannt zusahen, überflog sie all die Adressaten, in der Hoffnung, einen Hinweis auf den Narren zu finden. Umso mehr überraschte es sie, als sie ein versiegeltes Schriftstück entdeckte, das ihren Namen trug. Zwar hatte sie all die Zeit über dieses Bündel bei sich getragen, Tandûn von Amosthal hatte ihr jedoch stets verboten, die Briefe durchzusehen oder gar zu lesen. Sogleich erbrach sie das Wachssiegel, das den Stempel ihres Lehrmeisters trug, und begann zu lesen.
Dir, Marbana, tüchtigste Schülerin und treueste Gefährtin.
Wenn Du diesen Brief liest, habe ich bereits versagt.
Doch in Dir liegt die Kraft, meinen Weg fortzuschreiten, meine Aufgaben zu vollenden.
Verzeihe mir, dass ich Dich nicht eingeweiht habe, Dir nicht den wahren Grund unserer Reise genannt hatte. Ich bin geplagt von Zweifel, ob der Weg, den ich eingeschlagen habe, auch der richtige ist. Mit meiner Suche nach den Abtrünnigen begehe ich Hochverrat am Königshaus! Sollte man uns gefangen nehmen, so will ich nicht, dass Du von meinem Vorhaben gewusst hast, sondern vielmehr, dass dieser Brief Dich womöglich entlasten könnte. Doch nun, da ich Dich nicht mehr führen kann, musst Du diesen Weg alleine fortsetzen. Wir brachen eben aus Tarangien auf, wo ich erfahren habe, dass jener, den wir suchen, in einem entlegenen Dorf in den Bergen zurückgezogen lebt. Er hat sich von seinem Weg als Krieger abgewandt, doch niemand kann sich seinem Schicksal entziehen, selbst ein Schützling der Göttin Helemâs nicht. Er hat geschworen, dem Volk zu dienen. Diesem Schwur muss er wieder Folge leisten!
Finde den Ersten dieser einstigen Krieger, den man den Narren nennt. Zeige ihm das Siegel auf diesem Brief. Er wird wissen, wer Dich schickt. Er wird wissen, wem er von mir berichten muss und welchen Dienst ich ihm abverlange.
Es erfüllt mich mit Stolz, Dich als meine Schülerin ausgebildet zu haben. Doch Du bist nicht mehr meine Schülerin. Deine Ausbildung ist seit unserer Abreise aus Bermos abgeschlossen. Nun bist Du die stolze Kriegerin, die Schriftenkundige, die Du einst sein wolltest. Es liegt an Dir selbst, ferne Städte zu bereisen, Wissen zu sammeln, um eines Tages als Gelehrte einem mächtigen Herrn dienen zu können.
Stolz und Enttäuschung erfüllten sie, als sie von dem Brief aufsah. Stolz darüber, was ihr Lehrmeister über sie geschrieben hatte. Stolz darüber, dass der alte Mann sie anerkannt und nicht mehr als das kleine Mädchen betrachtet hatte; Enttäuschung darüber, dass sie nicht mehr über den Narren erfuhr und weshalb sie ihn tatsächlich suchen musste.
»Was hat dein Meister geschrieben?«, fragte der Bärtige vorsichtig. Wortlos schob Marbana ihm den Brief zu, doch der Mann griff nicht danach, sondern starrte sie nur weiter auffordernd an. Als keiner Anstalten machte, den Brief lesen zu wollen, begriff das Mädchen und las den ersten Teil vor.
»Ihr kommt aus Tarangien?«, fragte der Priester überrascht, der nun doch den Brief genommen hatte und ihn still überflog. »Ihr habt einen weiten Weg hinter euch!«
»Komm!« Der Bärtige erhob sich von seinem Stuhl und schritt zur Tür hinaus. Hastig sammelte Marbana die Briefe zusammen und legte sie in das Bündel, das sie sich erneut um die Brust wickelte, ehe sie dem Dorfbewohner hinaus folgte.
Es dämmerte bereits, als sie das kleine Dorf querten und an eine Hütte traten. Der Bärtige schob die Tür auf und deutete ihr hineinzugehen. »Du schläfst heute hier. Es ist das Heim des Narren. Morgen verlässt du das Dorf! Du hast bereits genug Unheil über uns gebracht.« Ohne ein weiteres Wort wandte sich der Mann um und stapfte den Weg zurück.
Vorsichtig trat sie in das Innere der Hütte und sah sich mit zusammengekniffenen Augen um. Alles erweckte den Anschein, als hätte der Narr sein Heim fluchtartig verlassen. Die Felle, welche die Holzbank wohl in ein Bett verwandelt hatten, lagen verschoben oder waren zu Boden gefallen. Ein Stuhl stand inmitten des Raumes, im hinteren Bereich war eine Truhe, daneben eine Feuerstelle. Viel mehr an Einrichtung gab es nicht. Mit einem wehmütigen Seufzen schloss Marbana die Tür, ging zur Schlafstätte, rückte die Felle zurecht und legte sich nieder, um erneut, wie die Nächte zuvor, in trister Einsamkeit in Schlaf zu verfallen.
Ein leises Atmen war zu vernehmen. Jemand stand dicht neben ihr, sie konnte ihn riechen. Zweifellos ein Mann, dessen Kleidung nach modriger Erde und Tierfellen roch. Kaum wahrnehmbar öffnete sie die Augenlider für einen Spalt. Es war noch düster in der Hütte, doch sie konnte die Umrisse einer Gestalt neben sich klar erkennen. Mit einer schnellen Bewegung rollte sie sich zur Seite, holte mit ihrem Arm aus und schlug mit geballter Faust dem Eindringling in den Schritt. Noch ehe der Fremde stöhnend zurücktaumeln konnte, war sie aufgesprungen, umschlang seinen Hals mit dem Arm, schwang sich über seine Schulter und hielt ihn von hinten gefangen, während sie ihm mit der freien Hand über dem Becken in die Seite schlug. Sogleich sackte der Fremde erneut stöhnend unter ihrem Griff zusammen.
»Was willst du?«, fuhr sie ihn an.
»Lass mich los!« Die Stimme war erstaunlich jung.
»Sag mir, weshalb du hier bist!«
»Verrate du mir, was du vom Narren willst!«
Marbana ließ den Fremden los und stieß ihn nach vorn. Es wäre ihr ein Leichtes, den Eindringling erneut zu bezwingen.
»Wer bist du?«, fragte sie mit aufgeregter, aber bestimmter Stimme.
»Jophur. Meinem Vater gehört der Hof am oberen Ende des Dorfes«, antwortete der Junge zögernd, sichtlich von der Kraft des Mädchens überrascht.
»Was willst du hier?«
»Der Narr war ein Freund! Was willst du von ihm?«
»Weißt du, wo er ist?«, fragte Marbana, ohne auf seine Frage einzugehen.
Jophur zuckte mit den Schultern. Er war eingeschüchtert.
Marbana seufzte. »Mein Lehrmeister war auf der Suche nach ihm. Wir sind nicht die Einzigen, die ihn suchen, und bestimmt werden ihn die anderen finden, wenn ich es nicht tue. Nur dass ich nicht die Absicht habe, ihn zu töten.«
Misstrauisch musterte sie der Junge. Waffen trug sie tatsächlich keine – zumindest nicht sichtbar. Schließlich gab er nach und deutete ihr, ihm nach draußen zu folgen.
»Er ist in den Wald gegangen, nach Westen.«
»Hat er dir gesagt, wohin er wollte?«
»Nein, aber es führen Spuren dorthin, die nicht zurückführen – und er ist der Einzige, der das Dorf verlassen hat.«
»Was will er im Westen?«
»Es gibt einen Pfad durch die Berge, wenn man dem folgt, kommt man zu den Bergweiden und weiter nach Lamarn, wo auch die Tempelschule ist. Man kann auch in die Tiefebene hinabsteigen, nach Dumgust.«
»Kannst du mich dorthin führen?«
Jophur trat verlegen von einem Fuß auf den anderen. Der Narr war sein Freund gewesen, er war vor den zwei Fremden geflohen. Andererseits sah das Mädchen – trotz seines erstaunlichen Geschicks – nicht gefährlich aus und bestimmt würde der Narr es bezwingen können.





























