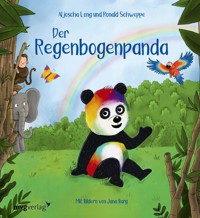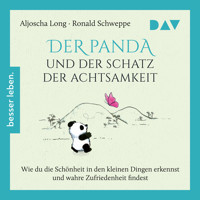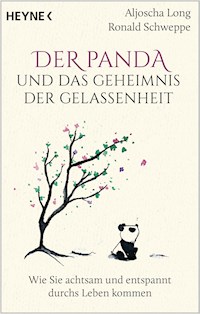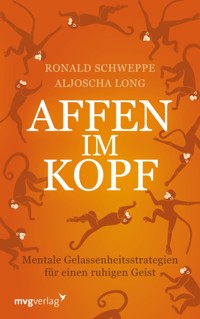9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lotos
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Eigentlich geht es der kleinen Katze Maya gut – wäre da nicht dieses ständig nagende Gefühl von Unzufriedenheit und innerer Leere. Deshalb verlässt Maya ihr vertrautes Samtkissen und begibt sich auf die Suche nach Sinn und Erfüllung. Doch weder bei den strengen »Heiligen Katzen«, noch bei den wilden Straßenkatzen und deren Vorliebe für allerlei Sinnesfreuden wird sie fündig. Erst als sie am Ende ihrer Kräfte von dem alten Maler Eugen aufgenommen wird, wendet sich das Blatt: In der Meditation entdeckt Maya die Kraft der Stille. Als Buddha-Katze macht sie sich auf, die Geheimnisse innerer Freiheit und tiefer Zufriedenheit in die Welt zu tragen …
Ein ebenso unterhaltsames wie inspirierendes Leseerlebnis: Mayas Geschichte vermittelt die Weisheit des Buddhismus für unser eigenes Leben – mit kleinen Übungen und geführten Meditationen.
- Eine Katze auf Erleuchtungssuche – Erkenntnisse voller Witz und Weisheit
- Vermittelt charmant und alltagsnah buddhistische Lebensweisheiten – mit praktischen Übungen und Meditationen
- Ein inspirierendes Leseerlebnis für alle Katzenfreunde und an Buddhismus Interessierten
- Von den Autoren der Bestseller Der Panda und das Geheimnis der Gelassenheit und Die 7 Geheimnisse der Schildkröte
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Die kleine Katze Maya hat es gut bei der reichen Witwe Alma – wenn da nicht dieses ständig nagende Gefühl von Unzufriedenheit und innerer Leere wäre. So verlässt Maya ihr vertrautes Samtkissen und begibt sich auf die Suche nach Sinn und Erfüllung. Doch weder bei den strengen »Heiligen Katzen«, noch bei den wilden Straßenkatzen und deren Vorliebe für allerlei Sinnesfreuden wird sie fündig. Erst als sie am Ende ihrer Kräfte von dem alten Maler Eugen aufgenommen wird, wendet sich das Blatt: In der Meditation entdeckt Maya die Kraft der Stille. Als Buddha-Katze macht sie sich auf, die Geheimnisse innerer Freiheit und tiefer Zufriedenheit in die Welt zu tragen …
Aljoscha Long
Ronald Schweppe
Das Geheimnis
der Buddha-Katze
Auf leisen Pfoten zu innerer
Freiheit und tiefer Zufriedenheit
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2022 by Lotos Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte sind vorbehalten.
Redaktion: Jürgen Teipel
Covergestaltung: Guter Punkt, München,
unter Verwendung eines Motivs von © Nadja Tilke, Guter Punkt, München
Illustrationen: Nadja Tilke und iStock Images
Satz: Sabine Dunst, Guter Punkt, München
E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-294670V002
www.penguin.de
Inhalt
Prolog
In der Alten Villa
1 – Der Überfluss
2 – Die Stadt und das Leiden
3 – Abschied von der alten Dame
Auf der Suche
1 – Die Heiligen Katzen
2 – Bei den Streuner
3 – Der alte Maler
4 – Das große Erwachen
Die Lehren der Buddha-Katze
1 – Das Geheimnis der Ruhe
Meditation
Ausatmen und loslassen
Meditation
Still wie ein Berg
Meditation
Nimm dir viel Zeit
Meditation
Ausruhen, nichts tun, entspannen
Lehrrede über die Ruhe
2 – Das Geheimnis der Achtsamkeit
Meditation
Achtsam im Körper sein
Meditation
Bewege dich achtsam und elegant
Meditation
Umarme deine Gefühle bedingungslos
Meditation
Tiefes Lauschen
Lehrrede über die Achtsamkeit
3 – Das Geheimnis der inneren Klarheit
Meditation
Drei Schritte ins Hier und Jetzt
Meditation
Das Richtige zur rechten Zeit
Meditation
Dinge, die wirklich da sind
Lehrrede über die innere Klarheit
4 – Das Geheimnis unerschütterlichen Gleichmuts
Meditation
Alles Schwere ausatmen
Meditation
Wünsche und Erwartungen loslassen
Meditation
Ruhiges Verweilen
Meditation
Den Dingen ihren Lauf lassen
Lehrrede über den Gleichmut
5 – Das Geheimnis des Mitgefühls
Meditation
Ebenso wie ich
Meditation
Liebevolle Worte wählen
Meditation
Liebe in die Welt strahlen
Lehrrede über das Mitgefühl
6 – Das Geheimnis der Freundschaft
Meditation
Liebe dich selbst
Meditation
Achtsames Zuhören
Meditation
Gemeinsam im Jetzt sein
Meditation
Verbundenheit mit dem inneren Auge sehen
LehrreDe über die Freundschaft
7 – Das Geheimnis der Lebensenergie
Meditation
Immer nur diese eine Sache
Meditation
Die Kraft aus der Mitte
Meditation
Lebensenergie speichern
Meditation
Was du auch tust – tu es achtsam
Lehrrede über die Lebensenergie
8 – Das Geheimnis, im Fluss zu bleiben
Meditation
Die Erscheinungen kommen und gehen lassen
Meditation
Auch das geht vorbei
Meditation
Beobachte dein inneres Wetter
Lehrrede über das Verweilen im Fluss
9 – Das Geheimnis der Freude
Meditation
Liebevoll atmen
Meditation
Dankbarkeit kultivieren
Meditation
Mit dem Herzen lächeln
Lehrrede über die Freude
Die Ferne ruft
Prolog
Ohne meinen alten Freund Eugen, den Maler, hätte ich niemals von der Buddha-Katze erfahren. Und er hätte sie nicht kennengelernt ohne die Sache mit den Straßenkatzen und dem Sturmtief über Westeuropa im April. Dass ich die Geschichte der Buddha-Katze zu hören bekam, ist also reiner Zufall. Dass ich sie aufgeschrieben habe, ist hingegen Absicht – und sollte ich dabei das ein oder andere durcheinandergebracht haben, will ich mich hier schon mal dafür entschuldigen.
Aber am besten eins nach dem anderen.
Es begann damit, dass mir nicht wohl war. Und das ist noch ziemlich untertrieben. Seit Tagen schlief ich schlecht und litt schon morgens unter pochenden Kopfschmerzen. Die Welt erschien mir grau, das Leben anstrengend und sinnlos – und wer weiß, wahrscheinlich war es das ja auch. Obwohl an Arbeiten schon lange nicht mehr zu denken war, konnte ich mich doch auf nichts anderes besinnen; denn auf meinem Tisch lag ein unvollendetes Manuskript zu einem Roman, den ich in wenigen Wochen würde abgeben müssen. »Unvollendet« trifft es nicht ganz – ich hatte gerade mal die ersten beiden Kapitel geschrieben, und die waren Mist.
Wie immer, wenn es mir schlecht ging, rief ich meinen Freund Eugen an, der in seinem Atelier hoch über den Dächern der Altstadt lebt und stets ein offenes Ohr für mein Gejammer hat. Wir verabredeten uns für den Nachmittag in unserem Stammcafé.
Ich musste Eugen nicht viel erzählen – schon auf den ersten Blick erkannte er, wie es um mich stand. »Hmm«, sagte er schließlich und legte den Kopf schräg. »Du scheinst ja wirklich ziemlich gestresst zu sein.«
»Allerdings!«, seufzte ich und rührte lustlos in meinem Milchkaffee.
»Vielleicht wäre es eine ganz gute Idee, wenn du ein bisschen weniger grübelst und erst mal versuchst, den Stress loszulassen. Weißt du, beim Malen ist es mir früher auch immer wieder passiert, dass mich Zweifel gepackt haben. Oft habe ich monatelang an einem Gemälde gearbeitet – und dann plötzlich gemerkt, dass das alles nicht hinhaut. Die Harmonie der Farben oder die Gesamtkomposition – irgendwie stimmte alles nicht. In solchen Situationen habe ich mich oft lange gequält. Inzwischen lasse ich die Widerstände los und fange einfach an zu übermalen. Manchmal wird es dann noch schlechter. Aber das macht nichts. Dann übermale ich eben wieder. Und beim dritten oder vierten Mal kommt etwas Gutes dabei heraus, mit dem ich zufrieden bin – und meine Galeristin auch.«
»Schön und gut. Loslassen ... klingt aber einfacher, als es ist, oder?«
Eugen sah mich lange an. Ich lehnte mich zurück und wartete. Ich kannte das schon. Oft überlegte er ewig, bevor er etwas sagte. Und was er dann sagte, klang manchmal recht verrückt. Aber auf eine angenehme Art war er ja auch ziemlich verrückt, mit seinem fleckigen Malerkittel, der langen grauen Mähne und seinem Gehstock mit dem goldenen Löwenknauf. Schließlich beugte er sich nach vorne, sah mich bedeutungsvoll an und flüsterte: »Kannst du dir vorstellen, dass manche Menschen mit Tieren sprechen können?«
Obwohl ich von Eugen schon so einiges gewohnt war, verschlug es mir doch erst einmal die Sprache. Wie bitte? Im Ernst jetzt? – Oder machte sich Eugen einen Spaß mit mir? Stumm schüttelte ich den Kopf. Eugen kratzte sich am Kinn und sah mich durchdringend an. Nach einer Weile nickte er. »Ich versteh schon, dass das schwer zu glauben ist. Doch lass deinen logischen Verstand mal für einen Moment ruhen und glaub mir einfach, dass ich tatsächlich mit manchen Tieren sprechen kann – zum Beispiel mit Katzen. Vor allem aber mit einer ganz besonderen, wirklich außergewöhnlichen Katze.«
Dazu fiel mir absolut nichts ein. Ich zog nur die rechte Augenbraue ein wenig hoch und musterte Eugen. Im Moment wirkte er eigentlich ganz und gar nicht verrückt. Zumindest nicht mehr als sonst. Eine leise Stimme in mir sagte, dass es das Beste wäre, einfach mal zuzuhören und all meine Zweifel vorerst in ein Hinterzimmer meines Bewusstseins zu verbannen; auch wenn mir das nicht gerade leichtfiel. Doch was immer Eugen für eine Geschichte auf Lager haben mochte – zumindest würde es interessant und unterhaltsam werden und mich ein wenig von meinen eigenen Problemen ablenken. Vorsichtig nickte ich also und antwortete leise: »In Ordnung. Ich versuche mal, dir zu glauben.«
Eugen grinste mich breit an. »Gut für dich!« Er nahm einen Schluck Kaffee, räusperte sich und begann. »Ich erzähle dir jetzt alles, was ich von Maya erfahren habe. Einiges, was mir wichtig schien, habe ich in mein Tagebuch geschrieben. Da kannst du später gerne noch einen Blick drauf werfen. Aber fangen wir mal ganz am Anfang an.«
Und so erzählte mir Eugen die Geschichte von der Buddha-Katze.
In der Alten Villa
1
Der Überfluss
Mayas Suche nach dem Glück begann an dem Nachmittag, als ihr bewusst wurde, dass sie keinerlei Lust mehr darauf verspürte, Mäuse zu fangen.
Der Sommer ging dem Ende zu, die Abende wurden kühler, die Luft feuchter. Wie so oft lag Maya an ihrem Lieblingsplatz auf der Veranda der Alten Villa, wo sie sich ausgestreckt hatte, um die letzten warmen Strahlen der untergehenden Sonne zu genießen. Als sie plötzlich ein leises Rascheln vernahm, hatte sie aus alter Gewohnheit den Kopf gehoben und die Verursacherin sogleich entdeckt. Die Maus, die im Zickzack durch den Obstgarten huschte, ahnte nichts von den smaragdgrünen Augen, die jedem ihrer Schrittchen durch die Beete folgten. Erst recht aber ahnte sie nicht, dass sie, obwohl sie gerade von einer Katze beobachtet wurde, völlig unbesorgt sein konnte. Maya würde sie ziehen lassen. Sollte sie doch hinlaufen, wo sie wollte. Maya würde sich nicht die Mühe machen, auch nur eine ihrer weißen Pfoten zu rühren.
Was immer ein Katzenherz begehren konnte – Maya hatte all das im Überfluss. Wozu also Mäuse jagen? Tag für Tag bekam sie in der Villa die feinsten Lachs- und Thunfischmenüs serviert – auf einem Porzellantellerchen, so wie sich das für eine Katzendame, wie sie es war, gehörte. Die Jagd war ihr immer nur ein Zeitvertreib gewesen. Aber wozu das Ganze? War es nicht ganz und gar sinnlos?
Maya setzte sich auf, sah in die Bäume, sah in den Himmel, wo die rote Sonne hinter einem zarten Wolkenschleier unterging, sah Starenschwärme über der Stadt ihre Kreise ziehen. Sicher – schön anzusehen war das alles, wo aber war die wahre Bedeutung von alledem? Welchen Sinn hatte es, tagein tagein, zu fressen, faul auf dem Fensterbrett zu liegen oder mit Knäueln aus Kaschmirwolle zu spielen? Worin lag der Sinn ihres Lebens? Warum war sie nur so freudlos? War sie immer schon so gewesen – so unzufrieden, so leer? Maya schloss die Augen und tauchte tief in den dunklen See ihrer Erinnerungen hinab.
Das Leben begann in einer Schachtel ...
Zu ihrem achtzigsten Geburtstag hatte Frau Alma von Lilienfeld, Witwe und Besitzerin der Alten Villa, von einem ihrer illustren Gäste, Baron Valkenberg, eine kleine Schachtel mit goldener Schleife überreicht bekommen. Das Schächtelchen war zu groß für ein Fabergé-Ei, aber zu klein für einen Hut. Die alte Dame hielt sich die Schachtel ans Ohr und schüttelte kräftig, woraufhin der sonst so gefasste Baron erbleichte und entsetzt dreinblickte. »Alma ...« Doch Frau Lilienfeld hatte schon mit dem Schütteln aufgehört und damit begonnen, ihr Geschenk auszupacken. Als sie den Deckel der Schachtel anhob, blickte sie in zwei große smaragdgrüne Augen, die, von flauschigem weißem Fell umrahmt, erstaunt in die Welt blickten. Sie verliebte sich auf den ersten Blick in das süße Kätzchen.
Schon als Kind hatte sie sich heiß und innig eine kleine Katze gewünscht, aber ihre Eltern waren keine Tierfreunde gewesen. Später hatte sie nie mehr ernsthaft daran gedacht, sich eine Katze ins Haus zu holen. Und jetzt war sie alt. Aber war das nicht der beste Grund? Ihr Freund, der Baron, war ein besonnener Mann, und sicher hatte er seine Gabe mit Bedacht gewählt. Alma würde nicht ewig leben. Und je kürzer die verbleibende Zeit, desto wichtiger schien es ihr, Freude in ihr Herz zu lassen und die Geschenke des Lebens zu genießen. Und so war dieses niedliche Kätzchen nun bei ihr gelandet.
Als Alma das weiße Katzenbaby vorsichtig aus der Schachtel hob und in ihren Armen hielt, wusste sie sofort: Sie würde sich mit ganzer Seele um die kleine Samtpfote kümmern. Es sollte der kleinen Maya an nichts fehlen.
Und tatsächlich hatte das kleine Katzenwesen alles, was es sich nur wünschen konnte: ein eigenes Zimmer mit einem großen Kratzbaum. Spielzeugmäuse in allen Farben und Katzenkissen mit dem wunderbaren Duft von Katzenminze. In einer Ecke stand ein Katzenhäuschen, in das Maya sich jederzeit zurückziehen konnte. Sogar ein Aquarium gab es, vor dem sie stundenlang sitzen und die Fische beobachten konnte. Von einem großen Fenster aus sah sie in den Garten und folgte mit ihrem Blick den Vögeln. Und natürlich gab es stets Leckereien und dreimal am Tag eine köstliche Mahlzeit.
Obwohl sie die einzige Katze im Haus war, war sie nie einsam. Alma nahm sich immer Zeit, um ihr geliebtes Maya-Kätzchen zu kraulen und mit ihm zu spielen – ebenso wie die vielen Besucher und Marina, die junge Haushälterin. Als Maya ein wenig älter wurde, durfte sie auch in den Obstgarten hinaus. Das war ein wunderbares Abenteuer, und zwischen den knorrigen Kirsch- und Apfelbäumen entdeckte sie im hohen Gras die Freude an der Jagd. Stolz brachte sie ihrer Gönnerin die erlegten Mäuse ins Haus. Bald schon merkte sie jedoch, dass ihr Frauchen über diese Gaben ganz und gar nicht erfreut zu sein schien. Und nachdem die alte Dame sogar richtig böse wurde, als Maya ihr ein totes Vögelchen auf die Chaiselongue legte, jagte sie nur noch zum Spaß – und ließ alle Mäuse und Vöglein gleich wieder frei.
Eine Weile genoss Maya ihr unbeschwertes Leben. Allmählich jedoch schlich sich ein Schatten auf ihre Seele, der immer dunkler wurde. Mit jedem Tag, an dem sie den Fischen im Aquarium zusah, sich die Krallen am Kratzbaum schärfte und auf ihrer Samtdecke döste, tropfte die Freude mehr und mehr aus ihrem Leben – wie Wasser aus einem Eimer mit einem winzigen, kaum sichtbaren Loch.
Zunächst merkte sie kaum, dass sich etwas verändert hatte, dass etwas nicht stimmte. Sie wurde nur etwas unruhiger, fraß mehr, wurde schwerer und unbeweglicher und verschlief ganze Tage. Schließlich aber verging ihr jegliche Lust, durch den Garten zu schleichen und zu jagen. Immer seltener wollte sie ins Freie, und wenn sie einmal hinausging, suchte sie sich schnell ein sonniges Plätzchen auf der Veranda, rollte sich zusammen und döste vor sich hin.
An jenem Tag, da Maya dem vorüberhuschenden Mäuschen gelangweilt hinterherblickte, wurden ihr zwei Dinge klar. Zum Ersten, dass sie nie wieder Mäuse oder Vögel jagen und keinem fühlenden Wesen mehr Schaden zufügen würde. Und zweitens, dass alle Freude in ihrem Herzen erloschen war. Lange grübelte Maya darüber nach, woran das wohl lag. Wo lag der Sinn ihres Katzendaseins? Und wie sollte das alles weitergehen?
In Maya keimte der Entschluss, etwas zu verändern. Nur, was das sein konnte, das wusste sie nicht. Nachdem sie sich ausgiebig durchgestreckt hatte, erhob sie sich und machte einen Rundgang durch den Garten. Als ihr Blick auf die verfallene Backsteinmauer fiel, stutzte sie. Zum ersten Mal wurde ihr bewusst, dass es auch eine Welt außerhalb des Gartens, jenseits dieser Mauer geben musste. »Merkwürdig«, dachte sie, »dass ich vorher nie daran gedacht habe.« Und so beschloss sie, sich diese Welt dort draußen einmal näher anzusehen.
2
Die Stadt und das Leiden
Mit einem eleganten Satz landete Maya auf der Mauer, die den Garten der Alten Villa umschloss. Jenseits der Mauer breitete sich ein riesiger Park aus. Unglaublich, wie groß die Welt war! Maya staunte über die weit ausladenden Wiesen, die kein Ende zu haben schienen, doch in ihr Staunen mischte sich ein wenig Angst. Vorsichtig spazierte sie auf der Mauer entlang, bis sie an die Vorderseite der Villa gelangte. Hatte der Park ihr schon den Atem geraubt, so kam sie jetzt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus, denn vor ihr eröffnete sich eine fremde, bedrohliche Welt. Dicke Straßen, auf denen Autos fuhren, Ströme von Menschen, die die Bürgersteige füllten, Hunde, die an Leinen zerrten, blinkende Lichter und dann plötzlich eine heulende Sirene ...
Wie von Dämonen gejagt sprang Maya zurück in den Garten, schoss durch die Terrassentür in die Villa und flüchtete die Treppe hinauf in ihr Zimmer, wo sie so lange in ihrem Katzenhäuschen saß, bis Almas vertraute Stimme an ihre Ohren drang und sie daran erinnerte, dass es Zeit für das Abendessen war. Sie war offenbar wieder in Sicherheit.
Die Welt jenseits der Mauer hatte ihr einen gehörigen Schreck eingejagt, doch so schnell würde sich sie nicht geschlagen geben. Viel zu groß war ihre Neugier. Maya wollte unbedingt wissen, was es mit der Welt dort draußen auf sich hatte. Vielleicht fand sie ja dort den Sinn des Lebens und das Glück, nach dem sie suchte. Sicher, die Villa war ihr Zuhause, und doch spürte sie, dass ihr etwas fehlte. In letzter Zeit spielte Alma nur noch selten mit ihr; meist lag sie den ganzen Tag müde im Bett, und Maya spürte, dass die alte Dame es nicht mehr ganz so gern hatte, wenn sie sich zu ihr kuschelte. Doch Maya sehnte sich ohnehin nach etwas anderem; sie wusste nur noch nicht, wonach. Dass sie aber unbedingt herausfinden musste, ob es in der Welt da draußen etwas gab, das ihr tiefe Erfüllung schenken konnte, das wusste sie genau.
Und so unternahm sie schon am nächsten Tag den zweiten Versuch. Lange saß sie geduckt auf der Mauer und betrachtete das rastlose Treiben in der Stadt. Es dauerte eine ganze Weile, bis sie den Mut fasste und von der Mauer auf den Gehweg sprang. Kaum gelandet, rannte ein Menschenkind auf sie zu und rief aufgeregt: »Mami, guck mal, die süße Katze. Darf ich die mitnehmen?« Und schon griff das Mädchen nach Maya. Maya hatte zwar keine Angst vor Menschen, doch sie schätzte es ganz und gar nicht, von Fremden angefasst zu werden. Sie legte die Ohren an und wich dem Kind aus. Eine dicke Frau packte das Mädchen am Arm und zerrte es von Maya weg. »Nimm die Finger da weg, Nina! Die hat bestimmt Flöhe.«
Maya drehte sich blitzschnell um und trabte los. Sie lief einen kleinen Weg entlang, der weniger bedrohlich wirkte als die breite Straße, die an der Villa vorbeiführte.
Doch was war das nur für ein Geruch? Ungewohnte Düfte vermischten sich zu einem einzigen Gestank. Maya roch die Markierungen anderer Katzen und Hunde. Sie witterte die Duftspuren von Mäusen und Mardern – und von Menschen, auch wenn die ja eigentlich gar keine Duftmarken hinterließen. Vor allem aber lag ein durchdringender Geruch von ekelhafter Nahrung in der Luft, der Mayas feine Nase beleidigte und von dem ihr übel wurde.
Aus allen Richtungen drangen zudem grelle Geräusche und schreiende Farben auf sie ein. Es war wie ein schrecklicher Traum. Dennoch ging Maya tapfer weiter – schließlich hatte sie beschlossen, mehr über die Welt zu erfahren, und sie würde nicht so schnell klein beigeben. Auch wenn ihre bisherigen Erfahrungen nicht gerade ermutigend waren, so konnte es doch immerhin sein, dass das Glück bereits hinter der nächsten Ecke auf sie wartete.
Der Abend nahte und der Himmel wechselte von Himmelblau zu Dunkelblau. In der Stadt aber wurde es nicht dunkler. Beinahe im Gegenteil. Immer mehr bunte Lichter leuchteten und blinkten. – Und dann sah Maya zum ersten Mal in ihrem Leben eine andere Katze. Die Fremde sah sie misstrauisch an. Aber Maya ging vorsichtig auf sie zu und sah sie freundlich an. »Hallo! Ich bin Maya. Kannst du ...?« Noch bevor sie ihre Frage zu Ende stellen konnte, legte die braune Katze ihre Ohren an und fauchte: »Hau ab!« Maya blieb wie angewurzelt stehen. Die Katze sah sie böse an, wandte sich ab und verschwand in einem Kellerloch.
Maya war verwirrt. Was war nur mit dieser Katze los? Warum war sie so unfreundlich gewesen? Nachdenklich ging sie weiter. Ein unangenehm beißender Geruch, der mit jedem Schritt stärker wurde, schoss ihr in die Nase. In einem Hauseingang lag ein großer Klumpen, von dem der Geruch ausging. Als Maya näher kam, bewegte sich der Klumpen und begann zu husten. Maya stellte die Ohren auf und erstarrte. Und dann erkannte sie es: Der Klumpen war ein Mensch – ein in alte Zeitungen, Plastiktüten und dreckige Decken gehüllter Mann. Dass ein Wesen so schrecklich riechen konnte, hätte sie nie für möglich gehalten. In den Gestank von menschlichen Ausscheidungen mischte sich ein Geruch, der Maya irritierte. Woher kannte sie ihn nur? Jetzt fiel es ihr wieder ein: Er ähnelte dem eines roten Getränks, das Alma und ihre Gäste mitunter beim Essen tranken. Doch hier war dieser Geruch nicht fein und aromatisch, sondern beißend und abstoßend. Maya rümpfte die Nase. Sie trat vorsichtig noch ein wenig näher und sah eine leere Flasche neben dem alten Mann liegen. Und neben dem Geruch von Alkohol nahm sie jetzt auch den Geruch von Krankheit, Fäulnis und Verfall wahr.
Warum musste dieser kranke Mensch hier auf der kalten Straße schlafen? Warum schlief er nicht wie Alma in einem weichen, warmen Bett? Maya begriff, dass die Welt, die ihr vertraut war, nur ein winziger Teil der Wirklichkeit sein konnte. Hatte sie sich bisher selbst für eine besonders unglückliche Katze gehalten, so erkannte sie jetzt, wie viel mehr Leiden es in der Welt geben musste. Und sie wunderte sich, warum nicht dieser Mann, ja warum wohl nicht alle leidgeprüften Wesen, ebenso auf der Suche nach Glück und Zufriedenheit waren, so wie sie.
Plötzlich bewegte sich der Mann wieder, röchelte, hustete schwer und rülpste laut. Er griff nach der leeren Flasche, sah sie aus trüben Augen an und murmelte etwas Unverständliches. Dann fiel sein Blick auf Maya und er lächelte ein zahnloses Lächeln. »Na, Kätschen, miez, miez, komm mal her.« Er wollte Maya streicheln, doch sie wich zurück. Sofort verschwand sein Lächeln. »Blödes Katzenvieh! Hasch wohl Angsch vor mir?« Er versuchte noch einmal, nach Maya zu greifen. Als sie ihm geschickt auswich, schleuderte er seine Flasche in Mayas Richtung. Sie konnte sich mit einem Sprung zur Seite gerade noch retten. Die Flasche zersplitterte, der Mann schrie und verfluchte Maya, die erschrocken davonrannte und so lange lief, bis sie das Geschrei und den Geruch weit hinter sich gelassen hatte.
Maya war erschüttert. Sie hatte nicht gedacht, dass Menschen so leben konnten. Sie konnte das Bild dieses alten, übel riechenden, kranken Mannes, der in einem Hauseingang auf der Straße schlafen musste, nicht mehr loswerden. Sie erkannte, dass die Welt ein gefährlicher Ort war – dass das alles nicht viel mit der sauberen, warmen Villa zu tun hatte, in der Maya aufgewachsen war. Wie sehr hatte sie sich doch darin getäuscht, dass die ganze Welt wie die Villa wäre, nur bunter und weiter.
In einer kleinen Gasse kamen ihr Schritte entgegen. Maya blieb stehen und drückte sich an eine Hauswand. Die Schritte waren die eines Menschen, der einen alten hinkenden Hund an der Leine hinter sich herzerrte! Eine Leine! Wieso musste der Hund einen Strick um den Hals tragen?
Der Hund sah Maya sofort. Er bellte ein kurzes »Hallo, Katze!« und richtete seine triefenden Augen auf sie. »Hallo, Hund! Ich bin Maya«, rief sie leise.
»Ich bin Bobo«, sagte der Hund. Schwanzwedelnd ging er auf Maya zu, doch der Mensch zerrte grob an der Leine, sodass Bobo stolperte. »Tut mir leid«, sagte er. »Ich muss weiter.«
Maya sah dem seltsamen Gespann nach, bis beide hinter der nächsten Ecke verschwunden waren. Sie wurde immer nachdenklicher. Ob es wohl überhaupt möglich war, in dieser Welt so etwas wie Glück und einen Sinn zu finden?
Gedankenverloren trabte sie weiter. Sie musste nach Hause zurück; Alma würde sich sicher schon Sorgen machen. Und Maya hatte auch wenig Lust, in dieser fremden Umgebung die Nacht zu verbringen. Ihre Intuition wies ihr die Richtung, und bald kam sie in den Park, der hinter der Villa lag. Mit einem Satz war sie auf der Mauer, landete im vertrauten Garten und huschte über die Veranda durch die Katzentür. Kaum war sie in ihrem Katzenhäuschen angelangt, rollte sie sich auf ihrer flauschigen Schmusedecke zusammen. Wie wohlig und warm es hier war. »Wie ruhig und friedlich«, dachte Maya. Doch obwohl sie von ihrem Ausflug erschöpft war, fand sie keinen Schlaf. Was nützte ein Frieden, was nützte ein Glück, die einzig dem Zufall unterworfen waren? Ihr Blick schweifte über ihren Kletterbaum, den Napf aus Porzellan, die Spielzeugmäuse, die Samtdecken – und all das erschien ihr wertlos und leer. Immer klarer erkannte Maya, dass Almas Liebe, dass die Wärme der Alten Villa sie nicht immer auffangen, ihr nicht für alle Zeit Zufriedenheit würden schenken können.
3
Abschied von der alten Dame
Maya war aufgefallen, dass Alma schon seit einer ganzen Weile weder aufgestanden war noch mit der Haushälterin gesprochen oder gar Besuche empfangen hatte, sondern fast ständig in ihrem Bett lag. Maya konnte das an sich gut verstehen –auch sie lag ja gern lange in ihrem Katzenbett oder in der Sonne auf der Veranda. Doch was sie nicht verstehen konnte, war, dass Alma nun endgültig nicht mehr mit ihr spielen und schmusen wollte.
Besorgt beobachtete sie, wie die alte Dame sich in ihrem Bett immer wieder vor Schmerzen krümmte. Und es entging ihr auch nicht, dass Almas Haut immer blasser und ihre Stimme immer dünner wurde. Was anfangs nur eine dunkle Ahnung gewesen war, wurde Maya immer mehr zur Gewissheit: Krankheit und Leiden waren nicht nur in der Welt dort draußen zu finden. Ihre sichere, warme, liebevolle Welt in der Villa hatte alles Beängstigende und Beschwerende für lange Zeit von ihr ferngehalten – doch still und heimlich schlich sich das Leiden nun auch hier ein. Und es kam näher. Maya verstand längst, dass Alma krank sein musste. Sehr krank vielleicht sogar. Bisher hatte sie noch nie über den Tod nachgedacht. Nun aber kamen ihr mit einem Mal all die Mäuse, Käfer und Vögel, die sie gejagt hatte, in den Sinn. Für Maya selbst war es in der Villa und im Garten immer erfüllend und schön gewesen. Doch die Tierchen, die sie gejagt, verletzt und getötet hatte, hatten sicher ganz anders gefühlt. Bei diesen Gedanken wurde Maya immer trauriger.
War das Leiden wirklich überall? Und wenn es so war: Gab es dann nicht eine Möglichkeit, sich ein für alle Mal davon zu befreien?
Eines Abends, als Maya sich in ihre Schmusedecke eingehüllt hatte, wurde sie von einem plötzlichen Aufruhr im Haus aus ihren trüben Gedanken gerissen. Menschen riefen durcheinander, immer mehr Fremde kamen ins Haus und Maya hörte Marina, die Haushälterin, laut weinen.
Was war da los? Maya streckte sich, wand sich aus ihrer Decke und schlich leise die Treppe hinunter, um herauszufinden, was diesen ungewohnten Lärm verursachte. Im Zimmer der alten Dame hatten sich viele Menschen versammelt. Einige standen nah an ihrem Bett. Alle wirkten betrübt, einige weinten. Maya begriff sofort, was ihr Herz noch nicht wahrhaben wollte. Alma war gestorben – auf dem Bett lag ihr toter Leib und die herbeigerufenen Ärzte konnten nichts mehr für sie tun.
Maya sprang auf das Bett und betrachtete ihre alte Freundin. Sie sah so friedlich aus. Noch einmal wollte sie sich an sie kuscheln, ihr noch einmal ganz nahe sein. Doch da packte einer der Männer Maya grob am Nackenfell und trug sie mit schnellen Schritten aus dem Raum. Als Maya zurück ins Zimmer wollte, trat er nach ihr. Sie wich aus und fauchte, woraufhin der Mann erneut nach ihr trat.
Erschrocken lief Maya in ihr Zimmer zurück, in die Sicherheit des Katzenhäuschens und der Schmusedecke. Sie fühlte sich, als hätte jemand sie mit kaltem Wasser übergossen. Alma war tot! Sie konnte es nicht fassen. Ihre alte Freundin war doch immer da gewesen. Seit Maya aus dem Dunkel der kleinen Schachtel geschlüpft war, war kein Tag vergangen, an dem sie nicht von der alten Dame geliebt und verwöhnt worden war. Und all das sollte nun vorbei sein?
Schon einen Tag nach Almas Tod waren Menschen gekommen, um Bücher, Möbel oder Teppiche abzuholen. Auch das Aquarium hatten sie abtransportiert. Schließlich war das Haus wie leer gefegt. Maya wanderte einsam durch die Räume der leeren Villa und fühlte sich so verlassen wie noch nie. Doch wie sie schon sehr bald erkennen musste, hatte sie noch ein drängenderes Problem: Niemand bereitete Mahlzeiten für sie. All die trockenen Häppchen für zwischendurch hatte sie längst verzehrt. Noch schlimmer war, dass sie nichts zu trinken hatte. Keine Milch, kein Wasser. Maya dämmerte es, dass sie von nun an wohl für sich selbst würde sorgen müssen. – Und dass sie damit ja keinerlei Erfahrung hatte. Angst legte sich wie eine kratzige, dicke Wolldecke über ihre Seele. Wie würde sie nur überleben können? Zweifellos würde sie die Villa verlassen müssen. Ja, vielleicht müsste sie sogar wieder Mäuse, Käfer und Vögel jagen und töten. Aber was war das für ein Leben? Töten, um zu überleben und schließlich doch krank zu werden und sterben zu müssen. Ein ewiger Kreislauf des Leidens. Aber nein, das konnte nicht alles sein!
Viele schöne Augenblicke hatte Maya in ihrem Leben erfahren – auf der Veranda, in der Sonne, auf der Wiese zwischen den Bäumen, auf Almas Füßen im warmen Bett. Vieles hatte sie gelernt. Sie wusste, wie man Mäuse fing, wie man die besten Häppchen aus dem Napf fischte, wie man der Haushälterin signalisierte, dass es Zeit war, die Milchschale nachzufüllen oder wie man sich in eine Kuscheldecke hüllte. Aber dem Leiden zu begegnen, das hatte sie nie gelernt. Und so konnte sie auch keinen Frieden in ihrem Herzen finden.
Es musste einen Weg aus diesem Kreislauf geben. Und sie würde diesen Weg finden. Immer mehr spürte Maya, dass es ihr Schicksal war, sich dieser Aufgabe zu stellen, dass sie sich nicht darum herumdrücken konnte.
Maya hatte Angst. Doch sie fühlte auch eine innere Kraft, die sie bisher noch nie gebraucht hatte. In ihr reifte ein Entschluss: Sie würde den Umgang mit dieser Kraft lernen. Irgendwie hatte das alles mit Mut zu tun. Maya erkannte: Nur wer Angst hat, kann mutig sein. Und deshalb würde sie ihre Angst überwinden und sich auf die Suche machen. Sie würde den Kreislauf durchbrechen und den Sinn des Lebens erkunden.
Und so schlief sie zum letzten Mal in ihrem Katzenhäuschen in der großen Villa.
Auf der Suche
1
Die Heiligen Katzen
Als Maya erwachte, knurrte ihr Magen so laut, dass sie beinahe glaubte, ein Hund habe sich in die Villa geschlichen. Ihre Zunge klebte ihr am Gaumen und ihre Kehle fühlte sich an, als hätte sie an einem Sandkasten geleckt. Sie musste sofort etwas trinken. Aus alter Gewohnheit lief sie in die Küche, doch die war kalt und verlassen. Aber immerhin – der Wasserhahn tropfte! Maya sprang auf die Arbeitsfläche, wo die Haushälterin noch vor wenigen Tagen die leckersten Mahlzeiten für sie zubereitet hatte und leckte gierig die wenigen Tropfen auf, die sich im Spülbecken gesammelt hatten. Das linderte ihren Durst zwar kaum, aber immerhin ließ das sandige, raue Gefühl in ihrem Mund ein wenig nach. Schnell wurde Maya klar, dass sie unmöglich hierbleiben konnte, und bei dieser Erkenntnis zog sich ihr vollkommen leerer Magen noch ein ganzes Stück mehr zusammen.
Ein letztes Mal lief sie durch die hellen Räume, in die die Morgensonne unbekümmert blitzte, ganz als wäre die Welt noch die alte. Traurig erinnerte Maya sich an die vielen schönen Tage, die sie in der Geborgenheit der Villa verbracht hatte und verabschiedete sich von ihrem alten Leben. Der Abschied fiel ihr schwer. Die Gedanken an das, was nun kommen mochte, ängstigten sie. Doch dann erinnerte sie sich daran, was sie gestern erkannt hatte: Nur wer Angst hat, kann auch mutig sein! Und so nahm sie all ihren Mut zusammen und schritt erhobenen Hauptes hinaus auf die Veranda und in den Garten. Sie kletterte auf die Mauer, von wo aus ihr Blick über den morgendlichen Park fiel. Dort sah alles so friedlich aus. Ganz bestimmt würde sie nun etwas zu essen und zu trinken finden.
Maya sprang von der Mauer und schlich durch das von Tautropfen noch feuchte Gras. Tautropfen – das war Wasser. Wie kam es dorthin? Waren es die Tränen, die die Nacht geweint hatte? Maya leckte den Tau vom Gras. Süße Tränen! Wie frisch und gut dieses Wasser schmeckte! Aber es war viel zu wenig. Sie blieb stehen, spitzte ihre Ohren und sog den Duft des Parks ein. Es war noch früh am Morgen, doch schon atmete das Leben überall in tiefen Zügen: Da war das Rascheln im Gebüsch – Vögel auf der Suche nach ihrem Frühstück. In der Ferne hörte sie vereinzelte Rufe von Enten und Gänsen, die sich einen guten Morgen wünschten. Da war der Geruch von Gras und Erde, von Hunden, die ihre Menschen bei ihren Spaziergängen im Park begleiteten und überall ihre Markierungen hinterließen. Doch da war noch etwas anderes – von weit weg wehte der Duft von Gebratenem heran. Maya lief das Wasser im Mund zusammen. Und was war das? Ein leises Rauschen und Plätschern! Vermutlich ein Bach, auf jeden Fall aber ein Geschenk des Himmels, denn das bedeutete, dass sie ihren Durst löschen konnte!
Maya beschleunigte ihren Schritt und kam an einen Teich, in dem Enten und Gänse schwammen. Ein kleiner Bach ergoss sich in ihn. Maya lief los und achtete nicht auf die Gänse, die sie umso böser anzischten, je näher sie ihnen kam. Sie konnte nur noch an eines denken – Wasser!
Vorsichtig beugte sie sich hinunter und leckte gierig das köstliche Nass, bis sie keinen Durst mehr hatte. Gerade begann sie zu glauben, dass nun alles gut werden würde, da bekam sie umso mehr den Hunger zu spüren, der unerbittlich an ihr nagte. Sie war so hungrig wie noch nie in ihrem Leben – so hungrig, dass sie nun doch daran dachte zu jagen. Dann aber besann sie sich. Nein, sie würde keine anderen Wesen mehr töten. Nicht einmal, wenn sie noch genug Kraft dazu hätte – was sie im Moment ohnehin bezweifelte. Sie folgte ihrer Nase. Die Essensgerüche waren stärker geworden. Sehr angenehm roch es nicht gerade, doch der Hunger ließ ihr keine Wahl. Nach wenigen Schritten entdeckte sie die Quelle des Geruchs – einen Mülleimer voll alter Zeitungen, leerer Flaschen und zerbeulter Dosen sowie unappetitlicher Essensreste. Maya zögerte. Dann aber überwand sie ihren Widerwillen und wühlte sich durch den Müll. Sie zerrte ein großes Stück eines Teigfladens heraus und begann, daran zu knabbern.
Kaum hatte sie den ersten Bissen hinuntergewürgt, vernahm sie Flügelschläge und das Krächzen eines Raben.
»He, Katze!«, krächzte er. »Verzieh dich gefälligst. Dieser Mülleimer gehört uns.«
Maya sah den Raben an. Wollte er sich wirklich mit ihr anlegen? »Ich habe seit zwei Tagen nichts gegessen. Lass uns doch teilen«, schlug sie vor.
»Kommt nicht infrage. Hau ab.«
Maya legte die Ohren an und sah den Raben bedrohlich an. Der erschrak und erhob sich mit ein paar Flügelschlägen, um sich über ihr auf einem Ast niederzulassen. Wütend krächzte er allerlei Unverständliches, und Maya wusste erst nicht so genau, was er wollte. Doch schließlich verstand sie ihn.
»Ich warne dich, Katzenvieh! Mich kannst du vielleicht noch besiegen, aber bestimmt nicht unseren ganzen Schwarm. Pass nur auf – meine Freunde werden gleich kommen!«
Maya suchte den Himmel ab – und tatsächlich, da waren sie. Mindestens zehn Raben kamen direkt auf sie zugeflogen. Sie zögerte nicht lange – in ihrem Zustand würde sie sich nicht auf einen Kampf einlassen. Sie warf dem Raben noch einen mitleidigen Blick zu, drehte sich um und suchte das Weite. »Was soll’s«, dachte sie. »Schließlich wird es ja bestimmt noch andere Mülleimer geben.« Und so machte sie sich auf die Suche nach weiteren Abfällen. Doch während sie weiter durch den Park irrte, legte sich mit jedem ihrer Schritte Verzweiflung wie ein dunkler Schatten über ihr Herz. Wie sollte es nur weitergehen? War das Leben in der sogenannten Freiheit wirklich nur ein Kampf um Nahrung? Und war es nicht die Gier, die Schuld an all den Kämpfen und der Gewalt hatte?
In Mayas Geist blitze kurz ein Gedanke auf: »Wie sähe die Welt wohl aus, wenn alle Wesen freundlich und großzügig und nicht länger von Gier getrieben wären? Würde das nicht zu viel mehr Frieden führen?« Aber wäre es überhaupt möglich, die Gier ganz zu überwinden? Darüber müsste sie noch einmal nachdenken, doch im Augenblick ließ der Hunger keinen vernünftigen Gedanken zu. Auf ihrer Suche nach Essbarem kam sie wieder an dem Teich vorbei – und diesmal standen eine Mutter und ihr kleiner Sohn am Ufer. Die beiden fütterten die Enten, die sich gierig um sie scharten. Maya näherte sich vorsichtig. Die Enten beäugten sie misstrauisch.
»Ich tu euch nichts«, rief Maya ihnen freundlich zu, doch die Enten nahmen vorsichtshalber trotzdem etwas Abstand. Der Junge hielt Maya ein großes Stück Brot hin. Behutsam kam sie näher und nahm es. Plötzlich streckte der Kleine seine Hand aus und Maya wich erschrocken zurück. Das Brot im Maul, rannte sie davon, und erst, als sie das Stück Brot verschlungen und den größten Hunger gestillt hatte, wurde ihr klar, dass der Junge sie wohl nur hatte streicheln wollen. Wie dumm von ihr, fortzulaufen. Wahrscheinlich hätte er ihr sonst noch mehr gegeben.
Es dauerte jedoch nicht lange, bis ihr das Brot wie Blei im Magen lag. Sie wusste zwar nicht, wie es den Enten damit erging, aber für Katzen – das war ihr jetzt klar – schien Brot keine geeignete Nahrung zu sein. Der Park brachte Maya nichts als Pech. Und so beschloss sie, ihr Glück in der Stadt zu versuchen – auch wenn sie ahnte, dass dort unbekannte Gefahren lauerten.
Kaum hatte sie den Park hinter sich gelassen, fand sie sich in einem unüberschaubaren Geflecht aus Straßenzügen wieder. Schon bald hatte sie die Orientierung verloren – aber dafür fand sie zwischen den Häuserblocks tatsächlich leicht etwas zu essen. Die Menschen warfen viel weg. Die Mülltonnen waren eklig – doch zwischen all dem Widerwärtigen fand sie auch immer wieder Nahrung, die sie ohne größeren Ekel verzehren konnte. Allerdings liefen überall Hunde herum. Ständig wurde sie angebellt, und anfangs musste sie sich dauernd hinter Straßenecken oder in Hauseingänge flüchten. Dann bemerkte sie, dass sie gar keine Angst zu haben brauchte, da die Hunde fast ausnahmslos an der Leine gehalten wurden. »Kein Wunder, dass die so wütend auf mich sind. Wahrscheinlich sind sie neidisch, weil ich frei herumlaufen kann«, dachte Maya. Doch dann traf sie immer öfter auf andere Katzen, die nicht angeleint und dennoch ebenso bösartig wie die Hunde waren. Maya lief weg, wann immer sie von einer anderen Katze angefaucht wurde. Sie begann, sich einsam und ausgestoßen zu fühlen.
Schließlich war sie es leid, immer wegzulaufen, und als ihr wieder eine Katze begegnete, legte sie die Ohren an und machte sich kampfbereit – diesmal würde sie nicht wegrennen. Doch zu ihrem großen Erstaunen begann ihr Gegenüber zu lachen.
»Sei gegrüßt. Mein Name ist Milo. Bist du frei oder noch eine Sklavenkatze?«
Maya entspannte sich. »Hallo, Milo, ich bin Maya. Ob ich eine Sklavenkatze bin? Keine Ahnung, was ist denn das? Ich bin neu hier ...«
Milo kam näher und beschnüffelte sie. »Bist du deinem Menschen weggelaufen?«
Milo schien ganz anders als die Straßenkatzen zu sein – viel freundlicher, herzlicher. Maya fasste Vertrauen und begann zu erzählen. Milo hörte ihr aufmerksam zu. Als sie fertig war, sprach er mit ernster Miene: »Gut, dass du mir begegnet bist! Du hast erkannt, wie vergänglich ein Leben im Überfluss ist und dass wir dem Leiden niemals ganz entkommen können, weil es so etwas wie immerwährendes Glück in unserer äußeren Welt nicht geben kann.«
Maya nickte. Ein warmes Gefühl erblühte in ihrem Herzen. Was für ein Glück, dass es Katzen wie Milo gab!
»Ich bin Meister des dritten Grades im Orden der Heiligen Katzen«, fuhr Milo fort. »Wir lehren den Weg, der aus dem Leiden führt. Ich glaube, du könntest dich uns anschließen.«
Maya sah ihn mit großen Augen an. »Ich möchte mich euch gern anschließen. Aber ich weiß gar nichts von dieser Welt. Und von einem Orden der Heiligen Katzen habe ich noch nie etwas gehört. Tut mir leid ...«
Milo nickte verständnisvoll. »Natürlich nicht. Du warst schließlich dein ganzes bisheriges Leben lang eine Sklavenkatze ...« Er sah ihren verwirrten Blick und erklärte: »Sklavenkatzen nennen wir Katzen, die einem Menschen gehören. Viele von ihnen reden sich ein, dass sie ganz freiwillig bei ihrem Frauchen oder Herrchen wären, aber sie täuschen sich nur selbst.«
Maya überlegte. War sie wirklich eine Sklavenkatze gewesen? Die alte Dame war doch immer gut zu ihr gewesen. Jederzeit hätte sie gehen können. So gesehen ...
Milo schien ihre Gedanken gelesen zu haben. »Sicher hast du gemeint, dein Mensch wäre gut. Und vielleicht war er das ja auch. Trotzdem warst du nicht frei, wie es eine Katze sein sollte. Auch wenn es dir nicht bewusst war, hast du doch in Abhängigkeit gelebt. Kein Wunder, dass es dir so schlecht gegangen ist, als du plötzlich auf dich alleine gestellt warst.«
Maya musst sich eingestehen, dass da etwas Wahres dran war. Es stimmte schon: Niemand hatte sie festgebunden – jedenfalls nicht mit einem Strick wie einen Hund. Aber war sie deshalb wirklich frei gewesen? Das angenehme, leichte Leben in der Villa hatte sie gefesselt; vielleicht sogar stärker als eine Leine. Von einer Leine konnte man sich losreißen oder sie durchbeißen ... Sie sah Milo an und nickte.
»