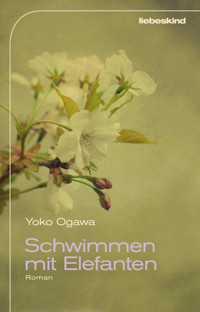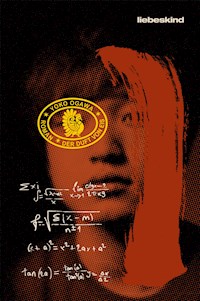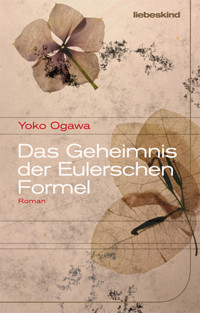
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Liebeskind
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Frau wird als Haushälterin für einen verschrobenen Professor eingestellt, der jeden Tag aufs Neue vergisst, wer er ist. In ihrer zarten, eindringlichen Sprache erzählt Yoko Ogawa eine berührende Geschichte über Freundschaft und Verlust - und über die Schönheit der Mathematik. Ein alter Mathematikprofessor, dessen Karriere nach einem geheimnisvollen Unfall ein abruptes Ende fand, lebt zurückgezogen auf dem prächtigen Anwesen seiner Schwägerin. Seit seinem Unfall währt sein Kurzzeitgedächtnis nur mehr achtzig Minuten, danach kann er sich an nichts mehr erinnern. Acht Haushälterinnen hat seine Schwägerin bislang für ihn eingestellt und jede schon nach kurzer Zeit wieder entlassen. Aber mit Nummer neun wird alles anders. Rasch gewinnt sie das Vertrauen des Professors, der auch ihren zehnjährigen Sohn sofort ins Herz schließt. Einfühlsam führt der Professor die beiden in die faszinierende Welt der Mathematik ein. Und mit jeder neuen Gleichung, mit jeder neuen Formel entstehen zwischen ihnen Bande, die stärker sind als der Verlust der Erinnerung - bis die Schwägerin des Professors dem ein plötzliches Ende setzt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Yoko Ogawa
Das Geheimnis derEulerschen Formel
Roman
Aus dem Japanischenvon Sabine Mangold
Die Originalausgabe erschien 2003
unter dem Titel Hakase no Aishita Sûshiki
im Verlag Shinchosha, Tokio.
Yoko Ogawa wird durch das
Japan Foreign-Rights Centre vertreten.
© Yoko Ogawa 2003
© der deutschen Ausgabe:
Verlagsbuchhandlung Liebeskind, München 2012
Umschlaggestaltung: Marc Müller-Bremer, München
Umschlagmotiv: plainpicture / Arcangel
Typografie und Satz: Frese Werkstatt, München
Herstellung: Büro Sieveking, München
Druck und Bindung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm
ISBN 978-3-935890-88-5
1
Wir nannten ihn den Professor. Und er taufte meinen Sohn »Root«, weil ihn sein flacher Schädel an das Dach eines mathematischen Wurzelzeichens erinnerte.
»Oh, da steckt ein kluger Verstand drin«, sagte der Professor, während er ihm über das Haar strich.
Mein Sohn zog argwöhnisch die Schultern hoch. Um sich gegen den Spott seiner Freunde zu wappnen, trug er ständig seine Baseballkappe.
»Das Wurzelzeichen bietet unendlich vielen Zahlen ein schützendes Dach über dem Kopf. Übrigens auch solchen, die für uns nicht mehr wahrnehmbar sind.«
Er malte das besagte Symbol auf eine Ecke des verstaubten Schreibtisches:
Unter den zahllosen Dingen, die uns der Professor beibrachte, nahm das Wurzelzeichen den bedeutendsten Rang ein. In Anbetracht seiner Überzeugung, dass sich die Entstehung der Welt in mathematischen Formeln ausdrücken lässt, würde er über meinen Ausdruck »zahllos« wohl die Nase rümpfen. Aber mir fällt kein treffenderes Wort ein. Er erzählte uns von ungeheuer großen Primzahlen mit mehr als hunderttausend Stellen, von der allergrößten Zahl, die in mathematischen Beweisen eine Rolle spielt und im Guinnessbuch der Rekorde aufgeführt ist, sowie von mathematischen Ideen jenseits der Unendlichkeit. Aber so beeindruckend das auch sein mochte, es war nichts im Vergleich zu der intensiven Erfahrung, mit ihm die Stunden zu verbringen.
Ich erinnere mich noch gut an den Tag, als er uns zu erklären versuchte, welch magische Angelegenheit es doch sei, Zahlen einem Wurzelzeichen zu unterstellen. Es war ein verregneter Abend Anfang April, im schummrigen Arbeitszimmer hatte lediglich eine Glühbirne gebrannt. Der Schulranzen meines Sohnes lag achtlos hingeworfen auf dem Teppich und draußen vor dem Fenster schimmerten die nassen Aprikosenblüten.
Egal, um welches Problem es gerade ging, der Professor erwartete von uns nicht unbedingt die richtige Lösung. Wenn wir, anstatt ratlos und stumm zu verharren, notgedrungen herumrätselten, bereiteten ihm unsere laienhaften Versuche großes Vergnügen. Am meisten freute es ihn jedoch, wenn sich aus dem ursprünglichen ein ganz neues Problem ergab. Er hatte eine besondere Vorliebe für »korrekte Irrtümer«, was uns gerade dann Mut machte, wenn wir trotz angestrengtem Nachdenken nicht auf die Lösung kamen.
»Schauen wir uns mal die Quadratwurzel aus -1 an«, schlug der Professor vor.
»Es muss also -1 herauskommen, wenn man eine Zahl mit sich selbst multipliziert, nicht wahr?« fragte Root.
Mit dem Professor hatte mein Sohn, der in der Schule gerade erst Bruchrechnen lernte, schon nach einer halben Stunde begriffen, dass es Zahlen kleiner als Null gab.
Wir stellten uns die Quadratwurzel aus -1 vor: .
Die Quadratwurzel von 100 ist 10, die Quadratwurzel von 16 beträgt 4, die Quadratwurzel von 1 ist 1 …
Der Professor drängte uns nie. Ganz im Gegenteil: Voller Freude beobachtete er uns dabei, wie wir angestrengt nachdachten.
»Solch eine Zahl gibt es vielleicht gar nicht?« fragte ich zaghaft.
»Doch, doch, sie existiert, und zwar hier.« Er tippte sich an die Brust.
»Es ist die scheueste Zahl überhaupt. Deshalb tritt sie einem auch nie unter die Augen. Sie befindet sich tief in unserem Herzen und in ihren kleinen Händen liegt die ganze Welt.«
Sprachlos versuchten wir uns die Quadratwurzel von -1 vorzustellen, wie sie uns an einem fernen, unbekannten Ort die Hände entgegenstreckte. Nur das Geräusch des Regens war zu hören. Mein Sohn strich sich über den Kopf, als wollte er sich noch einmal die Form des Wurzelzeichens vergegenwärtigen.
Aber der Professor verstand sich nicht als Lehrmeister. Er hatte großen Respekt vor Angelegenheiten, die er nicht begriff, und zeigte dann die gleiche demütige Zurückhaltung wie die Quadratwurzel aus -1. Wenn er mich brauchte, sagte er stets: »Entschuldigen Sie vielmals die Störung, aber könnten Sie bitte …«
Selbst dann, wenn ich ihm bloß den Toaster auf dreieinhalb Minuten einstellen sollte. Wenn ich den betreffenden Schalter justiert hatte, reckte er den Hals und spähte so lange in die Schlitze, bis das Brot geröstet war. Dann sah er den Toaster an, als ob es sich um einen von mir dargebrachten Beweis handeln würde, der ebenso bedeutend war wie ein Lehrsatz des Pythagoras.
Es war im März 1992, als ich von der Akebono-Haushaltsservice-Agentur an den Professor vermittelt wurde. Die Firma befand sich in einer Kleinstadt am Seto-Binnenmeer. Ich war zwar die Jüngste von allen, die dort registriert waren, hatte jedoch schon über zehn Jahre Berufserfahrung. Bislang war ich mit den unterschiedlichsten Kunden zurechtgekommen und hatte mich selbst dann nie beim Geschäftsführer beklagt, wenn ich schlecht behandelt wurde. Meine Kolleginnen hingegen machten um solche Kunden einen großen Bogen. Ich konnte mit Fug und Recht behaupten, eine sehr professionelle Einstellung zu haben.
Im Fall des Professors genügte ein Blick auf seine Karteikarte, um zu ahnen, dass er ein schwieriger Mensch sein musste. Auf der Rückseite wurde mit einem blauen Sternchen vermerkt, wenn die Haushälterinnen wechselten, und beim Professor waren es bereits neun solcher Stempel – der absolute Rekord seit meinem Eintritt in die Firma.
Als ich mich zum Vorstellungsgespräch begab, wurde ich von einer schlanken älteren Dame in eleganter Aufmachung empfangen. Sie hatte ihr kastanienbraun gefärbtes Haar hochgesteckt, trug ein Strickkleid und benutzte einen Gehstock.
»Sie werden sich um meinen Schwager kümmern«, erklärte sie.
Ich fragte mich, in welcher genauen Verwandtschaftsbeziehung die beiden wohl zueinander standen.
»Bisher hat hier niemand lange zugebracht«, fuhr sie fort. »Das ist für meinen Schwager und mich höchst unerfreulich. Wenn jemand Neues kommt, müssen wir jedes Mal wieder von vorn anfangen. Das ist sehr zeitraubend.«
Schließlich erfuhr ich, dass sie mit »Schwager« den Bruder ihres Mannes meinte.
»Die Arbeit ist nicht besonders schwierig. Sie kommen jeden Tag um 11.00 Uhr, von montags bis freitags, bereiten das Mittagessen vor, dann machen Sie die Zimmer sauber, erledigen Einkäufe, kochen das Abendessen und können um 19.00 Uhr nach Hause gehen. Das wäre alles.«
Ihre Stimme stockte jedes Mal, wenn sie das Wort »Schwager« aussprach. Ungeachtet ihres beherrschten Auftretens spielte ihre linke Hand nervös mit dem Gehstock. Obwohl sie es vermied, dass unsere Blicke sich trafen, bemerkte ich, dass sie mich argwöhnisch musterte.
»Die Einzelheiten sind in dem Vertrag aufgeführt, den ich in der Agentur hinterlegt habe. Ich möchte nur, dass sich jemand um meinen Schwager kümmert, damit er ein normales Leben führen kann, so wie andere auch.«
»Wo ist denn Ihr Schwager jetzt?« fragte ich.
Die Alte wies mit dem Stock auf ein Häuschen hinten im Garten. Ein braunes Schieferdach lugte über eine akkurat geschorene Mispelhecke.
»Bitte vermeiden Sie es, zwischen dem Gartenhaus und dem Hauptgebäude zu verkehren. Ihre Tätigkeit beschränkt sich allein auf die Wohnung meines Schwagers. An der Nordseite existiert ein Eingang von der Straße. Benutzen Sie bitte in Zukunft ausschließlich diesen. Versuchen Sie alle Probleme mit ihm vor Ort zu regeln. Tun Sie mir den Gefallen und halten Sie sich bitte strikt an diese Regel.«
Zur Bekräftigung stieß sie mit dem Stock auf den Boden.
Verglichen mit den absurden Forderungen meiner früheren Arbeitgeber – dass ich Zöpfe und jeden Tag ein andersfarbiges Haarband tragen sollte; dass das Teewasser genau 75 Grad Celsius heiß sein musste; dass ich jeden Abend meine Hände zum Gebet falten sollte, wenn der Abendstern am Himmel aufging – erschienen mir die Wünsche der alten Dame unproblematisch.
»Kann ich Ihren Schwager jetzt sehen?«
»Das ist nicht nötig.«
Sie erteilte mir eine derart schroffe Abfuhr, dass ich das Gefühl hatte, sie beleidigt zu haben.
»Wenn Sie sich heute bei ihm vorstellen, hat er Sie bis morgen vergessen. Das macht keinen Sinn.«
»Wollen Sie damit andeuten …«
»Um ehrlich zu sein, sein Gedächtnis lässt ihn im Stich. Aber er ist nicht etwa senil, seine Geisteskraft ist unvermindert groß. Vor siebzehn Jahren hat er sich bei einem Autounfall eine schwere Kopfverletzung zugezogen und leidet seitdem an Gedächtnisverlust. Seit 1975 funktioniert sein Kurzzeitgedächtnis nun schon nicht mehr. Sämtliche neuen Informationen sind nach genau 80 Minuten aus dem System gelöscht. Er kann sich zwar an irgendwelche Theoreme erinnern, die er vor dreißig Jahren aufgestellt hat, aber er weiß nicht mehr, was er gestern zu Abend gegessen hat. Es ist so, als hätte er ein achtzigminütiges Videoband in seinem Kopf, das sich nur einmal abspielen lässt, und wenn er etwas neu aufzeichnen möchte, dann wird die vorherige Erinnerung gelöscht. Sein Gedächtnis währt nur achtzig Minuten. Ganz genau eine Stunde und zwanzig Minuten – nicht mehr und nicht weniger.«
Die alte Dame ratterte die Ausführungen völlig gefühllos herunter. Wer weiß, wie oft sie das schon hatte erklären müssen.
Ich konnte mir nur schwer ein Bild machen von einem achtzigminütigen Gedächtnis. Natürlich hatte ich mich schon oft um Kranke gekümmert, aber ich wusste nicht, wieweit diese Erfahrung mir jetzt nützlich sein würde. Erneut fiel mir die Reihe blauer Sternchen auf seiner Karteikarte ein.
Vom Hauptgebäude aus wirkte der Gartenpavillon wie ausgestorben. In die Mispelhecke war eine altmodische Pforte eingelassen, von wo aus man Zutritt zum Pavillon hatte. Als ich genauer hinschaute, sah ich, dass sie mit einem verrosteten alten Schloss verschlossen war, das mit Vogeldreck überzogen war und das offenbar kein Schlüssel mehr zu öffnen vermochte.
»Mehr gibt es nicht zu sagen, wir sehen uns am Montag.« Sie beendete das Gespräch, um mir keine Gelegenheit zu geben, irgendwelche überflüssigen Fragen zu stellen.
So wurde ich also die Haushälterin des Professors.
Im Vergleich zum stattlichen Hauptgebäude wirkte der Gartenpavillon äußerst schlicht, fast schäbig. Der kompakte, flache Bau sah aus, als hätte man ihn lieblos zusammengezimmert. Dieser Eindruck sollte wohl durch das verwilderte Dickicht, das um den Pavillon herum wucherte, kaschiert werden. Der Eingang lag im Schatten, die Klingel war kaputt.
»Welche Schuhgröße haben Sie?«
So lautete die erste Frage des Professors, nachdem ich mich ihm als seine neue Haushälterin vorgestellt hatte. Nach meinem Namen erkundigte er sich nicht. Kein Grußwort, keine Verbeugung. Als Haushälterin hielt ich mich an die Grundregel, auf Fragen meines Arbeitgebers niemals eine Gegenfrage zu stellen, und antwortete deshalb gehorsam: »Größe 24.«
»Oh, eine würdevolle Zahl! Sie besitzt die Fakultät 4.«
Der Professor verschränkte seine Arme, schloss die Augen und verharrte schweigend.
»Was ist denn eine Fakultät?« fragte ich unsicher.
Vermutlich war es klug, auf das Thema einzugehen, auch wenn ich keine Ahnung hatte, weshalb sich mein neuer Arbeitgeber so für meine Schuhgröße interessierte.
»Wenn man sämtliche natürlichen Zahlen von 1 bis 4 miteinander multipliziert, ergibt das 24«, erwiderte der Professor, ohne die Augen zu öffnen.
»Wie lautet Ihre Telefonnummer?«
»576-1455.«
»5761455, sagen Sie? Ist das nicht zauberhaft? Das entspricht der Anzahl sämtlicher Primzahlen zwischen 1 und 100.000.000.« Er nickte, offenbar zutiefst beeindruckt.
Ich wusste zwar nicht, was an meiner Telefonnummer zauberhaft sein sollte, aber seine Stimme klang warmherzig. Er vermittelte nicht den Eindruck, als würde er mit seinem Wissen prahlen wollen. Ganz im Gegenteil, er gab sich aufrichtig und bescheiden. Das erweckte in mir die angenehme Vorstellung, dass meine Telefonnummer vielleicht wirklich bedeutungsvoll war und somit Einfluss auf mein eigenes Geschick hatte.
Erst später, nachdem ich die Stelle als Haushälterin bei ihm angenommen hatte, begriff ich, dass es eine Marotte des Professors war, über Zahlen zu reden, wenn er nicht wusste, worüber er sich mit seinem Gegenüber unterhalten sollte.
Es war seine ausgetüftelte Methode, mit Menschen zu kommunizieren. Zahlen waren für ihn eine Geste, dem anderen die Hand zu reichen, und zugleich ein Mantel, der ihm Schutz bot. Ein Mantel so dick und schwer, dass er unantastbar blieb und niemand ihn bloßstellen konnte. So konnte er sich in seinen eigenen Kokon zurückziehen.
Bis zu meinem letzten Arbeitstag bei ihm wiederholte sich unser Zahlenritual Tag für Tag an seiner Eingangstür. Für den Professor, dessen Gedächtnis nach achtzig Minuten erlosch, war ich stets eine neue Angestellte, der er wie beim ersten Mal mit großer Zurückhaltung begegnete. Wenn er sich nicht nach meiner Schuhgröße oder Telefonnummer erkundigte, wollte er meine Postleitzahl wissen, die Registriernummer meines Fahrrads oder die Anzahl der Striche in den Schriftzeichen meines Namens. Und immer endete es damit, dass er jeder Ziffer eine Bedeutung beimaß. Dabei hatte man nicht den Eindruck, dass er sich dafür besonders anstrengen musste. Die sogenannten Fakultäten und Primzahlen sprudelten scheinbar mühelos aus ihm heraus.
Auch später, als er mir nach und nach die Struktur der Fakultäten, Primzahlen und anderen mathematischen Größen erklärte, bereitete mir das Frage-und-Antwortspiel Freude. Es gab mir immer wieder aufs Neue die Gewissheit, dass meine Telefonnummer noch eine andere Bedeutung besaß, und allein das half mir, meine tägliche Arbeit voller Tatendrang zu beginnen.
Er war einst Hochschulprofessor gewesen, der sich auf das Gebiet der Zahlentheorie spezialisiert hatte. Mit 64 Jahren wirkte er älter, als er tatsächlich war. Das lag vor allem an seinem ausgemergelten Zustand. Es war, als würden die nötigen Nährstoffe nicht in alle Winkel seines Körpers gelangen.
Wegen seines arg gekrümmten Rückens war sein Körpermaß auf weniger als 1,60 Meter geschrumpft. In den Falten seines verknöcherten Nackens hatte sich Schmutz angesammelt und das wild zerzauste, struppige Haar bedeckte zur Hälfte seine Glück verheißenden Buddhaohren. Seine Stimme klang brüchig, und er bewegte sich so langsam, dass er für alles doppelt so viel Zeit benötigte.
Wenn man jedoch genauer hinschaute und von seinem ausgezehrten Körper absah, konnte man ein hübsches, jungenhaftes Antlitz entdecken. Zumindest wiesen sein ausgeprägtes Kinn und die klaren Gesichtszüge darauf hin, dass er früher mal ein schöner Mann gewesen sein musste.
Ob der Professor daheim blieb oder ausging – was höchst selten vorkam –, er trug jeden Tag ausnahmslos einen Anzug mit Krawatte. In seinem Kleiderschrank hingen drei Anzüge, einer für den Winter, einer für den Sommer und einer für den Übergang, drei Krawatten, sechs Oberhemden und ein Mantel aus Schurwolle. Er besaß weder einen Pullover noch eine Freizeithose. Für eine Haushälterin war solch ein pflegeleichter Kleiderschrank perfekt.
Der Professor wusste augenscheinlich nicht, dass es außer einem Anzug noch andere Kleidungsstücke gab. Vermutlich interessierte es ihn kaum, was andere Leute trugen, und noch weniger kümmerte er sich um sein eigenes Aussehen. Für ihn war das wohl Zeitverschwendung. Er begnügte sich damit, morgens nach dem Aufstehen den Kleiderschrank zu öffnen und den für die Jahreszeit passenden Anzug anzuziehen, während die beiden anderen unangetastet in der Plastikfolie der Reinigung blieben. Alle drei Anzüge waren dunkel und abgetragen. Irgendwie passten sie zur äußeren Erscheinung des Professors, als wären sie seine zweite Haut.
Was mich jedoch am meisten verblüffte, waren die unzähligen kleinen Notizzettel, die mit Klammern befestigt an allen möglichen Stellen an ihm hingen. Sie baumelten am Kragen, an Ärmeln, Taschen und Säumen, am Gürtel, an den Knopflöchern. Wegen der Klammern war der Anzugstoff arg verknittert. Die Notizzettel selbst waren nicht mehr als Papierfetzen, zum Teil schon vergilbt und eingerissen. Um die jeweilige Notiz lesen zu können, musste man ganz nah herangehen und die Augen zusammenkneifen. Es war zu vermuten, dass er als Erinnerungsstütze für sein Kurzzeitgedächtnis alles notierte, was er nicht vergessen durfte, und sich die Zettel, die er sonst verlegen würde, an den Körper heftete. Sein Aufzug war ebenso skurril wie die tägliche Frage nach meiner Schuhgröße.
»Treten Sie ein. Ich habe zu tun und kann mich nicht um Sie kümmern. Sie können hier frei schalten und walten.«
Nach dieser Aufforderung verschwand der Professor in seinem Arbeitszimmer. Bei jeder seiner Bewegungen raschelten die Notizzettel.
Aus den Erzählungen meiner neun entlassenen Vorgängerinnen hatte ich heraushören können, dass die alte Dame verwitwet und ihr verstorbener Mann der ältere Bruder des Professors gewesen war. Nach dem frühen Tod der Eltern hatte ihr Ehemann die Textilfabrik übernommen, sie erfolgreich vergrößert und bereitwillig das Studiengeld für seinen jüngeren Bruder gezahlt, der sich somit der Mathematik widmen und sogar ein Auslandsstudium in Cambridge antreten konnte. Aber bald nachdem dieser seinen akademischen Titel erworben hatte und mit einem Lehrstuhl an der Mathematischen Fakultät finanziell auf eigenen Beinen stand, starb der ältere Bruder unerwartet an Hepatitis. Da das Ehepaar kinderlos geblieben war, schloss seine Schwägerin die Fabrik und ließ auf dem Grundstück ein Wohnhaus errichten, von dessen Mieteinnahmen sie fortan lebte. Ihrer beider Leben änderte sich dann schlagartig, als der Professor im Alter von 47 Jahren Opfer eines Verkehrsunfalls wurde. Ein Lastwagenfahrer war am Steuer eingeschlafen und mit dem Wagen des Professors frontal zusammengestoßen, wobei der Professor einen irreparablen Hirnschaden erlitt. Das kostete ihn seinen Lehrstuhl an der Universität. Da er außer den Preisgeldern für die Lösung mathematischer Probleme in Fachzeitschriften kein Einkommen besaß und nie geheiratet hatte, war er auf die Unterstützung seiner Schwägerin angewiesen.
»Die alte Dame kann einem leidtun. Mit ihrem verschrobenen Schwager, der sich wie ein Parasit durch das Erbe ihres Mannes frisst.« Das vertraute mir meine Vorgängerin an, eine sehr erfahrene Haushaltshilfe. Sie hatte sich über die Zahlenattacken des Professors beklagt und war nach einer Woche entlassen worden.
Im Inneren wirkte der Gartenpavillon genauso trostlos wie von außen. Es gab lediglich zwei Räume: eine Essküche und das Arbeitszimmer, in dem der Professor auch schlief. Die Räume waren schäbig eingerichtet, an der Wand hingen ausgeblichene Tapeten und die Fußbodendielen im Flur knarrten bedrohlich. Es war nicht bloß die Türklingel, fast alles in diesem Haushalt funktionierte nicht. Die Scheibe der Fensterluke im Badezimmer war zerbrochen, der Knauf der Küchentür fehlte und das Radio auf der Anrichte gab keinen Laut von sich, wenn man auf die Tasten drückte.
In den ersten beiden Wochen war die Arbeit sehr anstrengend, da ich nicht wusste, wie ich vorgehen sollte. Obwohl ich keineswegs körperlich schwere Arbeit zu verrichten hatte, waren meine Muskeln am Abend völlig verspannt und meine Glieder bleischwer. Bei jeder neuen Anstellung ist es anfangs sehr mühevoll, bis man den richtigen Arbeitsrhythmus findet, aber diesmal war alles schwieriger als sonst. In der Regel konnte ich von den Anweisungen meiner Arbeitgeber auf deren Charakter schließen, ich wusste, auf was ich zu achten hatte, wie ich Konflikte vermeiden konnte und welche Anforderungen an mich gestellt wurden. Doch der Professor verlangte nichts von mir. Er nahm mich einfach nicht zur Kenntnis, so als wäre es sein sehnlichster Wunsch, dass ich mich überhaupt nicht rührte.
Am ersten Arbeitstag besann ich mich auf die Worte der alten Dame, dass ich in erster Linie die Mahlzeiten für den Professor zubereiten sollte. Im Kühlschrank gab es wie zu erwarten überhaupt nichts Essbares, und als ich den Küchenschrank inspizierte, fand ich lediglich eine Packung mit feuchten Haferflocken und Nudeln, deren Haltbarkeitsdatum vor vier Jahren abgelaufen war.
Ich klopfte an die Tür seines Arbeitszimmers. Als ich keine Antwort erhielt, klopfte ich abermals. Wieder keine Reaktion. Unaufgefordert betrat ich schließlich den Raum und sprach den Professor, der am Schreibtisch saß und mir den Rücken zuwandte, an.
»Verzeihung, dass ich Sie bei der Arbeit störe.«
Er blieb reglos sitzen. War er schwerhörig oder hatte er sich Stöpsel in die Ohren gesteckt? Ich trat näher.
»Was möchten Sie zu Mittag essen? Haben Sie ein Lieblingsgericht oder etwas, dass Sie gar nicht mögen? Sind Sie gegen irgendetwas allergisch? Es wäre hilfreich, wenn Sie mir darüber Auskunft geben könnten …«
Es roch nach Papier. Die Luft im Zimmer war abgestanden, vermutlich konnte man nicht ordentlich lüften, da die Hälfte des Fensters mit Regalen zugebaut war. Alle Bücher, die nicht mehr in die Fächer passten, waren auf dem Boden aufgestapelt. An der Wand stand ein Bett mit einer durchgelegenen Matratze. Auf dem Schreibtisch lag lediglich ein aufgeschlagenes Notizheft. Es gab weder einen Computer, noch hatte der Professor irgendeinen Stift in der Hand. Er starrte abwesend in die Luft.
»Wenn Sie keine besonderen Wünsche haben, dann koche ich Ihnen einfach irgendetwas, ja? Sollte Ihnen noch etwas einfallen, können Sie es mir ja sagen.«
Mein Blick fiel auf einige der Zettel, die an seinem Anzug hingen. Der Fehler der analytischen Methode … Hilberts 13. Problem … Die Lösung elliptischer Kurven …
Inmitten all der rätselhaften Zahlen, Zeichen und Wörter gab es eine Notiz, die auch ich verstand. Von den Flecken und der angerosteten Klammern her zu urteilen, befand sich der Zettel offenbar schon sehr lange in seiner Sammlung.
Meine Erinnerung dauert nur 80 Minuten, stand dort geschrieben.
»Ich habe nichts zu sagen!« brüllte der Professor plötzlich und drehte sich zu mir um.
»Ich denke gerade nach. Und wenn ich nachdenke, ist jede Art von Störung eine Qual, als würde man mir an die Gurgel gehen. Ist Ihnen klar, wie unhöflich es ist, hier so hereinzuplatzen, wenn ich mich meinen geliebten Zahlen widme? Das ist schlimmer, als jemanden auf der Toilette zu belästigen.«
Völlig betreten entschuldigte ich mich, aber meine Worte schienen ihn nicht zu erreichen. Er war mit seinen Gedanken bereits woanders.
Gleich am ersten Tag derart kritisiert zu werden, ohne überhaupt mit der Arbeit angefangen zu haben, war niederschmetternd. Es war zu befürchten, dass ich das zehnte blaue Sternchen werden würde. Ich schwor mir, ihn nie wieder zu belästigen, wenn er nachdachte.
Allerdings war der Professor fast immerzu in Gedanken. Sei es, dass er aus dem Arbeitszimmer kam und sich an den Esstisch setzte, im Badezimmer lautstark gurgelte oder komische gymnastische Verrenkungen machte, immer grübelte er über etwas. Er verschlang alle Speisen, die man ihm vorsetzte, wobei er alles mechanisch in sich reinschaufelte, ohne wirklich zu kauen. Danach schlurfte er auf wackligen Beinen davon. Mir gelang es einfach nicht, nach Dingen zu fragen, die ich unbedingt wissen musste: wo er beispielsweise den Putzeimer aufbewahrte oder wie der Boiler funktionierte. Ich war sehr vorsichtig, möglichst kein unnötiges Geräusch zu machen. Mit angehaltenem Atem geisterte ich durch den Pavillon, immer darauf bedacht, den Professor in einer – und sei es noch so kleinen – Denkpause zu erwischen.
Es geschah an einem Freitag. Zwei Wochen waren seit meinem Arbeitsantritt vergangen. Der Professor saß um sechs Uhr abends wie üblich am Tisch. Da er beim Essen nie achtgab, hatte ich einen Gemüseeintopf gemacht, den er problemlos zu sich nehmen konnte, denn Gerichte, wo er Gräten entfernen oder die Schale ablösen musste, erschienen mir für ihn wenig geeignet.
Es mochte daran liegen, dass er früh seine Eltern verloren hatte, jedenfalls ließen seine Tischmanieren sehr zu wünschen übrig. Er bedankte sich nie, wenn man ihm seine Mahlzeit servierte, ihm fiel fast jeder Bissen aus dem Mund und mit seiner schmutzigen Serviette pulte er sich in den Ohren herum. Er beschwerte sich nie über meine Kochkünste, machte aber auch keine Anstalten, sich mit mir zu unterhalten, wenn ich gerade in der Nähe war.
Plötzlich entdeckte ich an seinem Ärmelaufschlag eine Notiz, die gestern noch nicht dort war: Neue Haushälterin. Jedes Mal, wenn er den Löffel eintauchte, lief er Gefahr, mit dem Zettel in den Eintopf zu geraten.
Die Schrift war klein und krakelig. Darunter war ein Frauengesicht gemalt: kurzes Haar, pausbäckig, mit einem Muttermal neben dem Mund. Es sah aus wie eine Zeichnung aus dem Kindergarten, doch mir war sofort klar, dass es ein Bild von mir war.
Während ich ihn den Eintopf schlürfen hörte, stellte ich mir vor, wie der Professor die Zeichnung hastig hingekritzelt hatte, bevor ihn nach meinem Dienstschluss seine Erinnerung wieder im Stich lassen würde. Der kleine Zettel zeigte mir, dass er ein wenig von seiner kostbaren Zeit für mich geopfert hatte.
»Möchten Sie noch eine Portion? Es ist noch reichlich da. Sie können getrost noch mehr essen.«
Völlig unbedacht hatte ich einen vertraulichen Ton angeschlagen. Doch statt einer Antwort hörte ich ein Rülpsen. Ohne mich eines Blickes zu würdigen, verschwand der Professor wieder in seinem Arbeitszimmer. Auf seinem Teller hatte er nur die Karotten zurückgelassen.
Als ich mich am Montag wieder zu ihm begab, stellte ich mich wie üblich mit meinem Namen vor und zeigte dabei auf den Zettel an seinem Ärmel. Der Professor verglich mein Gesicht mit dem der Zeichnung, und nachdem er eine Weile schweigend über die Bedeutung der Notiz nachgesonnen hatte, grunzte er und erkundigte sich nach meiner Schuhgröße und meiner Telefonnummer.
Doch dann geschah etwas Überraschendes. Der Professor brachte mir einen Stapel Papiere, die er am Wochenende mit Formeln vollgekritzelt hatte, und bat mich, sie an das Journal of Mathematics zu schicken.
»Dürfte ich Sie um einen Gefallen bitten …?«
Sein Ton war unerwartet höflich, nachdem er mich neulich in seinem Arbeitszimmer so angebrüllt hatte. Es war zum ersten Mal, dass er etwas von mir wollte. Offenbar hatte er eine Grübelpause eingelegt.
»Aber gerne doch«, erwiderte ich und schrieb gewissenhaft, um keinesfalls einen Fehler zu begehen, Buchstaben für Buchstaben der ausländischen, für mich absolut nichtssagenden Adresse auf den Umschlag. Es ging um die Teilnahme an einem Preisausschreiben dieser Zeitschrift, und als Überbringerin der Lösung eilte ich begeistert zum Postamt.
Wenn der Professor einmal nicht in Gedanken versunken am Schreibtisch saß, ruhte er die meiste Zeit in dem Sessel, der im Esszimmer vor dem Fenster stand. In der Zeit konnte ich dann sein Arbeitszimmer sauber machen. Ich öffnete das Fenster und brachte den Futon und sein Kopfkissen zum Auslüften in den Garten. Dann ließ ich den Staubsauger auf Hochtouren laufen. Das Zimmer war vollkommen chaotisch, aber irgendwie gemütlich. Ich saugte die unter dem Schreibtisch liegenden Haare weg und fand es nicht sonderlich überraschend, wenn zwischen seinen zerfledderten Büchern verschimmelte Eiscreme-Stiele oder abgenagte Hühnerbeine herumlagen.
Hier herrschte eine Art von Stille, die ich noch nie erlebt hatte.
Diese Stille, die auch den Professor erfüllte, wenn er schweigend durch den dichten Zahlenwald streifte, war nicht einfach bloß geräuschlos, sondern undurchdringlich, als hätte sie mehrere Schichten. Nie würde sie von verlorenen Haaren oder Schimmel verunreinigt werden. Es war eine Stille, die so klar war wie ein See, der in der Tiefe eines Waldes verborgen lag.
Bei aller Gemütlichkeit bot das Zimmer nichts, was meine Neugier hätte wecken können. Es gab keine Relikte aus der Vergangenheit des Hausherrn, weder persönliche Fotografien noch irgendwelche Souvenirs – einfach nichts, was die Fantasie einer Haushälterin anstacheln konnte.
Ich ging mit dem Staubwedel über das Bücherregal. Gruppentheorie, Algebraische Zahlentheorie, Studien der Zahlentheorie … Chevalley, Hamilton, Turing, Hardy, Baker … Unzählige Bücher, aber keines, das zu lesen ich Lust gehabt hätte. Die Hälfte davon trug fremdsprachige Titel auf dem Buchrücken, die ich nicht einmal entziffern konnte. Auf dem Schreibtisch lagen Stapel von Schreibheften, umgeben von Bleistiftstummeln und einer Unmenge Büroklammern. Es war ein trostloser Platz, dem man nicht ansah, welche geistigen Anstrengungen dort unternommen wurden. Einzig die Krümelreste vom Radiergummi zeugten davon, dass hier noch vor Kurzem jemand gearbeitete hatte.
Eigentlich sollte ein Mathematiker doch kostbare Utensilien wie Zirkel oder komplizierte Rechenschieber besitzen – Dinge, die es nicht in normalen Schreibwarenläden zu kaufen gab. Darüber wunderte ich mich, während ich die Radiergummikrümel wegfegte, die Heftstapel ordnete und die verstreuten Büroklammern auf einen Haufen legte. Auf dem durchgesessenen, gepolsterten Stuhl konnte man den Gesäßabdruck des Professors erkennen.
»Wann haben Sie Geburtstag?«
An diesem Abend verschwand er nach dem Essen nicht sofort in sein Zimmer, sondern schien ein Gesprächsthema zu suchen, während er mir beim Aufräumen zuschaute.
»Am 20. Februar.«
»Sieh an …«
Der Professor hatte aus dem Kartoffelsalat die Karotten herausgepickt und als Einzige auf dem Teller zurückgelassen. Ich räumte den Tisch ab und wischte ihn sauber. Wie immer war er voller Flecken, selbst wenn der Professor einmal nicht nachdachte. Der Ölofen in der Ecke brannte, denn obwohl der Frühling bereits fortgeschritten war, wurde es abends noch immer recht kühl, sobald die Sonne untergegangen war.
»Schicken Sie öfter Ihre Abhandlungen an solche Zeitschriften?« fragte ich.
»Das sind doch keine Abhandlungen. Es war nur die Lösung einer Rechenaufgabe. Zeitschriften für Leute, die Spaß am Rechnen haben, veröffentlichen gern solche Rätsel. Wenn man Glück hat, gewinnt man sogar einen Preis. Wohlhabende Mathematikliebhaber spenden dafür Geld.«
Er suchte seinen gesamten Anzug ab, bis sein Blick auf eine Notiz fiel, die an der linken Tasche festgemacht war.
»Heute habe ich einen Beweis an Heft 37 des Journal of Mathematics geschickt, nicht wahr?«
Es war länger als achtzig Minuten her, seitdem ich am Vormittag auf dem Postamt war.
»Das tut mir leid. Ich hätte es per Eilboten schicken sollen. Wenn es nicht zuallererst eintrifft, bekommen Sie den Preis womöglich nicht.«
»Nein, eine Eilsendung ist nicht erforderlich. Natürlich zählt, wer vor allen anderen die Lösung findet, aber noch viel wichtiger ist die Schönheit des Beweises.«
»Ach, es macht tatsächlich einen Unterschied, ob ein Beweis schön ist oder nicht?«
»Selbstverständlich.«
Der Professor erhob sich und trat neben die Spüle, wo ich das Geschirr wusch.
»Ein wahrhaftiger Beweis findet das perfekte Gleichgewicht zwischen perfekter Solidität und Geschmeidigkeit. Es gibt nämlich Lösungen, die an sich fehlerfrei sind, aber keine Anmut haben. Verstehen Sie? Aber es ist sehr schwierig, diese Schönheit in Worte zu fassen, genauso wie man nicht genau erklären kann, weshalb die Sterne einen in ihren Bann schlagen.«
Um den Professor, der zum ersten Mal so ausführlich mit mir plauderte, nicht zu verstimmen, hielt ich mit dem Abwaschen inne und nickte mit dem Kopf.
»Ihr Geburtstag ist im zweiten Monat, und zwar am 20. Das ergibt 220. Eine äußerst faszinierende Zahl. Hier, schauen Sie! Dies ist der Preis des Dekans, den ich auf der Hochschule für meine Abhandlung über transzendente Zahlen gewonnen habe.«
Der Professor löste seine Armbanduhr und hielt sie mir direkt vors Gesicht. Es war ein luxuriöses ausländisches Modell, das so gar nicht zu ihm passte.
»Das ist aber ein schöner Preis.«
»Ach, eigentlich lege ich keinen Wert darauf. Können Sie die eingravierten Zahlen lesen?«
Auf der Rückseite des Gehäuses war die Inschrift Preis des Dekans Nr. 284 zu lesen.
»Soll die Zahl bedeuten, dass es sich um die zweihundertvierundachtzigste Preisverleihung handelte?«
»Wahrscheinlich, aber das Spannende daran ist die Zahl selbst. Machen Sie doch eine kurze Pause. Sagen Ihnen die beiden Zahlen 220 und 284 nichts?«
Der Professor zog mich an der Schürze zum Esstisch hinüber und ließ mich dort Platz nehmen. Dann holte er einen Bleistiftstummel aus der Innentasche seines Jacketts und schrieb auf die Rückseite eines gefalteten Werbeprospekts die beiden Zahlen auf:
Sie hielten einen merkwürdigen Abstand zueinander.
»Was fällt Ihnen dazu ein?«
Während ich meine nassen Hände an der Schürze abwischte, spürte ich, dass sich etwas Unangenehmes anbahnte. Ich wollte den Erwartungen des Professors gerne entsprechen, aber so sehr ich auch nachdachte, mir fiel keine gescheite Antwort ein, die das Herz eines Mathematikers erfreuen konnte. Für mich waren es einfach nur Zahlen.
»Nun ja, man könnte sagen«, sagte ich zaghaft, »dass beides dreistellige Zahlen sind. Und dass sie sich ähneln. Hm … ich meine, so großartig ist der Unterschied zwischen ihnen natürlich nicht. Wenn ich zum Beispiel im Supermarkt an der Fleischtheke ein Paket Gehacktes nehme, das 220 Gramm wiegt, oder eines mit 284 Gramm, dann ist das für mich in etwa das Gleiche. Ich würde eher darauf achten, welches das frischere ist. Rein äußerlich betrachtet, machen sie den gleichen Eindruck. Beide haben drei Ziffern und … na ja … und alle Ziffern, aus denen sie bestehen, sind gerade.«
»Gut beobachtet!« lobte der Professor und wedelte mit der Armbanduhr herum. Ich war perplex.