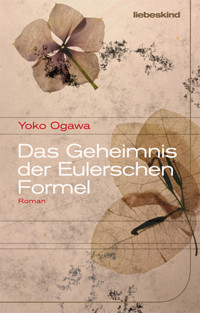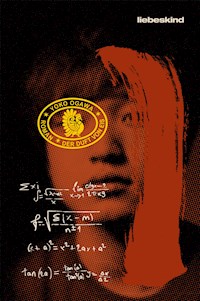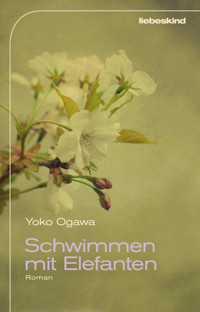
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Liebeskind
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einem ausrangierten Bus wird ein kleiner Junge vom Hausmeister des städtischen Busdepots in die Geheimnisse des Schachs eingeweiht. Der Mann hat sofort das außergewöhnliche Talent des Jungen erkannt, der am besten spielt, wenn er unter dem Schachbrett sitzt - ohne die Figuren vor sich zu haben, ohne seinem Gegner in die Augen zu sehen, in Gedanken bei einem Elefanten, mit dem er befreundet ist. Jedoch wird ihm aufgrund dieser Angewohnheit der Beitritt in den örtlichen Schachklub verwehrt. Er darf nur einen Schachautomaten bedienen, der die Gesichtszüge des berühmten Großmeisters Alexander Alexandrowitsch Aljechin trägt. Im Inneren des Automaten, eingezwängt zwischen Hebeln und Knöpfen, treibt der Junge seine Kunst zur Vollendung. Doch dann kommt es zu einem verhängnisvollen Zwischenfall ... Yoko Ogawa hat einen hinreißenden Roman über eine außergewöhnliche Freundschaft geschrieben - und über den Zauber des Schachspielens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Yoko Ogawa
Schwimmenmit Elefanten
Roman
Aus dem Japanischenvon Sabine Mangold
Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem TitelNeko wo Daite Zô to Oyogu im Verlag Bungeishunju, Tokio.
Yoko Ogawa wird durch das Japan Foreign-Rights Centre vertreten.
© Yoko Ogawa 2009
© der deutschen Ausgabe:Verlagsbuchhandlung Liebeskind, München 2013
Umschlaggestaltung: Marc Müller-Bremer, MünchenUmschlagmotiv: Arcangel ImagesTypografie und Satz: Frese Werkstatt, MünchenHerstellung: Sieveking · Verlagsservice, MünchenDruck und Bindung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm
ISBN 978-3-95438-013-8
1
Ich möchte die Geschichte von Anfang an erzählen, noch bevor unser Held »Kleiner Aljechin« genannt wurde, also zu einer Zeit, als er noch den Namen trug, den ihm seine Eltern gegeben hatten.
Im Alter von sieben Jahren fand er es jedes Mal sehr aufregend, wenn seine Großmutter mit ihm und seinem jüngeren Bruder einen Kaufhausbummel unternahm. Zwar war die zwanzigminütige Busfahrt ins Stadtzentrum eine Tortur, weil dem Jungen dabei immer schlecht wurde, und es bestand auch nicht die Aussicht, ein Spielzeug gekauft zu bekommen oder im Restaurant ein Kindermenü bestellen zu dürfen. Trotzdem war es für den Jungen ein ganz besonderes Erlebnis. Während seine Großmutter mit seinem jüngeren Bruder durch die Etagen lief, um sich Miniatureisenbahnen oder U-Boot-Modelle anzuschauen, beziehungsweise Seidenkleider und Krokodillederhandtaschen, verbrachte er die Zeit oben auf dem Dach. Zu jener Zeit waren die Dachterrassen von Kaufhäusern alle ähnlich ausgestattet: es gab einen Spielplatz mit Holzpferdchen, Reitautomaten, Karussellen und Drehscheiben wie jene überdimensionale Kaffeetasse, in der sich lachende Kinder drängten.
Doch er interessierte sich nicht für diese Art von Vergnügungen. Das mulmige Gefühl von der Busfahrt war nie ganz verflogen, und außerdem hatte er kein Geld, um sich ein Billett für die Spielgeräte zu kaufen. Er ging immer schnurstracks über die Terrasse und um das Riesenrad herum und stellte sich in die Nische zwischen der Wand zum Kesselraum und dem Schutzgitter. An dem Gitter war eine kleine Hinweistafel angebracht:
Hier an diesem Ort ist der Elefant Indira gestorben. Er war zur Einweihung des Kaufhauses eigens aus Indien geholt worden und sollte eigentlich nur als Jungtier hier bleiben und danach dem Zoo übergeben werden. Da er aber bei den Kindern so beliebt war, versäumte man die Übergabefrist, und schließlich war er zu groß geworden, um das Dach verlassen zu können. Er ließ sein Leben, nachdem er 37 Jahre lang an diesem Ort die Herzen der Kinder erfreut hatte.
Für einen Jungen, der gerade Lesen und Schreiben in der Schule lernte, war es schwierig, die Inschrift zu entziffern, aber seine Großmutter hatte ihm die Tafel Dutzende Male vorgelesen, sodass er sie auswendig kannte.
Zum Andenken an Indira war am Pfeiler ein eiserner Fußring befestigt, der schon völlig verrostet und so schwer war, dass ihn ein Kind unmöglich hochheben konnte. Neben der Inschrift war ein Bild des Elefanten angebracht – auf indische Art mit Glasperlen und Quasten geschmückt und mit triumphal erhobenem Rüssel –, aber der Junge wusste, dass es sich um eine Fälschung handelte. Es fehlte der Eisenring um Indiras Fuß.
Wie üblich stand der Junge eine ganze Weile lang still vor dem Gitter und ließ sich den kalten Wind um die Ohren blasen, während seine Gedanken um den Elefanten kreisten. Die kleine Indira, wie sie im Fahrstuhl auf das Dach transportiert wurde. Neugierig raunende Zuschauer, die sich drängten und gegenseitig wegschubsten, um das Tier zu berühren. Johlende Kinder auf den Schultern ihrer Eltern. Indira machte Kulleraugen, schwenkte ihren Rüssel hin und her und aß Bananen.
Schließlich kam der Tag, da Indira in den Zoo umziehen sollte. Aus diesem Anlass wurde ein großes Fest veranstaltet. Kinder lasen schluchzend Abschiedsbriefe vor, dann begann der Aufbruch. Ihr Wärter führte sie hinüber zum Fahrstuhl, und die Leute schrien überrascht auf, als Indira mit dem Kopf anstieß. Der Elefant passte nicht mehr in die Kabine. Der Wärter drückte mithilfe eines Stocks seinen Rüssel herunter, während die anderen das Tier mit vereinten Kräften von hinten hineinzuschieben versuchten. Indira verstand nicht, was genau gerade mit ihr geschah. Sie wollte es allen recht machen, vor allem ihrem Wärter, indem sie die Ohren anlegte und ihr Hinterteil einzog, aber alle Anstrengung war vergebens. Ihr taten die Glieder weh, und diese Schmerzen trieben ihr Tränen in die Augen. Was immer auch unternommen wurde, man sah schließlich ein, dass Indira für den Fahrstuhl inzwischen zu groß geworden war.
Jetzt blieb nur noch die Möglichkeit, die Treppe zu nehmen.
»Na, sei ein braves Mädchen. Du musst ganz langsam machen. Das schaffst du schon, du bist doch klug genug. Stufe für Stufe, einen Fuß vor den anderen. Für jede Stufe gibt es eine Belohnung. Versuch es doch einmal!«
Aber alles Zureden oder Drohen war vergeblich. Indira, die nie zuvor eine Treppe gesehen hatte, zitterte vor Angst.
Mit gesenktem Kopf trottete sie zu ihrem Platz zurück, wo noch immer das Banner »Sayonara, Indira!« hing. Obwohl sie nichts Schlimmes getan hatte, plagten sie Gewissensbisse, die Menschen enttäuscht zu haben.
Auf der Terrasse wurden rasch die nötigen Vorkehrungen getroffen, um für den Elefanten halbwegs annehmbare Lebensbedingungen zu schaffen. Der Zaun wurde erhöht und mit einem solideren Schloss versehen, Indira wurde mit dem Fußring angekettet.
Wenn Kinder sie darum baten, streckte Indira majestätisch ihren prächtigen Rüssel in die Höhe. Bereitwillig ließ sie sich auf alles ein, nur um ihnen eine Freude zu machen. Das Rasseln ihrer Kette wurde vom Johlen der Kinder übertönt. Aber es gab auch Besucher, die sie ärgern wollten und mit Bierdosen nach ihr warfen.
Weitaus trauriger waren jedoch verregnete Feiertage, die Indira mutterseelenallein auf dem Dach verbringen musste. Es gab keinen einzigen Baum, unter den sie sich hätte stellen können, das Riesenrad und das Karussell standen still, nur der Regen prasselte unablässig auf die Terrasse nieder. Indira wiegte sich hin und her, um ein wenig Ablenkung zu haben, aber sofort zerrte die Kette an ihr. Sie konnte sich immer nur in einem Umkreis von wenigen Metern bewegen.
Auf diese Weise lebte Indira siebenunddreißig Jahre auf dem Dach des Kaufhauses. Wie sehr sie sich auch danach sehnte, es gelang ihr nie, diesem Ort hoch oben in den Wolken zu entkommen. Sie, die eigentlich durch den Dschungel hätte stampfen sollen, schwebte fast ihr ganzes Leben lang zwischen Himmel und Erde.
Der Junge gab sich wieder einmal seinen Fantasien über Indira hin. Einsam und verträumt stand er in der Ecke, unbemerkt von den anderen Kindern, die sich derweil auf den Karussellen vergnügten. Unter wolkenlosem Himmel ritten sie selig auf den Holzpferden, umgeben vom süßen Duft der Zuckerwatte. Wer nahm schon Notiz von dem alten verblichenen Schild? Der Junge hatte Indira ganz für sich allein.
Manchmal wunderte er sich selbst darüber, dass ihn ein toter Kaufhauselefant so faszinierte. Aber er konnte noch nicht in Worte fassen, was ihn mit diesem Elefanten verband, der in seinem Leben eine wichtige Rolle spielen sollte.
Um ihm näher zu sein, kniete sich der Junge auf den Boden und roch an dem Fußring. Jahrelang lag der nun schon vergessen da, kein einziges Elefantenhaar klebte mehr an ihm, aber der rostige Geruch, der an ein schmutziges Scheuertuch oder einen kariösen Zahn erinnerte, holte Indira in die Gegenwart zurück.
Was mag in einem Elefanten vorgehen, wenn ihm klar wird, dass er für immer und ewig auf dem Dach gefangen ist? Bestimmt ist er völlig verzweifelt. Ob er sich wünscht, fliegen zu können, um mit seinen riesigen Segelohren sanft auf der Erde zu landen? Aber gutmütig, wie sie war, machte sich Indira wahrscheinlich eher Sorgen über ihr zunehmendes Gewicht und die Gefahr, deswegen irgendwann durch das Dach zu brechen.
In diesem Augenblick verstand der Junge, dass er nicht bloß Mitleid mit dem Elefanten hatte, sondern auch so etwas wie Neid verspürte. Er beneidete Indira darum, dass sie ihr Leben auf einem Dach verbrachte, ohne jemals ausbrechen zu können.
»He, großer Bruder!« Die helle Stimme übertönte den Lärm auf dem Dach. Seine Großmutter tauchte auf, mit seinem kleinen Bruder im Schlepptau. Der Junge sah, dass er heute nichts bekommen hatte, aber der Kleine fasste ihn unbekümmert am Arm und erzählte, wie toll die neuen Plastikmodelle in der Spielzeugabteilung waren.
»Ihr seid bestimmt hungrig, nicht wahr? Lasst uns etwas essen«, sagte derweil ihre Großmutter, die auf der Bank Platz genommen hatte und sich, anscheinend müde vom vielen Herumlaufen, die Knie rieb. Sie wischte sich die Hände mit dem Tuch sauber, das ihr von der Hüfte hing, und wühlte in der Einkaufstasche, aus der sie schließlich eine Thermosflasche und in Papier gewickelte Sandwichs holte. Die beiden Brüder sahen ihr wortlos zu.
Die Bank stand direkt neben dem Schild. Bislang hatte nie ein anderer Besucher hier Platz genommen. Sie war so verwittert und morsch, dass man den Eindruck hatte, man habe sie eigens für die drei dort vergessen. Von hier aus schauten sie in den Himmel, wie einst Indira, aßen dabei ihre Sandwichs und tranken Eistee. Der Kleine schwärmte unverdrossen, wie toll es doch in der Spielzeugabteilung gewesen sei.
Der Junge hörte seinem Bruder aufmerksam zu und pickte hin und wieder Brotkrümel von dessen Pullover. Auch als der Redeschwall über die Spielzeugabteilung für kurze Zeit ins Stocken geriet, ließ er die anderen beiden nicht an seiner Freundschaft mit Indira teilhaben.
»Aber an meinem Geburtstag essen wir im Restaurant, oder?« Als sie ihre Sandwichs aufgegessen hatten, sprang sein kleiner Bruder von der Bank auf. Die beiden Jungen gingen immer zu den langweiligsten von allen Spielgeräten. Wenn man eine Münze in den Schlitz steckte, konnte man eine Minute lang auf einer Giraffe, einem Löwen oder einem Elefanten reiten. Aber die beiden warfen nichts ein. Der Junge bewegte seinen Körper selbst ruckartig vor und zurück, während seine Großmutter den kleinen Bruder durchschüttelte. Auf diese Weise konnten sie sich immer mehrere Minuten nach Herzenslust amüsieren. Giraffe, Löwe und Elefant. Sein Bruder entschied sich stets für den Löwen, der Junge nahm die Giraffe. Er würde niemals auf dem Elefanten reiten.
Der Junge lebte bei seinen Großeltern, die in der Nähe der Endstation der Buslinie wohnten, in einem alten Viertel am Ufer des Kanals. Die Eltern hatten sich kurz nach der Geburt seines jüngeren Bruders scheiden lassen, worauf die Mutter mit beiden Kindern zu ihrer Familie zurückkehrte. Zwei Jahre später starb sie an einer plötzlichen Hirnblutung.
Sie wohnten in einem Haus, das so schmal war, als wäre es von den Nachbarhäusern zusammengestaucht worden. Immerhin hatte es ein Giebeldach. Manchmal geschah es, dass der Postbote die Hausnummer übersah und einfach mit dem abzuliefernden Brief am Haus vorbeiging. In den schmalen Spalt zum Nachbarhaus passte gerade einmal eine Hand hinein. Tief darin herrschte eine schaurige Finsternis, und einer alten Legende zufolge soll einmal ein Mädchen in den Spalt geraten sein. Das Mädchen ist nie wiederaufgetaucht, obwohl seine besorgten Eltern überall nach ihm gesucht hatten. Irgendwann ist aus dem Mädchen eine Mumie geworden, die bis heute zwischen den Häusern herumspukt. »Sei lieb, sonst wirst du in den Spalt gesteckt«, lautete eine Drohung, vor der sich sämtliche Kinder im Viertel fürchteten.
Wer vor dem Haus stand, konnte bereits ahnen, wie eng es drinnen sein mochte. Die Tapeten waren vergilbt, die Fensterrahmen durch die salzige Meeresluft verwittert und die Elektrogeräte völlig veraltet. Nur die Möbel waren mit Politur auf Hochglanz gebracht. Der Großvater des Jungen war von Beruf Schreiner. Seine Werkstatt befand sich im Erdgeschoss. Er hatte sich auf die Reparatur von Möbelstücken spezialisiert, obwohl es meistens sinnvoller war, gleich etwas Neues zu bauen – was bestimmt dazu beigetragen hätte, die Atmosphäre im Haus etwas freundlicher zu gestalten. Der Junge fragte sich stets, was sein Großvater mit dem alten Gerümpel zu schaffen hatte.
»Neue Möbel haben zu viel Energie«, pflegte der Alte zu sagen, der sonst ein sehr einsilbiger Mensch war. »Gerade alte, ausgediente Sachen muss man gut behandeln.«
Der Junge begriff zwar nicht genau, was er damit meinte, aber da er ihn bei der Arbeit nicht stören durfte, nickte er zustimmend.
In der Werkstatt flogen ständig Hobelspäne herum. Es war ein einziges Durcheinander: Sofagestelle ohne Polster, schiefe Türme von übereinandergestapelten Schubladen, dreibeinige Sessel und anderer Krempel. Der Junge schaute dem Alten gern bei der Arbeit zu, um etwas von ihm zu lernen, auch wenn seine Großmutter das nicht guthieß, weil sie fürchtete, er würde seine Kleidung schmutzig machen. Ein reich verzierter Schrank, der aus dem Salon einer Villa zu stammen schien, sah hoffnungslos aus, nachdem sein Großvater sich daran zu schaffen gemacht hatte. Es fehlte das Deckbrett, das geschnitzte Ornament war mit Holzstaub übersät, die Schubladen hingen heraus. Aber der Junge wusste, dass auf seinen Großvater immer Verlass war.
Um seine Großmutter zu beschreiben, muss man die Geschichte von ihrem Tuch erzählen. Den ganzen Tag lang, vom Aufwachen bis zum Einschlafen, egal ob sie sich drinnen oder draußen aufhielt, es durfte niemals fehlen. Ursprünglich war es sicher einmal ein ganz gewöhnliches Tuch gewesen, aus weißer Baumwolle und mit einem Blumenmuster verziert, so wie man es zum Abtrocknen von Geschirr benutzt. Aber seit der Junge denken konnte, hatte es nie diesen Zweck erfüllt. Stattdessen wischte sich seine Großmutter damit den Schweiß von der Stirn, wenn sie in der Küche Eintopf machte, oder sie schnäuzte sich damit die Nase, wenn sie den Kindern beim Ankleiden half. Wenn sie mit den Nachbarn plauderte, knetete sie darauf herum, drückte es zusammen und zog es wieder auseinander. Abends, wenn sie die Strickarbeit beiseitelegte, malte sie mit der Spitze ihrer Stricknadeln irgendwelche Zeichen in den Stoff.
Das Tuch war Großmutters Talisman, ihr Heiligtum, ihr Schutzengel, es war wie ein Teil ihres Körpers. In dieser Eigenschaft wurde es auch nie gewaschen. Hätte sie das Tuch zum Trocknen auf die Leine hängen müssen, wäre das einer Amputation gleichgekommen. Natürlich war das Blumenmuster längst verblichen. Das Tuch besaß nun eine Patina, die kein Farbpigment hätte zustande bringen können, und verströmte einen eigentümlichen Geruch. Irgendwann war es nicht mehr von der Farbe ihrer Haut zu unterscheiden.
Wie es dazu gekommen war, hing mit dem Tod ihrer einzigen Tochter zusammen. Sie hatte das Tuch von jenem Moment an ins Herz geschlossen, nachdem sich im Anschluss an die Bestattungszeremonie alle Trauergäste verabschiedet hatten. Das liegen gebliebene Küchentuch nahm sie beiläufig vom Tisch, als sie sich auf einem Stuhl niederließ. Erst als sie es in Händen hielt, konnte sie ihren Tränen freien Lauf lassen. Ihr Mann schaute derweil nur stumm aus dem Fenster. Später gingen sie gemeinsam hinüber zu einem schäbigen Sofa, wo ihre Enkel bereits eingeschlafen waren, und trugen sie ins Bett.
Der Junge war ein sehr stilles Kind. Die Nachbarn vermuteten, er käme nach seinem Großvater, aber in Wirklichkeit gab es dafür einen Grund, von dem niemand wusste. Bei der Geburt des Jungen waren seine Oberund Unterlippe miteinander verwachsen. Deshalb konnte auch kein Schrei aus seinem Mund dringen.
Lippendeformationen sind bei Neugeborenen an sich keine Seltenheit, aber die Lippen des Jungen klebten so fest aneinander, dass man sie partout nicht lösen konnte, sosehr man sich auch bemühte. Auch für den Arzt war dies ein völlig neuartiges Phänomen, das ihm in seiner medizinischen Laufbahn bislang nicht begegnet war.
Fast schien es, als wäre das Neugeborene wild entschlossen, den anderen seine im Mund versiegelte Dunkelheit vorzuenthalten. Zugleich schien es aber nicht zu wissen, wohin mit dem Hall der eigenen Stimme, die nun in seinem Herzen eingekerkert war. Man nahm unverzüglich einen Eingriff vor. Das Neugeborene wurde aus den Armen der Mutter gerissen und auf einen kalten Operationstisch gelegt. Seine Lippen waren zierlicher als der kleine Finger des Arztes, so zart, als seien sie noch gar nicht reif für diese Welt. Blitzschnell wurden sie mit einem Skalpell auseinandergeschnitten. So wurde Gottes gnädiges Werk von den zittrigen Händen eines Chirurgen vollbracht. Aber was, wenn Gott vielleicht gewollt hätte, dass zum Wohl des Kindes seine Lippen verschlossen blieben?
Die ihrer ursprünglichen Form beraubten Lippen bluteten, die Haut platzte auf, die Schleimhäute lagen bloß. Der Arzt verpflanzte ein Stück Haut von der Wade. Als der Säugling aus der Narkose erwachte, spürte er sofort, dass etwas mit ihm geschehen war. Nur zögerlich öffnete er die Lippen, und sein Blick schien zu fragen, ob er so alles richtig machte. Dann fing er an zu schreien, seine ersten Laute auf dieser Welt. Es war ein unbeholfenes Schreien, entweder wirkte die Narkose noch, oder aber das schnell hingepfuschte Lippenpaar behinderte ihn.
Es war jedoch fraglich, ob seine Wortkargheit tatsächlich darauf zurückzuführen war. Allein die Tatsache blieb bestehen, dass er zum Zeitpunkt seiner Geburt kein geeignetes Organ besaß, um seine Worte herauszulassen. Die neu geschaffenen Lippen waren für immer und ewig nur eine Imitation.
Seine Schweigsamkeit bedeutete allerdings nicht, dass er sprachlich zurückgeblieben war. Bereits in der Phase, in der Kinder das Laufen lernen, verstand er, dass alle Dinge einen Namen haben, und lernte diese mit verblüffender Geschwindigkeit. Seiner Großmutter fiel als Erster auf, wie intelligent der Junge war. Eines Tages, als sie in ihrem Nähkorb wühlte und gedankenverloren »leer … leer …« murmelte, kam der Kleine herbei und hielt ihr seinen Teddybär hin.
»Oh, du hast wohl verstanden, wonach ich suche. Wie schlau du bist. Vielen Dank.«
Die Großmutter nahm den Teddy in ihren Arm, schmiegte ihn an die Wange und stickte ihm das Wort »Bär« auf den Po.
Auch die Konzentrationsfähigkeit des Jungen war bemerkenswert. Besonders angetan hatte es ihm der Reißverschluss einer Einkaufstasche. Den ganzen Tag über machte er ihn unermüdlich auf und zu, strich von innen und außen darüber und prüfte, wie die einzelnen Zähne ineinandergriffen, wobei er sich durch nichts und niemanden stören ließ. Am dritten Tag schließlich war der Reißverschluss kaputt.
Da die verpflanzte Haut auf seiner Lippe von der Wade stammte, wuchs dort ein zarter Flaum. Immer wenn er sprach oder sein Atem darüberstrich, erzitterten die Härchen. Da sie sich sorgte, ob die Narbe richtig verheilte, starrte die Großmutter unentwegt auf die Lippen des Jungen. Sie wusste besser Bescheid über die Bewegung der Härchen als jeder andere. Auch wenn ihr Enkel sie nur schweigend anschaute, ahnte sie, was in ihm vorging. Deshalb war er ihr gegenüber sogar noch eine Spur einsilbiger. Die beiden kommunizierten über seinen Flaum.
Am redseligsten war der Junge beim Zubettgehen. Sein Refugium war ein Schrank neben dem Ofen im Wohnzimmer, der zu einer Art Alkoven umgebaut worden war. Sein kleiner Bruder schlief im Schlafzimmer der Großeltern im zweiten Stock, sodass der Junge nachts allein war.
Den Alkoven verdankte er der Handwerkskunst seines Großvaters. Auf die verstärkten Mittelbretter wurde eine Matratze gelegt, während die nackten Innenwände, die aus Sperrholzplatten bestanden, mit einer Flugzeug-Tapete ausgekleidet waren. Es gab auch einen Vorhang, der an einer Schiene befestigt war. Auf diese Weise hatte der Junge sein eigenes Reich, das ihm an sich schon genügte, aber sein Großvater gab sich damit noch nicht zufrieden. Am Kopfende brachte er eine kleine Glühbirne an und eine blau angemalte Flügeltür, die man auch von innen öffnen und schließen konnte. Bei geschlossener Tür konnte man den Jungen nun nicht mehr sehen.
»Aber da drinnen kriegt er doch keine Luft. Und wenn er das Bewusstsein verliert, merkt es keiner.«
Dieser Einwand kam natürlich von der Großmutter, die sich um das Wohlergehen ihres Enkels immer übermäßig sorgte. Wobei es der Junge nie mochte, wenn zu viel Aufhebens um seine Person gemacht wurde. Aber sein Großvater kramte daraufhin in seinem Werkzeugkasten herum und sägte dann ein rechteckiges kleines Fenster oben in die Tür. Es war eigentlich als Luftschlitz gedacht und gerade groß genug, um die Sorgen der Großmutter zu zerstreuen. Andererseits war es auch klein genug, damit der Junge ungestört bleiben konnte. Denn sein Großvater hatte intuitiv begriffen, was für eine Art von Unterschlupf sein Enkel brauchte.
Als der Alkoven fertig war, wurde sein kleiner Bruder neidisch und bestand darauf, selbst darin zu schlafen. Widerwillig erlaubte es ihm der Junge, aber nur für eine Nacht. Am Ende hielt es der Kleine keine halbe Stunde darin aus und stürzte dann weinend heraus.
»Wenn man in solch einem engen Raum schläft, kann man ja gar nicht wachsen«, rechtfertigte er sich. Er war ein schlechter Verlierer. Und so blieb der Alkoven, wie ursprünglich vorgesehen, das Reich seines großen Bruders.
Für den Jungen war es ein maßgeschneiderter Kasten inmitten nächtlicher Dunkelheit. Sie umgab ihn wie ein schützender Kokon, der absolut undurchlässig war. Da es nur die eine Tür gab, rückte die Außenwelt in weite Ferne. Der Junge liebte die Finsternis im Inneren und genoss es, wenn sich vor seinen Augen, egal ob sie geschlossen oder geöffnet waren, nicht das Geringste änderte. Aber genauso mochte er die vage flackernden Schattenfiguren, die das Licht projizierte, wenn er die Glühbirne am Kopfende einschaltete. Als wäre er in einem Kaleidoskop oder in einer Laterna magica eingesperrt. Er hatte das Gefühl, etwas zu besitzen, was für andere unsichtbar blieb.
Zudem hatte der Junge immer einen Gesprächspartner: das kleine Mädchen, das in dem Spalt zwischen den Häusern feststeckte und nicht mehr herauskonnte. Wenn er sich nach links drehte, war er mit dem Gesicht direkt an der Hauswand.
»Hallo Miira, guten Abend.«
Er hatte das Wort »Miira«, Mumie, bei den Erwachsenen aufgeschnappt und war überzeugt, das wäre ihr Name.
»Was für ein Glück, dass ich dich immer zur Schlafenszeit antreffe. Stell dir vor, es wäre am Morgen, wie sollte ich dich dann begrüßen? Bei dir herrscht doch immer dunkle Nacht, Miira.«
Jedes Mal, wenn er mit ihr redete, dachte er daran, wie hübsch doch ihr Name war.
»Heute habe ich Indira auf der Dachterrasse einen Besuch abgestattet. Der Boden, wo einst ihr Käfig stand, hat lauter Dellen. Gestern Nacht hat es geregnet, und es haben sich darin Pfützen gebildet. Es sind bestimmt Indiras Fußabdrücke. In den Pfützen schwammen Mückenlarven. Wie kommen die nur dahin? Wahrscheinlich erging es ihnen genauso wie Indira damals.«
Miira war die Einzige, der er von Indira erzählte. Er war überzeugt, dass niemand außer ihr Verständnis für die Lebensumstände eines Elefanten aufbrachte.
Seine Worte hallten eine Zeit lang in dem Alkoven, bis sie sich in der Ecke zusammenballten und schließlich durch die Wand drangen.
»Bist du schon mal in ein Flugzeug gestiegen?«
Diese Frage kam ihm beim Anblick des Tapetenmusters. Es waren Propellermaschinen, die zwischen Sternen umherflogen. Es roch immer noch nach dem Kleister, den sein Großvater zum Tapezieren benutzt hatte.
»Mit einem Flugzeug kann man ziemlich weit reisen, nicht wahr? Von allen Menschen, die ich kenne, ist noch nie jemand geflogen. Allerdings verstehe ich auch nicht, wieso man überhaupt so weit weg muss …«
Der Junge legte sein Ohr an die Wand. Er wusste zwar, dass Miiras Stimme nicht bis zu ihm drang, aber er fand es höflicher, ihre Antwort abzuwarten. Alles, was er hören konnte, war das feine Knistern der Glühbirne.
»Na, dann gute Nacht, Miira.«
Als der Junge das Licht löschte und die Augen schloss, tauchte die Gestalt von Miira hinter seinen Lidern auf. Er wünschte ihr abermals eine gute Nacht, so wie es ihr gemeinsames allabendliches Ritual vorsah.
Miira war ein winzig kleines Mädchen. Wie klein sie war, ergab sich natürlich aus dem Umstand, dass sie überhaupt in einen Spalt passte. Sie war so klein, als wollte sie sich für ihre bloße Existenz entschuldigen, ja, als wäre sie allein zum Zweck dieser Entschuldigung zusammengedrückt worden: »Nein, der Platz reicht aus, bitte kümmern Sie sich nicht um mich. Ich komme mir sogar viel zu groß vor.«
Wenn der Junge Miira vor Augen hatte, brannte ihm eine Frage auf der Seele, die er sich jedoch nicht zu stellen traute.
Wie ist Miira bloß in diesen Spalt geraten?
Indiras Fall hatte ihn gelehrt, dass es kein besonderes Vergnügen war, unabänderliche Dinge zu hinterfragen. Was wäre wenn? Wieso hat man dich nicht eher in den Zoo gebracht? Wie bist du in diesen Spalt geraten? In dem Moment, in dem man weiß, dass die Situation unabänderlich ist, sind solche Fragen überflüssig, denn sie führen dem Betroffenen bloß seine traurige Situation vor Augen. Deshalb zügelte der Junge seine Neugier und verkniff sich die Frage. Seine Lippen blieben versiegelt wie damals bei seiner Geburt.
Vielleicht war eine Murmel in den Spalt gerollt und sie wollte sie wiederhaben. Oder sie hatte beim Spielen ein geeignetes Versteck gesucht. Oder aber sie wollte einfach bloß herausfinden, ob man es dort in dem dunklen Spalt aushalten konnte. Anfangs hatte sie bestimmt alles Mögliche unternommen, um sich zu befreien.
Dabei war bestimmt ihr Rock verrutscht, sie hatte sich Stirn und Knie aufgeschürft, und ihre Knochen hatten geknackt. Ganz sicher hatte sie um Hilfe gerufen. Aber sosehr sie ihre Stimme auch anstrengte, kein Laut war durch die Wände nach außen gedrungen. Die Hilferufe versickerten zu ihren Füßen. Sie konnte sich kein Stück bewegen. Gelang es ihr mit größter Mühe, den Kopf zu heben, sah sie den Himmel nur als fernen, schmalen Strich. Mit eintretender Dämmerung verschwand der Himmelsstrich nach und nach, bis Miiras Körper von der Dunkelheit verschluckt wurde. Ihre Umrisse prägten sich mit der Zeit tief in die Wand. Dies geschah nur sehr langsam, aber war unumgänglich. Miira hatte verstanden, dass sie nie wieder nach Hause zurückkehren würde.
»Mach dir keine Sorgen, ich bin bei dir«, sagte der Junge zu dem Mädchen hinter seinen Augenlidern.
Und während er sein Mitgefühl in den dunklen Spalt sandte, in jenen von der Welt vergessenen Winkel, sank er allmählich in den Schlaf.
2
Indira und Miira waren die einzigen Freunde des Jungen. In der Schule war er immer allein. Von sich aus sprach er niemanden an, und falls der Lehrer ihn aufrief, murmelte er nur leise eine Antwort. Dabei lag der Flaum ruhig auf seinen Lippen. Es bereitete ihm allerdings keinen Kummer, allein zu sein, ihm war es eher unangenehm, wenn ihm seine Klassenkameraden zu nahe kamen. Eines Tages passten ihn drei von ihnen ab und zerrten ihn hinter das Schwimmbad, um ihn dort in die Mangel zu nehmen. Der vermeintliche Anführer packte seinen Unterkiefer und rief: »So, jetzt verpassen wir dir eine Rasur.«
Dabei ließ er die Klingen der Schere theatralisch in der Sonne aufblitzen.
Warum befindet sich ein wehrloses, zartes Organ wie die Lippen eines Menschen so auffällig mitten im Gesicht? Wieso schickten robustere Körperteile wie Nägel und Zähne ausgerechnet sie an die vorderste Front? Wollten sie sich hinter den Lippen verschanzen? Dem Jungen erschien das in diesem Moment unsinniger denn je.
Der Anführer schnitt ihm den Flaum weg. Als die Klingen seine Lippen berührten, schmeckten sie bitter. Die Härchen waren so fein, dass sie beim Schneiden überhaupt keinen Widerstand leisteten, woraufhin der Anführer besonders laut mit der Schere klapperte. Der Junge dachte bei sich, dass seine Kameraden bestimmt nicht so abgebrüht waren, den Anblick von Blut zu ertragen, und ließ die Prozedur klaglos über sich ergehen.
»So, jetzt fühlst du dich bestimmt frisch, was? Wenn sie nachwachsen sollten, bin ich gerne wieder behilflich«, rief der Anführer ihm zu, als er mit den anderen abzog.
Der Junge spuckte auf den Boden, wischte sich mit dem Ärmel die Lippen ab und strich mit einem Finger über die vernarbte Stelle, wohin die Haut von der Wade verpflanzt worden war. Es war eine wulstige, schlecht genähte Wunde. Aus der Ferne bedachten ihn seine Schulkameraden mit neuen Hänseleien. Aber anstatt sich zu wehren, presste der Junge die Lippen fest aufeinander, sodass sie in ihrem ursprünglichen Zustand waren. Er erinnerte sich an das Gefühl von damals, als sie noch miteinander verwachsen waren. Obwohl sein Erinnerungsvermögen eigentlich nicht so weit zurückreichte, überkam ihn ein wohliger Schauer von Vertrautheit. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass niemand mehr in der Nähe war, stand er auf und lief nach Hause.
Nur ein einziges Mal hatte er seine Großmutter gefragt, weshalb man seine Lippen voneinander getrennt habe.
»Weil du sonst keine Luft bekommen hättest.«
Ihre Antworten waren stets sehr pragmatisch.
»Aber man kann doch auch durch die Nase atmen …«
»Ja, aber wie hätte man dich sonst stillen sollen?«
»Aber wieso hat Gott mich so geschaffen, dass ich nicht an der Brust saugen kann?«
Die Großmutter ließ ihre Stickarbeit sinken und knetete auf ihrem geliebten Tuch herum, das an ihrer Schürze hing.
»Nun ja, auch der liebe Gott handelt manchmal etwas überstürzt«, sagte sie und blickte auf das Tuch.
»Vielleicht hat er sich ja an einer anderen Stelle sehr viel Mühe gegeben und es deshalb nicht rechtzeitig geschafft, noch deine Lippen zu trennen.«
»Welche andere Stelle denn?«
»Das kann man nicht immer sofort erkennen, denn es liegt allein in seiner Hand! Augen, Nase, die Stimmbänder – irgendeines dieser Organe hat er bestimmt mit einem besonderen Mechanismus ausgestattet, den andere nicht haben. Da bin ich mir sicher.«
»Aber ich habe keinen solchen Mechanismus.«
»Es ist ja auch nicht Gottes Aufgabe, dir zu zeigen, welchen Nutzen du daraus ziehen kannst. Dafür musst du schon selbst sorgen. Es ist der Mensch, der Gottes Einfälle zur Geltung bringt. Ohne ihn wäre Gott aufgeschmissen, meinst du nicht? Aber da Gott sich so beeilen musste, ist bestimmt etwas ganz Besonderes dabei herausgekommen. Vielleicht bist du handwerklich genauso begabt wie dein Großvater. Oder du wirst einmal der Beste bei einem Singwettbewerb oder der Schnellste beim Laufen sein. Weißt du, ich kann es kaum erwarten, dass du erwachsen wirst. Dann werden wir schon sehen.«
Die Großmutter nahm ihren Enkel in den Arm und strich ihm über das Haar. Der merkwürdige Geruch des Tuchs stieg ihm in die Nase. Es roch genauso wie Indiras Fußring.
Es war einem Zwischenfall zu verdanken, dass die Jungen aus seiner Klasse künftig davon abließen, ihm weitere »Rasuren« zu verpassen. Um seinen Mitschülern aus dem Weg zu gehen, verließ der Junge allmorgendlich schon früh das Haus. Auch an jenem Tag war er als Erster in der Schule und ging durch das Tor am Schwimmbad vorbei in Richtung Klassenzimmer. Plötzlich bemerkte er, dass an diesem Morgen etwas anders war als sonst, und blieb stehen. Der Sommer war vorüber und damit auch der Schwimmunterricht, aber das Wasser im Becken war noch nicht abgelassen. Auf der sonnenbeschienenen Oberfläche schwammen dürres Laub und tote Insekten. An der Stirnseite des Beckens entdeckte der Junge einen bäuchlings im Wasser treibenden Körper.
Er dachte zunächst gar nicht daran, dass es sich um einen Menschen handeln könnte, sondern meinte, jemand habe eine Schaufensterpuppe ins Schwimmbad geworfen, um ihm einen Schrecken einzujagen. Der Junge ging an den Duschkabinen vorbei und stieg auf den Startblock mit der Nummer acht, von wo aus er die Puppe genauer in Augenschein nehmen konnte.
»Verzeihen Sie bitte …«
Er schlug einen höflichen Ton an. Etwas Besseres fiel ihm nicht ein, schließlich wollte er herausfinden, was da vor seinen Augen im Wasser trieb.
»Hallo!« Er rief abermals, aber seine Stimme wurde von der Stille ringsumher verschluckt. Es kam keine Antwort. Dass es ein Mensch war und keine Puppe, begriff er in dem Moment, als er die Achselhaare des Mannes entdeckte. Sie schlingerten im Wasser, als seien sie noch lebendig.
Der Junge kniete sich hin und berührte den Rücken des Mannes. Der Körper schaukelte ganz leicht auf der Wasserfläche, blieb sonst aber reglos. Die Haut war aufgequollen und dunkel verfärbt, die Glieder des Toten grotesk verrenkt. Der Junge wurde an den Händen von einem durchdringenden Kältegefühl erfasst, das ganz anders war als die Kälte des Wassers. Das Gefühl blieb, auch lange nachdem er sich die feuchten Hände an seiner Hose trocken gerieben hatte. Er saß still im gleißenden Morgenlicht und sah den Toten an.
Als sich endlich der Hausmeister blicken ließ und der Junge ihm von seiner Entdeckung berichtete, herrschte mit einem Mal ein großer Aufruhr in der Schule. Schrille Sirenen waren zu hören, und bald fuhren ein Rettungswagen und eine Polizeistreife vor. Der Unterricht wurde abgesagt, aufgeregte Schüler stürmten durch die Korridore. Man führte den Jungen in den Pausenraum, wo ihn Lehrer und Polizeibeamte mit Fragen überhäuften. Es war unheimlich, dass die Erwachsenen so freundlich zu ihm waren.
»Der Mann wird jetzt im Krankenhaus versorgt. Das hat er allein dir zu verdanken, weil du heute Morgen so früh in die Schule gekommen bist.«
Aber trotz des überschwänglichen Lobs empfand der Junge keine Freude. Der Mann war ohne jeden Zweifel tot.
Es stellte sich heraus, dass er Busfahrer war und im Betriebsheim für Junggesellen gewohnt hatte. Er hatte sich zuvor regelmäßig auf das Schulgelände geschlichen, um allein im Schwimmbad seine Bahnen zu drehen. Unglücklicherweise hatte er in jener Nacht eine Herzattacke erlitten und war ertrunken. Deshalb hatte seine Kleidung so ordentlich zusammengefaltet neben dem achten Startblock gelegen.
Auch nachdem sich die Aufregung um den ertrunkenen Fahrer gelegt hatte, wurde der Junge von seinen Mitschülern gemieden, weil er derjenige war, der eine Leiche gefunden hatte. Man begegnete ihm mit einer Mischung aus Mitleid und Ehrfurcht, wobei keiner seiner Klassenkameraden genau wusste, wie er mit dem Fall umgehen sollte. Sie brannten zwar vor Neugier und hätten ihn gerne ausgefragt, wie ein Toter denn nun aussah, trauten sich aber vor lauter Angst nicht, ihn anzusprechen. Stattdessen sahen sie den Jungen an, als ob er selbst die Leiche wäre.
Von nun an wollte ihm niemand mehr eine Rasur verpassen. Das Wasser wurde unverzüglich abgelassen, und das Becken erhielt einen neuen Anstrich. Sogar die Duschkabinen wurden ausgetauscht. Alle wollten so schnell wie möglich die Sache mit dem toten Fahrer vergessen. Nur der Junge gedachte seiner, indem er jeden Morgen auf dem Weg zur Schule Blumen pflückte und vor dem Tor zum Schwimmbad niederlegte. Die Blumen, die so unscheinbar waren, dass niemand sie als Opfergabe für einen Toten hielt, waren bereits am nächsten Morgen zertrampelt oder vom Wind zerstreut. Doch der Junge scherte sich nicht darum. Es war seine Art, um den toten Fahrer zu trauern.
Eines Tages beschloss der Junge, auf dem Nachhauseweg beim Wohnheim der Busgesellschaft vorbeizugehen. Er spürte, dass es eine Verbindung gab zwischen dem Toten und seinen Freunden Indira und Miira. Seit dem Vorfall drehten sich seine Gespräche im Alkoven fast nur noch um den Fahrer. Der Junge beschrieb Miira das dunkle Wasser, auf dem sich nur der Mond spiegelte, die Wellen der Finsternis, in die der Mann eintauchte, und das Gefühl von Verlorenheit, allein am Ende der achten Bahn zu treiben. Einerseits bemitleidete er den Toten, der völlig entblößt sterben musste. Andererseits überlegte er, wie geheimnisvoll und aufregend es sein musste, nachts in einem menschenleeren Schwimmbad zu sein.
Das Wohnheim lag am Ende der Straße, wo sich der Betriebshof und die Geschäftsstelle befanden. Der Junge huschte zwischen den geparkten Bussen hindurch, damit ihn niemand entdeckte. Er schlüpfte durch einen Maschendrahtzaun und gelangte auf den verwilderten Hof des Wohnheims – ein zweistöckiges Betongebäude, dessen Putz an einigen Stellen bröckelte. Das Gelände war von Unkraut überwuchert. Aus der Ferne konnte man die an- und abfahrenden Busse hören, ansonsten war es totenstill. Der Junge stapfte ziellos durch das Gras.
Auf dem Boden lagen alle möglichen Dinge herum: Blumentöpfe, ein Schlauchfetzen, ein kaputter Fußball, ein verrostetes Fahrrad. Durch das Gestrüpp führte ein ausgetretener Pfad. Als er diesem Weg folgte, erblickte er plötzlich hinter einer halb verdorrten Palme einen Bus. Er hatte zweifellos die gleiche Form wie diejenigen auf dem Betriebshof und auch die gleiche Farbe, schien jedoch seinen Dienst weitgehend eingestellt zu haben und wirkte bereits wie ein fester Bestandteil des verwilderten Geländes. Die Fenster waren von Ranken überwuchert, die Reifen mit Moos bewachsen, und auf dem Dach hatte sich vertrocknetes Laub angehäuft. Auf dem Busschild stand »Betriebsfahrt«.
Die Bustür, die sich normalerweise automatisch öffnete und schloss, gab höchst widerwillig und nur mit einem ohrenbetäubenden Quietschen nach. In diesem Moment ertönte eine Stimme über dem Jungen.
»Was hast du hier zu suchen?«
Es war eine tiefe Stimme, die den Bus bis in den letzten Winkel ausfüllte. Erschrocken ließ der Junge die Schulmappe mit seinen Büchern fallen und stolperte nach hinten.
»Nicht so hastig, mein Junge!« rief der Mann.
Dies sollte er noch öfters hören. Nicht so hastig, mein Junge! Diese Worte würden sein künftiges Schicksal bestimmen und ihm zeit seines Lebens eine wertvolle Hilfe sein. Natürlich war dem Jungen, der sich in jenem Augenblick hochzurappeln versuchte, deren weitreichende Bedeutung noch nicht bewusst.
Als er sich in dem Fahrzeug umschaute, verschlug es ihm abermals die Sprache. Obwohl er eigentlich sicher war, in einen Bus gestiegen zu sein, hatte er nun den Eindruck, sich im Salon einer prachtvollen Villa zu befinden. Wie ein Bus von innen aussah, wusste er natürlich, schließlich war er oft genug zum Kaufhaus gefahren, um Indira zu besuchen. Aber hier gab es weder die vertrauten Halteriemen noch eine Kasse oder die üblichen dunkelroten Sitzbänke. Auch die Werbeplakate fehlten. Stattdessen staunte er über das seltsame Mobiliar: eine Truhe mit arabesken Schnitzereien, ein Kamin aus schwarzem Marmor, eine Lampe aus buntem Glas, Tafelsilber, die Standsäule mit der Büste einer Göttin, an der Wand hing ein Gobelin.
»Willst du mir nicht sagen, weshalb du hier bist?«
Der Mann erhob sich von der hintersten Bank, die ursprünglich für fünf Fahrgäste gedacht war. Jetzt befand sich dort ein Bett mit einem Baldachin.
»Das ist doch ein Bus, oder?« fragte der Junge, der sein eigentliches Anliegen längst vergessen hatte.
»Aber natürlich ist das hier ein Bus. Sieh nur … hier ist das Lenkrad, es gibt einen Rückspiegel und einen Halteknopf.«
Das stimmte. Als er sich umschaute, entdeckte der Junge, dass nichts Wesentliches entfernt worden war, sondern die meisten Relikte noch hier und da hervorblickten. An der Armatur vor dem Fahrersitz hingen Kochutensilien, während der Rückspiegel in der Waschecke als Toilettenspiegel diente. Der Junge griff nach dem Halteknopf, auf den er immer schon einmal drücken wollte. Auf den Busfahrten zum Kaufhaus hatte er stets seinem kleinen Bruder den Vortritt gelassen. Aber der Knopf leistete nicht den erwarteten Widerstand, und es ertönte auch nicht der übliche Signalton.
»Wohnen Sie hier? In diesem Bus?«
»Sieh an, das gefällt dir wohl, was?«
Der Junge schaute zu dem Mann hoch und nickte.
Da er unglaublich dick war, konnte man das Kinn des Mannes kaum erkennen. Sein kurz geschorenes Haar war bereits ergraut, aber seine glänzende Haut wirkte fest, und seine Stimme klang energisch.
»Auch wenn es nicht so aussehen mag, handelt es sich um eine sehr exklusive Einrichtung. Der Fußboden ist aus isländischem Pinienholz, die Balken stammen von armenischen Olivenbäumen und die gebrannten Kacheln aus Katalonien. Die Buntglaslampe kommt aus der Normandie, der Stuck aus dem Libanon, die Spitzen aus Vietnam. Man kann gar nicht alle Details aufzählen. Vom kleinsten Regalbrett bis hin zu den Griffen – alles hochwertiges Material und exzellent verarbeitet.«
Der Mann deutete mit seinem wulstigen Zeigefinger auf diverse Gegenstände und erwähnte ferne Regionen, von denen der Junge noch nie gehört hatte.
»Einen Bus umzugestalten ist viel schwieriger, als ein Haus zu bauen, wo man bei null anfängt. Man muss gewissenhaft prüfen, was man entfernen muss und was man weiterverwenden kann. Wenn man aufgrund der räumlichen Enge auf zu viel verzichtet, wird es langweilig, will man hingegen alles behalten, versinkt man im Chaos. Die Frage ist, wie kann man den eigenen Ansprüchen gerecht werden, ohne außer Acht zu lassen, dass es sich um einen Bus handelt. Entscheidend ist, wie man diesen Balanceakt meistert.«
Der Bus war unterteilt in eine Küche, die sich neben dem Fahrersitz befand, und einem Wohnzimmer, das sich über die vorderen Sitzplätze erstreckte, während die hinteren Reihen als Schlafgemach dienten.
Wenn der dicke Mann sich durch den Bus schob, hatte man nicht den Eindruck, er fühle sich beengt. Voller Stolz zeigte er dem Jungen, wo der Wassertank installiert war, wie er die Fenster dekoriert und die niedrige Decke kaschiert hatte. Der Junge nickte jedes Mal bewundernd und schaute sich alles genau an.
»Wie wäre es mit etwas Süßem, mein Freund? Nimm Platz, wo immer du magst.«
Als er mit seinen Erläuterungen fertig war, machte er auf einem tragbaren Gaskocher Wasser heiß, rührte Kakao an und holte einige Törtchen aus dem Küchenschrank. Der Junge war überzeugt, dass der Mann es gewohnt war, seine Gäste auf diese Art und Weise zu empfangen. Sie setzten sich einander gegenüber an den honiggelben, blank polierten Tisch.
»Aber wieso leben Sie in einem Bus?« wollte der Junge wissen, während er das klebrige Papier von einem Törtchen löste.
»Nun ja, ursprünglich habe auch ich in dem Junggesellenheim gewohnt, aber dort hat alles nicht so recht funktioniert und der Umgang mit meinen Kollegen war etwas problematisch. Hier in meinem Bus ist es viel bequemer, und ich bin ganz für mich allein.«
»Sind Sie auch Fahrer?«
»Früher schon. Ich hatte ein blitzendes Abzeichen auf der Mütze und blütenweiße Handschuhe, mit denen ich den Bus durch die Gegend gesteuert habe. Aber den Führerschein musste ich schon vor langer Zeit abgeben.«
»Weshalb?«