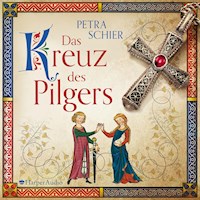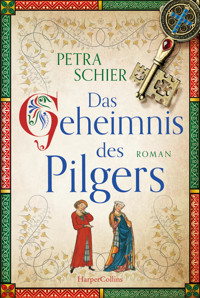
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pilger-Reihe
- Sprache: Deutsch
Adel verpflichtet - Handel errichtet
Koblenz 1379: Erst seit Kurzem trägt Conlin den Titel Graf vom Langenreth, der für ihn mehr Pflicht als Ehre bedeutet, denn nun ist es an ihm, den guten Ruf und den Wohlstand der Familie zu retten, die sein Bruder zugrunde gerichtet hat. Doch um als Händler von Sicherheiten erfolgreich zu sein, braucht er Kapital. Als ausgerechnet seine Verlobte Reinhild ihn finanziell unterstützen will und dann auch noch ihr lang gehütetes Geheimnis ans Licht kommt, droht die noch junge Liebe zu scheitern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zum Buch:
Geboren in ärmlichen Verhältnissen auf den Straßen Mailands und aufgewachsen als Ziehsohn eines angesehenen Koblenzer Kaufmanns, hat Palmiro sich als Pelz- und Geschmeidehändler inzwischen einen eigenen Namen gemacht. Es ist seine Gabe, die Gesinnung eines Menschen genau einschätzen zu können, die ihm stets das nötige Vertrauen in sich selbst und seine Mitmenschen gibt, um in der Welt voranzukommen. Er spürt, wenn Gefahr droht, und verlässt sich auf dieses Gefühl. Trotzdem lässt er sich überreden, dass er Maßnahmen ergreifen muss, um die Sicherheit seiner wertvollen Waren zu gewährleisten, und einen Wachhauptmann einzustellen. Doch dann begegnet Palmiro Benedikt vom Heidenstein, dem Mann, den sein Ziehvater für diese Aufgabe ausgewählt hat. Und zum ersten Mal in seinem Leben zweifelt er, ob er wirklich auf seine Gabe vertrauen kann.
Zur Autorin:
Seit Petra Schier 2003 ihr Fernstudium in Geschichte und Literatur abschloss, arbeitet sie als freie Autorin. Neben ihren historischen Romanen schreibt sie zauberhafte Liebesromane mit Hund. Sie lebt heute mit ihrem Mann und einem Deutschen Schäferhund in einem kleinen Ort in der Eifel.
Lieferbare Titel:
Das Kreuz des Pilgers
Nur eine Fellnase vom Glück entfernt
Plätzchen gesucht, Liebe gefunden
Dieser Roman wurde im Rahmen des Stipendienprogramms der VG Wort in NEUSTART KULTUR der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.
Originalausgabe © 2022 by HarperCollins in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg Covergestaltung von Nele Schütz Design Coverabbildung von Codex Manesse, Bernger von Horheim Wikipedia gemeinfrei; Yuliya Blonska, Lightix / Shutterstock Karte von Peter Palm, Berlin Initialen von Artyzan / Shutterstock E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck ISBN E-Book 9783749903825www.harpercollins.de
Zitate
»Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.«
Es ist kein anderes Gebot größer als dieses.
(3. MOSE 19,18 / MARKUSEVANGELIUM 12,31)
»Was ist die Liebe,
wenn sie tief im Herzen eingeschlossen bleiben muss?
Was ist sie, wenn sie nicht gezeigt,
gefühlt, geteilt und gelebt werden darf?
Sie wäre kümmerlich
und nicht der Bezeichnung Liebe wert.«
(PALMIRO IN »DAS KREUZ DES PILGERS«)
Karte
Personenverzeichnis
Hauptfiguren und ihre Familien
Palmiro Bongert, genannt Don Palmiro
Pelz-, Leder- und Geschmeidehändler aus Koblenz
Anton Bongert, genannt Don Antonio
Luzias jüngerer Bruder, Palmiros Ziehvater, Tuchhändler in Koblenz
Enneleyn Bongert
Don Antonios Gemahlin, Johann von Mantens uneheliche Tochter
Benedikt vom Heidenstein
niederer Landadliger aus der Nähe von Nürnberg stammend, ehemaliger Söldner, Spion für den Inquisitor Erasmus von London
Conlin vom Langenreth
jüngerer Sohn des verstor- benen Grafen Walther vom Langenreth, Oswalds Bruder
Adelheid vom Langenreth
Tochter von Amalia und Oswald
Amalia vom Langenreth
Oswalds Gemahlin
Christine vom Langenreth
Oswalds und Conlins Mutter
Kunigunde vom Langenreth
Tochter von Amalia und Oswald
Oswald Graf vom Langenreth
ältester Sohn von Walther vom Langenreth, Conlins Bruder
Reinhild von Winneburg-Manten
Tochter von Johann und Elisabeth von Manten, Witwe des Gottfried von Winneburg
Gräfin Elisabeth von Manten
Reinhilds Mutter
Frieder von Manten
Reinhilds Bruder
Gottfried von Winneburg
Reinhilds verstorbener Gemahl
Johann Graf von Manten
Reinhilds Vater, Bürgermeister
Johann (Hannes) von Winneburg
Reinhilds Sohn
Jutta von Manten
Johann von Mantens Stiefmutter
Mariana von Manten
Reinhilds jüngere Schwester
Notker von Manten
Graf Johanns jüngerer Bruder, Verwalter der Mantenburg
Richwin von Manten
Reinhilds ältester Bruder
Luzia Wied
Gewürzhändlerin in Koblenz, Don Antonios ältere Schwester, gute Freundin von Elisabeth von Manten, Gemahlin von Martin Wied
Martin Wied
Weinhändler in Koblenz, Bürgermeister
Gusti Wied
Tochter von Luzia und Martin
Arietta de Berge
Martin Wieds jüngste Schwester, Gemahlin von Wulfhart de Berge
Wulfhart de Berge
Gutsherr und Winzer in der Stadt Wied
Marie de Berge
Ariettas und Wulfharts Tochter
Mathys le Smithy
Handelsgeselle, ehemaliger Spion für den Inquisitor Erasmus von London
Gesinde
Anni
Reinhilds Magd, Hannes’ Kinderfrau
August
Palmiros Waffenknecht
Benno
Palmiros Waffenknecht
Eggebrecht
Palmiros Knecht
Heide
Hausmagd auf Gut Langenreth
Mats
Reinhilds Knecht, Wilberts Zwillingsbruder
Minta
Palmiros Küchenmagd
Nilda
Palmiros Haus- und Stallmagd, ehemalige Kindhure aus Aachen
Tilde
Reinhilds Köchin
Wilbert
Reinhilds Knecht, Mats’ Zwillingsbruder
Sonstige Personen
Adelina Merten
Tochter des Apothekers Albert Merten in Köln
(Vater) Anselm aus Köln
Prior des Dominikanerklosters in Köln, Exorzist
Arno Boos
ältester Sohn von Diederich Boos
Carlmann Boos
jüngerer Sohn von Diederich Boos
Carst van Thelen
Seidenhändler in Köln
Diederich Boos
Weinhändler in Koblenz
Edelfried Jager
Gemahlin von Ulf Jager
Erasmus von London
Dominikaner, Inquisitor in Rom
Pater Federicus
Gemeindepfarrer der St. Kastorkirche
Fiorina
Don Antonios erste Gemahlin, verstorben
(Pater) Fidelmus
ehemaliger Beichtvater auf Gut Langenreth, verstorben
Friedel Abel
Gemahlin von Siegmund Abel
(Bruder) Genericus
Mönch (und Priester) im Dominikanerkloster in Köln, Vetter von Oswald und Conlin
(Bruder) Georg
ehemaliger Beichtvater von Elisabeth von Manten, verstorben
Gylo
Schöffe in Koblenz
Hilger Quattermart von der Stesse
Ratsherr in Köln (historisch belegt)
Klais Brauer
Gastwirt in der Braugasse in Koblenz
Bruder Martinus
Dominikaner in Köln
Mede
Reynettes Tochter
Nikolaus Tunner
Goldschmied in Koblenz
Reynette Bonenfant
jüdische Geldverleiherin in Koblenz (historisch belegt)
Siegmund Abel
Amtmann in Kleve
Simone Borsano
italienischer Kardinal in Rom (historisch belegt)
(Bruder) Thomasius
Dominikaner in Köln
Trutwyn Tunner
Gemahlin von Nikolaus Tunner
Ulf Jager
Pelzgroßhändler aus Kleve
Walter Nyvelonck
Zunftmeister der Kaufleute, Holzhändler
1. Kapitel
28. Juli, Anno Domini1379
r war verflucht. Ganz eindeutig. Conlin vom Langenreth starrte in einer Mischung aus Missmut und Verzweiflung auf das hohe, zweiflüglige Tor, hinter dem sich das Kloster der Kölner Dominikaner befand. Dabei wurde er das eigentümliche Gefühl nicht los, dass er im Begriff war, sich weitere, unabsehbare Komplikationen aufzuhalsen. So als würden seine bereits vorhandenen Probleme nicht ausreichen, um sein Leben vollständig auf den Kopf zu stellen und in einen nicht enden wollenden Spießrutenlauf zu verwandeln.
Die unbarmherzige Sommersonne stach auf ihn herab und ließ ihm den Schweiß vom Nacken in den Kragen seines Hemdes rinnen. Dabei hatte er es erst vor weniger als einer Stunde auf Anraten seines zukünftigen Schwiegervaters gegen dasjenige getauscht, in dem er den bisherigen Tag verbracht hatte. So als wäre er noch ein kleiner Junge, dessen Mutter oder Kinderfrau dafür sorgen musste, dass er ordentlich und standesgemäß gekleidet war.
Auch das verfluchte Wams hatte er getauscht und trotz der unmenschlichen Hitze vollständig geschlossen. Sein blondes Haar hatte er der Züchtigung durch einen Kamm ausgesetzt und im Nacken mit einem Lederriemen zu einem ordentlichen Zopf zusammengefasst. Alles nur, um den größtmöglichen Anschein von Ehrbarkeit und Autorität aus seiner Erscheinung herauszuholen und die Tatsache zu verschleiern, dass er verzweifelt war – und vollkommen verwirrt.
»Was ist? Willst du dich nicht allmählich bemerkbar machen?« Die ungehaltene Stimme seines Schwiegervaters in spe, des Grafen Johann von Manten, riss ihn aus den selbstmitleidigen Gedanken. »Wenn wir hier noch lange untätig verharren, wirst du dich wegen deiner Unpünktlichkeit noch unbeliebter machen, als du mit großer Wahrscheinlichkeit sowieso schon bist.«
»Dieser Dominikaner ist mir nicht geheuer.« Nur mit Mühe widerstand Conlin dem Drang, sich mit den Fingern durchs Haar zu fahren und es damit wieder in Unordnung zu bringen. »Er will nicht nur Geld, das ich nicht besitze, sondern ist ganz sicher auch noch auf etwas anderes aus, das mir und meiner Familie Ungemach verspricht. Weshalb sonst hat er mir vorgeschlagen, unseren Vetter, Bruder Genericus, in unser Haus aufzunehmen?«
Johann, ähnlich hochgewachsen und breitschultrig wie Conlin und sogar mit identischer Haartracht, sah man einmal davon ab, dass die seine bereits vollständig ergraut war, blieb vollkommen ungerührt. »Sich einen Beichtvater ins Haus zu holen, der für die Seelsorge der Familienmitglieder zuständig ist, hat beim Adel eine lange Tradition.«
»Das ist mir bewusst.« Immer noch starrte Conlin das schwere dunkle Eichentor an. »Doch ausgerechnet den Mann soll ich mit nach Hause nehmen, der im Moment schwer verletzt in der Infirmerie darniederliegt, weil mein Bruder ihn in einem Anflug geistiger Umnachtung verprügelt hat. Haltet Ihr das für sinnvoll?«
Nachdenklich rieb Johann sich übers Kinn. »Das«, gab er schließlich zu, »ist in der Tat ungewöhnlich. Allerdings wirst du die Beweggründe dieses Dominikaner-Priors nicht in Erfahrung bringen, wenn du dich nicht endlich bemerkbar machst, damit man uns einlässt.«
»Bruder Thomasius ist nicht der Prior. Er vertritt ihn nur, weil Bruder Anselm nicht in Köln weilt, sondern sich auf einer Wallfahrt nach Trier befindet.«
»Was ziemlich wahrscheinlich unser Glück ist.« Johann bedachte ihn mit einem vielsagenden Blick. »So wie ich es verstanden habe, ist doch dieser Anselm jener Exorzist, dessentwegen dein Bruder nach Köln gekommen ist. Nicht auszudenken, in welcher Misere wir jetzt stecken würden, wenn Oswald mit seinem Ansinnen erfolgreich gewesen wäre.«
Dem konnte Conlin schwerlich widersprechen. Der Gedanke, dass sich sein älterer Bruder in die Fänge eines Exorzisten zu begeben getrachtet hatte, drehte ihm auch jetzt noch die Eingeweide um. Etwas anderes an Johanns Worten ließ ihn jedoch aufmerken. »Wir?«, hakte er nach.
Ein weiterer vielsagender, wenn auch alles andere als freundlicher Blick traf ihn. »Glaub mir, ich bin nicht sonderlich erpicht darauf, mir die Probleme deiner Familie aufzuhalsen.« Ein abgrundtiefes Seufzen folgte. »Aber so, wie die Dinge nun mal liegen, muss ich mich wohl oder übel damit abfinden, dass deine Familie in absehbarer Zeit auch die meine sein wird – und meine Tochter deine Frau. Ich möchte sie nicht unglücklich und in Bedrängnis sehen. Also bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als dem Mann, dem sie so unbedacht ihr Eheversprechen gegeben hat, unter die Arme zu greifen.« Er hüstelte. »Nimm diese Hilfe gefälligst an. Du bist weder in der Position noch in der Verfassung, dich hinter deinem Stolz zu verstecken, Junge. Also klopf endlich an dieses verdammichte Tor. Oder soll ich dir das etwa auch noch abnehmen?«
***
Mit pochendem Herzen stand Reinhild von Winneburg-Manten vor dem Eingang zu dem beeindruckenden dreigeschossigen Haus in der Judengasse, in dem die weithin bekannte und geachtete Geldverleiherin Reynette Bonenfant mit ihrem Gemahl Moses und ihren Kindern wohnte. Die unangenehme Hitze, die Koblenz seit Tagen im Griff hatte, machte ihr den Besuch, den sie sich vorgenommen hatte, nicht eben angenehmer. Der Schweiß rann ihr unter der bestickten Leinenhaube über den Nacken und die Wirbelsäule hinunter.
Heiß war ihr allerdings auch ohne Zutun des Sommerwetters bereits über Gebühr, denn das, was sie sich für den heutigen Tag vorgenommen hatte, war nicht ganz ungefährlich. Wenn ihr Plan wohl auch keine prekären Auswirkungen auf ihre körperliche Unversehrtheit mit sich bringen würde, so stand ihr doch unmissverständlich vor Augen, dass sie im Begriff war, ihren zukünftigen Gemahl zu hintergehen – oder vielmehr sich gegen seine ausdrückliche Anordnung zu stellen. Damit würde sie das bisschen Wohlwollen, das er im Augenblick für sie aufbrachte, aufs Spiel setzen. Doch so manche ausweglos anmutende Situation verlangte nun einmal nach dem beherzten Handeln der Betroffenen. Vielmehr in diesem Fall dem Handeln der Verlobten des in der Misere befindlichen Edelmannes.
Vielleicht hätte sie warten sollen, bis ihr Vater und Conlin aus Köln zurück waren, vielleicht sich an ihre Mutter wenden und sich mit ihr beraten sollen. Doch die Zeit drängte, und sie war sich ganz sicher, dass ihr Plan aufgehen würde. Sie vertraute Conlin und ganz besonders seinen Fähigkeiten als zukünftiger Händler für Sicherheiten. Vermutlich war ihr Vertrauen in ihn sogar deutlich größer als sein eigenes.
Ihre Position, bei der Geldverleiherin um einen kurzfristigen Kredit anzufragen, war hingegen eindeutig besser als Conlins, denn die Schulden, die sein Bruder Oswald in den letzten Jahren angehäuft hatte, drohten die angesehene Grafenfamilie vom Langenreth an den Bettelstab zu bringen. Kein Geldverleiher der Welt, der noch bei Verstand war, würde Conlin ohne einen vorhandenen Gegenwert auch nur einen Heller anvertrauen. Und falls doch, stünde zu befürchten, dass die Zinsen nur durch die Aufgabe der noch vorhandenen Güter der Grafenfamilie aufzubringen sein würden. Unlautere Kreditgeber mochten sich solcher Praktiken bedienen, doch zumindest stand Reynette Bonenfant nicht in dem Ruf, ihre Geschäfte unehrenhaft zu führen.
Reinhild war sich bewusst, dass auch ihr Vater Conlin unter die Arme greifen würde, falls er ihm nicht doch in Köln bereits den Garaus gemacht hatte, aber Conlin würde es hassen, von seinem Schwiegervater abhängig zu sein. Sinnvoller, wenn auch ihrem Seelenfrieden wenig zuträglich, war es deshalb, wenn sie ihre Mitgift sowie das Haus, in dem sie mit ihrem Sohn lebte und das dieser von seinem Vater, ihrem geliebten Gemahl Gottfried, geerbt hatte, in die Waagschale legen und Reynette als Sicherheit anbieten würde.
Wenn Reynette auf ihren Vorschlag einging, würde Conlins Zorn sich ausschließlich auf Reinhild richten, seine Abhängigkeit sich mittelfristig auf seine zukünftige Gemahlin reduzieren, nicht auf ihre Familie. Sie konnte nur hoffen, dass er ihr das eigenmächtige Handeln irgendwann verzieh, wenn er sich erst einmal in seinem Gewerbe etabliert und den Kredit mit Zins und Zinseszins zurückgezahlt hatte. Denn dass er dazu in der Lage sein würde, vielleicht sogar viel schneller, als er glaubte, dessen war sie sich vollkommen sicher. Sie kannte ihn, und auch wenn sie sich lange Zeit hatte einreden lassen, dass er ein ehrloser Tunichtgut und Tagedieb war, hatte ihr Gefühl dem stets widersprochen.
Conlin war ein guter Mann. Ein Ehrenmann. Andernfalls wäre ihr guter Freund Palmiro nicht so eng mit ihm befreundet und hätte sie wohl auch niemals dazu gedrängt, Conlin die Ehe anzutragen. Denn, lieber guter Gott im Himmel, genau das hatte sie getan. Im Nachhinein wusste sie nicht einmal mehr, wie sie den Mut aufgebracht hatte, den Stier bei den Hörnern zu packen und dabei gleich eine Wagenladung ihrer eigenen Ängste und Sorgen über Bord zu werfen. Dass jene Wagenladung sie jedoch, einem Anker gleich, weiterhin an sie gekettet verfolgen würde, versuchte sie zu verdrängen.
Entschlossen reckte sie das Kinn vor, straffte ihre gesamte Haltung und trat auf die mit kunstvollen Schnitzarbeiten verzierte Eichentür zu. Doch noch bevor sie die Hand heben konnte, um den schmiedeeisernen Klopfer zu betätigen, schwang die Tür auf und die Hausherrin höchstpersönlich stand ihr gegenüber.
»Guten Tag, Frau Reinhild.« Weder aus Reynettes Stimme noch aus ihrer Miene ging sonderliche Überraschung über den Besuch hervor. »So tretet doch bitte ein. Im Haus ist es deutlich kühler. Ihr müsst Euch doch in dieser stechenden Sonne unwohl fühlen.«
Reinhild schluckte tapfer gegen den Schrecken an, den der plötzliche Anblick der Hausherrin ihr verursacht hatte, und setzte ein, wie sie hoffte, freundliches Lächeln auf. »Guten Tag, Frau Reynette. Ihr habt recht, das Wetter ist nicht dazu angetan, das Wohlbefinden zu fördern.«
»Dann kommt nur.« Reynette trat einen Schritt zur Seite, um den Eingang freizugeben. »Kommt herein und erzählt mir, was mir die Ehre Eures Besuchs verschafft.«
Der Raum, der sich hinter der Eingangstür befand, war wie eine Mischung aus Kontor und Wohnstube eingerichtet und offenbar das Herz des Hauses. Im hinteren Bereich stand ein schweres, über und über mit Wald- und Tierschnitzereien verziertes Schreibpult, das auf beiden Seiten von silberbeschlagenen Truhen flankiert wurde. Es stand nicht an der Wand, sondern so, dass Reynette dahinter Platz nehmen und somit den Raum und die Tür im Auge behalten konnte. Die Wand hinter dem Pult war mit einem riesigen, wertvollen Wandteppich geschmückt, auf dem gar wundersame Szenen mit Menschen und Tieren dargestellt waren. Da spielten vollkommen nackte Frauen und Kinder mit Schlangen, Bären und anderen wilden Tieren, während ebenso nackte Männer auf Bäume kletterten, miteinander rangen, auf ausgebreiteten Decken saßen und Schach spielten oder mit Frauen …
Reinhild errötete, als sie begriff, was dieser Wandschmuck alles enthüllte.
Reynette lächelte sichtlich amüsiert. »Eine hübsche Interpretation des Garten Eden, nicht wahr? Mein verstorbener erster Gemahl, der gute Leo, hat diesen Wandteppich einst von einem Händler aus Konstantinopel gekauft.«
Reinhild wandte den Blick von dem unzüchtigen Tun auf dem Teppich ab, konnte aber nicht umhin, sich zu fragen, ob die dargestellten Ringkämpfe, die von den Männern ausgetragen wurden, wirklich nur Ringkämpfe waren oder nicht doch bei näherem Hinsehen etwas gänzlich anderes. »Ein sehr … beeindruckender Wandteppich«, lobte sie mit etwas Verspätung. »Sehr fantasievoll gestaltet.«
»Es freut mich, dass Ihr es wie ich seht.« Reynette deutete auf einen weiteren Tisch rechter Hand, um den acht hochlehnige, gepolsterte Stühle verteilt standen. »Setzt Euch doch. Ich lasse die Magd etwas Kühles zu trinken und einen kleinen Imbiss bringen.« Schon eilte sie zu einer geschickt hinter einem eigens dafür angefertigten Ausschnitt des Wandteppichs verborgenen Tür und öffnete sie. »Ruth, bring Gebäck und kühlen Wein und Kirschsaft. Wir haben einen Gast.«
Lächelnd trat sie ebenfalls an den Tisch und ließ sich Reinhild gegenüber nieder. Dabei raschelte der üppige blaue Seidenstoff, aus dem ihr Surcot ebenso wie das weiße Unterkleid bestanden. Beides war von ausgesuchter Qualität und dennoch überaus schlicht gehalten, ebenso wie die einfach geschnittene blaue Seidenhaube. Auch Schmuck trug die reiche Jüdin nicht zur Schau, sah man einmal von dem großen Siegelring ab, der ihren rechten Ringfinger zierte.
Es war nicht ihr eigener, wie Reinhild wusste, einer Jüdin war es nicht erlaubt, ihr eigenes Siegel zu führen. Deshalb verwendete sie dasjenige ihres Gemahls Moses. Er war Rabbiner, betätigte sich jedoch auch offiziell als Geldverleiher. Gerüchte besagten allerdings, dass er die großen und wichtigen Geschäfte seiner Gemahlin überließ. Sie war diejenige mit den einflussreichen Verbindungen und dem ausgeprägten Geschäftssinn. Nicht umsonst wurde Moses sogar in aller Öffentlichkeit als Mann der Reynette bezeichnet. Da er sich gegen diese Despektierlichkeit nicht zur Wehr setzte, schien er sehr genau zu wissen, wer das Zepter in der Familie sowie im Kontor führte, und damit zufrieden zu sein. Zum Nachteil gereichte ihm dies ganz offensichtlich nicht. Gemessen an der erlesenen Einrichtung des Hauses war die Bezeichnung reich für die Vermögensverhältnisse der Bonenfants beinahe noch untertrieben, auch wenn sie jenen Reichtum nicht in ausuferndem Prunk zur Schau stellten.
Tatsächlich standen nicht nur viele Händler, Kaufherren und Ratsmitglieder aus Koblenz bei Reynette in der Kreide, sondern auch Grafen, Herzöge und sogar ganze Städte im gesamten Rheinland. Selbst Fürsten und der Erzbischof höchstpersönlich liehen sich Geld bei der Jüdin, die nun mit einem feinen Lächeln ihre Hände auf der Tischplatte faltete. »Ihr braucht Euch nicht in Verlegenheit zu ergehen, Frau Reinhild, weil Ihr an meine Tür geklopft habt. Zwar sind wir uns schon das eine oder andere Mal bei offiziellen Anlässen begegnet, doch ich nehme nicht an, dass Euer Besuch rein freundschaftlicher Natur ist. Dazu haben wir noch nie genügend Worte miteinander gewechselt.« Sie hielt inne, als eine junge, dralle Magd ein Tablett mit silbernen Schüsseln, Krügen und Trinkbechern hereintrug und auf dem Tisch abstellte. Genauso still und flink, wie sie gekommen war, verschwand die Magd auch schon wieder.
Reynette schob Reinhild einen der Becher zu. »Möchtet Ihr lieber einen leichten Wein oder den süßen Kirschsaft probieren, den ich auf meinen eigenen Gütern vor den Stadttoren herstellen lasse? Saft? Eine gute Wahl, in der Tat.« Sie goss sowohl Reinhild als auch sich selbst von der tiefroten Flüssigkeit ein. »Nehmt auch von den Wecken. Sie sind ebenfalls mit einem Kompott aus Kirschen und Johannisbeeren gefüllt. Der helle Überzug besteht aus Zucker, Zimt und Muskatnuss. Höchst schmackhaft.«
»Danke.« Pflichtschuldig nahm Reinhild sich einen der kleinen Wecken, obwohl sie nicht wusste, wie sie ihn hinunterbekommen sollte. Jetzt, da sie der weit bekannten Geldverleiherin gegenübersaß, fühlte sie sich gar nicht mehr so sicher und selbstbewusst. Zweifel stiegen in ihr auf, ob sie das Richtige tat und ob Reynette überhaupt in Erwägung ziehen würde, ihr zu helfen.
»Ach, verzeiht, Frau Reinhild!« Unvermittelt streckte Reynette ihre Hand aus und berührte sie am Handgelenk. »Ich habe Euch noch gar nicht mein tief empfundenes Beileid zum Verlust Eures wohledlen Gemahls ausgesprochen. Von diesem scheußlichen Überfall in der Fremde habe ich selbstverständlich gehört. Entsetzlich, entsetzlich.« Zwar drückte ihre Miene Mitgefühl aus, doch ihr Blick blieb davon unberührt und wirkte seltsam stoisch. »Ich hoffe, Ihr habt Euch von diesen Schrecken bereits ein wenig erholt. Um Eures Sohnes willen müsst Ihr natürlich stark sein und weise Entscheidungen treffen. Mir ging es nicht anders, als mein guter Leo verstarb!« Kurz umwölkte ihr Blick sich, doch es wirkte nicht so, als trauere sie noch um ihren ersten Mann. »Die Entscheidungen, die man im Sinne der Familie und insbesondere der Kinder zu treffen geradezu verpflichtet ist, wiegen oft schwer, aber eine kluge Frau lässt sich davon nicht aufhalten, nicht wahr? Auch wenn es hin und wieder zu Verdruss führen mag.«
Reinhild nickte nur vage, äußerte sich jedoch nicht dazu. Sie wusste um die Tatsache, dass Reynettes älteste Tochter Mede sich nach dem Tod des Vaters strikt geweigert hatte, den wesentlich älteren Mann zu ehelichen, den Reynette für sie ausgesucht hatte. Stattdessen hatte Mede sich nach Köln abgesetzt, wo sie wohl nach wie vor lebte. Solche Dinge sprachen sich in einer überschaubaren Stadt wie Koblenz nicht nur herum, sondern blieben auch über lange Zeit im Gedächtnis der Menschen. Mede mochte nur wenige Jahre älter als Reinhild sein, deshalb konnte diese nur zu gut nachfühlen, dass die Aussicht auf eine Ehe mit einem Mann, der ihr Großvater hätte sein können, die junge Frau einst in die Flucht geschlagen hatte.
Dass Reynette hinsichtlich der Verheiratung ihrer Kinder wenig Skrupel zu besitzen schien, war im Hinblick auf ihre wirtschaftliche Machtstellung zwar nachvollziehbar, machte sie in Reinhilds Augen jedoch nicht unbedingt sympathisch. Vielleicht lag es daran, dass Reinhilds Eltern deutlich mehr Feingefühl für die Befindlichkeiten ihrer Kinder an den Tag legten, dass Reinhild im Geiste schon immer Medes Partei ergriffen hatte. Sich dies ausgerechnet jetzt anmerken zu lassen, war aber vermutlich nicht zielführend.
Ehe ihr einfiel, wie sie das Thema taktvoll wechseln könnte, schien Reynette sie bereits sehr gut eingeschätzt zu haben. Ihre nächsten Worte ließen jedenfalls auf eine ausgezeichnete Menschenkenntnis schließen. »Ihr seid verzagt, Frau Reinhild, das sehe ich Euch an. Der Verlust des Gemahls kann schmerzlich sein, insbesondere wenn die Ehe nicht rein aus strategischen Gründen geschlossen wurde, sondern, wie in Eurem Fall, echte Zuneigung zugrunde lag. Ein solcher Glücksfall ist ja nicht allen Menschen beschieden, nicht wahr, und wenngleich die Zuneigung in vielen Fällen, wenn nicht den meisten, mit der Zeit zu wachsen pflegt, kann man doch nicht ohne Weiteres erwarten, ein solches Glück gleich mehrfach für sich beanspruchen zu dürfen … oder überhaupt. Geld und Politik stehen nun einmal stets weit über den Bedürfnissen des Herzens. Aber ich versichere Euch, dass eine Frau wie Ihr, die Verstand besitzt, stets kluge Entscheidungen zu treffen in der Lage ist. Insbesondere wenn es darum geht, Eure Zukunft zu planen und sich einen neuen Manne zu wählen.« Ihre graubraunen Augen waren interessiert auf sie gerichtet. Ihr Blick war beinahe lauernd. »Sagt, was plant Ihr für Eure Zukunft und die Eures Sohnes? Dass Ihr Euch in dieser Hinsicht nicht dem Rat und der Führung Eures Vaters anvertraut, scheint mir offensichtlich zu sein, denn andernfalls wärt Ihr wohl heute nicht hier. Ihr habt Euch schon einmal das Recht ausbedungen, den Gemahl selbst zu wählen. Also nehme ich an, Ihr seid auch jetzt darauf bedacht, Euer Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Ihr helft seit Wochen in Don Palmiros Kontor aus und führt ihm die Bücher.« Auf Reinhilds überraschten Blick hin lächelte Reynette wieder kühl. »Selbstverständlich ist mir dies bereits zu Ohren gekommen. In Koblenz bleibt nichts lange ein Geheimnis.« Beiläufig nahm nun auch Reynette einen der winzigen Wecken, biss hinein und kaute mit sichtlichem Genuss. Erst nachdem sie den Bissen hinuntergeschluckt hatte, sprach sie weiter. »Habt Ihr nun also den Entschluss gefasst, Euch an Stelle Eures verstorbenen Gemahls im Handel zu versuchen, und möchtet mich um finanzielle Unterstützung ersuchen, weil Eure Eltern mit einem solchen Unterfangen sehr wahrscheinlich nicht einverstanden sein und seine Förderung entsprechend verweigern werden, oder«, sie legte eine bedeutungsvolle Pause ein, »hat die Tatsache, dass man Euch in letzter Zeit des Öfteren in Gesellschaft des edlen Conlin vom Langenreth gesehen hat, vielmehr mit Eurem heutigen Besuch in meinem Haus zu tun?«
Reinhild spürte, wie sich ihre Wangen erwärmten. Der Jüdin schien tatsächlich kaum etwas zu entgehen, deshalb war es wohl müßig, um den heißen Brei herumzureden. Auch wenn erneut Zweifel an ihr zu nagen begannen, ergriff Reinhild endlich das Wort. »Ihr seid eine scharfsichtige Frau, und ich danke Euch, dass Ihr mir so unangemeldet Gehör schenkt. Tatsächlich bin ich hergekommen, um Euch um einen Kredit zu bitten. Keinen besonders hohen, gemessen an den Beträgen, mit denen Ihr sonst zu tun habt, und auch nicht, um mich selbst im Handel zu betätigen. Ich bin nicht so vermessen zu glauben, das Führen von Rechnungsbüchern für meinen Neffen, Don Palmiro, befähige mich dazu, ein eigenes Kontor zu eröffnen oder auch nur in dem seinen einen maßgeblichen Einfluss auszuüben.«
»Stimmt ja, stimmt, Ihr seid die Tante des jungen Handelsherrn.« Die Erheiterung stand Reynette ins Gesicht geschrieben. »Dabei ist er wie viel älter als Ihr? Fünf, sechs Jahre? Nun ja, die verwandtschaftlichen Bande sind manchmal höchst verworren, nicht wahr? Insbesondere, wenn sich der alteingesessene Adel mit dem Bürger- und Kaufmannstum vermischt. Übrigens etwas, das ich für eine kluge und auf lange Sicht sinnvolle Entwicklung halte.« Sie legte den Kopf ein wenig schräg. »So tragt Ihr Euch also mit dem Gedanken, Euch alsbald neu zu vermählen, und da der Gedanke allein noch nicht rechtfertigt, Euch bei mir einzufinden, nehme ich an, es ist bereits eine Verlobung erfolgt oder doch zumindest eine bindende Absprache mit dem betreffenden Manne und seiner Familie.« Als Reinhild zur Bestätigung den Kopf neigte, seufzte Reynette überraschend. »Conlin vom Langenreth also. Frau Reinhild, mit Verlaub, ein wenig mehr Verstand hätte ich Euch allenthalben zugetraut.«
2. Kapitel
rinnerungen an lange zurückliegende Tage stiegen in Conlin auf, als er von dem ältlichen Bruder Martinus durch das Kloster zur Schreibstube des Priors geführt wurde. Erinnerungen an die Zeit, die er auf seines Vaters Geheiß in einem Konvent der Augustiner verbracht hatte, um sich auf ein Leben als Mönch vorzubereiten. Beklemmende Erinnerungen an all jene Gelegenheiten, zu denen er wegen aufmüpfigen oder ungebührlichen Verhaltens zum dortigen Prior oder gar zum Abt gerufen worden war, um sich dem Strafgericht zu stellen.
Dass er heute von seinem zukünftigen Schwiegervater begleitet wurde, machte die Sache nicht unbedingt angenehmer. Es fiel Conlin schwer, Hilfe von Graf Johann anzunehmen, bedeutete es doch, die Schmach, die seine Familie getroffen hatte, ausgerechnet mit dem Mann teilen zu müssen, der sowieso schon die schlechteste Meinung über ihn vertrat.
»Wartet hier bitte einen kurzen Moment.« Bruder Martinus hatte vor der Tür zur Kammer des Priors Halt gemacht: Er kratzte leise an dem dunklen Eichenholz und trat auf die Aufforderung durch Bruder Thomasius rasch ein.
Conlin rieb sich unbehaglich über den Nacken, dann übers Kinn. Zumindest war es hier im Haus deutlich kühler als draußen. Dennoch trieb ihm der Gedanke an das bevorstehende Gespräch erneut den Schweiß auf die Stirn.
»Man kommt sich ein wenig vor wie in Erwartung einer Maßregelung durch den Schulmeister«, brummelte Johann zu Conlins Überraschung. »Was treiben die denn da drinnen so lange?«
Zu einer Antwort kam Conlin nicht, denn just in diesem Augenblick öffnete sich die Tür wieder und ein anderer Dominikaner, deutlich jünger als Martinus und von gedrungener Gestalt, verließ die Kammer. Am Arm trug er einen Korb, der offenbar Salben und Verbandszeug enthielt. »Seid gegrüßt, ihr hohen Herren«, murmelte er. »Und verzeiht, dass Ihr warten musstet. Bruder Thomasius musste ärztlich versorgt werden.«
»Ist er etwa krank?« Argwöhnisch versuchte Johann, einen Blick in die Kammer zu werfen.
»Verletzt wohl eher.« Der Dominikaner hob die Schultern, so als wisse er es selbst nicht so genau. »Keine Angst, es ist nicht ansteckend. Zumindest nehmen wir das zu diesem Zeitpunkt nicht an. Geht nur zu ihm hinein, Bruder Thomasius erwartet Euch bereits.« Damit eilte er davon.
Conlin wechselte einen unangenehm berührten Blick mit Johann, richtete sich dann jedoch entschlossen auf und betrat die Schreibstube.
»Ah, da seid Ihr ja, Herr Conlin, und Verstärkung habt Ihr auch gleich mitgebracht?« Die leicht ölige, hochfahrende Stimme von Bruder Thomasius klang amüsiert. »Gut jetzt, Martinus, ich komme schon zurecht.« Die letzten Worte hatte er ungehalten an den ältlichen Pförtner gerichtet, der gerade dabei war, Thomasius ein Kissen unter die rechte Hand zu schieben, die dick verbunden auf dem Pult ruhte, hinter dem der Stellvertreter des Priors saß. »Geh wieder zurück an deine Arbeit. Durch Verhätscheln wird meine Hand auch nicht schneller heilen.«
»Gewiss, Bruder Thomasius, gewiss.« Martinus zog sich eilfertig zurück und schloss leise die Tür hinter sich.
»Seid gegrüßt, Bruder Thomasius.« Conlins Stimme klang ein wenig kratzig. Er sehnte sich nach einem kühlen Trunk! »Dies ist Graf Johann von Manten, mein …« Nun versagte ihm die Stimme fast. »Er ist der Vater meiner zukünftigen Gemahlin. Ich traf ihn vorhin zufällig«, er räusperte sich unterdrückt, »als ich vom Frankenturm zurückkehrte, und …«
»In Anbetracht der Umstände habe ich darauf bestanden, meinen zukünftigen Schwiegersohn hierher zu begleiten«, beendete Johann den Satz mit einem ehernen Blick, der sich jedwede weitere Fragen oder Erklärungen verbat.
Thomasius nickte zufrieden. »Schön. Nun nehmt denn Platz, damit wir zum Grund Eures Hierseins kommen können.« Er gestikulierte mit der verbundenen Hand in Richtung der beiden einfachen Besucherhocker, die vor dem Pult aufgestellt worden waren. Dabei verzog er jedoch schmerzlich das Gesicht und bettete die Hand sogleich wieder sehr vorsichtig auf das Kissen. »Verzeiht meine angeschlagene Verfassung. Als ich mich heute Mittag auf den Rückweg vom Frankenturm begab, begann meine Hand seltsam zu schmerzen und zu brennen, und ein eigentümlicher Ausschlag hat sich gebildet, der inzwischen wie eine Brandwunde anmutet. Höchst ärgerlich, denn unser Bruder Infirmarius hat dergleichen noch nicht gesehen.«
»Ein Ausschlag, sagt Ihr?« Johann runzelte die Stirn. »Er schmerzt und sieht aus wie eine Brandwunde, doch einem Feuer seid Ihr nicht zu nahe gekommen?«
»Ganz genau so«, bestätigte der Dominikaner. »Habt Ihr vielleicht schon einmal so etwas gesehen?« Er löste eine Stelle an dem Verband, bis ein Teil der Haut sichtbar wurde. Gerötetes Fleisch, auf dem sich Beulen und Blasen gebildet hatten, die der Infirmarius, der Arzt des Klosters, mit einer grau-weißlichen Salbe behandelt hatte.
Johann stieß hörbar die Luft aus. »Nein, dergleichen ist mir noch nicht unter die Augen gekommen.«
Conlin starrte entsetzt auf die verunstaltete Hand. Gleichzeitig spürte er, wie das silberne Kruzifix an seiner Brust sich erhitzte und zu vibrieren begann. Nur mit Mühe hielt er sich davon ab, das Schmuckstück zu berühren, um den Dominikaner nicht darauf aufmerksam zu machen. Bei dem Kruzifix handelte es sich um eine machtvolle Reliquie aus dem Heiligen Land, dem Gralsschatz gar, wenn die Legenden stimmten.
Das Kreuz des Zachäus konnte Gut und Böse unterscheiden, zumindest hatte Conlins Freund Palmiro dies behauptet, als er es ihm vor seiner Abreise aus Koblenz aufgedrängt hatte. Seither hatte es sich tatsächlich schon einige Male höchst merkwürdig verhalten, gesummt, sich erwärmt und ihm damit eine Heidenangst eingejagt. Nicht zuletzt hatte es ihn wohl davor bewahrt, dass Graf Johann ihm den Garaus gemacht hatte. Als dieser das Kruzifix entdeckt hatte, war er zornig geworden, hatte Conlin jedoch zu seiner höchsten Verblüffung in seiner Familie willkommen geheißen, wenn auch sichtlich widerwillig. Das Kruzifix war seit Jahrhunderten Teil von Graf Johanns Familienbesitz und -geschichte, demnach wusste dieser nur zu gut über die Kräfte der Reliquie Bescheid. Angeblich, so hatte er ähnlich seinem Enkel Palmiro dem verdutzten Conlin erklärt, könnten ausschließlich Menschen mit reinem Herzen und unbefleckter Ehre das Kruzifix unbeschadet tragen. Jeden anderen Menschen zerstöre es.
Conlin wurde es heiß und kalt zugleich, als er sich daran erinnerte, wie Bruder Thomasius früher am Tage im Frankenturm, in den die Stadtbüttel Oswald gesperrt hatten, das Kruzifix an der Kette um Conlins Hals erblickt und neugierig in die Hand genommen hatte. Nur kurz, doch es war seine rechte Hand gewesen. Die, die nun verwundet in einem Verband steckte.
Jetzt glühte das Kreuz an Conlins Brust geradezu, vibrierte beinahe zornig. Glücklicherweise war es diesmal unter Conlins Wams vor den aufmerksamen Blicken des Dominikaners verborgen.
»Seid Ihr sicher, dass Ihr nicht etwas berührt habt, das dieses Übel ausgelöst hat?« Johann hatte sich ein wenig vorgebeugt, um die verunstaltete Hand näher in Augenschein zu nehmen. »Eine Pflanze oder Ähnliches. Hin und wieder können auch Stiche von Wespen oder anderem Stechgetier solcherlei Zustände hervorrufen.«
Bruder Thomasius nickte, schüttelte aber gleich darauf wieder den Kopf. »Das mag sein, doch habe ich ganz gewiss nichts berührt, seit ich den Gefängnisturm verlassen habe, und an den Stich einer Wespe müsste ich mich wohl erinnern, meint Ihr nicht? Nein, es muss eine andere Ursache zugrunde liegen. Vielleicht eine Prüfung durch den Allmächtigen, wer weiß das schon?«
Conlin wollte etwas sagen, schwieg jedoch, als er bemerkte, dass Johann ihm einen eindringlichen Blick zuwarf. Also besann er sich auf den Grund, dessentwegen sie hier waren. »Was meinen Vetter, Bruder Genericus, angeht …«
»O ja, natürlich, Herr Conlin.« Mit einem nun wieder heiteren, leutseligen Lächeln nickte der Dominikaner ihm zu. »Wie ich Euch vorhin bereits erklärt habe, deucht mich der Geisteszustand Eures wohledlen Bruders Oswald überaus besorgniserregend. Deshalb halte ich es für angeraten, dass Ihr Euch die Hilfe und den Beistand eines erfahrenen Geistlichen ins Haus holt. Das Vorhandensein eines Beichtvaters und Seelsorgers ist schon unter den besten Umständen höchst wünschenswert, in einem Fall wie dem Euren oder vielmehr Eures Bruders halte ich es für angebracht und sogar unerlässlich. Eine solche Bürde ist nicht leicht zu tragen, insbesondere dann nicht, wenn zu befürchten steht, dass sich sein Zustand nicht wieder bessert oder gar, Gott bewahre, verschlimmert.«
»Demnach wollt Ihr also diesen Vetter, Bruder Genericus, als Beichtvater in Conlins Haushalt entsenden.« Johann rieb sich übers Kinn. »Ausgerechnet den Mann, den Oswald erst kürzlich so übel verprügelt hat, dass der arme Mönch ins Hospital musste. Verstehe ich das richtig?«
»Nun.« Bruder Thomasius’ verbundene Hand zuckte auf dem Kissen. Offenbar hätte er gern seine nun folgenden Worte mit Gesten unterstrichen. »Ich begreife, dass Ihr diesem Ansinnen skeptisch gegenübersteht. Auf den ersten Blick mag es widersinnig erscheinen. Doch ich bin der Ansicht, dass niemand anderes als unser geschätzter Bruder Genericus für diese Aufgabe geeignet ist.«
»Ach ja?« Nun hatte auch Conlin seine Stimme wieder im Griff. »Und woher rührt diese besondere Eignung? Hatte er vielleicht schon mit Menschen zu tun, die den Verstand … ich meine, deren Verstand sich zeitweilig verwirrt, wie es bei meinem Bruder der Fall ist? Ich dachte, er sei bisher für die Betreuung der Beginen- und Begardenhöfe in Köln zuständig gewesen.«
»Das war er auch«, bestätigte Bruder Thomasius mit säuerlich-strenger Miene und einer seltsamen Entschlossenheit, der etwas Verschlagenes anhaftete. Das Kruzifix unter Conlins Wams vibrierte bei des Dominikaners folgenden Ausführungen wieder stärker. »Genau dieser Umstand veranlasst mich dazu, Euch Genericus anvertrauen zu wollen.«
Johann beugte sich erneut ein wenig vor. »Ihr sprecht in Rätseln. Das will mir nicht gefallen.«
»Verzeiht, Herr Graf, ich werde mich bemühen, Euch die Lage mit klaren und deutlichen Worten darzustellen.« Das Lächeln des Mönchs war nun eindeutig verschlagen. »Bruder Genericus ist ein höchst belesener Mann und von, nun, nennen wir es einnehmendem und feinfühligem Wesen. Deshalb war und ist er in den uns zur Seelsorge anvertrauten Begarden- und Beginenhöfen stets gern gesehen und beliebt.« Eine kurze, bedeutungsvolle Pause folgte. »Ganz besonders die Beginen halten große Stücke auf ihn, denn so, wie ich es begreife, hat Genericus eine besondere Gabe …«
»O nein«, stöhnte Johann.
»… eine besondere Gabe«, fuhr Bruder Thomasius unbeirrt fort, »das weibliche Gemüt mit all seiner Verworrenheit zu verstehen. So hat er denn auch schon vielen dieser Frauen Trost und Zuspruch angedeihen lassen können, besonders in schweren Zeiten der Trauer und des Verlustes.«
»Trost gespendet hat er?« Argwöhnisch musterte Conlin den Dominikaner. Ihm schwante, ebenso wie offenbar Johann, nichts Gutes.
»O ja, Bruder Genericus hat, wie gesagt, ein sehr einfühlsames Wesen.« Bruder Thomasius verzog keine Miene. »Belesen in den Werken antiker Gelehrter ist er ebenfalls, und er zieht aus diesen Schriften ein großes Wissen um die Krankheiten von Geist und Seele.«
»Und einen solchen hochgelobten Mitbruder wollt Ihr seines Wirkungskreises entreißen, in dem er schon so viel Gutes getan hat?« Johann erhob sich, stützte sich mit beiden Händen auf dem Pult ab und fixierte den Dominikaner. »Nun sagt schon, was hat der feine Bruder Genericus angestellt, dass Ihr ihn so unbedingt loswerden wollt?«
Conlin hüstelte. Er hielt es nicht für angebracht, einen Mönch in der Position eines stellvertretenden Priors derart anzublaffen, wenngleich ihm selbst inzwischen eine ganz ähnliche Frage auf der Zunge lag.
»Nehmt nur wieder Platz, Graf Johann.« Bruder Thomasius blieb bewundernswert gelassen, seine Stimme wurde jedoch noch eine Spur öliger. »Seid versichert, dass meine Entscheidung, unseren Bruder im Herrn, den guten Genericus, zu seiner Familie zu entsenden, ausschließlich wohlmeinende Gründe hat, sowohl was ihn selbst betrifft als auch hinsichtlich der Menschen, denen er fortan als Seelsorger dienen soll.«
»Und wenn ich mich weigere, ihn aufzunehmen?«, wagte Conlin einzuwenden und erntete dafür einen spöttischen Blick seines zukünftigen Schwiegervaters.
»Den Wunsch kannst du getrost begraben, Junge.«
»Nun, seht Ihr, Herr Conlin …« Der Dominikaner stand auf und trat an ein Regal schräg hinter ihm, um ihm ein Pergament zu entnehmen. Er legte es beiläufig auf dem Pult ab, blieb dann aber stehen, wohl, um seiner Erscheinung mehr Autorität zu verleihen. Lediglich die dick verbundene Hand minderte das Gesamtbild ein wenig. Da ihm dies bewusst zu sein schien, musterte er die Hand für einen Moment missbilligend, bevor er weitersprach. »Euer Bruder, der Graf Oswald vom Langenreth, hat unserem Konvent einen nicht unerheblichen Schaden zugefügt, indem er den armen, wehrlosen Genericus so grundlos und brutal angegriffen hat. Auch wenn ich begreife, dass er unter einer nicht näher geklärten Verwirrung des Geistes leidet – und ich empfehle Euch dringend, Euch diesbezüglich mit dem städtischen Medicus Arnoldus zu beraten und ihn Euren Bruder untersuchen zu lassen –, kann ich solch ein Gebaren nicht ungesühnt lassen, das werdet Ihr wohl verstehen. Deshalb blieb mir nichts anderes übrig, als Klage gegen ihn zu erheben und eine Wiedergutmachung zu fordern.«
»Wie viel Gold wollt Ihr?« Johann, der sich zuvor auf Geheiß des Mönchs wieder gesetzt hatte, erhob sich nun ebenfalls erneut, sodass auch Conlin es als angeraten sah, von seinem Hocker aufzustehen, um sich mit den beiden anderen Männern auf Augenhöhe zu befinden.
»Gar keines.« Überaus freundlich und wie zum Erteilen eines Segens hob Bruder Thomasius die gesunde Hand. »Natürlich wäre eine Wiedergutmachung in barer Münze grundsätzlich wünschenswert, ganz besonders weil, wie ich Herrn Conlin bereits im Frankenturm dargelegt habe, eine der üblichen Leibesstrafen in Graf Oswalds Fall die sprichwörtlich vergebene Liebesmüh wäre.« Er ließ seine Worte einen Moment wirken, dann lächelte er wieder dieses haarsträubende, verschlagene Lächeln. »Der Vorschlag, den ich Herrn Conlin unterbreiten möchte, würde ihn von der Bürde und Schmach eines öffentlichen Prozesses gegen seinen Bruder entheben, ebenso wie der Zahlung eines nicht unerheblichen Geldbetrags. Denn verzeiht, wenn ich das anmerke, aber mir war so, als sei Euch dies alles andere als recht, wohl wegen bereits bestehender Zahlungsverpflichtungen, die, wie ich annehme, ebenfalls von Eurem Bruder verschuldet wurden.«
Conlin knirschte mit den Zähnen. Natürlich hatte der Dominikaner sein Gespräch mit Oswald in der Gefängniszelle belauscht.
»Seht Ihr, und da kam mir nun der Gedanke«, fuhr Bruder Thomasius salbungsvoll fort, »dass wir uns anderweitig einigen könnten.«
Conlin warf einen Blick auf das Schriftstück auf dem Pult. Es war besorgniserregend dicht beschrieben. »Das soll für uns alle von Vorteil sein? Sogar für Genericus, der doch wohl alles andere als erfreut sein dürfte, nicht nur seinem bisherigen Wirkungskreis entrissen zu werden, sondern ausgerechnet in das Haus des Mannes aufgenommen zu werden, der ihn schwer verletzt hat.«
»Begreif es doch endlich«, knurrte Johann. »Das ist die gerechte Strafe für deinen feinen Vetter.«
»Strafe?« Unbehaglich fuhr Conlin sich mit der Hand in den Nacken, besann sich dann aber und ließ sie wieder sinken. »Genericus hat sich etwas zuschulden kommen lassen?«
»Und sie wollen ihn loswerden«, ergänzte Johann grimmig. »Was denn sonst?« Er fixierte erneut den Dominikaner. »Wie schlimm sind seine Verfehlungen?«
Bruder Thomasius nahm das Schriftstück in die Hand. »Folgende Vereinbarung, die auch unser Vater Abt befürwortet, biete ich Euch an.« Er blickte Conlin fest in die Augen, und seiner Miene war zu entnehmen, dass es keinerlei Verhandlungsspielraum geben würde. »Vom Tage seiner vollständigen Genesung an wird Bruder Genericus in den Haushalt der Familie vom Langenreth aufgenommen, wo er Euch zeitlebens getreulich und mit all seiner Kraft als Seelsorger, Beichtvater und Priester dienen wird. Von jenem Tage an liegt die Verantwortung für ihn hinsichtlich Verpflegung, Wohnraum, Bekleidung und Gesundheit vollständig in Eurer Hand. Da er ein Familienmitglied ist, werdet Ihr sicher dafür Sorge tragen, dass es ihm an nichts fehlen wird, wobei ich natürlich der Ordnung halber darauf hinweisen muss, dass Genericus als Dominikaner nach wie vor dem Armutsgebot unseres Ordens unterliegt.«
»Und weiter?« Allmählich machte die ausschweifende, salbungsvolle Art des Mönchs Conlin nervös.
Thomasius’ Miene war nicht anzusehen, was er dachte, seine Stimme hingegen verriet es sehr wohl. »Darüber hinaus werdet Ihr die zum heutigen Tage siebenjährige Jungfer Ida ebenfalls in Euren Haushalt aufnehmen, für sie sorgen, ihr eine gute Erziehung angedeihen lassen und ihr, sobald sie alt genug ist, eine ausreichende Mitgift zur Verfügung stellen, damit sie sich einem ehrbaren Bürger anvermählen kann.«
»Wer ist Jungfer Ida?« Natürlich ahnte Conlin es bereits.
»Genericus hat also eine Tochter.« Johann seufzte. »Wer ist die Mutter? Nein, lasst mich raten: Es ist eine der Beginen, denen er so vortrefflich Trost gespendet hat, nicht wahr?«
3. Kapitel
twas widerwillig, weil die Sommerhitze nach wie vor beinahe unerträglich durch die Gassen von Koblenz waberte, verließ Benedikt vom Heidenstein die angenehme Kühle der Liebfrauenkirche, in der er sich eine ganze Weile aufgehalten hatte. Vorgeblich um zu beten, was er allerdings recht schnell hinter sich gebracht hatte. Den Rest der guten Stunde, die er in dem imposanten Bauwerk verbracht hatte, war er der Betätigung nachgegangen, für die er bezahlt wurde: Er hatte Informationen gesammelt.
Sein Auftrag machte es notwendig, sich sehr genau mit den Menschen zu befassen, derentwegen er nach Koblenz entsandt worden war, ebenso mit der Umgebung, in der sie lebten.
Er sollte einen möglicherweise abtrünnigen Spion aus der Truppe des Inquisitors Erasmus von London ausfindig machen und nach Rom zurückbringen. Da besagter Spion gefährliche Ketzer und deren Sympathisanten hätte ausfindig machen müssen, war diese Aufgabe nun ebenfalls Benedikt zugefallen.
Über die Hälfte seines Lebens verdingte Benedikt sich bereits als Söldner. Zwar war er zum ersten Mal hinter mutmaßlichen Ketzern her, doch das machte kaum einen Unterschied für ihn. Ob es um Verräter, Mordbuben, Fahnenflüchtige oder eben um Ketzer ging – sie auszuspionieren, um ihrer habhaft zu werden, sie bestenfalls zu überführen und sie ihrer Strafe zuzuführen, gestaltete sich in der Ausführung stets sehr ähnlich. In jedem Fall würde bei einem erfolgreichen Abschluss des Auftrags eine fette Entlohnung auf ihn warten.
Inzwischen hatte Benedikt sein Ziel erreicht. Seit zwei Tagen hielt er sich bereits in der Handelsstadt Koblenz auf und hatte sich einen guten Überblick über die örtlichen Gegebenheiten verschafft. Überdurchschnittlich viele Händler und Kaufleute hatten sich hier am Zusammenfluss von Mosel und Rhein angesiedelt und gingen erklecklichen Geschäften nach. Knapp fünftausend Seelen mochten insgesamt in der Stadt leben, so schätzte er. Damit war Koblenz keine kleine Stadt, aber dennoch überschaubar. Benedikt war sich darüber im Klaren, dass die Anwesenheit eines Fremden nicht lange unbeachtet bleiben würde. Besonders dann, wenn er, wie es nun einmal notwendig war, sich eine geraume Weile hier aufhalten würde. Dieser Umstand floss selbstverständlich in seine Planung mit ein.
Da ihm der Magen knurrte, machte Benedikt sich entschlossen auf den Weg in Richtung der nahe gelegenen Braugasse, um im Gasthaus von Klais Brauer ein leichtes Mittagsmahl einzunehmen, begleitet von einem hoffentlich sehr kühlen Trunk.
In der Kirche hatte er so einige Gespräche der anwesenden Personen belauscht, die sich, ihm nicht unähnlich, aus der drückenden Hitze in das Gotteshaus geflüchtet und dort fröhlich getratscht hatten oder ihren Geschäften nachgegangen waren. Kirchen waren überall ein Born der Information, da sich dort, wie auch auf Friedhöfen, stets viele Menschen aufhielten und ihrem Tagewerk nachgingen. Alles, was er bisher vernommen hatte, wollte er nun in Ruhe für sich sortieren und bewerten, um sein weiteres Vorgehen entsprechend anpassen zu können.
Im Wirtshaus herrschte bereits ein reger Trubel, die sechs langen Holztische, jeweils von zwei Bänken flankiert, waren alle bereits teilweise besetzt. Sehr gut. So würde es ihm nicht schwerfallen, die ersten Kontakte zu knüpfen. Nachdem er seinen Blick über die Gäste hatte schweifen lassen, ging er zielstrebig auf den zweiten Tisch linker Hand zu und fragte nach einem Gruß, ob es den Anwesenden genehm sei, dass er sich zu ihnen setzte.
»Sicher, sicher, nehmt Platz!« Einer der Männer, korpulent, vermutlich Mitte oder Ende vierzig und der Kleidung aus feiner Wolle und Seide nach zu urteilen ein wohlhabender Kaufmann, deutete mit einem leutseligen Grinsen auf den freien Platz neben sich. »Ihr seid fremd in der Stadt, nicht wahr? Zumindest habe ich Euch noch nie hier gesehen. Seid Ihr auf der Durchreise? Ach ja, gestattet, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Diederich Boos.«
»Benedikt vom Heidenstein.« Benedikt ließ sich auf der Bank nieder. »Sehr erfreut, Eure Bekanntschaft zu machen, Herr Diederich. Ihr habt recht, ich bin neu in Koblenz, jedoch nicht nur auf der Durchreise.« Er winkte einer vorbeieilenden Schankmagd zu, um auf sich aufmerksam zu machen.
»Ach, dann besucht Ihr wohl jemanden? Familie gar?« Der Kaufmann sah ihn neugierig an.
»Das weniger.« Benedikt fasste einen Entschluss, der ihm in diesem Augenblick am sinnvollsten erschien. »Ich suche nach einer neuen Anstellung. Bislang habe ich als Soldat in verschiedenen Heeren gedient, bin jedoch der Kriege und Schlachten müde und möchte mich fortan lieber einem Handelsherrn anschließen oder vielleicht die Gleve eines Amtmannes ergänzen und Wachdienste verrichten.« Er setzte ein gewinnendes Lächeln auf. »Mir scheint, Ihr selbst seid im Kaufmannsgewerbe tätig. Vielleicht wisst Ihr ja sogar eine geeignete Stellung für mich.«
»Ihr seid ja sehr geradeheraus.« Diederich Boos griff nach seinem Weinbecher und trank einen Schluck. »Das gefällt mir.« Er musterte Benedikt eingehend. »Ich nehme an, Ihr könnt Referenzen vorweisen. So, wie Ihr ausseht und Euch kleidet, seid Ihr von höherer Geburt, nehme ich an?«
Benedikt zögerte nur einen Lidschlag lang. Er sprach nicht gern über seine Herkunft und Vergangenheit, doch hin und wieder war es unvermeidlich. »Meine Familie entstammt väterlicherseits einer jüngeren Linie der Grafen vom Heidenstein, die unweit der Stadt Nürnberg ihren Sitz haben. Meine Mutter war die jüngste Tochter eines Nürnberger Bürgermeisters.« Er bemühte sich um eine gleichmütige Miene, die nichts über seine Gedanken und Gefühle verriet.
»Ah, soso.« Boos nickte ihm mit mildem Interesse zu. »Ihr sucht Euch aber eine Stellung sehr weit von Eurem Geburtsort entfernt. Man möchte meinen, dass es einen Mann nach langer Abwesenheit in die Heimat zurückzieht – zu seiner Familie.«
»Meine Familie existiert nicht mehr.« Nun klang seine Stimme doch ein wenig hohl, aber er gestattete sich keinerlei Gefühlsregung. Es war müßig, über Tatsachen Schmerz zu empfinden, die sich nicht ändern ließen. »Meine Eltern und Schwestern starben an einem Lungenfieber, das in meiner Heimat grassierte, als ich fast noch ein Junge war. Ein Knappe in den Diensten meines Onkels. Als er vom Tod seines Bruders, meines Vaters, erfuhr, wollte er mich in ein Kloster geben, zu dem er freundschaftliche Bande pflegte und in dem er bereits zwei seiner eigenen jüngeren Söhne untergebracht hatte.«
Boos nickte erneut, diesmal mit gerunzelter Stirn. »Er wollte Euch loswerden. Das Los vieler verwaister Nichten und Neffen.«
»Nicht das meine.« Nun klang Benedikts Stimme wieder vollkommen gleichmütig, obgleich die Erinnerung an die Kaltherzigkeit seines Onkels, zu dem er bis zu jenem Tag bewundernd aufgeblickt hatte, ihm immer noch ein gewisses Unwohlsein bescherte. Dabei begriff er mit dem Verstand die Beweggründe eines Mannes, der zuvorderst das Wohl seiner eigenen Familie und das Erbe der eigenen Söhne im Auge zu behalten hatte. Einen vom Rang her unbedeutenden Neffen ohne ersichtlichen Nutzen hätte er selbst, so redete Benedikt sich seit Jahren mehr oder weniger erfolgreich ein, wahrscheinlich ebenfalls loswerden wollen. Das kaum erwähnenswerte Erbe seines Vaters hätte gerade ausgereicht, um die Aufnahmegebühr für das Kloster abzudecken.
»Ja, ganz offensichtlich.« Boos lachte trocken. »Mir scheint, Ihr seid auch nicht unbedingt ein Mann, der sich in Mönchskutte und Tonsur wohlfühlen würde. Nun denn. Leider habe ich selbst derzeit keinen Bedarf an weiteren Wachleuten. Ihr solltet Euch an die Zunft der Kaufleute wenden, die findet Ihr hier in der Braugasse, nur drei Häuser weiter.« Vage gestikulierte Boos in Richtung des Ausgangs. »Dort wissen sie normalerweise um offene Stellen. An die Amtmänner oder den Adel gelangt Ihr eher über den Stadtrat. Einer unserer beiden Bürgermeister ist Graf Johann von Manten. Er stellt etliche Gleven für die Stadtverteidigung. Bei ihm könntet Ihr Glück haben.« Er stockte einen Moment und grinste dann breit. »Vielleicht gar … Habt Ihr selbst ein Weib, Herr Benedikt?«
»Nein.« Da endlich die Schankmagd an den Tisch trat, bestellte Benedikt einen Krug leichtes Bier sowie Brot, Käse und gebratenen Schinken und nach kurzer Überlegung auch noch eine Schüssel Rührei. Er hatte durch seine vermaledeite Seekrankheit in den letzten Tagen und Wochen häufig nur wenig oder gar nichts bei sich behalten können, und seine Hosen schlackerten inzwischen unerfreulich um seine Beine. Als die Magd weitereilte, fügte er an Boos gewandt hinzu: »Das Leben eines Söldners ist nicht geeignet, eine Familie zu gründen.«
»Falls Ihr dies nun ebenfalls ändern möchtet, kann ich Euch im Vertrauen den Hinweis geben, dass Graf Johann eine Tochter im heiratsfähigen Alter hat.« Boos’ Stimme hatte einen leicht süffisanten Unterton angenommen, der Benedikt verriet, dass Boos der Grafenfamilie von Manten offenbar nicht allzu freundliche Gefühle entgegenbrachte, sich jedoch offenbar nicht wagte, dies öffentlich auszusprechen. Vermutlich fürchtete er den Einfluss des Grafen, der als Bürgermeister in Koblenz ganz sicher hohes Ansehen genoss.
»Tatsächlich«, war alles, was Benedikt sicherheitshalber darauf erwiderte.
»Ja, ein Zufall, nicht wahr?« Das Grinsen des Kaufmanns reichte mittlerweile von Ohr zu Ohr. »Jungfer Mariana ist ein zauberhaftes Wesen, ganz ohne Zweifel. Sie ist erst kürzlich von der Mantenburg zurückgekehrt, wo sie erzogen wurde. Ich nehme an, der Graf will sie endlich unter die Haube bringen. Zeit wird es allemal. Sie muss schon an die zwanzig oder einundzwanzig Jahre alt sein. Dass er sie nicht schon viel eher verheiratet hat, ist mir ein Rätsel. Freier gab es mithin genügend, soweit ich weiß. Aber für Euch könnte sich dieser Umstand als Vorteil erweisen, wenn Ihr Eure Karten richtig ausspielt. Ihr seid ein stattliches Mannsbild, da wird sie doch gewiss Gefallen an Euch finden.« Boos hielt inne, weil Benedikts Speisen aufgetragen wurden, und fuhr erst fort, nachdem die Schankmagd sich entfernt hatte.
»Sie, also Jungfer Mariana, soll allerdings ein ordentliches Temperament besitzen. Einem Mann wie Euch könnte das wohl gefallen, oder? Falls Ihr aber lieber etwas weniger Feuer bevorzugt, haltet Euch an des Grafen ältere Tochter Reinhild. Sie ist seit Kurzem verwitwet, müsst Ihr wissen, und von wesentlich ausgeglichenerem Gemüt. Allerdings könnte es auch sein, dass sie nicht mehr, nun ja, verfügbar ist. Man munkelt, sie werde immer öfter in Gesellschaft von Conlin vom Langenreth gesehen. Möglicherweise hat er ein Auge auf sie geworfen. Verstehen könnte man es. Sein älterer Bruder, Graf Oswald, ist nicht gerade … Nun, sagen wir, er täte gut daran, seinen Bruder in eine gut betuchte Familie einzuverheiraten. Anderenfalls wird es wohl mit dem Geschlecht derer vom Langenreth alsbald nicht mehr weit her sein.«
Lieber Himmel, dieser Kaufmann war nicht nur ganz eindeutig von missgünstiger Natur, sondern tratschte auch noch mit offensichtlichem Vergnügen. Das machte ihn für Benedikt zu einem absoluten Glücksfall, wenngleich nicht einmal ansatzweise sympathisch.
»Falls Ihr Euch also mit dem Gedanken tragen solltet, sesshaft zu werden …«, redete Boos munter weiter.
»Ich werde Eure Ratschläge bedenken«, unterbrach Benedikt ihn rasch. »Zunächst einmal suche ich nur nach einer Anstellung.«
»Natürlich, natürlich.« Fröhlich klopfte Boos mit den Handflächen auf die Tischplatte. »Gewiss wird Eure Suche von Erfolg gekrönt sein. Koblenz ist ein guter Ort, viele wohlhabende Familien leben hier. Bei einer werdet Ihr gewiss Glück haben.« Er atmete hörbar ein und wieder aus, und es wirkte, als wolle er noch weitere Ratschläge folgen lassen, doch bevor er dazu kam, trat ein halbwüchsiger Junge zu ihnen und raunte Boos etwas ins Ohr, das sich für Benedikt so anhörte wie: »Wied sucht nach Euch. Er ist ziemlich wütend.«
Boos’ Miene verlor all ihre Leutseligkeit. »Sag ihm, er soll sich nicht so anstellen.«
»Aber …« Die Kinnlade des Jungen klappte herab. »Er ist der Bürgermeister.«
»Jaja, ich weiß.« Sichtlich vergrätzt erhob Boos sich und hielt gleichzeitig die vorbeieilende Schankmagd am Arm fest, sodass sie abrupt herumgewirbelt wurde. Nur ihrer Geschicklichkeit war es zu verdanken, dass ihr dabei nicht alle leeren Krüge und Teller entglitten, die sie gerade in die Küche tragen zu wollen schien. »Sag dem Wirt, er soll meine Zeche anschreiben. Ich zahle wie immer am Ende des Monats.«
»Ja, Herr Boos, gewiss.« Die Magd nickte und eilte weiter.
Boos wandte sich an Benedikt. »Ich muss mich leider nun verabschieden. Wichtige Schöffenangelegenheiten rufen mich. Gehabt Euch wohl. Vielleicht trifft man sich bei Gelegenheit wieder.«
»Gehabt Euch wohl.« Benedikt war nicht unglücklich darüber, den Kaufmann nun loszuwerden und sich seinem Mahl widmen zu dürfen. Dass Boos offenbar ein städtischer Schöffe war, notierte er sich jedoch im Geiste ebenso wie den Namen des zweiten Bürgermeisters neben Johann von Manten und den Umstand, dass jener wohl ein Hühnchen mit Boos zu rupfen hatte. Solche Informationen waren wichtig, um die verborgenen Strukturen ebenso wie die Händel innerhalb eines städtischen Gefüges einschätzen zu können.
Fest stand für Benedikt zum jetzigen Zeitpunkt bereits, dass die Familie Boos in Koblenz zwar einen hohen Rang innehatte, sich jedoch auf wenig freundschaftlichem Fuße mit den derzeit offenkundig einflussreichsten Familien von Manten und Wied befand. Falls er sich entschied, eine Freundschaft mit Boos anzustreben, musste er diese Fakten berücksichtigen. Boos’ beinahe schon unverfrorenen Vorschlag, sich eine der beiden Töchter des Grafen zu angeln, hätte er durchaus als Affront auffassen können, wenn er viel darauf geben würde, dass er, wenn auch von Adel, so doch von wenig beachtenswerter Stellung war. Da Boos aber vermutlich nur in reichlich alberner Manier gute Ratschläge hatte loswerden wollen, dachte Benedikt gar nicht weiter darüber nach.
Ganz abgesehen davon, dass er sich von jeglichem Standesdünkel schon vor vielen Jahren verabschiedet hatte, war er ganz sicher nicht hergekommen, um sich ein Weib zu suchen. Dass er nur in Koblenz weilte, um einen Auftrag, zwei, wenn man es genau nahm, auszuführen, durfte er natürlich nicht verlauten lassen.
Da Boos ihm nicht allzu angenehm war, beschloss Benedikt, dessen ersten Ratschlag viel eher zu beherzigen. Er würde sich bei der Zunft nach offenen Stellen für Wachleute erkundigen – und wohl auch beim Stadtrat. Insbesondere der Name Conlin vom Langenreth klang vielversprechend, denn dieser Mann war einer der beiden mutmaßlichen Ketzer, die Mathys, Sohn des Earl von Smithingham, genannt Mathys le Smithy, laut seiner Berichte an den Inquisitor Erasmus von London bis nach Koblenz verfolgt hatte. Wenn Benedikt es fertigbrachte, sich jenem Conlin anzudienen, würde er mit Sicherheit ganz leicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Dass Mathys le Smithy, jener offenbar abtrünnige Spion des Inquisitors, nicht etwa, wie Benedikt zunächst angenommen hatte, gestorben war, sondern sich quicklebendig in der Stadt aufhielt, noch dazu als Handelsgeselle des zweiten mutmaßlichen Ketzers, eines Pelz- und Geschmeidehändlers mit dem eigentümlichen Namen Palmiro Bongert, hatte er schon sehr kurz nach seinem Eintreffen in Koblenz in Erfahrung bringen können. Nun musste er sich weiteres Hintergrundwissen aneignen, um dieser potenziell gefährlichen Männer habhaft zu werden und sie möglichst bald zusammen mit aussagekräftigen Beweisen nach Rom zu überführen.
Ob Mathys tatsächlich abtrünnig war, musste er natürlich ebenfalls erst einmal herausfinden. Vielleicht gab es auch einen anderen Grund dafür, dass dessen Berichte an Erasmus immer seltener und nichtssagender geworden und zuletzt beinahe gänzlich ausgeblieben waren. Ein Spion musste sich stets den Gegebenheiten anpassen. Manchmal bedeutete das, sich gänzlich bedeckt zu halten und zur eigenen Sicherheit die Kommunikation mit den Auftraggebern einzustellen, um nicht entdeckt zu werden. Erasmus wusste das, gehörte jedoch beileibe nicht zu der geduldigsten Sorte Mensch. Er wollte Ergebnisse sehen, möglichst noch innerhalb der kommenden sechs bis zwölf Monate. Je eher, desto besser, denn ein weiterer erfolgreich geführter Kampf gegen die Häretiker würde ihm in Rom sicherlich großes Ansehen verschaffen und ihm den Weg aufwärts auf der Karriereleiter des Vatikans ebnen. Dass der Inquisitor vermutlich auch noch einen anderen Beweggrund für seine Jagd auf zwei Männer hatte, die so fern von Rom lebten, ging Benedikt zwar nichts an, machte die Sache jedoch eine Spur interessanter als alles, was er bisher getan hatte, um sein täglich Brot zu verdienen.
Während Benedikt sich mit Genuss über das Mahl aus Eiern, Schinken und Brot hermachte, behielt er seine Umgebung gewohnheitsgemäß wachsam, jedoch unauffällig, im Auge. Dieses Gasthaus gehörte zu den besseren in Koblenz, was bedeutete, dass er hier am ehesten Informationen über genau die Personen sammeln konnte, um die sich sein Auftrag drehte. Deshalb sprach er, nachdem er seinen Teller und die Schüssel mit dem Rührei geleert hatte, einen Mann zu seiner Rechten an, dessen aufwendig bestickter Mantel ihn als Amtmann einer Zunft auswies.
»Sagt, guter Mann, wo in dieser schönen Stadt finde ich wohl einen Pelzhändler? Ich suche schon seit einer Weile nach einem, der mir meinen alten, verschlissenen Winterpelz durch einen neuen ersetzen kann.«
»Einen Pelz wollt Ihr kaufen? Jetzt im heißesten Sommer?« Der Mann, schon etwas über fünfzig wohl und mit schütterem Haar und Halbglatze, hustete in seinen Weinbecher. »Habt Ihr Euch da nicht die falsche Jahreszeit ausgesucht?«
»Ganz und gar nicht.« Benedikt setzte eine leutselige Miene auf. »Im Sommer bekommt man eine Winterausstattung meist deutlich günstiger als im Herbst, wenn es kalt wird und alle Welt zu frieren beginnt.«
»Hm, ja, da mag etwas dran sein«, gab der Mann zu. »Nyvelonck ist übrigens mein Name, Walter Nyvelonck.«
»Erfreut, Eure Bekanntschaft zu machen.« Freundlich nickte Benedikt ihm zu. »Mein Name ist Benedikt vom Heidenstein.«
Auch Nyvelonck nickte. »Ihr seid fremd in Koblenz, nehme ich an.«
»Seit ein paar Tagen erst bin ich hier«, bestätigte Benedikt. »Wenn ich eine Anstellung finde, werde ich vielleicht länger bleiben.«
»Eine Anstellung sucht Ihr? Als was, wenn ich fragen darf?« Die Neugier seines Gegenübers war geweckt.
»Als Wachmann oder dergleichen. Ich war Soldat, möchte mich aber nicht mehr auf Schlachtfeldern herumschlagen.«
»Allzu verständlich.« Nyvelonck schauderte sichtlich, bemühte sich aber um ein Lächeln. »Ein Mann will wohl in seinem Leben noch etwas mehr sehen als Kriege, nicht wahr?«
»So ist es«, bestätigte Benedikt. »Man riet mir, mich an die Zunft der Kaufleute zu wenden, wo man am ehesten über offene Stellen Auskunft geben könne.«
»Da könnt Ihr gleich mit mir mitkommen.« NyveIoncks Lächeln verbreiterte sich. »Ich bin Zunftmeister der Kaufleute und für die Zunftverwaltung zuständig. Ich kann Euch gern einige Handelshäuser nennen, bei denen sich das Vorsprechen lohnen dürfte.«
Erfreut richtete Benedikt sich auf. »Das ist ja ein ausgesprochen vielversprechender Zufall, will ich meinen.«
»Offensichtlich.« Nyvelonck gestikulierte mit seinem Weinbecher. »Ich muss ohnehin gleich ins Zunfthaus. Begleitet mich also gern, wenn Ihr wollt. Und was Eure Frage nach einem Pelzhändler angeht, so kann ich Euch das Kontor des jungen Don Palmiro empfehlen. Nicht nur, weil er derzeit der einzige Kaufmann ist, der in Koblenz mit Pelzen handelt, sondern auch, weil er ein angesehener, rechtschaffener Mann ist. Von etwas fragwürdiger Herkunft vielleicht, genauso wie sein Vater – oder vielmehr Ziehvater –, der Tuchhändler Don Antonio, aber darüber kann und sollte man tunlichst hinwegsehen, schon wegen seiner familiären Verbindung zu unseren beiden Bürgermeistern. Einen ordentlichen Winterpelz wird er Euch ganz sicher verkaufen können und ganz bestimmt zu einem erschwinglichen Preis.«
»Don Palmiro ist sein Name?« Da Nyvelonck sich erhob, trank Benedikt rasch sein Bier aus und tat es ihm gleich. »Ein ungewöhnlicher Name.« Er beeilte sich, einige Münzen aus der Geldkatze an seinem Gürtel zu fischen, um seine Zeche zu bezahlen, während Nyvelonck der Schankmagd auftrug, den Betrag, den er schuldete, anschreiben zu lassen. Ähnlich wie Boos zuvor schien er nicht abgeneigt, sein Wissen über die offenen Geheimnisse der Koblenzer Bürger mit Benedikt zu teilen. So erfuhr Benedikt denn auf dem Weg zum Zunfthaus so einige interessante, zum Teil höchst erstaunliche Details über Palmiro Bongert und dessen illustre Familie.
4. Kapitel
anu, du bist ja schon hier.«
Als sie Palmiros Stimme hinter sich vernahm, hob Reinhild den Blick von dem Rechnungsbuch, das aufgeschlagen vor ihr auf dem großen Schreibpult lag. Sie hatte gerade erst begonnen, die neuesten Notizen von den umherliegenden Wachstafeln zu sortieren und in das Buch einzutragen. Seit einiger Zeit schon half sie ihrem Neffen, der einige Jahre älter als sie und mehr ein enger Freund oder Bruder für sie war, in seinem neuen Pelz- und Geschmeidehandelskontor aus.