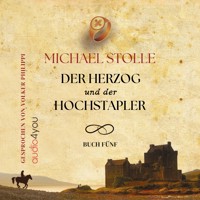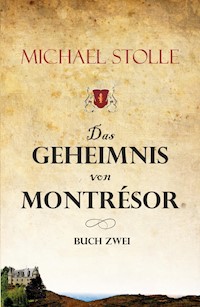
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geheimnisse von Montrésor ist die mit Spannung erwartete Fortsetzung von »Der Waisenjunge und der Kardinal« und setzt die Geschichte des jungen Pierre de Beauvoir fort ... Ein großes Erbe anzutreten, bringt auch immer eine große Verantwortung mit sich, aber wenn man ein unerfahrener Teenager ist, scheint es, dass überall Überraschungen - und nicht immer sehr angenehme - auf einen warten. Pierre, ehemaliges Waisenkind und jetzt Marquis de Beauvoir, hat zwar sein Erbe angetreten, aber das Leben ist niemals einfach. Zunächst einmal muss er ziemlich schnell lernen zu erkennen, wem er vertrauen kann und wen er besser auf Abstand halten sollte. Wie kann man zum Beispiel die Absichten des mächtigsten Mannes im Frankreich des 17. Jahrhunderts, Kardinal Richelieu, herausfinden … und überleben? Und was tut man, wenn die Menschen, denen man eigentlich vertrauen sollte, versuchen, einen in die Hände des schlimmsten Feindes zu liefern? Und dann ist da noch die kleine Angelegenheit einer Reise nach Italien, um ein heiliges Versprechen zu erfüllen ... Zum Glück für Pierre hat er seinen besten Freund Armand, der ihm zur Seite steht, während er sein Schloss in Montrésor, seine Bewohner und ... seine dunklen Geheimnisse kennenlernt. Die Zukunft ist alles andere als sicher und Pierre muss sich vielen Herausforderungen stellen, um zu überleben, denn seine Feinde warten nur darauf, ihre Chance zu ergreifen und sein Erbe an sich zu reißen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Michael Stolle
Das Geheimnis Von Montrésor
Historischer Roman
Copyright: © 2021 Michael Stolle
Satz: Erik Kinting – www.buchlektorat.net
Umschlagentwurf: Authordesign
Verlag und Druck:
tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
978-3-347-37145-3 (Paperback)
978-3-347-37146-0 (Hardcover)
978-3-347-37147-7 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Was bisher geschah …
Pierre ist in einer Klosterschule in Reims mit dem Wissen aufgewachsen, dass er ein mittelloses Waisenkind ist, bis sein bester Freund Armand de Saint Paul beschließt, endlich die Wahrheit herauszufinden. Als Pierre entdeckt, dass er nicht nur väterlicherseits der Erbe der aristokratischen Familie de Beauvoir ist, sondern mütterlicherseits auch der Erbe des Herzogtums Hertford, wird seine Welt auf den Kopf gestellt.
Doch das Leben ist nie so einfach. Pierres Cousin Henri de Beauvoir, der Pierre vom Aussehen her so ähnlich ist, will Pierres Platz als Erbe des Marquis de Beauvoir einnehmen und schreckt vor nichts zurück, um dies auch zu erreichen. Unterstützt vom mächtigen Kardinal Richelieu, der ebenfalls auf der Jagd nach dem Beauvoir-Erbe ist, um seine und die Kassen der Kirche zu füllen, verfolgt Henri Pierre quer durch England und Frankreich in seinem Bestreben, ihn zu beseitigen und das Erbe für sich zu beanspruchen. Als wir Henri zum letzten Mal sehen, hat er gerade seinen Adoptivvater, den Grafen Roquemoulin, ermordet – ein großes Erbe ist nun seins – doch wurden seine Taten heimlich beobachtet …
Pierre gelingt es immer wieder, den Fängen von Henri und Richelieu zu entwischen und mithilfe seines englischen Cousins Charles, seines Freundes Armand und der schönen Marie (einer Cousine von Armand, in die er sich verliebt hat) wird er zum Schluss sowohl in Frankreich als auch in England in sein Erbe eingesetzt. Für dieses Erbe muss er jedoch einen Preis zahlen – er und Armand mussten der geheimnisvollen Organisation der Tempelritter schwören, drei wertvolle, aber seit Jahrhunderten verschollene Ringe zu finden. Nun, da Pierre das Erbe angetreten hat, muss er sein Versprechen erfüllen und diese gefährliche Suche wird ihn und seinen Freund in neue Abenteuer weit über Frankreich hinaus führen.
Folgen Sie Pierre auf seinem Weg …
Briefe für einen Kardinal
In der beeindruckenden Bibliothek war es heiß, sehr heiß.
Der elegante Besucher, der auf dem reich geschnitzten, aber eher unbequemen Stuhl saß, dachte darüber nach, dass es vielleicht kein Zufall war, dass das Vorzimmer eines hohen Fürsten der französischen Kirche so heiß war, wie ein Vorraum der Hölle. Sein Gastgeber, der mächtige Kardinal, Herzog von Richelieu, sah in seinem scharlachroten Gewand gebrechlich und kränklich aus. Sein goldenes Kreuz baumelte schwer von seinem Hals – eigentlich viel zu schwer, um von diesem zerbrechlichen Körper getragen zu werden. Aber die Fassade der Zerbrechlichkeit war nicht nur irreführend, sie konnte genauso gut nur einer seiner sorgfältig inszenierten Auftritte sein, denn die scharfsinnigen Augen des Kardinals waren wachsam wie immer als er den makellos gekleideten Marquis de Saint Paul betrachtete, der elegant vor ihm saß und sich von der intensiven Hitze, die von dem riesigen Kamin ausging, nicht irritieren ließ.
Richelieu fragte sich, warum sein Besucher darauf bestanden hatte, ihn zu einer Privataudienz zu ersuchen, wo doch normalerweise ein höflicher, aber nicht minder intensiver – und zuweilen gnadenloser – Krieg zwischen dem adligen Clan der Familie de Saint Paul und dem Premierminister von Frankreich tobte.
Richelieu hatte wichtige Dinge im Kopf; bald würde er einen Weg finden müssen, den jungen Favoriten des Königs, Cinq-Mars, vom königlichen Hof und – viel schwieriger – aus dem Herzen des Königs zu entfernen. Deshalb war er nicht allzu erpicht darauf, einen Kampf an einer zweiten Front zu eröffnen, aber warum sollte der Marquis sonst zu ihm kommen?
»Ich bin sehr erfreut, Eure Eminenz bei guter Gesundheit zu sehen«, log der Marquis schamlos.
Richelieus Augen blinzelten amüsiert; er hatte natürlich die Ironie der Aussage des Marquis erkannt.
»Das Gleiche gilt für mich, mein edelster Marquis«, antwortete Richelieu höflich und genauso verlogen. Er öffnete eine kostbare, mit emaillierten Ornamenten im orientalischen Stil verzierte Silberschatulle, die kandierte Kirschen enthielt und bot sie seinem Besucher an.
Der Marquis betrachtete misstrauisch die dunkelroten Kirschen, die im Licht der Kerzen verlockend glitzerten; höflich, aber bestimmt, lehnte er das Angebot ab.
Der Kardinal gluckste. »Sie waren schon immer ein sehr vorsichtiger Mann«, sagte er und tauchte seine krallenartigen Finger in die Schachtel. Mit großem Gusto wählte er das größte Exemplar. »Sie hätten wirklich eine probieren sollen! Ich bekomme sie direkt aus Italien. Selbst mein lieber Mazarin ist verrückt nach ihnen, aber er hat noch nicht herausfinden können, woher ich sie beziehe.«
Der Marquis lächelte nur und schüttelte höflich den Kopf, denn er erinnerte sich lebhaft an mehrere Fälle von tödlicher Lebensmittelvergiftung, die ahnungslose Feinde des Kardinals dahingerafft hatten, kurz nachdem sie von ihm bewirtet worden waren.
Kardinal Richelieu hatte die Augen geschlossen, als wolle er sich auf den intensiven Geschmack der delikaten Kirsche konzentrieren, doch nur Sekunden später richtete sich sein durchdringender Blick auf seinen Besucher und er setzte das Gespräch fort. »Gibt es irgendetwas, das ich für Sie tun könnte? Hat Ihr jüngster Sohn Armand beschlossen, Buße zu tun und in den Schoß unserer heiligen Mutter Kirche zurückzukehren? Möchten Sie, dass ich eine geeignete Stelle für ihn finde?«
Der Marquis schaute amüsiert. »Auch wenn Armand denselben christlichen Namen trägt wie Eure Eminenz, fürchte ich, dass seine Dienste der Kirche keinerlei Nutzen bringen würden – im Gegensatz zu den Ihren. Ich glaube, mein Sohn ist im Herzen ein Soldat.«
Der Marquis hielt inne, und als er Richelieu direkt in die Augen sah, beschloss er, dass es an der Zeit war, zum Grund seines Besuchs zu kommen. »Ich frage mich, ob Eure Eminenz mit Euren gegenwärtigen Sorgen nicht etwas Hilfe gebrauchen könnten?«, fuhr er vorsichtig fort.
Richelieu war überrascht; was führte sein Besucher im Schilde – war eines seiner normalerweise gut gehüteten Geheimnisse durchgesickert? Der Marquis war eine Macht, mit der man rechnen musste. Doch der Kardinal blieb äußerlich gelassen und antwortete: »Bereiten Sie sich auf den Eintritt in den Himmel vor, mein lieber Marquis – Sie scheinen wohltätig zu werden?«, fragte er höflich, wobei nur ein leichtes Hochziehen der Augenbrauen andeutete, für wie unwahrscheinlich er diese Möglichkeit einschätzte.
»Ich fürchte, ich würde mich dort oben ziemlich einsam fühlen, ich würde unter anderem die Gesellschaft Eurer Eminenz vermissen – und ich hoffe, es ist noch ein bisschen zu früh, um dorthin zu gehen«, erwiderte der Marquis, fuhr dann aber mit einem versöhnlichen Lächeln fort. »Nein, ich muss gestehen, dass meine Motive eigentlich mit profaneren Dingen verbunden sind. Ich möchte Ihrer Eminenz eine Spende anbieten – etwas viel Wertvolleres als Geld – im Namen von Pierre de Beauvoir.«
Der Marquis hielt inne, aber es war unmöglich, die Gedanken des Kardinals zu lesen. Richelieus Gesicht war zu einer höflichen, aber völlig unverbindlichen Maske erstarrt.
Der Marquis fuhr fort. »Ich denke, dass es in der Vergangenheit einige unglückliche … nennen wir sie … Missverständnisse gegeben hat, die endlich geklärt und beseitigt werden sollten. Ich weiß, dass Sie derzeit wichtige Themen auf dem Herzen haben und denke, dass wir uns zum Wohle Frankreichs auf diese konzentrieren sollten, anstatt alte Schlachten auszutragen. Wenn ich mich darauf verlassen kann, dass Eure Eminenz den Anspruch des gegenwärtigen Marquis de Beauvoir endgültig anerkennt – wie es seine Majestät gnädigerweise bereits getan hat – werde ich Ihrer Sache mit einigen recht interessanten Dokumenten zu helfen können.«
Während er weiter sprach, holte der Marquis einige Briefe aus seiner Weste und überreichte sie dem Kardinal. »Diese Briefe sind nur Kopien, aber wenn Eure Eminenz einer Vereinbarung zustimmt, werde ich veranlassen, dass Ihnen die Originale übergeben werden«, erklärte er sachlich.
Richelieu überflog schnell den Inhalt des ersten Briefes und obwohl er ein Meister darin war, ein Pokergesicht zu machen, konnte er seine Zufriedenheit nicht verbergen. Die Briefe enthielten eine ausdrückliche Einladung von Monsieur de Cinq-Mars an seine Freunde, sich dem Kampf gegen Kardinal Richelieu anzuschließen – und die Rebellion im Namen von König Philipp IV. von Spanien zu unterstützen.
Richelieu war über den Inhalt nicht schockiert – was hätte man von einem solchen politischen Dilettanten auch anderes erwarten können – aber er war erstaunt, wie dumm manche Menschen sein konnten. Diese Briefe waren nichts anderes als ein direkter Weg zum Block des Scharfrichters. Schnell überflog er zwei weitere Briefe – einer schien noch hirnloser und kompromittierender zu sein als der andere. Ein kurzes Lächeln huschte über das Gesicht des Kardinals: Diese Dokumente würden es ihm ermöglichen aufzuräumen und das Unkraut auszureißen, das während seiner längeren Krankheit am Hof des Königs Wurzeln geschlagen hatte – es lag nun an ihm, den besten Zeitpunkt zu bestimmen, um sein Blatt auszuspielen.
Diese Briefe waren ein Vermögen wert, ein wahrhaft edles Geschenk.
»Mein edelster Marquis, Sie haben immer wieder die Fähigkeit, mich zu verblüffen«, sagte der Kardinal mit einem seiner seltenen Lächeln. »Ich denke, wir haben eine Vereinbarung. Ich werde gerne den Marquis de Beauvoir in einer offiziellen Audienz empfangen und ihn öffentlich anerkennen, sobald die Originale dieser Briefe ihren Weg – sagen wir mal, auf wundersame Weise – auf meinen Schreibtisch gefunden haben.«
Das Lächeln blitzte noch einmal über seine dünnen Lippen. »Übrigens werde ich sofort anordnen, dass das Verfahren vor den Kirchengerichten, das Sie und ihre Mittelsmänner so eifrig verzögert haben, eingestellt wird«, und dem Marquis ein Zeichen gebend, dass er schweigen solle, während er versuchte, Protest einzulegen, fügte er hinzu, »natürlich war das nichts weiter als ein unglückliches Unterfangen einiger äußerst eifriger, aber im Grunde inkompetenter Beamter.«
Der Marquis erwiderte das Lächeln. Richelieu fraß ihm aus der Hand – wie er es vorausgesagt hatte, als er die Idee dieses Treffens im Vorfeld mit seiner Frau besprochen hatte. Es gab allerdings noch einen letzten Punkt, der geklärt werden musste, und er räusperte sich. »Was ist mit den fehlenden Besitztümern von Pierre de Beauvoir, werden die ihm zurückgegeben?«
»Mein lieber Marquis, Sie und ich wissen aus trauriger Erfahrung, dass Ehrlichkeit und Diplomatie nicht immer gut zusammenpassen, aber ich muss gestehen, dass ich dieses Mal wirklich keine Ahnung habe, wovon Sie sprechen! Wenn irgendetwas fehlen sollte, fürchte ich, dass es sein Cousin Henri de Beauvoir ist, bei dem man suchen sollte – mein Ruf mag in manchen Kreisen nicht der Beste sein, aber ich kann Ihnen versichern, mein edelster Marquis, dass ich kein Dieb bin.«
Der Kardinal hob seine knochige Hand mit dem goldenen Ring und erstickte damit jegliche Beteuerungen des Marquis, er sei missverstanden worden. Doch der Marquis de Saint Paul erkannte, dass er entlassen worden war, und empfand die Überraschung des Kardinals über seine letzte Bemerkung als echt genug. Sie würden also anderswo nach Pierres Diamantring suchen müssen; Richelieu schien – ausnahmsweise – nicht involviert zu sein. Da der Ring einer der Schlüssel zum Auffinden des verborgenen Schatzes war, war das keine gute Nachricht für Pierre.
Der Marquis ging zurück zu seiner wartenden Kutsche, tief in Gedanken versunken. Er musste dringend mit den Bankiers der Familie sprechen, da er von Pierres Dienern wusste, dass Henri de Beauvoir nicht in der Lage gewesen war, den Ring zu entwenden. Sie konnten nicht länger warten, nun, nachdem der mächtige Kardinal Richelieu einen Waffenstillstand akzeptiert hatte.
Jetzt mussten Pierre de Beauvoir und sein Sohn Armand ihren Teil der Abmachung erfüllen und die drei antiken Ringe wieder zusammenführen, die der Schlüssel zu dem uralten Schatz waren, denn das hatten sie der Bruderschaft der Tempelritter versprochen. Dazu mussten sie allerdings zuerst den Diamantring finden und in ihren Besitz bringen. Wenn der Ring wirklich gestohlen worden war – und der Kardinal Richelieu ausnahmsweise mal nicht involviert war -, deuteten alle Spuren auf Kardinal Mazarin hin, einen ebenso mächtigen Feind wie Richelieu.
Wie sagte man so schön … vom Regen in die Traufe …
Der Marquis seufzte.
***
Der Marquis de Saint Paul atmete tief ein. Die rauchgeschwängerte Dunstglocke der Pariser Winterluft war seit ein paar Tagen einem sanften Südwind gewichen, der die Düfte und Verheißungen von Sonne, frischem Grün und Blumen in sich trug. Die Bäume der königlichen Louvre-Gärten standen in voller Blüte und bildeten einen passenden Rahmen für die fröhlich plätschernden Springbrunnen. Der Marquis bedauerte zutiefst, dass er in seiner stickigen Kutsche sitzen musste, umgeben von einer kleinen Armee livrierter Lakaien. Sein hoher Rang gebot es aber, das Protokoll zu respektieren, und außerdem wäre es töricht gewesen, in Paris ein Risiko einzugehen. Es gab daher keine Gelegenheit für ihn, auf dem Pferd zu reiten und die Sonne zu genießen.
Der Marquis beschloss, den Befehl zu geben, direkt zum Palais de Beauvoir zu fahren, wo ein äußerst neugieriger Pierre de Beauvoir auf ihn wartete, und er würde ein Vermögen darauf wetten, dort auch seinen Sohn anzutreffen – die beiden waren unzertrennlich. Der Marquis lächelte und das warme Lächeln verwandelte sein hochmütiges Gesicht. Er würde es Armand nie gestehen, aber er hatte ihn immer als seinen Lieblingssohn betrachtet.
Der Marquis hatte richtig geraten. Pierre und Armand warteten schon in einem der zahlreichen Salons, beide sichtbar gelangweilt. Sie sprangen von ihren Stühlen auf, um den Marquis de Saint Paul mit dem gebotenen Anstand zu begrüßen. Pierre schaute ihn an, seine blauen Augen einziges Fragezeichen.
»Willkommen, lieber Vater, Sie sehen aus wie eine Katze, die einen ganzen Teller Rahm geschleckt hat«, rief Armand respektlos aus. »Ich nehme also an, dass Ihre Mission erfolgreich war?«
Der Marquis warf seinem Sohn einen strengen Blick zu – er achtete stets peinlich genau auf Etikette und erwartete, dass seine Kinder dies auch taten. »Würde es dir etwas ausmachen, deinem Vater etwas mehr Respekt zu erweisen, mein lieber Sohn oder mir könnten ansonsten einige wichtige Aufgaben für dich einfallen. Da wäre unter anderem unser Schloss, weit entfernt in der Bretagne, das deine dringende und langwierige Aufmerksamkeit benötigen könnte.«
»Es tut mir leid, liebster Vater, ich verspreche, mich zu bessern und Buße zu tun«, antwortete Armand, aber seine lachenden Augen widersprachen seinen demütigen Worten.
»Ja, ich bringe gute Nachrichten. Der Kardinal ist jetzt unser bester Freund, er konnte seine Genugtuung kaum verbergen, als ich ihm die Briefe zu lesen gab. Meine persönliche Empfehlung ist daher: Solltet Ihr mit Monsieur Cinq-Mars Karten spielen, bittet ihn besser sofort zur Kasse. Ich ahne irgendwie, dass er früher oder später seinen hübschen, aber leider dummen Kopf verlieren wird – eher früher als später.«
Der Marquis bediente sich mit einem Glas Wein, dann fuhr er fort. »Unsere kleine Vereinbarung wird Pierres Zukunft als Marquis de Beauvoir ein für alle Mal regeln. Ich bin also sehr zufrieden mit dem Ergebnis meines Gesprächs mit Seiner Eminenz. Was mich jedoch sehr verwundert, ist, dass der Kardinal aufrichtig überrascht zu sein schien, als ich andeutete, dass eventuell Besitztümer verschwunden sind. Pierre, wir müssen uns dringend mit der Bank, sprich Monsieur Piccolin treffen, um Licht in diese Angelegenheit zu bringen. Wisst ihr, ob er inzwischen zurückgekehrt ist?«
»Lassen Sie mich Ihnen zuerst von ganzem Herzen danken, Monsieur le Marquis«, rief Pierre aus und mit Tränen in den Augen eilte er nach vorn, um die Hand des Marquis zu ergreifen und sie kräftig zu schütteln. »Ich bin voller Bewunderung und verstehe wirklich nicht, warum Sie so viel von Ihrer wertvollen Zeit und Energie für mich aufwenden. Wie kann ich Sie jemals dafür entlohnen? Ich stehe tief und ewig in Ihrer Schuld!«
Der Marquis sah ihn überrascht an, in der Familie der Saint Paul war es nicht üblich, Gefühle zu zeigen.
Armand bemerkte das Unbehagen seines Vaters und breit grinsend antwortete er an seiner Stelle: »Mein Vater ist einfach nur dankbar, dass du es mit mir aushältst, das ist ihm die Mühe wert.«
Der Marquis warf seinem Sohn einen strengen Blick zu. Er fand diese flapsige Bemerkung nicht besonders lustig. »Du bist unmöglich, Armand«, sagte er schroff.
»Ja, Vater, und ich verspreche demütigst, dass ich jetzt den Mund halten werde. Schließlich will ich nicht in der Bretagne versauern«, versprach Armand, erschien aber nicht besonders eingeschüchtert von der Drohung seines Vaters.
So sehr Pierre auch erleichtert war, dass Kardinal Richelieu endlich Frieden schließen wollte, so wurde ihm doch unangenehm bewusst, dass er sich neuen Aufgaben stellen musste.
Armand und er hatten keinerlei Ausreden mehr, sie waren jetzt verpflichtet, ihren Teil der ursprünglichen Abmachung zu erfüllen und diese verfluchten Ringe zu finden. Tief in Gedanken versunken betrachtete er den Rubinring, den er trug, seit er in die Fußstapfen seines Großvaters getreten war. Der dunkelrote Stein schien zu schlafen, nur wenn Pierre den Stein in die Nähe einer Kerze oder in die Sonne bewegte, erwachte er und blitzte wütend in der Farbe dunklen Blutes. Was für ein Geheimnis bewahrte dieser Ring?
»Das stimmt, wir müssen mit Monsieur Piccolin sprechen, nur er kann uns helfen, den Diamantring zu finden«, sagte Pierre laut.
»Ich bin ganz Eurer Meinung«, kommentierte Armand. »Nur schade, dass der Schlüssel zum Diamantring von einem ehrenwerten alten Mann und nicht von einer schönen jungen Dame gehalten wird. Meine Talente werden eindeutig vergeudet!«
Zwei Tage später überbrachte ein junger Diener die Nachricht, dass der ehrenwerte Monsieur Piccolin um die Gunst eines dringenden Termins bat. So versammelten sich die beiden Freunde, begleitet von Armands Vater, neugierig in einem geräumigen und frisch renovierten Salon des Palais de Beauvoir. Über dem Marmorkamin prangten stolz die Porträts von Pierres Eltern.
Der alte Bankier war pünktlich erschienen, was im dichten Pariser Verkehr nicht leicht zu bewerkstelligen war. Er zögerte kurz, wen er zuerst begrüßen sollte, da Pierre – da er nicht nur ein Marquis, sondern auch ein Herzog war – von höherem Rang war, aber der Marquis de Saint Paul war zweifellos von höherem Rang in Frankreich und hatte viel mehr Einfluss. Er beschloss, sich zuerst vor dem Marquis de Saint Paul zu verbeugen, was sich als die richtige Entscheidung erwies, da der Marquis es nicht zu schätzen gewusst hätte, im Rang unter Pierre zu stehen.
Nachdem er seine ausführliche Begrüßung beendet hatte, nahm Piccolin mit einem zufriedenen Seufzer die Einladung an, Platz zu nehmen. Dann wandte er sich in seinem angenehmen italienischen Akzent förmlich an die drei Männer, die ihn erwartungsvoll ansahen.
»Mein höchst ehrenwerter Marquis, Euer Gnaden, Eure Lordschaft! Lassen Sie mich zunächst meine tiefste Freude und Genugtuung darüber zum Ausdruck bringen, dass der Sohn des verstorbenen Marquis de Beauvoir – endlich – seinen rechtmäßigen Platz einnehmen konnte und dass er über seine Feinde triumphiert hat. Meine Familie und unsere Bank haben alles getan, was möglich war, um das Familienvermögen und die Schätze zu sichern, die uns der verstorbene Marquis anvertraut hatte. Lassen Sie mich in aller Bescheidenheit erwähnen, dass sich diese Aufgabe als schwieriger erwies, als wir erwartet hatten, da wir unter starkem Druck seitens einiger Mitglieder der Familie de Beauvoir standen. Manchmal kam mir fast der Gedanke, dass einige von diesen Verwandten vielleicht sogar den Wunsch hegten, den natürlichen Lauf Ihres Erbes zu ihren Gunsten zu ändern.«
Er hielt kurz inne, um die Wirkung seiner kleinen Rede abzuschätzen, aber Pierre gelang es, eine undurchdringliche Miene zu bewahren, obwohl er verstand, dass die letzte Bemerkung auf seinen Cousin Henri gemünzt war.
Der alte Bankier fuhr fort: »Aber da wir die Ehre und das Privileg haben, der Familie Euer Gnaden schon seit mehreren Generationen zu dienen, waren natürlich alle unsere Bemühungen darauf gerichtet, die Interessen des wahren Erben zu verteidigen. Heute bin ich glücklich und stolz, bestätigen zu können, dass Euer Gnaden, sobald alle Dokumente unterzeichnet und besiegelt sind, vollen Zugriff auf das Familienvermögen haben werden, das sich in unserer Obhut befindet.«
Pierre anstrahlend fügte er hinzu: »Und natürlich wäre es uns eine große Freude, Euer Gnaden und der Familie de Beauvoir weiterhin zu Diensten sein zu dürfen, falls dies der Wunsch Eurer Gnaden sein sollte.«
Der Marquis de Saint Paul hielt es für an der Zeit, den blumigen Wortschwall zu stoppen. »Sind Sie sicher, dass Sie von allen Schätzen sprechen, die bei Ihrer Bank deponiert waren?«
»Darf ich Eure Lordschaft fragen, warum Ihr diese Frage stellt?« Der Bankier hob leicht seine Augenbrauen, als er die Frage stellte.
»Monsieur Piccolin, ohne weitere Umschweife, wir haben die Information erhalten, dass Seine Eminenz, der Kardinal Mazarin, vor einigen Wochen versucht hat, in dieses Haus einzudringen und alle Schätze zu beschlagnahmen.«
Die Stimme des Marquis de Saint Paul nahm nun eine entschiedene Schärfe an. »Und – was zugegebenermaßen am beunruhigendsten ist – als wir Ihren Sohn vor vierzehn Tagen trafen, weigerte er sich, uns eine klare Antwort über die Handlungen des Kardinals Mazarin zu geben. Bitte bestätigen Sie uns, dass kein einziger Gegenstand an ihn übergeben wurde – und damit meine ich insbesondere den berühmten Diamantring, der seit Jahrhunderten zum Erbe der Familie de Beauvoir gehört!«
Die Stimme des Marquis klang kalt, er war kein Liebhaber von Versteckspielen.
Er hatte eigentlich erwartet, Monsieur Piccolin, nach dieser Aussprache als Nervenbündel vorzufinden, aber der Bankier lächelte nur verschmitzt und antwortete: »Wenn Sie gestatten, mein edler Marquis, habe auch ich meine kleinen Geheimnisse. Geheimnisse, die ich nicht einmal meinem Sohn anzuvertrauen wagte. Bitte versprechen Sie mir, dass unser Gespräch streng vertraulich behandelt wird – ich muss leider sogar darum bitten, dass Ihr Sohn den Raum verlässt, denn was ich Ihnen zu sagen habe, ist nur den Ohren der Betroffenen vorbehalten.«
Pierre fand es an der Zeit, sich in dieses Gespräch einzumischen, das eine seltsame Wendung nahm. »Es kommt nicht infrage, dass Armand diesen Raum verlässt; seine Geheimnisse sind meine und umgekehrt. Sie dürfen aber darauf vertrauen, dass wir nichts verraten werden.«
Monsieur Piccolin sah die beiden jungen Männer skeptisch an. Das Konzept, volles Vertrauen zu haben, schien nicht zur Einstellung eines Bankiers zu gehören, aber schließlich gab er nach. »Seine Eminenz, der Kardinal Mazarin, hat tatsächlich unsere Büros besucht. Sein Ultimatum war klar: Entweder wir übergaben die de Beauvoir-Schätze in seine Obhut, oder er würde dafür sorgen, dass meiner Bank die Lizenz entzogen würde – was bedeutet, dass unsere Bank geschlossen würde.«
»Das ist schon ziemlich unverschämt«, kommentierte Armand aufgebracht. »Wie haben Sie auf diese Herausforderung geantwortet?«
»Er hatte mit meinem Sohn gesprochen, der sich natürlich große Sorgen machte. Es kam natürlich nicht infrage, das Vertrauen eines unserer Kunden zu missbrauchen – aber wir alle wissen, dass der Kardinal Mazarin höchstwahrscheinlich der nächste Premierminister wird …«
»Kurzum, Sie mussten zwischen Ihrer Ehre und der Zukunft Ihrer Bank wählen. Sagen Sie uns also, wie Sie sich entschieden haben?«, fragte der Marquis.
»Da wir italienischer Herkunft sind, sind wir mit einem besonderen Sinn für Ehre und Stolz aufgewachsen – aber auch mit einem ausgeprägten Sinn für Flexibilität. Es ist in ganz Frankreich bekannt, dass der Kardinal ein leidenschaftlicher Liebhaber von Diamanten ist – ich vermutete daher, dass diese Geschichte von der sicheren Verwahrung nur ein Vorwand und ein fast verzweifelter Versuch war, den berühmten de Beauvoir-Ring zu erwerben, einen Ring, den der verstorbene Marquis an unsere Bank verpfändet hatte, als er dringend eine große Geldsumme benötigte.«
»Sie meinen, der Ring gehörte in Wirklichkeit der Bank und nicht mir?«, warf Pierre, völlig verblüfft, ein.
Der Bankier fummelte an seiner Weste und holte vorsichtig ein Dokument hervor, das mit dem Siegel des Marquis de Beauvoir und einer majestätischen Unterschrift versehen war. Er reichte es dem Marquis, der es sorgfältig überprüfte und an Pierre weiterreichte. Darin wurde ein Darlehen über eine bedeutende Geldsumme gewährt und die darin enthaltende Beschreibung des Diamantrings, der für den Fall verpfändet wurde, dass das Darlehen nicht zurückgezahlt werden konnte, passte perfekt – sie erwähnte sogar die geheimnisvollen Gravuren.
Der Raum lag plötzlich in völliger Stille.
»Was, in Gottes Namen, haben sie dann entschieden?«, fragte Pierre mit heiserer Stimme.
Ein Zeuge zu viel
Henri de Beauvoir trat heftig gegen den Körper seines schwer verletzten Adoptivvaters und immer schneller rollte der schreiende Graf, bis er in die reißenden Gewässer der Loire fiel und von den Fluten erbarmungslos mitgerissen wurde. Jean-Baptiste de Roquemoulin war für immer verschwunden.
Es war sein Triumph, denn hier stand er – Henri – der neue Graf von Roquemoulin. Er war reich, er war frei. Er hatte es geschafft – er hatte sich dieses ältlichen, ewig nörgelnden Liebhabers entledigt, des Mannes, der dumm und blind genug gewesen war, ihn zu adoptieren.
Noch immer das herrliche Gefühl seines Triumphs in seinen pulsierenden Adern spürend, wandte sich Henri um, um zu seinem Pferd zurückzulaufen. Aber als sein Blick die Hügelkuppe streifte, setzte sein Herzschlag beinahe aus. Oben, auf dem Hang, warteten drei Reiter. Sie mussten ihn schon seit einiger Zeit beobachtet haben. Fieberhaft suchte er nach einer Waffe und fluchte; er hatte Pistole und Schwert bei seinem Pferd dort oben auf dem Pfad gelassen.
Es blieb ihm keine andere Wahl, als den drei Reitern unbewaffnet zu begegnen und sich dem Unvermeidlichen zu stellen.
Einer der drei Reiter stieg ab und noch während Henri den Hang wieder hochkletterte, kam der Mann mit gezücktem Schwert auf ihn zu gerannt, doch seltsamerweise fing er an, ihm zuzuwinken.
Hölle und Verdammnis, was soll ich jetzt nur tun? Henri ging fieberhaft alle Möglichkeiten durch, die ihm einfielen. Die Person kam näher und nun erkannte er, dass diese Person, in Wirklichkeit kein Mann, sondern eine Frau war. Es war Marina, seine Geliebte, und eine Welle der Erleichterung überkam ihn.
Marina stürzte in seine Arme. »Henri, endlich bist du diesen dummen Mann losgeworden! Ich wusste, dass es heute passieren würde, ich habe es in den Sternen gelesen.«
Henri befreite sich aus ihrer stürmischen Umarmung und zeigte auf die beiden Reiter, die wie Marmorstatuen auf ihren Pferden sitzen geblieben waren. »Wer sind sie? Warum bist du nicht allein gekommen?«
Marina lächelte ihn an, aber Henri war sich nicht sicher, ob er dieses Lächeln mochte.
»Das sind mein Vater und mein Bruder«, bemerkte sie lässig.
Henri musterte die beiden Männer. Sie hatten die gleiche stolze Haltung und er konnte eine Familienähnlichkeit erkennen. Beide hatten ebenfalls Haare vom dunkelsten und glänzendsten Schwarz, das er je gesehen hatte. Die Haut von Marinas Bruder war etwas dunkler getönt als ihre, aber auch er war stolz und schön.
»Soll ich jetzt sagen, dass ich mich freue, sie kennenzulernen?«, knurrte Henri, ‚Warum bist du nicht allein gekommen?«
»Ja, das solltest du«, erwiderte Marina und ihre Augen blitzten triumphierend. »Ich nehme an, dass es eine kleine Überraschung für dich sein mag, aber du bist dabei, deinen zukünftigen Schwiegervater und Schwager kennenzulernen!«
Henry wusste nicht, ob er lachen oder vor Wut explodieren sollte. »Bist du verrückt? Ich bin Henri de Beauvoir, Comte de Roquemoulin, meine Vorfahren haben Jerusalem zusammen mit den Königen von Frankreich erobert, meine Familie hat königliches Blut in ihren Adern, ich werde niemals eine Schlampe wie dich heiraten!«, rief er aufgebracht.
Als Antwort verpasste Marina ihm eine harte Ohrfeige, wobei sich ihre Nägel in sein Fleisch bohrten und blutige Spuren hinterließen.
Henri taumelte unter dem unerwarteten Angriff und dann sah er, dass ihr Bruder eine Armbrust auf ihn richtete. Das Gesicht ihres Bruders vermittelte eine klare Botschaft: Nur zu gerne würde er diesen wütenden Fremden, der gerade seine Schwester und ihren Stamm beleidigt hatte, töten.
»Du bist ein Nichts, ein Niemand!«, schrie sie ihn an. »Ich bin diejenige, die von königlichem Blut ist, mein Vater ist der König unseres Stammes. Du hast mir meine Jungfräulichkeit genommen und nach unseren Regeln musst du mich entweder heiraten oder du stirbst. Mein Sohn wird nicht unehelich geboren werden. Du hast die Wahl.«
Henri kochte vor Wut, aber bevor er etwas sagen oder ihren Angriff auch nur erwidern konnte, hörte er das Zischen des ersten Pfeils. Er traf sein Pferd, das sich vor Angst und Schmerz aufbäumte, bevor es den Halt auf dem glitschigen Pfad verlor und den Hang hinunter in die Loire stürzte. Dabei schrie das Pferd vor Schmerz fast wie ein Mensch und die schrecklichen Schreie kamen als Echo zurück. Es klang entsetzlich, als ob das Leiden des Pferdes ewig andauern würde.
Henri gefror das Blut in den Adern. Dann hörte er zum ersten Mal die erstaunlich melodiöse Stimme von Marinas Bruder. »Denk lieber nach, bevor du noch einmal sprichst. Ich verstehe nicht, warum sie dich heiraten will, sie sagt, dass sie ihr Schicksal in den Sternen gelesen hat. Aber wenn du meine Schwester oder unseren Stamm beleidigst oder auch nur bedrängst, schwöre ich hiermit, dich zu töten, und dein Tod wird ein schrecklicher sein.«
Henri sah den jungen Mann abschätzend an. Aber diese Drohung ängstigte ihn nicht, im Gegenteil, sie erregte ihn. Mal sehen, wer dieses Spiel gewinnen wird, dachte Henri. Wenn ich Richelieu schlagen kann, werde ich auch diesmal gewinnen. Ich werde euch alle dazu bringen, euch meinem Willen zu beugen.
Er schaute Marina und ihren Bruder trotzig an und antwortete: »Ich schätze, ich habe keine andere Wahl, als zu akzeptieren. Wenn ich das Erbe von Roquemoulin erfolgreich angetreten habe, werde ich eure Schwester heiraten. Aber wenn ihr mich jetzt tötet, gewinnt niemand, ich verliere mein Leben und Marina ihren zukünftigen Ehemann.«
»Hältst du uns für zurückgebliebene Trottel?«
Zum ersten Mal schaltete sich Marinas Vater in das Gespräch ein. »Du wirst sie hier und jetzt heiraten oder du gehst mit deinem leichtgläubigen Grafen da unten ins Wasser.«
Henri schluckte, sein Mund war plötzlich trocken. Was konnte er tun, außer zu akzeptieren? »Wie, jetzt?«, schaffte er es zu antworten.
»Steig auf das Pferd des Grafen und wir werden es dir zeigen!«, antwortete seine Braut triumphierend.
Der Tag, an dem ich dich töte, du Schlampe, wird der schönste Tag meines Lebens sein, dachte Henri. Wütend presste er seine Lippen zusammen.
Sie ritten über die Hügel mit grünen Feldern zu dem Ort, an dem die Zigeuner ihr Lager errichtet hatten. Er erblickte ein paar Zelte neben einigen klapprigen Wagen, daneben graste eine kleine Herde schmuddeliger Ziegen.
Henri wurde in ein Zelt geführt, wo man ihn warten ließ. Marina verschwand zusammen mit ihrem Vater, aber ihr Bruder hielt Wache, seine Armbrust stets präsent, seine Augen seltsam traurig, aber zugleich stolz und herausfordernd. Nur wenige Minuten später wurde Henri in ein größeres Zelt geführt.
Ein goldenes Kreuz stand auf einem Tisch, der mit einem kostbaren seidenen Teppich bedeckt war. Eine Ikone der Heiligen Jungfrau und ihres Kindes wurde neben das Kreuz gestellt. Das Bild musste sehr alt zu sein, denn der goldene Rahmen war vom Alter gezeichnet und das Bild selbst vom Schmutz und Rauch unzähliger Talglichter geschwärzt.
Neben dem Kreuz wartete bereits ein dicker Priester mit einem markanten Leberfleck auf seinem wackeligen Kinn und bevor Henri überhaupt begriffen hatte, was hier vor sich ging, hatte die Hochzeitszeremonie bereits begonnen.
Ich bin in einem Albtraum gelandet, das kann nicht wahr sein, dachte er und rieb seine Augen.
Und doch – schon trat seine Braut an seine Seite mit einem silbernen Kranz in ihrem leuchtend schwarzen Haar. Marina strahlte vor Freude. Und natürlich standen dort auch Mitglieder ihrer Familie, seine neuen Verwandten, die ihn höhnisch angrinsten. Henri war sich bewusst, dass sie ihn als fette Beute betrachteten, die seine neue Frau an Land gezogen hatte.
Widerwillig verfolgte Henri den Gottesdienst. Niemals hätte er sich vorstellen können, sich in einer solchen Situation wiederzufinden, mit einer Frau von niedrigster Geburt an seiner Seite. Er war ebenso wütend wie angewidert. Um nicht verrückt zu werden, wiederholte Henri in seinen Gedanken wie ein Mantra: Lass sie überzeugt sein, dass sie mich in der Falle haben, ich werde einen Ausweg finden!
Ein Dokument wurde zur Unterschrift vorgelegt und Henri erkannte, dass seine Braut mit drei Kreuzen unterschrieben hatte – natürlich konnte sie weder lesen noch schreiben. Er überlegte kurz, mit einem falschen Namen zu unterschreiben, aber das war ein erhebliches Risiko, denn zumindest der dicke Priester konnte sicherlich seine Unterschrift entziffern. Henri entschied sich, einfach zu unterschreiben – war es denn wirklich so wichtig? Das Ganze war eine Farce.
Der Priester strahlte ihn an, sichtlich zufrieden, dass alles gut geklappt hatte. Er schloss die Zeremonie mit den letzten Gelübden und den Worten: »Bis dass der Tod euch scheidet.«
Henri zuckte zusammen, das war der Fingerzeig, auf den er gewartet hatte.
Ja, der Tod wird die Antwort sein, Marina Darling, du wirst es bereuen, mich jemals herausgefordert zu haben, dachte Henri und fühlte, wie seine Energie zurückkehrte.
Wie es der Brauch verlangte, teilte er den Kelch mit dunkelrotem Wein mit seiner Braut und küsste sie pflichtbewusst. Aber seine Gedanken überschlugen sich: Ich werde dafür sorgen, dass der Tod uns schnell trennen wird. Marina hatte soeben ihr Schicksal besiegelt.
Arrogant und wieder selbstbewusst wandte er sich an seine neue Frau.
»Jetzt, wo wir verheiratet sind, musst du mir helfen, eine gute Entschuldigung für meine Abwesenheit zu erfinden. Ich vermute, dass die Knechte des Grafen bald nach uns suchen werden, wenn wir nicht zurückkehren. Ich muss sofort zurückkehren und so aussehen, als hätte ich einen schlimmen Unfall erlitten. Du musst mir dabei helfen. Wenn ich es richtig anstelle, werde ich der Erbe des Grafen. Es geht um ein Vermögen.«
Seine neue Familie nickte zustimmend – das war die Sprache, die sie verstanden.
Sie ritten zurück zum Pfad in der Nähe des Flusses und Henri ging noch einmal im Geiste durch, welche Geschichte er am besten der Dienerschaft des Grafen auftischen konnte. Praktischerweise hatten Marinas scharfe Nägel Kratzspuren auf seinem Gesicht hinterlassen, samt Spuren von getrocknetem Blut an seinem Kragen. Wieder einmal würde er also in die Rolle des armen Unfallopfers schlüpfen. Eigentlich, dachte Henri, ist die ganze Welt nichts anderes als eine riesige Bühne für eine schlechte Komödie.
Als Henri – in der Gestalt des einsamen und geschundenen Reiters sichtlich erschöpft das Anwesen von Roquemoulin betrat, war das ganze Schloss bereits in Aufruhr.
Besorgnis, danach blanke Angst, hatte sich breitgemacht, nachdem die beiden Reiter nicht zur erwarteten Zeit zurückgekehrt waren. Suchtrupps waren organisiert worden, aber ohne Erfolg. Später verbreitete sich die schreckliche Nachricht wie ein Lauffeuer, dass Henri de Beauvoir allein zurückgekehrt war, ein gebrochener Mann, Zeuge eines schrecklichen Unfalls, der dem Grafen widerfahren war. Obwohl die Sonne schon tief stand, wurden die Stallknechte sofort zur Unglücksstelle geschickt – Henri hatte Sie mit letzter Kraft und brechender Stimme aufgefordert, dass keine Mühe gescheut werden dürfe, nach dem Grafen zu suchen und dass man die Hoffnung niemals aufgeben werde, ihn lebend wiederzufinden.
Erst spät am Abend kehrten die Pferdeknechte zurück, die Augen müde und brennend von den rauchenden Fackeln. Sie legten Zeugnis von dem Unfall ab – die strauchelnden Pferde hatten tiefe Spuren im schlammigen Pfaden und im Gestrüpp hinterlassen – aber vom Grafen selbst war keine Spur am Flussufer gefunden worden.
Denn die Leiche des unglücklichen Grafen sollte nie geborgen werden.
Erst Wochen später und Hunderte von Meilen entfernt entdeckte ein Fischer die aufgedunsenen und entstellten Überreste dessen, was vermutlich einst ein wohlhabender Mann gewesen war. Dem Herrn für einen solchen fetten Fund dankend, schnitt er die halb verwesten Finger ab, um die kostbaren goldenen Ringe zu bergen, und versteckte die verwesende Leiche im Schilf. Der Fischer wusste aus leidvoller Erfahrung, dass er sich nur Ärger einhandeln würde, wenn er Meldung erstattete. Glücklich sah er sich die Ringe näher an: Sie waren schwer und ein Vermögen wert, weit mehr als alles, was er in seinem ganzen Leben je durch die Fischerei hätte verdienen können. Nicht einmal seiner stets nörgelnden Frau würde er diesen Fund zeigen, er würde einfach verschwinden. Sollte sie doch sehen, wie sie mit den sechs Kindern zurechtkam.
***
Es hatte nie einen Zweifel daran gegeben, dass Henri ein exzellenter Schauspieler war, aber diesmal spielte er seine Rolle zur Perfektion. Auch wenn den meisten Bediensteten die enge Verbindung des Grafen zu diesem arroganten Adligen, der sich wie ein Kuckuck ins Nest gesetzt hatte, ein Dorn im Auge gewesen war, jetzt waren sie von seiner stillen und edlen Trauer beeindruckt.
Henri gab dem Gutsverwalter unter Tränen den Befehl, sofort die Behörden und auch den Notar der Familie über den Unfall zu informieren. Sollte der Graf weiterhin vermisst werden, würde der Notar die Familie informieren und die Erben ermitteln müssen. Der Verwalter, der Henri immer mit Argwohn beäugt hatte, war angenehm überrascht. Er war eigentlich davon überzeugt gewesen, dass Henri versuchen würde, die Position des Grafen sofort an sich zu reißen. Selbst hier in der Provinz hatte es sich herumgesprochen, dass Henri keinen einzigen Sou besaß und vom Grafen ausgehalten wurde.
Irgendwie schien es dann nur natürlich, dass der persönliche Kammerdiener des Grafen nun auch Henri bediente und ihn damit indirekt als den neuen Herrn anerkannte. Während er sich immer wieder geräuschvoll die Nase schnäuzte, hatte der Kammerdiener Mühe, seine Tränen zurückzuhalten. Der verschollene Graf war ein guter Herr gewesen – zu gut und zu naiv, würden einige unten im Dienstbotentrakt murmeln.
Schweigend ertrug Henri die entnervende Zurschaustellung von Hingabe des alten Kammerdieners. Alberner, alter Narr, dachte Henri, bald wirst du auch nach meiner Pfeife tanzen, dann gibt es keine tränenreichen Szenen mehr.
Das warme Gefühl des Triumphs machte sich in Henri breit. Er war sich jetzt sicher, dass er in der Lage sein würde, jede Herausforderung zu meistern, die sich ihm bieten würde. Dies galt auch für Marina, er konnte sie einfach nicht seine Frau nennen, oder ihren Zigeunerstamm. »Ich bin ein Genie!«, flüsterte er und kostete die Worte aus. »Mein Plan war einfach perfekt. Schon bald wird die Welt wissen, dass ich der neue Comte de Roquemoulin bin. Ich werde ein reicher Mann sein, ein Mann, mit dem man rechnen muss. Liebster Cousin Pierre und auch du alte Krähe Richelieu, nehmt euch in Acht!«, und er brach in ein wildes Gelächter aus.
Henris Gedanken kehrten zu Marina zurück: Sie war schön, in ihrer Wildheit begehrenswert, aber sie war zu einem Ärgernis geworden. Was sollte er mit ihr machen? Plötzlich blitzte eine neue, wundervoll bösartige Idee auf. Marina und ihr Clan sind niemandem außer mir bekannt, dachte er – was für eine großartige Waffe kann daraus werden!
Er lächelte zufrieden. Der Graf von Roquemoulin zu werden war eine Leistung, aber das reichte nicht. Seine Bestimmung war es, der Marquis de Beauvoir zu werden. Selbst in den schwierigsten Momenten, hatte Henri nie einen Zweifel an seiner Bestimmung gehegt.
Das Schicksal hatte ihm eine neue Waffe in die Hand gespielt – er würde seine niedrig geborene, aber äußerst attraktive Frau benutzen, um Pierre de Beauvoir eine Falle zu stellen und ihn zu vernichten. Erst wenn diese Aufgabe erfüllt war, würde er sich der Frage zuwenden, wie er Marina loswerden konnte. Sie würde noch für die Anmaßung, ihn zu einer Hochzeit gezwungen zu haben, büßen müssen.
»Du wirst für deine Arroganz und Unverschämtheit noch teuer bezahlen, Marina Darling«, flüsterte er.
Bald schon schlief er tief und fest. Es war der zufriedene Schlaf, der jedem nach einem Tag harter, aber lohnender Arbeit gegönnt ist. Aber in seinen Träumen tauchte weder der unglückliche Jean Baptiste de Roquemoulin, noch seine neue Frau auf – er sah und küsste das Gesicht von Marinas unnahbarem und doch so gut aussehendem Bruder.
***
Der alte Notar, der der Familie seit Jahrzehnten pflichtbewusst gedient hatte, erschien schon am nächsten Tag, trauernd, aber auch nervös. Er wurde in die stickige Bibliothek geführt, die Jean Baptiste de Roquemoulin so selten benutzte hatte.
Henri spielte seine Rolle wieder einmal fehlerlos. Mit dem Respekt, der seinem Amt gebührte, und mit der richtigen Mischung aus Kummer und Trauer empfing er den Notar bescheiden und bat ihn demütig um Hilfe und Beistand in dieser schrecklichen Stunde der Bedrängnis.
»Ich weiß, dass es der letzte Wille meines geliebten Jean Baptiste war, mich zu adoptieren, aber da ich nicht weiß, ob sein Wunsch in Erfüllung gegangen ist, ist es nun meine traurige Pflicht, mich auf eine Zukunft ohne den Menschen vorzubereiten, der mir so viel bedeutet hat.« Henris Stimme brach meisterhaft und er wischte sich eine imaginäre Träne aus seinem linken Auge. »Maître, darf ich Sie daher förmlich bitten, die gesetzlichen Erben zu ermitteln und ihre Vorladung vorzubereiten, sobald – und ich darf mir das gar nicht vorstellen, der geliebte Graf von den Behörden als tot erklärt werden sollte?«
Der Notar war sichtlich erschüttert. Er war allerdings angenehm überrascht, nicht nur von Henris aufrichtiger Trauer, sondern auch von seiner vornehmen Zurückhaltung. Als er das letzte Mal Roquemoulin verlassen hatte, war er der Überzeugung gewesen, dass der Graf völlig verrückt geworden sein musste. Instinktiv hatte er Henri als adligen Abenteurer und Tunichtgut eingeschätzt. Er war auch erstaunt festzustellen, dass Henri sich nicht bewusst zu sein schien, dass die Adoption bereits abgeschlossen war.
Der Notar räusperte sich. »Die nächste Verwandte des Grafen ist Ihre Gnaden, die Herzogin von Limoges«, sagte er in seiner langsamen und präzisen Diktion.
Henri musste sich beherrschen, er wurde von einem fast unbändigen Drang gepackt, sich auf den Boden zu werfen und sich vor Lachen zu wälzen – das war einfach zu schön, um wahr zu sein! Das Leben konnte die wildesten Fantasien immer noch übertreffen. Wie gerne würde er die Szene miterleben, wenn die Herzogin die Nachricht erhielt, dass er ihr das fette Erbe weggeschnappt hatte.
Den Wutanfall zu genießen, sobald sie realisierte, dass sie es verpasst hatte, eines der größten Vermögen zu erben, das Frankreich zu bieten hatte – und dass dieses Erbe nun an ihren abgelegten Liebhaber ging.
Schnell verbarg er sein Gesicht hinter einem Taschentuch. Der Notar deutete sein zuckendes Gesicht als ein weiteres Zeichen tiefer und echter Trauer.
»Aber was die Situation Eurer Lordschaft angeht«, fuhr der Notar fort, »so freut es mich, Ihnen mitteilen zu können, dass der Prozess der Adoption Eurer ehrenwerten Person auf Wunsch des verstorbenen Grafen«, er korrigierte sich schnell, »ich meine des Grafen de Roquemoulin, der leider als vermisst gemeldet wurde, bereits abgeschlossen wurde. Die von mir als Notar gesiegelten Dokumente sind bereits vor einigen Wochen an den Grafen übergeben worden. Eigentlich hatte ich erwartet, dass diese Tatsache bekannt ist.«
Er beobachtete Henri aufmerksam, aber einmal mehr gelang es Henri, perfekt zu reagieren. Seine Miene zeigte erst tiefe Trauer, dann ein plötzliches Erfassen der Bedeutung der letzten Worte des Notars, echte Überraschung und schließlich demütige Dankbarkeit.
»Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll«, sagte Henri nach einer längeren Pause. »Ich weiß, dass dies der Wunsch des Grafen war. Vielleicht wollte er mich zu meinem Geburtstag überraschen, es wäre ein wahrhaft edles Geschenk gewesen.« Er wandte sein Gesicht ab und fuhr mit gebrochener Stimme fort: »Aber wie soll ich jemals meine Dankbarkeit ausdrücken, jetzt, wo mein liebster, väterlicher Freund nicht mehr hier ist …« Den letzten Satz beendete er nur noch im Flüsterton. Von seinen Gefühlen überwältigt, verbarg er wieder sein Gesicht.
Der Notar gab ein paar tröstende Laute von sich, da er nicht wusste, wie er antworten sollte. Er missbilligte die skandalösen Motive hinter dieser Adoption immer noch, aber Henri war der unbestrittene und alleinige Erbe eines immensen Vermögens geworden und der Notar hatte nicht die Absicht, gute Geschäfte wegen Fragen anstößiger Moral zu verderben.
Henri gelang es mit sichtlicher Mühe, seine Fassung wiederzuerlangen. Er schüttelte die Hand des Notars, um ihm für sein Mitgefühl zu danken. Dann räusperte er sich. »In diesem Fall schlage ich vor, den Verwalter des Anwesens zu rufen. Solange der Graf verschwunden bleibt, muss ich die Verwaltung des Anwesens übernehmen. Jean-Baptiste würde dies von mir erwarten. Daher halte ich es für besser, wenn Sie dem Verwalter persönlich mitteilen, dass ich in Zukunft als Henri de Roquemoulin angesprochen werden sollte.«
Der Notar nickte, die Bitte schien wohlbegründet genug zu sein. Der Verwalter wurde gerufen und er erschien schnell. Als er vom Notar informierte wurde, dass Henri nun laut Gesetz der Sohn des verschwundenen Grafen und damit präsumtiver Erbe war, presste er die Lippen zusammen, verbeugte sich jedoch höflich vor Henri. »Darf ich Ihnen gratulieren? Wünschen Sie, dass ich Sie ab sofort als Graf de Roquemoulin anspreche?«
Henri lehnte sofort bescheiden ab. »Natürlich nicht! Wir alle sehnen uns so sehr danach, unseren geliebten Graf wohlbehalten zurückzusehen, es ist viel zu früh, die Hoffnung aufzugeben. Ich habe vor, heute Nachmittag weitere Suchtrupps, diesmal unten an den Ufern der Loire zu organisieren. Lasst uns alle zum Herrn beten, dass wir den Graf finden. Ich kann mir dieses Schloss gar nicht ohne ihn vorstellen. Ich wollte nur, dass Sie über die letzten Neuigkeiten informiert sind. Ich habe heute erst erfahren, dass unser geliebter Graf mich adoptiert hat. Ich bin immer noch überwältigt von dem Ausmaß seines Vertrauens und seiner Herzensgüte.«
Der Verwalter schaffte es, sein Gesicht ausdruckslos zu halten. Er war weniger leichtgläubig als der Notar. Es gehörte zu seiner täglichen Routine, von seinen Untergebenen belogen zu werden und er glaubte daher kein einziges Wort von Henris fassungsloser Überraschung und war auch nicht beeindruckt von dieser Zurschaustellung von falscher Bescheidenheit. Aber er hatte eine gute Position – die er gerne behalten wollte – daher tat er so, als würde er Henris Worte für bare Münze nehmen und verbeugte sich noch einmal respektvoll – wenn möglich, noch tiefer als zuvor.
Höflich, aber bestimmt lehnte der Notar Henris Einladung ab, zum Mittagessen zu bleiben. Er verließ das Anwesen mit gemischten Gefühlen. Widerwillig musste er zugeben, dass Henri einen viel günstigeren Eindruck auf ihn gemacht hatte als beim letzten Mal – aber irgendwie sagte ihm sein sechster Sinn, dass etwas nicht stimmte, und er verließ das Schloss immer noch verwundert über das plötzliche Verschwinden des Grafen – und besorgt. Aber sobald er in seiner Kutsche saß, zuckte er mit den Schultern – im Endeffekt es gab nichts, was er tun konnte, außer zu versuchen, so viel Geld wie möglich aus der Verwaltung dieses Erbes zu gewinnen.
Henri war zufrieden mit den Ergebnissen der morgendlichen Treffen. Er entließ den Verwalter, wissend, dass dieser die Nachricht in Windeseile verbreiten würde. Wie zu erwarten gewesen war, brummte das Schloss zur Mittagszeit wie ein Bienenstock und die Dienerschaft verbeugte sich noch tiefer als zuvor.
Henri gab vor, keine Veränderung zu bemerken und beteiligte sich pflichtbewusst an dem nutzlosen Suchtrupp, den er mit viel Aufwand organisiert hatte. Unermüdlich trieb er die Stallknechte an, weiterzusuchen, bis sie vor Erschöpfung von ihren Pferden fielen.
Während der Suche, inmitten seiner Lakaien und Stallknechte, bemerkte Henri von Zeit zu Zeit einige Zigeuner, die wie Schatten am Horizont erschienen und vorsichtig Abstand hielten. Es dauerte nicht lange, bis seine Männer sie ebenfalls bemerkten und die üblichen abfälligen Bemerkungen fallen ließen – Zigeuner waren bei der Landbevölkerung verhasst. Ein Stallknecht schlug sogar vor, die Hunde auf sie zu hetzen. »Lasst uns diesen dreckigen Abschaum vom Gelände jagen, sie belästigen unsere Frauen und stehlen – das ist alles, was sie können«, brummte er unter dem Beifall seiner Stallburschen.
Doch Henri erinnerte ihn daran, dass der Graf von Roquemoulin eine solche Aktion niemals akzeptiert hätte, und der Knecht gab Ruhe. Aber die Anwesenheit der Zigeuner erinnerte Henri schmerzlich daran, dass er unter ständiger Aufsicht stand.
Zurück im Schloss – seinem Schloss – ließ er sich auf sein Bett fallen, zufrieden mit der Arbeit des Tages. Henri fühlte sich beschwingt, obwohl er von der körperlichen Anstrengung des Reitens und Suchens völlig erschöpft war. Was für eine Glückseligkeit, sich seiner Müdigkeit hinzugeben und die Maske des trauernden Sohnes fallen lassen zu können.
Henri musste tief geschlafen haben, denn er bemerkte nicht, dass jemand sein Zimmer betreten hatte, bis es zu spät war. Eine starke, muskulöse Hand bedeckte seinen Mund mit einem eisernen Griff und drückte ihn tief in sein Bett. Henri öffnete seine Augen und erkannte das attraktive Gesicht von Marinas Bruder, das nur Zentimeter über seinem eigenen schwebte.
»Ich habe dir ein Geschenk für heute Abend mitgebracht«, flüsterte der Zigeuner und lockerte seinen Griff ganz leicht, nur um ihn wieder fest zu schließen, als Henri versuchte, seinen Mund zu öffnen.
Was ist mit dir, du könntest mein Geschenk für heute Nacht sein … schoss es Henri durch den Kopf, seine Erregung durch das Gefühl von Gefahr nur noch verstärkt.
»Halte die Klappe, wenn du noch etwas Luft in deinen Lungen behalten willst, schau dir zuerst dein Geschenk an«, befahl der Zigeuner mit rauer Stimme.
Henri entdeckte Marinas Silhouette im Mondlicht nahe an seinem Bett. Langsam drehte sie sich zu ihm und begann sich zu entkleiden, lockte ihn mit jeder Bewegung und reizte ihn mit jedem Teil ihrer Kleidung, die sie langsam auszog. Sie gab ihrem Bruder ein Zeichen sich zurückzuziehen und er hörte ihre heisere Stimme dicht an seinem Ohr. »Es ist an der Zeit, unsere Ehe zu vollziehen und deinen Sohn zu zeugen«, flüsterte sie ihm ins Ohr, dann strich sie mit dem Ärmel ihrer offenen Bluse über seine nackte Brust.
Henris Müdigkeit war längst verflogen, und die Fremdartigkeit der Situation ließ ihn vor Erregung zittern. Der Triumph und das Hochgefühl nach seinem erfolgreichen Mord, die seltsame Konstellation, die exotische Schönheit Marinas und – das musste er sich eingestehen – das Wissen, dass ihr attraktiver Bruder vermutlich ihr Liebesspiel beobachtete, wirkten wie ein Katalysator.
»Hast du mir nicht gesagt, dass du bereits schwanger seist?«, flüsterte er zurück. »Aber ich habe nichts dagegen, es noch einmal zu versuchen.«
Marina lachte leise und triumphierend, sein Nachthemd flog achtlos auf den Boden und Henri fand sich nackt auf dem Bett liegend wieder.
Henri streckte sich genüsslich, wissend, dass Marina und vielleicht auch ihr Bruder seine Erregung sehen konnten. Er zog Marina an sich und unermüdlich trieb er sie an den Rand des Wahnsinns, während er ihr Stöhnen und Schreien mit seiner Faust unterdrückte. Im Vorzimmer wartete sein Kammerdiener und das geheime Liebesspiel musste in absoluter Stille stattfinden. Aber dieses Wissen steigerte nur den Nervenkitzel und gab dem Ganzen eine zusätzliche Würze.
Als sie endlich fertig waren, lag sie in seinen Armen, schlaff und erschöpft, ihr dunkles Haar kitzelte seine Brust. Plötzlich tauchte ihr Bruder aus dem dunklen Schatten auf und machte ihr leise Zeichen, dass sie gehen mussten. Sein Gesicht machte deutlich, dass er verärgert war.
»Wir kommen wieder«, flüsterte Marina Henri zu, »und du kannst wählen, ob es wieder um Liebe geht – oder um Krieg.« Die beiden verließen den Raum durch das Fenster, wie sie ihn betreten hatten; Gott allein wusste, wie sie es geschafft hatten, unbemerkt die steilen Schlossmauern hinaufzuklettern.
Henri streckte sich wie ein zufriedener Kater in seinem Bett. Was für ein perfektes Ende für einen wunderbaren Tag, dachte er träge. Vielleicht dachte Marina, dass sie ihn nach ihrer Pfeife tanzen lassen, ihn zu einem Sklaven ihrer wilden Schönheit machen könnte. Aber wie so viele seiner früheren Liebhaberinnen würde auch sie auf die harte Tour lernen müssen, dass für Henri de Beauvoir Gehirn und Körper zwei völlig verschiedene Angelegenheiten waren und er niemals zulassen würde, dass sein Gehirn von den Launen oder Wünschen seines Körpers beherrscht wurde.
Henri konnte sich an keinen Liebhaber erinnern – weder männlich noch weiblich – der ihn nicht nach kurzer Zeit gelangweilt hatte. Er würde sie dazu bringen, nach seiner Pfeife zu tanzen, schwor sich Henri, bevor ein tiefer Schlummer ihn forttrug. Aber in der Zwischenzeit würde er genießen, was sie zu bieten hatte.
Der Diamantring
»Also, wie haben Sie sich entschieden?«, donnerte die tiefe Stimme des Marquis de Saint Paul durch den stillen Raum.
Der alte Bankier lächelte unbeirrt und fuhr mit seiner wohlklingenden Stimme fort: »Was konnte ich anderes tun, als ihm zu geben, was er wollte?«, antwortete er schlicht.
Armand sprang wütend von seinem Stuhl auf, aber Monsieur Piccolin gab ihm ein Zeichen, sich zu beruhigen.
»Gemach, gemach, hören Sie zu, Monsieur«, antwortete er mit plötzlich kraftvoller und autoritärer Stimme. Jetzt verstanden alle, warum dieser nette, sanftmütige Herr das Oberhaupt einer Bank war, die den Reichen und Berühmten diente. »Schwört einen feierlichen Eid, dass das Geheimnis, das ich jetzt mit euch teilen werde, niemals verraten wird. Es darf nur eine Ausnahme von dieser Regel geben – der Großmeister der Templer!«
Drei Paare schockierter Augen richteten sich auf den alten Bankier – woher konnte er wissen, dass dieser Ring der Bruderschaft versprochen worden war? Armand und Pierre nickten zustimmend und auch der Marquis de Saint Paul, der immer noch versuchte, diese plötzliche Enthüllung zu verdauen, gab nach und akzeptierte.
»Ich hielt es für das Beste – für mich und für Sie, meine Herren – Seiner Eminenz den begehrten Diamantring zu schenken, aber – und ich bestehe darauf, dass dies unter uns bleiben muss – ich habe den Ring Eurer Gnaden kopieren lassen, bevor ich ihn ihm gegeben habe.«
Und mit einem breiten Lächeln und der Geschicklichkeit eines Magiers packte er ein kleines Samtpäckchen aus und entnahm zur großen Überraschung der drei Anwesenden den Ring, den Pierres Vorfahren seit Generationen gehütet hatten.
»Dies ist der echte Ring, der aus dem Königreich Jerusalem stammt und von Generationen der Vorfahren Eurer Gnaden getragen wurde – hüten Sie ihn gut!«
Pierre nahm den Ring mit zitternden Händen entgegen. Er fühlte sich plötzlich demütig. Der Diamant schien eine überirdische Kraft auszustrahlen – die Sonnenstrahlen hatten ihn zum Leben erweckt und er sandte kräftige, fast zornige Blitze aus, zufrieden, endlich der Dunkelheit seines samtenen Gefängnisses entkommen zu sein.
Mit größter Sorgfalt zog Pierre den Rubinring seines Großvaters mütterlicherseits von seinem Finger und legte die beiden Ringe nebeneinander. Es wurde nun offensichtlich, dass die seltsame Form der goldenen Fassungen eine Einheit bildete und es wurde auch klar, dass die Gravuren zusammengehörten – sie ergänzten sich perfekt. Aber es blieb unmöglich, die seltsame Gravur zu entziffern. Ohne den dritten Ring konnte das Rätsel nicht gelöst werden.
Pierre betrachtete den Ring mit Ehrfurcht. »Sie sind sicher, das ist wirklich das Original?«, hauchte er.
»Ja, ich schwöre es beim Leben meiner Kinder und bei meiner Ehre – und«, er strahlte vor Stolz, »ich kann Ihnen versichern, dass es mich mehrere Tage und beste Verbindungen gekostet hat, um in Frankreich einen Diamanten gleicher Qualität zu finden. Kardinal Mazarin mag zwar gierig sein, aber er ist kein Narr und er ist ein anerkannter Experte. Ich hätte ihn niemals überzeugen können, wenn der Diamant seiner Kopie etwas anderes als erstklassig gewesen wäre.«
Monsieur Piccolin versuchte vergeblich, bescheiden zu wirken, aber es war klar, dass er sehr stolz auf sich war.
Pierre verdaute noch diese Geschichte, als ihm ein anderer Aspekt dämmerte.
»Ich bin Ihnen wirklich dankbar, Monsieur Piccolin, dankbarer als ich es mit Worten ausdrücken kann. Sie haben uns heute gelehrt, an den Anstand zu glauben und nicht jede Geschichte für bare Münze zu nehmen. Aber Ihre edle Tat bedeutet, dass ich Ihnen nicht nur zu großem Dank verpflichtet bin, sondern ein Vermögen schulde! Ich meine, wenn ich es richtig verstehe, hatte mein Vater nie die Möglichkeit, sein Darlehen zurückzuzahlen und nun haben Sie für mich einen zweiten Diamanten von unglaublichem Wert gekauft und vorgelegt! Es ist mir eine Verpflichtung, meine Schulden zu begleichen, aber so viel Geld aufzutreiben, wird einige Zeit brauchen!«
Monsieur Piccolin war sichtlich gerührt und er musste sich räuspern, bevor er antworten konnte. »Euer Gnaden, es war mir ein wahres Vergnügen, dem neuen Marquis de Beauvoir als Oberhaupt einer Familie zu dienen, die uns seit Generationen mit ihrem Vertrauen beehrt – und ich muss gestehen, dass es für mich auch eine persönliche Genugtuung war, einen unverschämten Fuchs wie Kardinal Mazarin zu überlisten. Sein Ultimatum, das Vertrauen eines Kunden zu verraten oder meine Bank schließen zu lassen, gefiel mir ganz und gar nicht. Das ging eindeutig zu weit.«
Der Bankier nahm seine Brille ab und begann sie energisch zu polieren, bevor er mit leiser Stimme hinzufügte: »Aber lassen Sie uns diese Angelegenheit abschließen, der Kardinal ist glücklich und Euer Gnaden ist im Besitz des Ringes, der rechtmäßig der Familie de Beauvoir gehört.«
Dann räusperte er sich und fuhr fort. »Tatsächlich sollte ich gestehen, dass ich zufällig weiß, warum Euer Gnaden den Ring dringend benötigt – und warum Sie und ihr Freund Armand de Saint Paul gezwungen sein werdet, Frankreich in Kürze zu verlassen, um den dritten Ring zu finden.«
Er hielt noch einmal inne und nahm das Glas Wein, das Armand ihm angeboten hatte, gerne an. Pierre sah Armand an und sie tauschten verwirrte Blicke aus. Dieses Treffen steckte tatsächlich voller Überraschungen.
Als der Bankier das Glas Wein nahm, bewegte er seine Hand und zum ersten Mal erkannten sie die Bedeutung des Siegels des goldenen Rings, den Piccolin heute zu tragen gewählt hatte. Vom Alter gezeichnet zeigte er ein eigenartiges Wappen, das zwei Ritter zeigte, die gemeinsam auf einem Pferd saßen – das Wappen der Templer.
»Es gibt keinen Grund, mir das Geld sofort zurückzuzahlen. Ich weiß, dass Ihr Vater das Geld, das wir ihm geliehen haben, in ein Unternehmen in den neuen Kolonien investiert hat und ich weiß – nicht ganz zufällig, dass dieses Geld gut angelegt war.«
Er gluckste. »Aber in Wirklichkeit wird der Kardinal selbst für beide Ringe zahlen, ich habe ihm meinen Preis schon genannt. Daher werde ich Ihnen gerne diesen Ring als Geschenk überreichen; bitte nehmen Sie ihn auch als Zeichen der Verbundenheit meiner Familie mit der Sache der de Beauvoirs an.«
Pierre betrachtete den Ring: Dies war ein königliches Geschenk. Kurzentschlossen ignorierte Pierre die Regeln des Protokolls und seines hohen Ranges. Es war an der Zeit, das Herz sprechen zu lassen.
Und so kam es, dass Seine Gnaden, der Herzog von Hertford, der edle Marquis de Beauvoir, ein Peer von Frankreich und des Königreichs Großbritannien, aufsprang, zu dem Bankier eilte und den alten Mann umarmte, als wäre er ihm ebenbürtig und ein Mitglied seiner eigenen Familie.
Monsieur Piccolin war ebenso fassungslos wie der Marquis de Saint Paul. Noch Jahre später konnte der Bankier nur mit Tränen in den Augen seiner eigenen Familie von dieser Szene erzählen. Für ihn waren Pierres Wertschätzung und Dankbarkeit weit mehr wert gewesen als zwei Diamantringe.
Er versuchte, seine Fassung wiederzuerlangen, und sagte: »Ich freue mich, dass Sie meine bescheidenen Dienste zu schätzen wissen. Ich fühle mich wahrlich geehrt, Euer Gnaden. Ich weiß, dass Ihr bald nach Venedig aufbrechen müsst, um den dritten Ring zu finden. Es wird mir ein Vergnügen sein, Ihnen und Ihrem Freund in dieser Hinsicht zu helfen.«
Armand, der bis jetzt ungewöhnlich ruhig gewesen war, meldete sich:
»Das war sehr edel von Ihnen, Monsieur. Auch ich möchte mich von ganzem Herzen bedanken. Wir müssen unsere Reise planen und es wäre uns eine Ehre, wenn Sie morgen zum Abendessen kommen könnten. Sie scheinen mit unserer Mission erstaunlich vertraut zu sein – und ich schätze, dass Sie uns wertvolle Hilfe leisten können.«
Er lächelte den Bankier an, der sichtlich erfreut zurücklächelte.
»Ich nehme gerne an«, strahlte der alte Bankier. »Ich bin überzeugt, ich kann Ihnen bei dem Vorhaben behilflich sein, Messieurs. Die meisten Leute denken immer, dass eine Bank nur Geld verleiht, aber glauben Sie mir, der größte Teil unserer Arbeit – unser wahres Vermögen – besteht darin, Informationen zu sammeln und sie zu nutzen – nicht unähnlich unserem derzeitigen Premierminister. Er würde übrigens einen exzellenten Banker abgeben – vielleicht nicht immer vertrauenswürdig genug. Aber diese Aussage trifft auf die meisten Politiker zu, denke ich.«
Er kicherte über seinen Scherz und verbeugte sich tief, wobei er sorgfältig darauf achtete, sich noch ein wenig tiefer vor dem Marquis de Saint Paul zu verbeugen, der diese Geste mit Genugtuung bemerkte, und verabschiedete sich.
Der Bankier hatte bereits den Raum verlassen, doch es herrschte noch absolute Stille im Raum. Die drei Männer waren fassungslos.
Armand war es, der die Stille unterbrach.
»Das ist doch unfassbar! Wir haben überall nach diesem verfluchten Diamantring gesucht. Alles war so geheim, dass wir alle ständig nur in Andeutungen geredet haben, aber während dieser gesamten Zeit hat dieser Mann mehr Wissen über die ganze Geschichte gehabt als wir drei zusammen. Ich fühle mich irgendwie blöde – aber gleichzeitig bin ich mehr als erleichtert. Ich hatte mir schon ausgemalt, wie ich in Mazarins Palast einbreche und versuchte, eine passende Ausrede für den Moment zu finden, in dem er mich in seinem Schlafzimmer beim Durchwühlen seiner riesigen Sammlung von Juwelen erwischt. Hätte ich ihm erklären sollen, dass Kleptomanie leider eine leichte Charakterschwäche unserer Familie ist?«
Armands anschauliches Bild brach das Eis und Pierre musste lachen; selbst der Marquis erlaubte sich ein dünnes Lächeln, obwohl ihm sicherlich der Gedanke nicht gefiel, den erhabenen Namen de Saint Paul mit kleptomanischen Neigungen in Verbindung zu bringen.
»Dann lasst uns weiter über eure Mission sprechen«, erinnerte der Marquis die beiden Freunde.
»Wir wissen jetzt, dass der dritte Ring das Rätsel der Gravuren entschlüsseln und euch logischerweise zum verborgenen Schatz führen kann. Da sogar unser Bankier zu wissen scheint, dass sich der dritte Ring in Venedig befindet, müssen wir eure Reise in den Süden planen. Die Templer haben ihren Teil der Abmachung eingehalten, ihr müsst nun euren einhalten.«
»Das ist offensichtlich, es ist nicht nötig, uns daran zu erinnern, Vater«, sagte Armand. »Pierre und ich sind bereit zum Aufbruch. Morgen kann es gerne losgehen.«