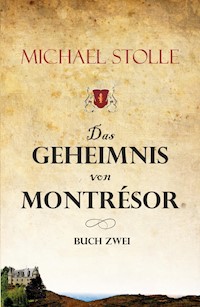5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der Waisenjunge und der Kardinal
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Wir schreiben das Jahr 1643. Der englische König kämpft verzweifelt um seine Krone. Der intrigante Kardinal Mazarin ist jetzt Premierminister von Frankreich. Ebenso verschlagen wie sein Vorgänger Richelieu, engagiert er den ehemaligen Offizier François de Toucy, um die Königin von England, eine frühere französische Prinzessin, in Sicherheit zu bringen. François und seine Freunde machen sich also auf die gefährliche Reise nach England. Während François versucht, sich im Labyrinth der Intrigen des königlichen Hofes zurechtzufinden, verliebt sich sein Freund Armand in die Hofdame der Königin, die ebenso schön wie gerissen ist. Wird die Liebe siegen? Auch der Herzog von Hertford muss eingreifen und schon bald sehen sich die Freunde gefangen in einer tödlichen Kombination aus politischem Kalkül, Katastrophen auf dem Schlachtfeld und erbitterten Intrigen bei Hofe. Als wäre das alles nicht genug, droht ein unbekannter Wahrsager aus London, den Freunden Tod und Unheil zu bringen. Eine fesselnde Geschichte, die sich nahtlos an die Trilogie »Der Waisenjunge und der Kardinal« anschließt. Das Buch ist eigenständig, das Lesen der vorherigen drei Bände nicht erforderlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 617
Sammlungen
Ähnliche
Michael Stolle
Der Herzog und der Wahrsager von London
Historischer Roman
Copyright: © 2021 Michael Stolle
Umschlag & Satz: Erik Kinting – www.buchlektorat.net
Verlag und Druck:
tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
Softcover 978-3-347-49304-9
Hardcover 978-3-347-49305-6
E-Book 978-3-347-49306-3
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Prolog
Die Pforten der Hölle hatten sich geöffnet.
Licht, gelb und giftig wie Schwefel, sickerte aus den schwarzen Wolken, die sich über dem Reiter zusammenballten. Sie wirkten so drohend, dass sie vermutlich die unmittelbare Ankunft des Fürsten der Finsternis und das Ende der Welt ankündigten.
Jeden Moment würden die Reiter der Apokalypse auftauchen und ihn vor sich herjagen, ihre grinsenden Schädel von mottenzerfressenen Kutten bedeckt. Hatte sein Beichtvater nicht darauf bestanden, dass er immer und ständig auf das Jüngste Gericht vorbereitet sein sollte?
Aber seine Heimat Frankreich und sein Beichtvater waren weit entfernt. Verzweiflung überkam ihn – warum hatte er sich überhaupt jemals entschlossen, nach England zu kommen?
Am Ende war es keine Armada von sensenschwingenden Gespenstern, die vom Himmel herabstieg, sondern dichter Regen, gefolgt von Hagel, der auf ihn niederprasselte und Armand begann sich zu fragen, ob das nicht noch schlimmer war. Vergeblich versuchte er, sich und sein kostbares Pferd vor dem plötzlichen Ansturm der Hagelkörner zu schützen, die so groß wie Taubeneier und so schwer wie Kieselsteine waren. Kein Wunder, dass sein Pferd scheute, vor Schreck die Augen rollte und vor Schmerz und Angst wieherte.
Jetzt hatte auch der Donner eingesetzt, der seine Ohren betäubte und alle anderen Geräusche übertönte, während sein Echo durch den Wald rollte und allen die Apokalypse ankündigte, die nun sicherlich unmittelbar bevorstand. Es war dunkel wie in der tiefsten Nacht. Nur vage konnte Armand die Silhouetten der hohen Bäume noch in der Dunkelheit erspähen. Die Äste waren noch kahl, denn der Frühling ließ auf sich warten – falls dieses gottverlassene Land überhaupt jemals wieder einen Frühling oder Sommer erleben würde.
Wie sollte er sich jemals in dieser höllischen Dunkelheit zurechtfinden?
Als ob jemand seine Gedanken gelesen hätte, zuckten plötzlich Blitze herab und warfen ihr blendend helles Licht auf die Bäume um ihn herum. In dem gleißenden Licht sah er die kahlen Bäume mit ihren abgestorbenen Ästen, die sich in den dunklen Himmel reckten. Es waren klägliche Skelette, die um den letzten Segen des Himmels flehten. Immer mehr Blitze folgten, ohne Pause, und ließen nun auch das Unterholz lebendig werden, wie kauernde Phantome der Unterwelt, die nur darauf gewartet hatten, sich auf ihn zu stürzen.
»Heilige Jungfrau, hilf mir, ich muss einen Unterschlupf finden! In diesem gottverlassenen Wald muss es doch irgendeinen Unterschlupf geben«, fluchte er laut und kämpfte gegen das lähmende Gefühl der Verzweiflung an.
Armand saß seit den frühen Morgenstunden im Sattel, war durch endlose Weiden und Wälder geritten, immer in der Hoffnung, Winchester zu erreichen, bevor das Gewitter losbrach.
Bis zum Mittag hatte ihm der Umriss einer blassen Sonne geholfen, sich zu orientieren, aber bald, viel zu bald, war die bleiche Scheibe der Sonne hinter dem dichten Wolkenvorhang verschwunden – wie so oft in diesem elenden Land. Ohne jegliche Orientierung hatte Armand den Weg verloren und wusste nicht mehr, wo er sich befand oder wohin er sein Pferd in diesem Wald, der zu einem Labyrinth ohne Ausgang geworden war, lenken sollte. Ritt er im Kreis? Er konnte es nicht mehr einschätzen.
Erschöpft folgte er einfach einem schmalen Pfad, der mit Schlaglöchern und tückischen Wurzeln übersät war und hoffte und betete, dass er ihn in die richtige Richtung führen würde.
Armand kämpfte nicht nur gegen das wachsende Gefühl der Verzweiflung an, er konnte auch kaum noch die Augen offen halten. Er war hungrig und völlig erschöpft. Doch ihm war bewusst, dass er sich nicht den Luxus leisten konnte, sich auszuruhen. Er musste wachsam sein, nicht nur, weil sein Ende besiegelt sein konnte, wenn er in diesem Gewitter unter einem Baum einschlief. Armand wusste, dass er gejagt wurde.
Diese Jagd hatte nur ein Ziel: alle Unterstützer, Offiziere und Soldaten des Königs von England, auch Kavaliere genannt, zu finden und zu eliminieren. Und er, Armand de Saint de Paul, gehörte dazu.
Blitz und Donner zogen weiter und Armands Pferd wurde ruhiger, als der Hagel endlich aufhörte; sie ritten nun langsam weiter. Das Pferd war genauso müde wie sein Reiter und so wankten sie voran, Schritt für Schritt. Armand lachte auf, aber selbst für seine eigenen Ohren klang es nicht besonders fröhlich.
»Was für ein tolles Team wir doch sind: ein lahmes Pferd und ein geschlagener Ritter, die in dieser dunklen Hölle gegen alle Widrigkeiten kämpfen!«, rief er laut in Dunkelheit.
Wie eine Antwort löste sich ein schwarzer Schatten von einem der Bäume und automatisch griff Armands Hand zu seinem Schwert, bereit zur Verteidigung. Doch es war nur eine schwarze Krähe, die ihr Versteck verließ und sich durch den herannahenden Reiter gestört fühlte.
Unheimliche Geschichten über diesen Wald kamen ihm in den Sinn, Geschichten, die man sich nachts unter Kameraden an den Lagerfeuern zugeflüstert hatte. Es waren unterhaltsame Geschichten gewesen – zumindest während er am knisternden Feuer saß, einen Krug mit Ale leerte und mit seinen Kameraden frotzelte.
»Dort unten im Südwald leben noch immer Hexen und Zauberer, die seit uralten Zeiten ihre dunklen Künste praktizieren. Aber diejenigen, die zu neugierig waren und die Elfen beobachtet haben, wie sie unter den verzauberten Bäumen tanzten«, hatte der Geschichtenerzähler geflüstert und dabei bedrohlich mit den Augen gerollt, »diese armen Seelen haben es nie mehr nach Hause geschafft.«
Die Krähe krächzte noch einmal verächtlich und verhöhnte den einsamen Eindringling, der es gewagt hatte, den Frieden des verwunschenen Waldes zu stören, bevor sie sich in langsamen Kreisen nach oben schraubte.
Der letzte Donner verklang, aber die darauf folgende Stille war fast genauso beunruhigend wie der Lärm zuvor. Der heftige Regen verwandelte sich in ein leichtes Nieseln; hoffentlich würde er bald ganz aufhören. Wenn Armand nur mehr Licht hätte. Und ein Feuer. Pferd und Reiter waren durchnässt und ihm war eiskalt.
Armands Gedanken schweiften ab. Cheriton! Werde ich eine solche Schlacht jemals vergessen können?
Es war eine Schlacht, die mit allen Vorzeichen eines leichten Sieges für die Kavaliere des Königs begonnen hatte, aber in einem totalen Fiasko geendete hatte. Armand schloss die Augen. Er hörte noch immer die verzweifelten Schreie der Verwundeten und Sterbenden, die fast menschlichen Schreie der Pferde, die sich die Beine brachen und dabei zu Boden stürzten, und die Geräusche der Kanonensalven, die aus allen Rohren schossen. Armand konnte immer noch das Blut riechen und schmecken – Blut, das überall gewesen war, Pferdeblut, menschliches Blut, ein glitschiges Durcheinander auf dem Boden mit einem durchdringenden süßen Geruch, vermischt mit dem Geruch von Schwarzpulver, eine Erinnerung, die ihm den Magen umdrehte.
Wütend über seine eigene Schwäche, wischte sich Armand eine Träne aus dem Auge. Er war bereit gewesen, auf dem Schlachtfeld zu sterben, ein Mitglied der Familie Saint Paul würde niemals aufgeben. Aber General Forth hatte ihn angeschrien: »Wir werden die Schlacht verlieren, Armand, zieh dich zurück!«
»Ein Saint Paul lässt seine Männer niemals im Stich und gibt niemals auf!«, rief Armand zurück und funkelte den General wütend an.
»Was denkst du, was wir hier tun? Wir sind bereits auf dem Rückzug. Jetzt ist es meine Aufgabe, so viele unserer Männer wie möglich zu retten. Wir haben eine Schlacht verloren, aber jetzt müssen wir sicherstellen, dass wir nicht den Krieg verlieren. Wenn die Roundheads dich gefangen nehmen, werden sie dich bei lebendigem Leibe häuten, denn sie hassen alle Franzosen – und Katholiken. Mach dich auf den Weg zur Küste, geh zurück nach Frankreich und wirf dich deinem seltsamen Premierminister dort zu Füßen, wir brauchen sein Geld und französische Soldaten, sonst ist unsere Sache verloren! Aber reite zuerst nach Wintershill Castle, der Earl of Wiltshire ist ein loyaler Mann, er wird dich verstecken und dir helfen, ein Schiff zu finden. Aber pass auf, meide die Straßen, sie werden uns verfolgen.«
»Ein Saint Paul wird niemals auf die Knie fallen, für niemanden und schon gar nicht für einen Parvenu von italienischem Kardinal, der sich Premierminister von Frankeich nennt!«
»Schluck deinen Stolz herunter, Saint Paul, geh und hol Hilfe für uns. König Karl braucht Geld, wir brauchen frische Truppen, sonst ist auch unsere nächste Schlacht verloren. Die Roundheads sind nicht länger eine Bande von Banditen, du hast sie heute mit eigenen Augen gesehen, sie haben sich in eine gefährliche Armee verwandelt. Brich jetzt auf, sofort, reite zur Burg Wintershill und dann nach Frankreich!«
Armand hatte geschluckt. General Forth hatte noch nie so offen gesprochen. In der Zwischenzeit war der Feind so schnell vorgerückt wie die herannahende Flut, und es blieb keine Zeit mehr für Diskussionen. Armand schluckte seinen Stolz herunter, wendete sein Pferd und ritt gen Süden in Richtung Winchester. Sein Auftrag war klar: Er musste zurück nach Frankreich segeln und dort Kardinal Mazarin bitten, schnellstens Unterstützung zu schicken. Die Lage von König Karl wurde immer verzweifelter.
Müde und erschöpft ritt Armand weiter durch den Wald, aber plötzlich musste sein Schutzengel Erbarmen zeigen: Wie ein Leuchtfeuer der Hoffnung durchdrang ein Strahl Sonne die Wolken.
Armand schloss vor Erleichterung für eine Sekunde die Augen – aber einen Sekundenbruchteil zu lang – denn er übersah den tief hängenden Ast, der den Weg vor ihm versperrte. Der Ast erwischte ihn unvorbereitet und warf ihn direkt vom Pferd. Es ging alles so schnell: ein stechender Schmerz, ein Gefühl der Panik, als er fiel und auf etwas Hartes aufschlug, noch mehr Schmerz und dann – nichts.
Vielleicht war das auch ein Segen, denn es bedeutete, dass Armand seine Verfolger nicht kommen hörte.
Ein paar Monate zuvor …
Der junge Herr, der im Vorzimmer des Louvre-Palastes wartete, wäre die Zierde eines jeden vornehmen Gastgebers gewesen. Er war groß und schlank, hatte schulterlanges blondes Haar und war tadellos gekleidet. Sein Hemd, seine Hose waren aus feinstem Leinen, dazu trug er Spitzen aus Flandern und das Wams war aus glänzender chinesischer Seide geschneidert. Seine hohen Schaftstiefel waren von einem wahren Meister angefertigt worden. Das polierte Leder glänzte im Licht der Sonnenstrahlen, schimmernde Knöpfe aus Perlmutt und modische, farbenfrohe Schleifen vervollkommneten seine Erscheinung. Aber sein muskulöser Körper und seine lebhaften, aufmerksamen grauen Augen verrieten, dass François de Toucy auf dem Schlachtfeld genauso zu Hause war wie am königlichen Hof von Frankreich.
Nur ein leichtes Klopfen seiner rechten Hand auf dem Schreibtisch neben ihm verriet, dass er ungeduldig war. Der Schreibtisch war mit Dokumenten, einem Kruzifix, Büchern und einem silbernen Ständer für Federkiele in verschiedenen Größen geradezu überfüllt. Es war der Schreibtisch eines mächtigen Mannes – und eines Mannes, auf den eine erschreckende Menge Arbeit wartete.
François seufzte. Er wartete schon seit mehr als einer Stunde. Der junge Mönch, der als Sekretär des Kardinals diente und akribisch die Akten auf dem Schreibtisch ordnete, lächelte mitfühlend. »Es wird nicht lange dauern, Monsieur, aber Seine Eminenz hat eine Privataudienz bei Ihrer Majestät und wie Sie vielleicht wissen, ist Ihre Majestät immer sehr interessiert an …«
»… sie tratscht gerne, ich weiß«, beendete François den Satz für den jungen Mönch.
Der junge Mönch wirkte schockiert über diese Antwort, verzichtete aber auf einen Kommentar, denn nicht einmal in seinen kühnsten Träumen hätte er sich erlaubt, so über die Königin und Regentin von Frankreich zu sprechen. Aber offensichtlich hatte sein eleganter Besucher keinerlei Skrupel.
Etwa eine halbe Stunde später konnte François endlich das Geräusch wahrnehmen, auf das er gelauert hatte. Draußen, in der Galerie, hörte man die Schritte der schweren Stiefel der Ehrengarde, das Rufen des Herolds, der das Herannahen eines wichtigen Mitglieds des Hofes ankündigte. Der bis dahin stille Flügel des Louvre-Palastes verwandelte sich im Handumdrehen in einen summenden Bienenstock, nur mit dem Unterschied, dass nicht die Königin erwartet wurde, sondern Seine Eminenz, Kardinal Mazarin, der Erste Minister des aller-katholischsten Königreichs Frankreichs.
Die Tür wurde aufgerissen, aber der Kardinal wartete nicht auf die feierliche Bekanntgabe seiner Titel – er betrat den Raum sofort mit wehenden Gewändern und seiner leuchtend roten Kalotte, die allerdings leicht schief auf seinen Haaren saß.
François de Toucy beeilte sich, von seinem Stuhl aufzustehen, und bückte sich tief, um den Amtsring des Kardinals zu küssen, sodass er fast mit dem Kardinal zusammenstieß, der immer noch in voller Fahrt war. Seine Eminenz lachte belustigt.
»Ich entschuldige mich, mein Sohn, ich bin nicht nur zu spät, sondern habe auch nie gelernt, mich mit der Besonnenheit und dem Anstand zu bewegen, die ich der Ehre meines Amtes eigentlich schuldig bin. Ich vermute, das liegt an meinem italienischen Erbe, ich kann einfach nicht genug Geduld aufbringen und war noch nie in der Lage zu warten.«
François de Toucy wunderte sich wieder einmal über den Unterschied zwischen Kardinal Mazarin und seinem Vorgänger, dem Kardinal Richelieu – wie oft hatte er Richelieu lachen gehört? Hatte er jemals gelacht?
Der Kardinal setzte sich hinter seinen Schreibtisch, schob einige Stapel der fein säuberlich geordneten Dokumente zur Seite, woraufhin sie reihenweise umkippten. Diese unvorsichtige Bewegung musste seinen Sekretär vor seelischen Qualen zusammenzucken lassen, denn sie machte in Sekundenschnelle die sorgfältige Vorbereitung und Sichtung zunichte, für die er sicherlich Stunden gebraucht hatte.
»Du darfst dich setzen, mein Sohn, obwohl ich weiß, dass dieser Stuhl sehr unbequem ist. Ich habe ihn von meinem Vorgänger geerbt, dem Kardinal Richelieu, möge der Herr seine Seele segnen«, schnell machte er das Zeichen des Kreuzes. »Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Stuhl seine heimliche Rache für alle Besucher war, die ihn länger als eine halbe Stunde beschäftigten.«
Das Lächeln des Kardinals veränderte sein Gesicht. Er war keineswegs ein hübscher Mann, aber François verstand jetzt, warum er mit seinem Charme nicht nur das Vertrauen von Königin Anne, der Mutter des jungen Königs, gewonnen hatte, sondern Gerüchten zufolge ihr in Wirklichkeit viel näher stand, als es die Hofetikette oder die Konvention es jemals zulassen würden.
»Ich habe schon auf viel unbequemeren Stühlen gesessen«, erwiderte François de Toucy lächelnd, »aber wenn ich mir erlauben darf, direkt zur Sache zu kommen: Warum haben mich Eure Eminenz eingeladen, in den Louvre zu kommen, und auf einer solchen Dringlichkeit bestanden?«
»Ihr Franzosen seid immer so direkt …«, murmelte der Kardinal und gab seinem Sekretär ein Zeichen, sich zurückzuziehen. Das anschließende Gespräch musste absolut vertraulich bleiben.
»Ich entschuldige mich dafür, dass ich Sie von der Seite Ihrer schönen jungen Frau weggeholt habe, mein Sohn, oder soll ich Sie jetzt mit Marquese ansprechen?«, eröffnete der Kardinal die Diskussion. »Wenn ich mich nicht irre, hat Ihre Frau kürzlich auch den Titel der Marchesa de Castelfranco geerbt?«
»Eure Eminenz irrt sich nie, aber ich benutze den Titel in Frankreich nicht.«
»Das ist sehr weise, die Franzosen sind nicht immer geneigt, ausländische Würdenträger oder Titel zu schätzen. Ich weiß das ja bestens aus eigener Erfahrung.«
Der Kardinal blickte auf seinen Schreibtisch, der mit Dokumenten und Akten übersät war. Er runzelte die Stirn: »Haben meine Diener vergessen, Ihnen ein Glas Wein anzubieten?«
»Ich wurde nicht gefragt«, erwiderte François lächelnd, »aber der Gedanke an ein Glas Wein ist durchaus reizvoll. Ich hätte nichts dagegen.«
»Imbéciles! Warum bezahle ich Diener, wenn sie die Grundregeln der Gastfreundschaft vergessen!«, rief Kardinal Mazarin und läutete die Glocke, kräftig genug, um selbst die schläfrigsten Lakaien zu wecken.
Wenige Minuten später wurde ein Glas mit honigfarbenem Wein vor François de Toucy gestellt, begleitet von Süßigkeiten und kandierten Früchten. François bemerkte, dass die Farbe des Weins des Kardinals wesentlich blasser war, und schloss daraus, dass der Kardinal den Befehl gegeben hatte, seinen Wein zu verdünnen.
»Santé, auf Ihre Gesundheit!« Seine Eminenz stieß an und hob das kostbare Kristallglas.
»Auf die Gesundheit Eurer Eminenz und auf die Gesundheit unserer königlichen Familie!«, antwortete François und er konnte sehen, dass seine Antwort dem Kardinal gefiel, der schnell hinzufügte: »Ja, auf die Gesundheit unserer Souveräne, möge der Herrgott sie beschützen!«
Der Wein war schwer und dick wie Honig. Ich muss vorsichtig sein, dachte François, dieser Wein ist das perfekte Mittel, um die Zunge selbst des schweigsamsten Besuchers zu lockern. Was sind die Absichten des Kardinals?
Währenddessen inspizierte Seine Eminenz sorgfältig die kandierten Früchte, die auf einem Silbertablett serviert wurden, während François geduldig darauf wartete, dass er das Gespräch eröffnete.
»Ihre Frau hat vor Kurzem große Ländereien geerbt, zusammen mit einer Reihe von Titeln von ihrem Onkel.« Eröffnete Mazarin schließlich die Diskussion.
»Wie immer sind Eure Eminenz bestens informiert. Wir planen, nächsten Sommer nach Venedig zu reisen, um die Details zu klären. Unsere Anwälte haben uns gewarnt, dass es Berge von Papieren zu unterzeichnen gibt, da mindestens fünf verschiedene Länder und Gerichtsbarkeiten betroffen sind.«
»Ich pflege noch einige alte Freundschaften in Venedig«, antwortete der Kardinal fast geistesabwesend, denn er schien sich auf die Auswahl der appetitlichsten kandierten Früchte zu konzentrieren. Schließlich wählte er eine Kirsche und bemerkte: »Das waren die Lieblingssüßigkeiten des verstorbenen Kardinals de Richelieu. Er dachte immer, ich wüsste nicht, wo er sie kaufte, also habe ich ihn in dieser Illusion gelassen. Richelieu hielt sich immer gerne für den Meister des Spiels.«
Sein Blick ging zurück zu François, der sich über das seltsame Thema ihrer Unterhaltung zu wundern begann.
»Zufälligerweise halte ich guten Kontakt zu meinen Freunden in Venedig. Ich weiß zufällig auch, dass zwei charmante, aber nicht sehr loyale Cousins Ihrer Frau ein neues Gesetz beim Rat eingereicht haben – ein Gesetz, das im Wesentlichen darauf abzielt, Frauen zu enterben, die sich die Freiheit genommen haben, außerhalb des geschlossenen Kreises des venezianischen Adels zu heiraten – das Goldene Buch, wie sie es nennen.«
François beherrschte sich und verbeugte sich nur vor dem Kardinal. »Ihre Informationsquellen scheinen wie immer ausgezeichnet zu sein, Eminenz, wenn ich das so sagen darf. Wir haben noch nichts von solch einem Gesetz gehört. Es ist immer gut, seine Feinde zu kennen.«
»Ihr könnt auch nichts davon gehört haben, denn es wurde als geheime Direktive beim Rate der Zehn eingereicht und nicht als formelles Gesetz, über das die Vollversammlung der Republik abstimmen muss. Diese Cousins sind gerissen, sie wissen genau, was sie tun.«
»Was schlägt Eure Eminenz vor?«
»Ich kann meinen Einfluss geltend machen, um die Entscheidung in der Schwebe zu halten – in der Schwebe für immer und ewig, wenn ich es will. Das wird eine Menge Geld kosten, da ich meinen Einfluss nicht nur in Venedig geltend machen muss, sondern auch beim Heiligen Stuhl intervenieren muss. Einer der Cousins kann zum Bischof in einem sehr abgelegenen Teil des Mittelmeers ernannt werden. Am Anfang wird er sehr zufrieden sein. Er wird viele schöne Titel tragen und vielleicht sogar einige Inseln regieren, wie ein echter Fürst. Natürlich gibt es einen Haken – sobald er dort ankommt, wird er seine Schatztruhen öffnen und sie leer vorfinden. Aber das wissen bisher nur wenige Menschen. Wenn er herausfindet, dass er nichts weiter ist als ein armer Bischof, der auf einer verlassenen Insel sitzt, die außer den marodierenden Türken niemand besuchen will, wird es zu spät sein.«
Der Kardinal grinste schelmisch, er genoss sichtlich seine kleine Intrige.
»Ihr müsst mir natürlich jeden einzelnen Sou zurückzahlen, sobald eure Frau ihr Erbe sicher hat; ich kann doch nicht Geld, das mir von unserer Regierung anvertraut wurde, für etwas verwenden, das als reine Privatangelegenheit betrachtet werden muss.«
»Sicherlich werden wir das tun, aber warum sollte Eure Eminenz das für mich tun? Ich nehme an, dass Eure Eminenz neben meiner ewigen Dankbarkeit auch eine winzige Gegenleistung erwartet?«
»Natürlich erwarte ich das. Ich finde es immer angenehm, mit jemandem zu diskutieren, der einen schnellen Verstand hat. Wenn ich Ihnen einen solchen Dienst erweise, erwarte ich natürlich auch eine Gegenleistung, etwas Besonderes.«
»Darf ich dann wissen, was von mir erwartet wird?«
Der Kardinal nahm einen Schluck von seinem Wein und schien das Aroma zu genießen, bevor er ihn trank. »Ausgezeichneter Wein, aus der Region Avignon, das Weingut gehört übrigens dem Heiligen Stuhl. Der Heilige Vater schickt mir jedes Jahr ein paar Fässer.«
François lachte. »Langsam werde ich nervös! Wenn Eure Eminenz sich so viel Zeit nimmt, um mir meinen Teil der Abmachung mitzuteilen, befürchte ich, dass es nicht einfach sein wird.«
»Ihre Majestät ist besorgt über die Lage in England«, antwortete der Kardinal schließlich. »Ich nehme an, Sie wissen, was dort vor sich geht?«
»So viel wie die meisten Menschen. Ich kenne allerdings nicht alle Details, die Situation sieht … sagen wir mal, kompliziert aus. Die Königreiche England und Schottland werden von einem Bürgerkrieg heimgesucht. Ich habe allerdings nie verstanden, warum die Dinge so schlecht stehen. Es scheint, dass König Karl sich mit dem Parlament zerstritten hat – warum hat er es überhaupt jemals zugelassen, dass das Parlament so mächtig wurde?«
»Geld und Religion«, erklärte der Kardinal schlicht. »Die übliche Geschichte. Ein schwacher König, ich erlaube mir, hier offen zu sprechen, mit einem Haufen nutzloser Berater. Das ist keine gute Kombination. Und seine Feinde haben eine Menge Geld.«
»Aber warum sollte Ihre Majestät besorgt sein? Frankreich und England sind seit Jahrhunderten verfeindet, es ist eine gute Nachricht, wenn ein Erbfeind für die nächsten Jahre geschwächt wird. Frankreich kann von dieser Situation doch nur profitieren.«
Der Kardinal schaute sich um, als wolle er sichergehen, dass bei diesem Gespräch keine Zeugen gäbe. »Ich bin geneigt, Ihrer Analyse zuzustimmen, de Toucy. Aber die Königin macht sich Sorgen um ihre Schwägerin, die Königin von England.«
»Königin Henrietta Maria, die Schwester des verstorbenen Königs?«
»Genau, das heißt, sie ist eine ’fille de France’, eine Prinzessin von königlichem Blut aus Frankreich, und Ihre Majestät macht sich Sorgen, dass sie in die Hände dieser verrückten Puritaner fallen könnte, die es auf das Blut der Anhänger des wahren Glaubens abgesehen haben. Sie hat Albträume, was einem Mitglied der französischen Königsfamilie unter diesen Umständen passieren könnte. Ich stimme mit Ihrer Majestät überein, dass wir das verhindern müssen; niemals darf es dazu kommen, dass ein Mitglied der französischen Königsfamilie in die Hände der Kanaille, des Mobs auf der Straße, fällt.«
Der Kardinal machte ein feierliches Kreuzzeichen, als wolle er das Böse abwehren, und hielt einen Moment inne.
»Hat Königin Henrietta vor, England zu verlassen und in Frankreich um Exil zu bitten, oder wird sie sich ihrer Tochter in Holland anschließen?«, fragte François.
»Das ist ein Teil des Problems. Königin Henrietta Maria besteht darauf, in England zu bleiben. Sie glaubt, dass Gott sie auserwählt hat, die Engländer zu bekehren und würde lieber als Märtyrerin sterben.«
François musste diese Information erst einmal verdauen und es entstand ein kurzes, aber beredtes Schweigen.
»Eure Eminenz möchte, dass ich mit der Königin spreche?«, fragte er ungläubig.
»Ja, denn jemand muss ihr erklären, dass sie England verlassen muss, wenn die Lage noch schlimmer wird. Zu allem Übel ist Ihre Majestät auch wieder guter Hoffnung – schon wieder«, fügte der Kardinal hinzu und nippte an seinem Wein. »Man könnte meinen, dass König Karl in einer so schwierigen Zeit vielleicht andere Prioritäten hätte setzen sollen …«
»Wie soll ich eine Königin davon überzeugen, ihre Meinung zu ändern und England zu verlassen, wenn sie ein Kind erwartet und nicht bereit ist, ihr Land und höchstwahrscheinlich auch ihren Mann zu verlassen?«, fragte François in einem höflichen Ton, wobei nur ein leichtes Hochziehen der Augenbrauen seine wahren Gefühle verriet.
»Das überlasse ich Ihnen. Vergessen Sie nicht, was für Ihre Frau auf dem Spiel steht, und übrigens, wenn Sie Erfolg haben, werde ich Sie in Frankreich in den Grafenstand erheben lassen, Ihre Majestät hat bereits gnädig zugestimmt. Im Moment scheint Königin Henrietta Maria in Sicherheit zu sein, denn der Hof ist nach Oxford umgezogen, einem viel sichereren Ort als London, das schon fest in der Hand des Parlaments ist. Aber meine Agenten berichten mir, dass die Kräfte des Parlaments jeden Tag stärker werden. In nur wenigen Monaten könnte die Lage ziemlich verzweifelt werden.«
Der Kardinal wählte noch eine kandierte Kirsche und fuhr fort. »Die französische Regierung hat beschlossen, nicht zu intervenieren. Wir wollen die Königin retten, nicht England. Auch der Prinz von Oranien wird sich nicht einmischen, was bedeutet, dass die Niederländer unsere Einstellung teilen. Sie mögen den König bemitleiden, aber sie freuen sich diebisch, wenn England geschwächt wird. Wir wissen sogar, dass ein beträchtlicher Teil des Geldes, das die Gegenpartei unterstützt, von den Niederländern stammt.«
Er spülte die Kirsche mit einem Schluck Wein herunter und fuhr fort. »König Karl könnte natürlich durch ein göttliches Wunder gerettet werden – aber das passiert in unserer modernen Zeit leider sehr selten. Wenn Sie mich fragen, ist er dem Untergang geweiht. Solange ich Premierminister in Frankreich bin, werde ich dafür sorgen, dass das Parlament in Paris niemals an Macht gewinnen wird. Das ist eine Frage der Ressourcen und der Führung. In England haben die Parlamentarier mehr Geld und mehr Männer zur Verfügung als der König. Schlimmer noch, sie scheinen begabte Anführer für ihre Armee gefunden zu haben. Kurz zusammengefasst: Bereiten Sie alles für eine rasche Abreise nach England vor, de Toucy, sobald ich Sie rufe. Das könnte schon morgen passieren – natürlich nur, wenn Sie den Auftrag annehmen, Monsieur le Comte.«
François de Toucy lächelte den Kardinal an, das berühmte Lächeln, das die Herzen aller Hofdamen der Königin höherschlagen ließ. »Wie könnte ich ablehnen, Eure Eminenz? Lasst mich wissen, wann ich die Ehre haben werde, Königin Henrietta Maria in England zu treffen.«
Der Kardinal hatte keine Schwäche für schneidige junge Männer; seine Schwäche galt den jungen, drallen Frauen, die regelmäßig sein Bett wärmten. Deshalb lächelte er nur kurz zurück und blieb streng sachlich.
»Dann ist ja alles geklärt, ich wusste, dass ich mich auf Sie verlassen kann, mein Vorgänger hatte Sie mir wärmstens für heikle Missionen empfohlen.« Er läutete die Glocke und der junge Mönch trat wieder ein. »Monsieur de Toucy wird dir später sagen, was er braucht, ein Schiff, etwas Gold usw. Er hat freie Hand, sorge dafür, dass seine Wünsche schnell erfüllt werden, und gib mir einen wöchentlichen Bericht. Seine Mission ist streng vertraulich.« Er schickte einen letzten strengen Blick zu François. »Aber keine unnötigen Ausgaben, Sie wissen, dass Sie später über alle Ausgaben Rechenschaft ablegen müssen!«
»Auch das hat sich nicht geändert: auch Kardinal Richelieu hat nie unnötige Ausgaben akzeptiert«, sagte François.
»Deshalb hat er Frankreich zu einer großen Nation gemacht! Und ich werde das Land noch größer machen. Vertrauen Sie mir.«
Der Sekretär trat vor, verbeugte sich ehrfurchtsvoll, und François de Toucy wurde entlassen. Mit dem Jagdinstinkt eines Bluthundes kramte der Kardinal einige Dokumente aus einem der verrutschen Stapel vor ihm hervor und begann zu lesen, scheinbar zufrieden damit, dass er gefunden hatte, was er gesucht hatte.
***
Begleitet von seinem treuen Burschen Michel, ritt François vom Louvre-Palast zurück zu dem neuen Stadtpalais, das er nach seiner Heirat erworben hatte. Obwohl er immer wachsam war – niemand, der bei klarem Verstand war, würde durch die schmutzigen Straßen von Paris reiten, ohne nach versteckten Schlaglöchern oder umherstreifenden Verbrechern Ausschau zu halten – dachte er immer noch an das Gespräch mit Kardinal Mazarin.
François ignorierte die aufdringlichen Hausierer, die ihm Gebäck, gefälschten Schmuck oder Reliquien – direkt aus dem Heiligen Land – verkaufen wollten. Letztere sollten garantiert gegen alle möglichen Gebrechen helfen. Er jagte auch die hartnäckigen Bettler wie lästige Fliegen davon, von denen einige so verstümmelt waren, dass er sich nur wundern konnte, wie sie es schafften, sich am Leben zu halten. Sonntags war es üblich, nach dem Gottesdienst Almosen an die wartenden Bettler vor der Kirche zu verteilen, aber heute war nicht Sonntag und François war ein Mann mit Prinzipien – außerdem war er praktisch veranlagt und wusste, dass ihm sofort ein Heer von Bettlern folgen würde, wenn er jetzt anfing, Almosen zu verteilen.
Michel schwang seine Peitsche, als ein dreckiger und besonders dreister Bettler aufdringlich wurde. Dazu ließ er ein paar obszöne sowie fantasievolle Flüche auf den Bettler niederprasseln, bis dieser endlich aufgab.
So kamen sie ohne größere Zwischenfälle in François’ neuem Zuhause an. Sobald sie das Tor erreicht hatten, eilten schon Diener herbei, um sich um ihren Herrn und die Pferde zu kümmern. Noch immer in Gedanken versunken, stieg François ab und die Treppe zum Salon hinauf, wo seine Frau sicher schon auf ihn wartete.
Julia sprang von ihrem Stuhl auf und stürzte in seine Arme, um ihn zu begrüßen. François drückte sie fest an sich und atmete den Duft ihres Parfüms ein, das sie aus Rosenblättern und einer geheimen orientalischen Mischung von Zutaten destilliert hatte, die sie aus Venedig mitgebracht hatte. Freude erfüllte sein Herz; er konnte sein Glück immer noch nicht fassen, Julia in Venedig begegnet zu sein – war das erst zwei Jahre her?
Julias Taille war etwas umfangreicher geworden – sie war schwanger. Eines der wenigen Geheimnisse, die Kardinal Mazarin scheinbar noch nicht kennt, überlegte François, während er seine Frau umarmte.
»Sag mir, was hat der Kardinal gewollt? Er hat dich doch nicht nur auf ein Glas Wein eingeladen?«
»Doch, er hat mir ein Glas Wein angeboten, meine Liebe«, antwortete François ausweichend, während er sich vergewisserte, dass Julia bequem auf seinem Schoß saß, »und zwar einen sehr guten, einen Wein von den Weingütern des Heiligen Vaters in Avignon.«
Julia war nicht sehr beeindruckt. »Der Papst Vater sollte sich mit wichtigeren Dingen beschäftigen, als Wein zu produzieren! Außerdem sind die Weine von unseren eigenen Weingütern viel besser, ich weiß nicht, warum ihr Franzosen immer so ein Aufheben um eure Weine macht. Die Weine aus Norditalien sind besser als alles, was ich in Frankreich je probiert habe. Aber egal, ich hoffe, du hast dem Kardinal gesagt, dass du verheiratet bist und ihm nicht mehr zur Verfügung stehst?«
»Ja, so ähnlich hat unser Gespräch begonnen«, antwortete François vorsichtig.
Julia schaute ihn kritisch an, sie merkte sofort, dass er keine guten Nachrichten mitgebracht hatte.
»Erinnerst du dich an deinen Cousin Giovanni und den anderen Cousin, der stottert und ein Stubenmädchen nach dem anderen schwängert?«, fuhr er fort.
»Ich nehme an, du meinst Giacomo, diese Kakerlake. Er hat immer mit Giovanni intrigiert, das sind die Art von Verwandten, die man eigentlich nicht haben möchte … Was ist mit ihnen? Warum erwähnst du sie jetzt? Du hast doch nicht etwa mit dem Kardinal über meine Verwandten gesprochen?«
»Doch, das haben wir. Der Kardinal hat mir im Vertrauen erzählt, dass deine Cousins ein neues Gesetz vorgeschlagen haben, um sich dein Erbe anzueignen. Natürlich haben sie es recht allgemein formuliert: dass venezianische Frauen, die außerhalb des noblen Kreises des Goldenen Buches heiraten, ihr Recht auf das venezianische Erbe verlieren sollen. Da ich nicht im Goldenen Buch eingetragen bin, wärst du die erste, die betroffen wäre, zumindest das Erbe deines Onkels wäre so verloren.«
»Ja, das passt zu Giovanni und Giacomo!« Julia sprang auf und ballte vor Wut die Fäuste. »Was für ein widerliches Paar. Aber die werden das noch bedauern, ich werde mit meiner Tante reden, ich werde sie töten, in Stücke hacken und in den Canal Grande werfen lassen!«
»Haben wir nicht gerade über Wein gesprochen? Es gab Zeiten, in denen mir meine reizende Frau ein Glas Wein angeboten hat, nachdem ich durch die gefährlichen Straßen von Paris galoppiert bin, um so schnell wie möglich zu ihr zu eilen« François wechselte schnell das Thema.
»Wenn du mir erklären kannst, wie jemand durch Paris galoppieren kann, wäre ich vielleicht versucht, dir zu glauben, aber die Straßen in dieser dreckigen Stadt sind so eng und verstopft, dass sich sogar die Königin im Schneckentempo bewegen muss, wenn sie zur Kirche reiten will«, antwortete Julia, nahm aber die Karaffe aus kostbarem Muranoglas und schenkte ihm ein Glas Wein ein. François bedankte sich bei ihr mit einem langen Kuss.
»Es hat keinen Sinn, meine Aufmerksamkeit abzulenken, Monsieur«, flüsterte sie, willigte aber bereitwillig ein, als François die Prozedur wiederholte.
»Der Kardinal hat angeboten, die Mitglieder des Ausschusses zu bestechen. Und er könnte dafür sorgen, dass Giacomo zum Bischof befördert wird und mit ein paar klangvollen Titeln, auf eine abgelegene Insel im Mittelmeer geschickt wird. Das wäre wohl eleganter, als ihn zu töten und im Meer zu versenken.«
»Ich würde ihn lieber tot sehen.« Julia war nicht in versöhnlicher Stimmung. »Aber ich stimme zu, dass das funktionieren könnte. Aber dieser Vorschlag wird eine Menge Geld kosten – und der Kardinal Mazarin ist kein Dummkopf, du wirst jeden Scudo zurückzahlen müssen – und mehr, also – raus mit der Sprache – was will er von dir?«
»Er will, dass ich ihm einen besonderen Dienst erweise, drüben in England. Aber er hat noch eine andere Belohnung parat: Wenn ich tue, was er verlangt, werde ich hier in Frankreich zum Grafen ernannt.
Julia riss erschrocken die Augen auf und schluckte, bevor sie antwortete. »So hat er dich also an den Haken bekommen! Ich könnte dir natürlich sagen, dass es mir egal ist, ob ich das Erbe meines Onkels antrete oder nicht, ich habe mehr als genug Geld. Aber dieser Mazarin ist hinterhältig. Er weiß, dass du alles tun würdest, um selbst ein Graf zu werden. Mein stolzer Mann kann es nicht ertragen, wenn er nur den Titel seiner Frau tragen darf.«
»Bist du böse auf mich?« François schaute sie mit seinen klaren grauen Augen an – keiner Frau war es bisher gelungen, diesem Blick standzuhalten.
»Natürlich bin ich das, und hör auf, mich so anzuschauen! Ich hasse dich, François de Toucy!«
François nahm Julia in seine Arme und jeder weitere Protest wurde durch einen langen Kuss zum Schweigen gebracht.
»Es scheint, dass ich nichts tun kann, außer in einen Wutanfall zu verfallen, aber das wird nicht helfen«, fuhr sie nach einiger Zeit fort und seufzte tief, »und das wäre auch verschwendete Zeit. Ich werde also meine Tante bitten, nach Paris zu reisen und bei mir zu bleiben, solange du in England bist. Ich bin also einverstanden, aber nur unter einer Bedingung!«
»Welche Bedingung?«
»Du musst mir jedes Detail über deine Mission erzählen, auch wenn der Kardinal wahrscheinlich zu dir gesagt hat, dass sie streng geheim ist und du kein Wort erwähnen darfst.«
Und so erzählte François ihr, wie er die Königin von England retten sollte.
Eine Reise wird geplant
François wechselte das Thema. »Wie wäre es, heute gemütlich einen netten Abend zu Hause zu verbringen? Gestern habe ich ein Exemplar eines neuen Buchs ergattern können, eine Komödie und man munkelt, dass es in Wirklichkeit die Karikatur einiger bekannter Mitglieder des königlichen Hofes ist. Ganz Paris wird sich darüber den Mund zerreißen.«
»Wir haben doch deiner Mutter und deiner Schwester versprochen, dass wir sie heute Abend ins Hôtel Saint Paul begleiten, wo der Marquis die Verlobung seiner jüngsten Tochter verkünden wird. Deine Mutter möchte die Gelegenheit nutzen, um deine Schwester vorzustellen und Armands Mutter zu bitten, Martine zu protegieren.«
François stöhnte auf. »Das klingt einfach furchtbar. Muss ich etwa den ganzen Abend auf meine Schwester aufpassen?«
»Hör auf zu jammern. Ich werde auch da sein und zusammen mit deiner Mutter auf sie aufpassen, und vergiss nicht, Armand de Saint Paul und Pierre de Beauvoir werden sicherlich anwesend sein. Wie ich dich kenne, verschwindest du zum Kartenspielen, sobald die Marquise uns in den Salon bittet. Als besonderen Leckerbissen hat sie nämlich einen jungen Dichter eingeladen, der uns aus seinen neuesten Werken vorlesen wird.«
François riss seine Augen vor Entsetzen weit auf. »Poesie!«, stöhnte er. »Ich hasse Poesie. Das Zeug langweilt mich zu Tode! Narzissen, die im Wind mit Nymphen tanzen und dieser ganze Quatsch. Wer ist es denn dieses Mal?«
»Ein vielversprechender, sehr attraktiver junger Dichter, der von der Herzogin von Limoges gefördert wird«, antwortete Julia verträumt. »Sehr interessant. Beim letzten Mal hat er ein sehr berührendes Gedicht über die ätherische Schönheit ihrer Augen vorgetragen.«
»Oh mon dieu!«, erwiderte François. »Aber sehen wir der Wahrheit ins Auge: Von der Schönheit der Herzogin ist nicht viel geblieben, abgesehen von ihren Schlössern und ihrem beträchtlichen Vermögen. Sie ähnelt mehr und mehr einem ihrer alten, zickigen Schoßhunde. Ich werde dich nicht allzu sehr schockieren, wenn ich annehme, dass dieser Dichter ihr neuester Liebhaber ist?«
»Oh nein, das ist ein offenes Geheimnis«, Julia musste kichern. »Aber zumindest scheint er talentiert zu sein – ich meine talentiert auch außerhalb ihres Schlafzimmers – und zwar mehr als ihre letzte Entdeckung. Ich muss schon sagen, dass Paris viel unterhaltsamer ist als Venedig. Keine Dame in Venedig würde es jemals wagen, sich mit einem jungen Liebhaber offen in der Gesellschaft zu zeigen.«
»Deshalb ist unsere Kultur im Niedergang begriffen«, antwortete François, der sich inzwischen mit der Tatsache abgefunden hatte, dass sich sein gemütlicher Abend zu Hause gerade in Luft aufgelöst hatte.
***
François hatte noch reichlich Zeit um zu bereuen, dass er zugestimmt hatte, den Ball zu besuchen. Ihre Kutsche kam nur mit Schneckengeschwindigkeit voran, denn viel zu viele luxuriöse Kutschen und Sänften blockierten den Eingang des Palais de St. Paul, dem Sitz des Marquis de Saint Paul und seiner zahlreichen Nachkommen. Abgesehen von der königlichen Familie gab es in Frankreich wohl kaum eine Familie von höherem Rang. Die Vorfahren des Marquis hatten Jerusalem erobert, das alte Byzanz im Namen des Allmächtigen geplündert und in Frankreich für die Valois gegen die englischen Usurpatoren gekämpft – oder sich mit ihnen verbündet, je nachdem, was zu einem bestimmten Zeitpunkt profitabler oder lohnender erschien. Im Laufe der Jahrhunderte war die Familie mit Titeln, Ländereien und Gold überhäuft worden und man munkelte, der jetzige Marquis sei reicher als der König von Frankreich – ganz zu schweigen von dem mittellosen Onkel des jetzigen Königs, dem König von England.
Mit zusammengebissenen Zähnen hatten die Saint Pauls den Aufstieg von König Heinrich IV. ertragen, dem ersten Bourbonen in einer langen Reihe von Königen, der aus einem schäbigen und winzigen Königreich im abgelegenen Süden stammte und den heiligen Thron Frankreichs bestiegen hatte. Aber der Marquis war nicht blind für die Realität. Nachdem Kardinal Richelieu geräuschlos, aber mit tödlicher Effizienz viele einflussreiche Familien von der Landkarte der Macht vertilgt hatte, hatte der Marquis geschickt dafür gesorgt, dass zumindest seine Familie ungeschoren blieb. Es war ein unausgesprochener Waffenstillstand zwischen zwei mächtigen Männern gewesen.
»Schau, François, ist das nicht schön?« François’ Schwester zerrte an seinem Ärmel und zeigte auf den Innenhof, als sie näher kamen. Ihr Gesicht war vor Aufregung gerötet, denn heute war ihr erster offizieller Ball, seit sie in Paris angekommen war.
Fackeln in schmiedeeisernen Halterungen warfen ihr helles Licht auf die Fassade des Palais de Saint Paul. Die lodernden Flammen ließen die Reliefs und Verzierungen so plastisch erscheinen, als seien sie zum Greifen nahe. Der Lärm der Dienerschaft war inzwischen ohrenbetäubend geworden, denn jede Kutsche forderte lautstark um Vorrang, um die Wichtigkeit ihrer edlen Besitzer zu unterstreichen.
Schließlich stiegen auch François, seine Frau, seine Mutter und seine Schwester aus der Kutsche und wurden herzlich von der Marquise de Saint Paul und ihrem Mann begrüßt. Die Marquise schätzte François nicht nur, weil er ein Verwandter war, sondern sie hatte auch ein Faible für ihren klugen und hübschen Neffen.
Bis vor Kurzem war der Kleidungsstil am Hof nüchtern und betont schlicht gewesen. Der plötzliche Tod des Königs hatte zu einer langen Zeit der Trauer geführt und somit waren alle Farben verpönt gewesen. Aber sobald der Anstand es erlaubte, brachen die Dämme und kam es zu einer Welle neuer Mode, so edel und luxuriös wie es der geizige, verstorbene König niemals toleriert hätte. Daher glitzerten und funkelten die Damen und Herren im Hôtel de Saint Paul heute Nacht in den leuchtendsten Farben. Die teuren Stoffe waren mit Fäden aus Silber und Gold verwebt und mit funkelnden Diamanten und Edelsteinen besetzt.
So schnell wie möglich fand François eine Ausrede, um seine Familie zu verlassen und nach seinen Freunden Armand de Saint Paul und Pierre de Beauvoir zu suchen. Schließlich fand er sie, aber nicht im Spielsalon – wie er gehofft hatte – sondern im großen Ballsaal, wo Armand den Tanz mit einer korpulenten jungen Dame anführte.
Pierre sah aus wie ein blutjunger Adliger, der gerade die Aufnahme in den Ritterstand anstrebte, obwohl er bereits zwei der höchsten Titel besaß: väterlicherseits trug er den Titel Marquis de Beauvoir von Frankreich und mütterlicherseits hatte er das Herzogtum Hertford in England geerbt. Pierre und Armand waren eng befreundet; der eine war ohne den anderen kaum vorstellbar. Da Pierre im letzten Jahr geheiratet hatte, war Armand nun einer der heißesten Preise auf dem Pariser Heiratsmarkt. Er sah sehr attraktiv aus, trug schulterlanges, lockiges braunes Haar und hatte eine muskulöse Statur. Aber seine wahre Waffe waren seine schmelzenden braunen Augen, die eine ständige – und sehr vielversprechende – Einladung für jede schöne Frau waren.
Armand war allerdings inzwischen dafür bekannt, dass er das Flirten vielleicht etwas zu sehr genoss und er war bisher noch in keine der zahlreichen Heiratsfallen getappt, die ihm gestellt worden waren. Deshalb waren die säuerlich dreinblickenden Matronen, die für die Tugend ihrer Töchter verantwortlich waren, sehr misstrauisch, sobald Armand sich näherte. Er hatte schon zu viele gebrochene Herzen hinterlassen.
Armand war nicht dafür bekannt, dass er reichen Erbinnen hinterherjagte, also konnte es nur eine Erklärung dafür geben, warum sich heute Abend um ein Mauerblümchen kümmerte: Seine Mutter musste ihn dazu verdammt haben. Dieser Verdacht wurde durch das breite Grinsen auf Pierres Gesicht bestätigt, wann immer er seinem Freund während einer der komplizierten Tanzfiguren begegnete. Die Musik hörte endlich auf und nichts hätte korrekter, charmanter und höflicher sein können als die Art und Weise, wie Armand sich von seiner Tanzpartnerin verabschiedete.
Schnell gesellte er sich zu seinen Freunden. »Bitte holt mich aus dieser Folterkammer hier raus. Ich habe meiner Mutter versprochen, mit den jungen Debütantinnen zu tanzen, die keinen Partner finden konnten, aber genug ist genug! Dieser Trampel ist mir zweimal auf die Füße getreten – kannst du dir das vorstellen?«
»Autsch!«, kommentierte Pierre. »Sie sieht ein bisschen schwer aus …«
»Das ist sie auch!«, antwortete Armand und warf einen vorwurfsvollen Blick auf die dickliche junge Dame, die jetzt auf der gegenüberliegenden Seite des Ballsaals saß und dort mit ihrer Schwester flüsterte und kicherte. Sobald die beiden Mädchen bemerkten, dass sie nicht nur von einem, sondern von drei attraktiven Männern beobachtet wurden, traten ihrer Fächer kokett in Aktion, in der Hoffnung, zu einem weiteren Tanz aufgefordert zu werden.
François ignorierte die sehnsüchtigen Blicke der Damen und wechselte das Thema. »Ich muss mit euch beiden reden – und zwar unter vier Augen – oder sollte ich sagen, unter sechs Augen?«
»Ich wünschte, es wäre etwas, das mit einem neuen Abenteuer zu tun hat«, seufzte Armand. »Paris ist so langweilig geworden. Ich könnte wirklich ein bisschen Abwechslung gebrauchen.«
»Ich auch«, warf Pierre ein und errötete. »Ich meine, ich bin ein verheirateter Mann – und sehr glücklich – aber manchmal …«
François lachte. »Ich verstehe schon. Ich muss zugeben, nachdem ich das Vergnügen hatte, euch beide bei eurem letzten Abenteuer in Venedig zu retten, kommt mir das Leben hier auch ein bisschen langweilig vor. Wo und wann können wir uns vertraulich unterhalten?«
»Später, François, nach Mitternacht. Sobald ich hier im Ballsaal die Debütantinnen geschwenkt habe, hat mich meine Mutter zu einer Dichterlesung in den blauen Salon beordert. Sie will damit zeigen, dass sich die Familie Saint Paul für die Förderung der schönen Künste einsetzt«, stöhnte Armand. »Übrigens, Pierre, meine Mutter verlangt auch deine Anwesenheit und ich soll dich warnen, dass sie keine Ausreden akzeptiert.«
»Ein Raum voller Damen mittleren Alters, die um die Aufmerksamkeit des großen Dichters buhlen. Ich kenne diese Art von Vorträgen, sie sind einfach grauenhaft!«, rief Pierre aus. »Du willst mich doch nicht ernsthaft in so etwas reinziehen!«
»Doch, und ich wiederhole, keine Ausrede wird akzeptiert. Du kennst Maman … aber sie wird dafür bezahlen müssen«, antwortete Armand düster. »Es gibt eine Grenze für das, was selbst der treueste Sohn für seine Mutter tun muss.«
»Dann lass uns das Treffen nach Mitternacht vereinbaren, aber wo?«, fragte François, der insgeheim erleichtert war, dass die Marquise offensichtlich vergessen hatte, ihn auch einzubestellen.
»Das ist nicht ganz einfach. In der Bibliothek wurden Spieltische aufgestellt, sie wird vor Gästen wimmeln. Bleibt eigentlich nur mein Zimmer, wenn es dir nichts ausmacht. Ein anderer Ort ist heute Abend nicht verfügbar, um etwas Vertrauliches zu besprechen.«
»Einverstanden, dann treffen wir uns nach Mitternacht in der Bibliothek und gehen gemeinsam hoch auf dein Zimmer. Aber jetzt muss ich erst mit meiner Schwester tanzen.« Sein Blick fiel auf Armand. »Oder hättest du etwas dagegen, mit ihr zu tanzen? Sie hat mir gesagt, dass es ihr peinlich ist, den Tanz mit mir zu eröffnen. Sie ist überzeugt, dass dann alle denken werden, dass sie keinen passenden Partner finden konnte.«
Armands Gesicht erhellte sich. »Mit Vergnügen, erstaunlich, wie hübsch deine Schwester geworden ist. Ich werde zwei daraus machen, wenn du es erlaubst!«
»Ein Tanz ist genug, sonst gehen sofort die Gerüchte los. Und bitte zurückhaltend, kein Flirten, klar?«
»Vertrau mir!«, antwortete Armand mit einem Augenzwinkern, »deine Schwester ist in den besten Händen.«
»Nun, dann können wir gerne über eine eheliche Verbindung nachdenken …«
»Ich hab’s schon verstanden, François, ich werde anständig sein.« Und schon war Armand verschwunden.
»Das Wort ‚Ehe’ löst immer Panik bei ihm aus«, erklärte Pierre entschuldigend.
»Genau deshalb habe ich es ja benutzt«, antwortete François lachend. »Bis später.«
***
Der Marquis de Saint Paul hatte seinem Maître de Cuisine freie Hand gegeben, der sich sofort seinen kühnsten Träumen hingegeben hatte. Im Speisesaal entdeckte François Speisen in einer Fülle, die noch nicht einmal der königliche Hof bieten konnte – wer außer dem Marquis de Saint Paul – konnte es sich in diesen Zeiten leisten, Berge von Kaviar zu servieren, der auf Schlitten mit Eis aus dem fernen Russland herbeigeschafft worden war?
Ein hochmütiger, ausgestopfter Pfau thronte in königlicher Pracht über einem Berg von köstlichem Geflügel. Dazu gab es mit Honig glasiertes Spanferkel, Rehpastete und Wildschweinbraten – die Liste war schier endlos.
Die Speisen waren auf polierten Silbertellern angerichtet. Dies war eine bewusste Untertreibung, denn der Marquis hätte seine goldenen Teller und Platten benutzen können. Aber da Seine Eminenz, der Kardinal Mazarin, heute Abend zu einem kurzen Besuch erwartet wurde, hatte der Marquis beschlossen, nicht zu viel von seinem Reichtum zur Schau zu stellen und damit zu riskieren, die Aufmerksamkeit des Premierministers zu erregen, der dafür bekannt war, Schätze zu horten und dabei die unterschiedlichsten – selten ethischen – Wege zu beschreiten, um alles, was ihm gefiel, an sich zu raffen.
François war gerade dabei, sich einige der Köstlichkeiten servieren zu lassen, als ein hünenhafter Mann den Raum betrat und mit tiefer, vor Zufriedenheit triefender Stimme ausrief: »Das ist genau der Raum, den ich gesucht habe. Ich bin am Verhungern!« Sein prüfender Blick glitt über das Essen – ein seltsamer Blick, denn der Riese besaß Augen mit zwei verschiedenen Farben.
»Charles!«, rief François aus. »Ich wusste nicht, dass du in Paris bist. Du bist genau der Mann, den ich brauche!«
Der Riese drehte sich um und lächelte François an. Sie waren nicht nur enge Freunde, sondern hatten in der Vergangenheit auch schon viele Abenteuer miteinander erlebt.
»Du klingst genau wie meine Frau!«, scherzte er mit seinem englischen Akzent.
»Aber lass mich erst eine Kleinigkeit essen, denn ich bin am Verhungern. Du willst doch sicher nicht, dass ich vor Erschöpfung umfalle, bevor du mir sagst, warum du mich brauchst. Zumal es bestimmt etwas Lästiges ist.«
François begann zu protestieren, aber Charles unterbrach ihn. »Es hat keinen Sinn, mir etwas anderes zu sagen, ich kenne dich einfach zu gut! Du hast schon wieder dieses Funkeln in den Augen, das hat mich das letzte Mal durch halb Europa gehetzt.«
»Ich bin empört, das ist üble Nachrede!«, antwortete François mit einem Augenzwinkern. »Nur ein kleiner Ratschlag, nichts, was dich stören könnte. Sieh mich nicht so an!«
Charles lachte, ein Geräusch, das den Raum fast zum Vibrieren brachte. »Ganz unschuldig, wie immer, aber mich kannst du nicht täuschen.«
Dann wählte er mit Bedacht und Genuss die besten Gerichte aus. Während sie aßen, tauschten sie sich über die neuesten Nachrichten aus, vermieden aber sorgfältig alle Themen, die nicht für die Öffentlichkeit gedacht waren. François hatte Gerüchte gehört, dass Charles mit einer geheimen diplomatischen Mission für Seine Majestät, König Karl, König von England, Schottland und Irland, betraut worden war. Aber angesichts seines letzten Gesprächs mit Kardinal Mazarin bezweifelte François, dass besagter König Karl in der Lage sein würde, seinen Kopf noch retten zu können.
»Ich treffe mich mit Pierre und Armand um Mitternacht in der Bibliothek, würdest du dich uns anschließen? Wir könnten deinen Rat gebrauchen.«
»Ihr drei auf einem Haufen – das bedeutet sicher eine Menge Ärger. Ich hatte mal wieder Recht – nicht wahr?«
Charles seufzte. »Ihr habt Glück, jetzt, wo ich gegessen habe, bin ich in versöhnlicher Stimmung und werde mich euch anschließen. Aber zieh mich bloß nicht eine eurer irren Geschichten hinein. Ich werde nie vergessen, wie mich deine lästigen Freunde Tag und Nacht durch Frankreich und Italien galoppieren ließen, um sie aus den Klauen von Pierres mörderischem Cousin Henri zu retten! Pierres französische Verwandte sind schon ein seltsames Völkchen.«
»Keine Abenteuer, das verspreche ich, bei allen Heiligen.« François sah ihn unschuldig an und kreuzte seine Finger hinter seinem Rücken. »Übrigens, einer dieser lästigen Freunde, die du gerade erwähnt hast, ist dein eigener Cousin. Mach dir aber keine Sorgen, Charles, wir haben nur das dringende Bedürfnis, aus der Quelle deiner Weisheit schöpfen zu dürfen.«
»Du schlauer kleiner Teufel, du machst dich schon wieder über mich lustig. Wir sehen uns später!«
Beim Anblick des üppigen Buffets erinnerte sich François mit einem Anflug von Schuldgefühlen daran, dass seine Frau und seine Familie auf ihn warten mussten, wahrscheinlich hungrig und ihn vermutlich für seine lange Abwesenheit verfluchten. Mit mehr als nur einem Anflug von schlechtem Gewissen machte er sich auf den Weg zurück in den Ballsaal, um nach Julia und seiner Mutter zu suchen, die seine Schwester chaperonierte.
Doch zu seiner größten Erleichterung blieben François Belehrungen über seine Nachlässigkeit erspart. Durch einen glücklichen Zufall hatte seine Mutter ein paar ihrer alten Freundinnen getroffen und er fand sie vertieft in einer angeregten Unterhaltung, während seine Frau mit Armand tanzte und dabei nicht verbarg, dass sie sich prächtig amüsierte.
»Du scheinst mich ja nicht allzu sehr zu vermissen«, begrüßte er seine Frau mit zusammengebissenen Zähnen.
»Sie waren abwesend, Sir?«, antwortete Julia. »Ich muss es vergessen haben, ich habe eine äußerst angenehme Zeit mit einem sehr attraktiven Herrn verbracht, der sich rührend um mich gekümmert hat, er hat uns sogar Wein und Süßigkeiten gebracht, während mein Mann irgendwohin verschwunden war …«
»Quäle mich nicht, Julia, wie kann ich deine Gunst jemals zurückgewinnen?«, flehte François.
»Das wird schwierig sein, mein Herr, aber ich könnte es mir überlegen. Du könntest mich zum Beispiel fragen, ob ich tanzen möchte und danach wäre ein nettes Essen der Vergebung förderlich.«
Die Zeit verging rasend schnell und beinahe hätte François die Verabredung mit seinen Freunden verpasst. Aber wie sich herausstellte, war er der erste, der in der Bibliothek ankam, wo er noch genügend Zeit hatte, ein Glas Wein zu trinken, bevor Pierre und Armand endlich auftauchten. Die beiden Freunde hatten die Zeit beim Würfelspiel vergessen.
»Ich habe Charles eingeladen, sich uns anzuschließen, hat ihn jemand gesehen?«
»Oh, Cousin Charles! Er ist jetzt ein hohes Tier geworden. Ich habe gesehen, wie er unten mit Kardinal Mazarin und Armands Vater diskutiert«, rief Pierre aus. »Stell dich lieber darauf ein, dass wir noch eine Weile warten müssen. Mazarin redet gerne und viel – genau wie Charles.«
Es dauerte dann auch noch, bis Charles endlich auftauchte. »Ihr wartet ja immer noch auf mich«, seufzte er. »Ich hatte gehofft, dass ihr es vergessen würdet. Ihr seid lästiger als ein Rudel junger Hunde.«
»Wie könnten wir dich nur vergessen, Charles?«, protestierte Armand, »deine schiere Größe macht dich unvergesslich.«
»Frechdachs!«, kommentierte Charles gut gelaunt. »Jetzt sei ein guter Gastgeber und organisiere etwas Wein. Wenn wir schon reden müssen, will ich nicht dabei verdursten.«
***
Armand war der jüngste Sohn des Marquis de Saint Paul. Sein Zimmer war angenehm groß, aber keineswegs das größte im Haus. Sein ältester Bruder, der Erbe des Titels, hatte dafür gesorgt, dass er das größte Zimmer besaß – abgesehen vom Marquis und seiner Frau, natürlich. Aber die Fenster von Armands Schlafzimmer gingen auf den Garten hinaus, was eine nette Entschädigung dafür war, dass sein Bruder durch den Lärm der Straße gestört wurde.
Bis Charles das Zimmer betrat, hatte es geräumig gewirkt – jetzt wirkte das Schlafzimmer plötzlich klein. Charles begutachtete misstrauisch den Sessel, der ihm angeboten wurde, bevor er sich setzte. Pierre hielt den Atem an: der Stuhl quietschte protestierend, aber er hielt. Zwei weitere Stühle standen für Pierre und François bereit, und Armand warf sich auf das große Himmelbett und tat dies mit einem zufriedenen Seufzer, da seine Füße vom Tanzen schmerzten.
»Zu Hause einen Ball abzuhalten ist ein Albtraum … da ich ein Gentleman bin, werde ich dir nicht sagen, was ich wirklich denke, aber ich fühle mich, als ob ich gefoltert worden sei – und zwar an Körper und Geist. Erst musste ich mit den hässlichsten und denkbar ungeschicktesten Mädchen tanzen, nur um meiner Mutter einen Gefallen zu tun, dann kam dieser dumme Dichter mit seiner schier endlosen ‚Ode an meine Nymphe, die im silbernen Licht des aufsteigenden Mondes badet’. Dieser gelackte Kerl hat mich fast umgebracht. Ich habe noch nie so viel Unsinn gehört. Und du hättest die Damen sehen sollen, die sich an seinen Worten weideten und ihm fast die Füße küssten, es war einfach ekelhaft!«
»Du scheinst dich aber mit Julia gut amüsiert zu haben«, warf François ein, immer noch eifersüchtig.
»Oh, Julia! Das muss man ihr lassen, sie ist wirklich etwas Besonderes, ein echter Schatz. Ich habe nie verstanden, warum sie dich geheiratet hat, ein Wort nur – und sie hätte mich haben können! Eines Tages wird sie aufwachen und verstehen, was für einen schrecklichen Fehler sie gemacht hat.«
François trat nach ihm, verzichtete aber auf einen Kommentar.
Charles nippte an seinem Wein. »Kann mir jemand verraten, warum wir uns hier oben wie eine Gruppe von Verschwörern verstecken müssen? Ich dachte, ich hätte zu Hause in England schon genug davon ertragen müssen.«
»Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich euch allen eine Erklärung gebe.« François bewegte sich, um eine bequemere Position in seinem Stuhl zu finden; schließlich gab er diese fruchtlose Übung auf und rief verärgert aus: »Dieser Stuhl stammt direkt aus euren mittelalterlichen Folterkammern.«
»Beschwere dich nicht über meinen Stuhl, er hat meiner Familie schon seit Generationen treu gedient«, erwiderte Armand.
»Vielleicht ist es dann an der Zeit, sich neue Möbel anzuschaffen?«
Doch dann fuhr er fort: »Was ich euch jetzt erzähle, ist streng vertraulich. Um es kurz zu machen: Ich habe die Ehre, nach England zu segeln, um dort die Königin von England zu treffen und ihr die Augen dafür zu öffnen, dass es an der Zeit ist, in die Sicherheit im Schosse ihrer Familie in Frankreich zurückzukehren. Hat jemand einen Vorschlag, wie ich das erfolgreich anstellen kann?«
»Machst du Witze?« Charles sah François an, als hätte er gerade entdeckt, dass sein Freund nicht mehr alle Tassen im Schrank habe.
»Nein, ich meine es todernst. Seine Eminenz hat den Befehl persönlich gegeben. Ihre Schwägerin, sprich unsere verehrte Königin Anne ist besorgt, dass die Ereignisse in England bald außer Kontrolle geraten könnten, und Mazarin teilt ihre Ansicht. Es wäre ein Albtraum, wenn Königin Henrietta Maria, sprich eine frühere Prinzessin von Frankreich, in die Hände der Schurken fällt, die gerade das Parlament erobert haben. Deshalb muss sie unbedingt davon überzeugt werden, zu fliehen – und zwar je früher, desto besser.«
»Hast du jemals etwas von Königin Henrietta Maria gehört?«, fragte Charles, während er sich ein weiteres Glas Wein einschenkte. »Ich brauche das jetzt und ich kann dir garantieren, dass du das gleich auch brauchst«, fügte er hinzu und deutete auf den Wein.
François runzelte die Stirn. »Ja und nein, ich meine, die üblichen Dinge. Sie soll eine Schönheit sein, aber wir alle wissen, dass das wahrscheinlich nicht stimmt. Wie kann sie schön sein, mit Eltern wie Heinrich IV., der mit seiner schrecklichen Nase wie ein Bauer aussah, und ihrer fetten Medici-Mutter mit ihrem Doppelkinn und einer Taille, dick wie ein Schwein. Ich habe auch gehört, dass ihr ständig das Geld ausgeht, aber das ist nichts Ungewöhnliches, es gibt kaum einen König oder eine Königin, die rechnen können.«
Charles nahm einen langen Schluck Wein, kratzte sich am Kopf und antwortete: »Unsere edle Königin ist etwas Besonderes, das gebe ich zu. Sie ist übrigens nie gekrönt worden, weil sie sich strikt weigert, an einem Gottesdienst teilzunehmen, der von einem Bischof der Kirche von England geleitet wird. Das mag überraschen, denn ihr Vater war ein überzeugter Protestant, aber er hat ja seinen Glauben so schnell gewechselt wie ein Hemd, als ihm angeboten wurde, sich die französische Krone auf sein kahles Haupt zu setzen. Aber Königin Henrietta – ihr Mann nennt sie übrigens Marie – wurde von Karmeliterinnen erzogen, ist religiös und dazu stur wie ein Maultier, eine Eigenschaft, die sie von ihrem Vater geerbt hat. Sie sieht sich selbst als Märtyrerin, die von der Vorsehung auf eine unkultivierte Insel namens England geschickt wurde, um die Heiden dort zu bekehren. Ach ja, sie sagt immer wieder, dass sie lieber sterben wolle, als ihren Mann zu verlassen.«
Pierre meldete sich: »Ich habe gerade eine dringende Depesche von König Karl erhalten, der Geld und meine Anwesenheit einfordert. Ich hasse die Vorstellung, nach England überzusetzen, aber ich habe wohl keine Wahl. Bald gehen mir die Ausreden aus.«
Charles nickte. »Ja, die Dinge ändern sich von Minute zu Minute – leider zum Schlechteren. Das Parlament in London gewinnt täglich an Stärke. Es gibt da einen neuen Anführer in der Armee, einen gewissen Cromwell, der ihnen einredet, dass er vom Allmächtigen inspiriert und geleitet wird.«
»Ist dein Cromwell eine Art englische Johanna von Orleans?«, scherzte Armand. »Sie hat sich zumindest ihren Platz in der Geschichte gesichert, denn sie hat uns vor den Engländern gerettet.«
Charles ignorierte diese Frechheit und fuhr fort: »Vielleicht wird dieser Oliver Cromwell auch seinen Platz in der Geschichte finden. Ich kann hier ganz offen sprechen, ich habe noch nie so viel Inkompetenz gesehen wie im königlichen Hauptquartier. Manchmal denke ich, dass sich unsere Adligen mehr um ihre Kleidung, ihre Pferde und ihren Rang kümmern, als an einem Plan zu arbeiten, wie man die Flut der Puritaner aufhalten kann, die unser altes Königreich wegzuspülen droht.«
»Was ist mit Prinz Rupert?«, fragte Pierre. »Er scheint ein ausgezeichneter Soldat zu sein – und wie ich gehört habe, ist er auch ein charismatischer Anführer der Truppen – und ein überzeugter Protestant?«
»Prinz Rupert ist ein guter Kämpfer, aber sein Cousin, der König, bleibt unser oberster Befehlshaber. Bei allem Respekt vor Seiner Majestät, der König ist ein langsamer Denker und macht sich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht lang Gedanken, bevor er eine Entscheidung trifft, wenn er überhaupt eine trifft …«
»Besser eine schlechte Entscheidung als gar keine, hat mein Vater immer gesagt«, warf Armand ein.
»Das stimmt, in der Kriegsführung muss man schnell handeln.«
»Also, ratet mir, wie soll ich vorgehen?«, fragte François. »Ich kann doch nicht nach London gehen und an die Tür von Schloss Windsor klopfen: ’Eure Majestät, ich schlage vor, dass Ihr eine Kutsche zurück nach Frankreich nehmt, und rein zufälligerweise wartet da draußen schon eine!’«
Charles musste lachen, aber dann wurde er ernst.
»Zunächst einmal musst du wissen, dass der Hof London schon vor längerer Zeit verlassen hat, denn selbst Schloss Windsor galt nicht mehr als sicher. Der König und sein Hof befinden sich jetzt in Oxford. Die Stadt wurde befestigt und ist viel leichter zu verteidigen als London. Die traurige Tatsache ist, dass die Hauptstadt für die Krone verloren ist, sie ist fest in der Hand der Puritaner.«
»In Oxford? Ich wusste nicht einmal, dass es dort einen königlichen Palast oder ein Schloss gibt?« Pierre war verblüfft.
»Nein, es gibt weder ein Schloss noch einen Palast. Die Königin wohnt im Merton College, sie hat dort ihren Hofstaat eröffnet«, antwortete Charles, »der König und sein Stab sind in ihrer Nähe, aber in einem anderen Gebäude der Universität untergebracht. Es ist nur ein vorübergehendes Arrangement, denn er ist überzeugt, dass er bald nach Whitehall zurückkehren wird, allerdings eine Ansicht, die ich mit Seiner Majestät nicht teile.
François griff nach einem Glas Wein. »Jetzt erinnere ich mich, Mazarin hat Oxford erwähnt. Ich brauche jetzt wirklich ein Glas Wein, du hattest recht. Die Königin wird niemals zustimmen, ihren Mann in einer solchen Situation zu verlassen, das würde wie Hochverrat aussehen.«
»Lass mich ein Wort der Warnung sagen, François, du musst von dem Moment an, in dem du englischen Boden betrittst, äußerst vorsichtig sein«, fuhr Charles fort. »Die Puritaner, oder Roundheads, wie wir sie nennen, hassen die Franzosen und sie verabscheuen jeden, der katholisch ist. Sobald sie merken, dass du aus Frankreich kommst, wirst du als Verräter verhaftet, wenn nicht sogar auf der Stelle getötet. Und was Pierre angeht, du musst auch sehr vorsichtig sein, nicht jeder wird deine Ankunft begrüßen.«