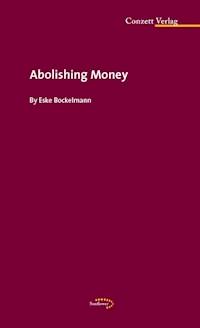Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Geld regiert die Welt, und die von ihm regierte Welt droht in einer Katastrophe zu enden – sozial und ökologisch. Doch warum bestimmt das Geld überhaupt über den Lauf der Welt? Worin besteht seine Herrschaft, dass selbst die mächtigsten Regierungen vor ihm strammstehen und wir uns kaum vorstellen können, dass es je anders gewesen sein könnte? In seiner grandiosen Schilderung, wie das Geld in die Welt kam, zeigt Eske Bockelmann entgegen den heute gängigen Überzeugungen, dass sich dieses besondere Tauschmittel erst im Europa des Spätmittelalters durchgesetzt hat – mag es davor auch Märkte und Münzen gegeben haben. Mit einem ungewöhnlich genauen Blick auf die Geschichte und Ethnologie des Wirtschaftens arbeitet er die Unterschiede zu vormonetären Gemeinwesen und ihrem sozialen Zusammenhalt ohne Geld heraus und beleuchtet die Etablierung der Marktwirtschaft in den freien Städten des späteren Mittelalters bis hin zum Platzen der ersten Finanzblase. Und mit dieser Herleitung des Geldes gelingt es endlich, auch das scheinbar ewige Rätsel zu lösen: was Geld überhaupt ist – und wie es zusammenhängt mit Wert und Kapital, Spekulation und Krise, Staat und Gesellschaft. Seine glänzend geschriebene Untersuchung ist revolutionär, noch über Marx hinaus: Gerade indem sie uns ein neues, tieferes Verständnis der Zwänge und der Allmacht des Geldes verschafft, eröffnet sie uns eine Perspektive auf eine zukünftige Welt, in der das Geld der Vergangenheit angehören könnte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 573
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eske Bockelmann
Das Geld
Was es ist,das uns beherrscht
Es kommt auch ein wolkenloses Reich dervollkommenen Güter, auf die kein Geld fällt.
Walter Benjamin
Inhalt
Einleitung
Erster Teil
WELT OHNE GELD
Prolog
des wil ich wesen gelt
Von Ewigkeit zu Ewigkeit
Anfang
IGaben
Ferne Gegenwart
Austausch
Ein dritter Mann
Gemeinwesen
Der Groll des Achilles
Wortkunde
Exkurs: Das Opfer
IIDanken und Sühnen
GELT als Zahlung
Pflicht und Schuldigkeit
Exkurs: Schulden
Zahlungsmittel
Im alten Mesopotamien
Der geschuldete Mensch
Münzen
IIIGeschätzte Güter
Kauf und Verkauf
Kauri in Dahome
Märkte ohne Markt …
… und frei von Wert
Schätzung
Exkurs: Aristoteles und die chrēmata
Handel oder Gewinn ohne Verlust
Zweiter Teil
WIE GELD WURDE
Prolog
IEin Abweg
Leben von Kauf und Verkauf
Verwerfungen
IINeustadt
Grund zu Gründungen
Getrennte Welten
Eine neuartige Abhängigkeit
IIIDer Umschlag ins Neue
Zwei Waagschalen
L’oeconomie politique
Carentia pecuniae
The Culture of Credit
Ein Preis für alle Dinge
Dritter Teil
WAS GELD IST
Prolog
IReines Tauschmittel
Reines Sein
Material gegen Nominal
Kreditwesen
IIWert, absolut relativ
Gleichsetzung
Wert/Ware
Exkurs: Gezählte Funktionen
IIIEin Quantum nichts und sein Etwas
Wert in sich und Wert in Ware
Reines gegen substanzielles Quantum
Exkurs: Theorie des Scheins I – Grenznutzen
Exkurs: Theorie des Scheins II – Arbeitswert
Wert oder Preis
IVWertgesetz
Auf immer zu realisieren, niemals realisiert
Zukunft ohne Gegenwart
Von Wert zu mehr Wert
VKapital
Der Zwang …
… und die Möglichkeit, mehr zu werden
Exkurs: »Abstrakt menschliche Arbeit«
Die Wirklichkeit des Mehrwerts
VIUnter Geldsubjekten
Eigentum
Konkurrenz
Staat
VIISpekulation
Geld schöpfen …
Exkurs: Vollgeld
… und Geld erwirtschaften
Potenzierung
VIIIÜberschreitung und Siegeszug
Finanzwirtschaft
Krisen
Die Unterwerfung der Welt
Epilog
Anmerkungen
Einleitung
Für dieses Buch gibt es guten oder – je nachdem – ausgesprochen schlechten Grund.
Und das ist: wie es um diese Welt steht. Es steht um diese Welt so, dass kaum eine Woche vergeht, in der nicht erneut von kundiger Seite gemahnt würde, es müsse allerspätestens jetzt etwas wegen des Klimas geschehen, es müsse endgültig jetzt mit der Zerstörung hier aufgehört oder mit der Rettung dort begonnen werden, es müsse jetzt und müsste schon längst dies geschützt und jenes erhalten und mit Unzähligem so ganz, ganz anders umgegangen werden, als heute damit umgegangen wird. Und dennoch bleibt es dabei, und was unternommen wird, bleibt planmäßig weit, weit hinter dem zurück, was nötig wäre.
Was dazu zwingt, wir haben es alle vor Augen. Es gibt sich ganz offen zu erkennen, wenn etwa der mächtigste Staat dieser geplagten Erde seine Macht nutzt, um noch dem harmlosesten Klimaabkommen fernzubleiben: Eine solche Rücksicht auf die Welt verträgt sich nicht mit den Interessen seiner »Wirtschaft« – einer Wirtschaft, die sich bekanntlich ums Geld dreht. Selbst die Supermacht gibt also mit ihrer Entscheidung zu Protokoll, dass es eine Macht noch über der ihren gibt. Es ist eine Macht, von der selbst vereinigte Staaten abhängen, jeder Staat und so auch jeder einzelne Staatsbürger auf dieser Welt. Es ist die Macht, die ebendiese Welt regiert.
Wozu das Geld aber Staaten und Menschen zwingt, es wird schon seit geraumer Zeit durch »die Krise« verschärft. Über ein Jahrzehnt dauert sie inzwischen an. Auch wenn die Börsenkurse längst wieder gefährlich von einem Jahreshoch zum nächsten fliegen, so zeigt doch der anhaltende Tiefflug der Zinsen und zeigen die Unsummen an neuem Geld, welches die Staaten unablässig nachschießen müssen, dass die »Wirtschaft« weiterhin im Krisenmodus steckt. Zu Recht nimmt daher auch das tiefe Unbehagen zu, das längst gegenüber dem Geld besteht, ein oft vages, aber in jedem Fall heftiges Unbehagen. Es ist die Gewissheit oder wenigstens die dunkle Furcht, dass es nicht gut gehen wird mit dem Geld und dass es für die Welt katastrophisch damit endet.
Einige wenige Leute versuchen sich deshalb bereits an einem Leben jenseits des Geldes. Sehr viel stärker jedoch ist die entgegengesetzte Reaktion, nicht die intensive Suche danach, wie das Geld zu überwinden, sondern danach, wie das Geld zu retten und zu bewahren wäre. Einflussreiche Initiativen machen Vorschläge, die es bereits bis zu Volksabstimmungen gebracht haben. Da sollen die Banken kontrolliert werden, soll eine Transaktionssteuer mäßigend einwirken oder eine andere geschickt angebrachte Steuer den rechten Einhalt gebieten. Die »Entschleunigung« des Marktes sei notwendig oder die Abschaffung von Zins und Zinseszins. Etwas wie »Vollgeld« soll für stabilen Geldwert sorgen oder ein »bedingungsloses Grundeinkommen« dafür, dass keinem mehr das Geld ausgeht. Einmal nähren Regionalwährungen die Hoffnung, mit ihnen werde das Geld insgesamt besser funktionieren, einmal wird ihm eine sichere Zukunft in weltweit flottierenden Bitcoins prophezeit. Oder man will das Geld kurzerhand per Gesetz darauf verpflichten, gut zu sein, damit sich unsere kapitalistische Wirtschaft schlicht nach Vorschrift aus einer bedrohlichen und bedrohten in eine Gemeinwohlökonomie verwandle.
Dass also dringender Anlass besteht, am Geld zumindest etwas zu ändern, ist bekannt. Wenig bekannt ist jedoch, wie das Geld selbst sich zu all dem verhielte, was da zu seiner Rettung dienen soll. Was davon würde die Macht des Geldes überhaupt zulassen? Welcher Eingriff vertrüge sich überhaupt mit dem Geld? Das bleibt unbekannt, weil zum einen viel zu wenig danach gefragt wird. Aber unbekannt bleibt es auch, da bereits die erste und drängendste Frage zum Geld – bis heute – keine ausreichende Antwort erfahren hat. Denn wie ungeheuerlich es auch klingen mag: Noch heute weiß niemand zu sagen, was Geld ist.
Selbstverständlich ist jedem geläufig, was es mit Geld auf sich hat, solange es darum geht, mit Geld umzugehen. Dass man es braucht und wofür man es braucht, wie man zu Geld kommt und wie es sich allgemein einsetzen lässt, alles das ist kein Geheimnis. Aber es verhält sich damit ähnlich wie mit der ptolemäischen Weltsicht: Der Gang der Gestirne lässt sich sehr wohl korrekt berechnen, auch wenn man falsch annimmt, dass sich die Sonne um die Erde drehen würde. Nur ist er auf diese Weise nicht verstanden – und man weiß nicht einmal, was man dabei alles nicht versteht. Das beschreibt den heutigen Wissensstand beim Geld.
Alan Greenspan, langjähriger Präsident der amerikanischen Notenbank und geübt in jederlei Umgang auch mit allergrößten Summen, hat nach seinem Ausscheiden aus dem Amt eingestanden, bis jetzt wisse er nicht, was Geld eigentlich sei. Und das ist nicht bloß die Koketterie, die es auch ist, sondern die biedere Wahrheit. In einem wissenschaftlich fundierten Enzyklopädischen Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens beginnt der aktuelle Artikel »Geld« mit den Worten: »Die Ökonomik hat es bisher nicht vermocht, einen allgemein akzeptierten Begriff des Geldes vorzulegen.«1 Und nicht nur sind die Versuche, das Wesen von Geld zu bestimmen, noch immer gescheitert, sie wurden auch selten genug unternommen. Denn »so allgegenwärtig das Geld auch sein mag, so überschaubar sind die Versuche, zu erklären, was Geld ist, warum es in die Welt kam und wie es funktioniert«.2 Die Autoren dieser raren Versuche tragen zwar die allergrößten Namen, Adam Smith, Georg Simmel, möglicherweise Keynes, vor allem aber Marx, doch auch ihnen hat sich das Rätsel Geld nicht gelöst. Jeder Kieferknochen eines prähistorischen Quastenflossers ist heute gründlicher erforscht als das Wesen, das unsere Welt in Grund und Boden beherrscht.
Es zu erkennen, wäre schon lange notwendig gewesen, aber es ist heute dringender notwendig als je. Da es um unsere Welt unter der Macht des Geldes so steht, wie es um sie steht, müssen wir wissen, wodurch dem Geld diese Macht zukommt: um ihm diese Macht zu nehmen. Dafür müssen wir wissen, wie es einmal ohne Geld zugegangen ist. Dafür müssen wir wissen, wie es historisch zu Geld kommt. Dafür müssen wir wissen, was Geld ist.
Hier sei es endlich dargelegt. Hier wird dieses Rätsel gelöst – nicht nur um ein Rätsel zu lösen, sondern damit wir dem beikommen, was uns beherrscht. Das ist der Grund für dieses Buch.
Erster Teil
WELT OHNE GELD
Prolog
des wil ich wesen gelt
Im Nibelungenlied wird erzählt, wie König Gunther, Herr der Burgunden, gemeinsam mit Recken wie Hagen von Tronje und einem Gefolge aus tausend seiner Leute den langen Weg an den Hof des Hunnenkönigs Attila unternimmt. Dorthin hat ihn dessen Gattin eingeladen, Gunthers Schwester Kriemhild, mit heimlich-finsteren Rachegedanken allerdings, die das Ganze in einem wüsten Blutbad werden enden lassen. Auf dieser Reise nun ergibt es sich eines Tages, als die Pferde müde geritten sind und der Proviant bereits zur Neige geht, dass der ganze Zug vor die Burg des Markgrafen Rüdiger gelangt. König Gunther schickt Leute hinein, die um gastliche Aufnahme bitten sollen, und Rüdiger lässt umgehend antworten, er werde die Ankömmlinge mit Freuden empfangen. Als sie dann vor ihn treten und er sie persönlich willkommen heißt, ehrt der Markgraf seine Gäste gar mit dem Versprechen, er werde für alles Sorge tragen, was sie mit sich führen, Pferde und Ausrüstung. Und er fügt hinzu: Sollten sie während ihres Aufenthalts auf seiner Burg einbüßen, was immer es sein mag, »des wil ich wesen gelt« – wörtlich: dafür wolle er Geld sein.3
Markgraf Rüdiger will Geld sein – seltsam. Er sagt nicht, er wolle Geld für etwas geben oder Geld für etwas haben, nein, er will es sein. Wie ist das möglich? Was von dem, was wir unter Geld verstehen, kann jemand sein? Für uns bedeutet Geld, dass wir etwas damit kaufen können. Doch ein Mittel, etwas zu kaufen, kann Rüdiger nicht sein wollen. Und selbst wenn er dergleichen Mittel nur haben wollte, würde es ihm in dieser Situation wenig nützen, denn nirgendwo in der Nähe fände sich etwas zu kaufen. Nirgends in der ganzen Gegend wird gerade ein Markt abgehalten, vielmehr heißt es ausdrücklich, es sei weit und breit nichts zu erstehen.4 Das Geld, von dem Rüdiger spricht, kann also nichts meinen, womit man etwas erwirbt.
Oder denkt er, wie es für uns im Zusammenhang mit Geld ebenfalls möglich ist, nur an den Wert dessen, was seine Gäste bei ihm einbüßen könnten? Falls zum Beispiel in seiner Obhut ein Pferd einginge, will Rüdiger dann den Wert des Pferdes ersetzen? Nein, auch ein solcher Wert, wenn es um ihn zu tun wäre, könnte Rüdiger nicht zu sein versprechen. Außerdem zeigt der Befehl, den Rüdiger unmittelbar auf sein Versprechen hin seinen Knechten erteilt, dass es hier ganz grundsätzlich um etwas anderes geht. Da gebietet er nämlich, den Pferden der Ankömmlinge das Zaumzeug abzunehmen und die Tiere danach frei weiden zu lassen – und das Nibelungenlied kommentiert, eine solche Gastfreundschaft hätten Gunther und die Seinen vorher vil selten erfahren, sprich: noch nie. Das Besondere an dieser Behandlung ist nämlich, dass die Gäste für den Unterhalt der Pferde weder selbst zu sorgen noch Ausgleich zu leisten haben. Aber auch der Markgraf muss für das Weidenlassen der Pferde natürlich nichts weiter aufbringen, es stellt keinen Wert dar, den er sich oder irgendjemandem berechnen müsste: Hier wird nur Gras gefressen, kein Geld verbraucht, kein Wert verschlungen.
Das Ganze läuft ohne Geld ab – ohne das, was wir Geld nennen und was wir unter Geld verstehen. Geld, wie wir es kennen, können wir nicht sein. Und das heißt: Was Rüdiger sein kann, kann nicht Geld gewesen sein, wie wir es kennen. Für ihn und zu seiner Zeit hat das Wort gelt offenbar etwas entschieden anderes bedeutet als in unserer Gegenwart, es entspricht nicht dem Begriff, den wir von Geld haben. Und so fragt sich, wie es im mittelalterlichen Europa, um das Jahr 1200, als das Nibelungenlied entsteht, überhaupt um Geld bestellt ist.
Bekanntlich gibt es damals längst Münzen und Gelegenheiten, bestimmte Dinge zu kaufen, indem man sie gegen Münzen oder andere Dinge tauscht. Doch weder in diesen Münzen noch in irgendwelchen anderen Dingen, mit denen man bei einem Kauf bezahlen konnte, hat man Geld gesehen. Wie sich an Rüdigers Versprechen zeigt, bezeichnete gelt eben nicht ein Tauschmittel als solches. Aber noch wichtiger, nicht nur dieses Wort tut es nicht, es gibt kein einziges Wort im Mittelalter, das bezeichnen würde, was für uns heute so selbstverständlich und einvernehmlich Geld heißt. Und das wiederum bedeutet mehr, als dass nur ein Wort für Geld gefehlt hätte: Das europäische Mittelalter hat nicht nur kein Wort für Geld, es hat keinen Begriff, es hat keine Vorstellung davon. Kein Geringerer als der große Mediävist Jacques Le Goff konstatiert, »dass es keinen mittelalterlichen Geldbegriff gab«:
»Die Menschen des Mittelalters, einschließlich der Kaufleute, Kleriker und Theologen, hatten nie eine klare, einheitliche Vorstellung davon, was wir heute unter diesem Begriff fassen.«5
Sie hatten keine Vorstellung von Geld, das heißt: Sie kannten kein Geld. Das ist eine Einsicht, die erstaunt und die uns heute zunächst unwillkürlich widerstreben wird. Denn sie besagt ernsthaft, dass es Geld noch in verhältnismäßig junger Zeit, als man längst mit Münzen umging, nicht gegeben hat.
Das Fehlen des einheitlichen Begriffs belegt beim Geld notwendig das Fehlen der Sache. Keinerlei Ding, auch eine Münze nicht, kann je für sich genommen schon Geld sein. Nur dadurch, dass Menschen was auch immer als Geld verwenden, wird es für sie überhaupt erst zu Geld. Und wenn sie es aber so verwenden, muss ihnen dies notgedrungen auch einen Begriff davon vermitteln, als was sie es durch ihre Verwendung bestimmen. Der spezifische Umgang mit Geld bringt einen Begriff von Geld hervor – und zwar, wie Le Goff richtig bemerkt, einen einheitlichen Begriff. Es mag uns bis heute Schwierigkeiten bereiten, Geld klar zu definieren, trotzdem haben wir einen Begriff von Geld, und zwar von Geld als einer Einheit: Egal ob es in Münzen auftritt, in Scheinen oder als bloße Zahl auf dem Konto, in all diesen Gestalten wissen und erkennen wir es einheitlich als Geld. Und genau dieser einheitliche Begriff von Geld ist es, der noch dem Mittelalter fehlt.
Solange Menschen keinen Begriff und keine Vorstellung davon haben, dass sie mit Geld umgehen, können sie nicht mit Geld umgegangen sein. Womit auch immer sie also bis dahin umgegangen sind, es war nicht Geld. Dass jemand zu König Gunthers Zeiten »gelt« sein kann, bedeutet wirklich und wahrhaftig: Noch im europäischen Mittelalter hat es kein Geld gegeben.
Von Ewigkeit zu Ewigkeit
Le Goffs Feststellung mag deshalb auf den ersten Blick unerheblich scheinen, in Wahrheit ist sie von großer, weitreichender Bedeutung – wenn man sie denn einmal ernst nimmt. Doch das zu tun fällt offenbar sehr, sehr schwer. Selbst Le Goffs Fachdisziplin, die Mediävistik als Wissenschaft vom Mittelalter, die solche Forschungsergebnisse aufnehmen müsste, zeigt sich dazu außerstande – ja, letztlich auch Le Goff selbst, der aus seiner Beobachtung nie explizit den nötigen Schluss ziehen mochte. Stattdessen »wissen« wir heute alle ganz selbstverständlich, Geld gäbe es schon so lange, dass ein Mittelalter ohne Geld schlicht undenkbar scheint. Wenn wir uns, was Geld betrifft, in ältere Zeiten versetzen, geht es in unserer Vorstellung alldieweil zu wie auf unseren modernen Mittelaltermärkten: Da stecken die Leute zwar in mehr oder weniger überzeugenden Kostümen, aber die Euro, die über die Theke gehen, werden schlicht »Taler« genennet – und das war’s an historischer Differenz. Jede Erkenntnis, die davon abweicht, wehrt man deshalb ab oder man biegt sie sich kurzerhand zurecht. Die Mediävistik zum Beispiel behilft sich mit der Auskunft, es hätte damals, wenn schon keinen Begriff von Geld, so doch »Ersatzwörter« für Geld gegeben. Sie übersieht also gezielt, dass solche »Ersatz«-Wörter, falls sie denn für Geld gestanden hätten, nicht bloß Ersatz für Wörter gewesen wären, die Geld bezeichneten, sondern geradewegs selbst Geld bezeichnet hätten. Solche Wörter aber fehlen; genau das war ja das Problem, dem die Idee mit den »Ersatzwörtern« auszuweichen suchte. Solche Wörter fehlen, weil Begriff und Vorstellung der Sache fehlen, nicht weil sich noch kein »eigentliches« Wort gefunden hätte – wo es doch immerhin das Wort gelt bereits gab.
Was im Mittelalter und in älteren Zeiten dagegen nicht fehlt, sind Wörter, die wir heute mit der Bedeutung von Geld belegen: nachträglich und historisch zu Unrecht. Sie sind es, denen die Mediävistik die »Ersatz«-Bedeutung unterstellt. Geläufig sind uns dabei schon antike Vokabeln wie das lateinische pecunia oder die griechischen chrēmata, die in allen modernen Lexika auch als »Geld« übersetzt werden. Daneben kennt etwa das Lateinische noch Wörter wie nummus, res, opes und fortunae oder wie aes, argentum und aurum, die wir nach heute gängiger Überzeugung allesamt mit »Geld« wiedergeben dürften. Zu ihrer Zeit hatten diese Wörter jedoch Bedeutungen, die sich in keinem Fall mit unserem einheitlichen Begriff von Geld decken. Sie heißen »Münze« oder heißen »Sachen«, heißen »Dinge« und »Güter«, »Habe« und »Mittel«, »Vermögen« und »Macht«, sie bezeichnen Kupfer, Silber, Gold, und pecunia meint etwa »geschätztes Gut«, »Eigentum« oder »Erlös«. Heute verbinden wir tatsächlich alles das auch mit Geld und fragen uns sogleich: Sind Münzen denn nicht immer Geld? Ist ein Erlös denn nicht notwendig in Geld berechnet? Und bestehen nicht auch Vermögen, Güter und Habe grundsätzlich in Geld, beziehungsweise sind sie dieses Geld wert? Nein, das sind sie nicht grundsätzlich, nicht notwendig und nicht schon immer – so verhält es sich vielmehr nur für uns: für alle, die bereits mit Geld und daher mit unserem Begriff von Geld umgehen. Für uns heute verbinden sich Münzen, Güter und Vermögen selbstverständlich mit Geld und stellt all dies tatsächlich etwas von jener einheitlichen Größe dar, die für uns das Geld ist. Doch ebendiese Größe hat vor dem Ende des Mittelalters nicht existiert.
Folglich geben wir all solche Wörter grundsätzlich falsch wieder, wenn wir sie mit »Geld« übersetzen, und verfälschen so jedes der antiken Wörter und jedes der mittelalterlichen – aber genauso auch entsprechende Wörter aus sämtlichen anderen Kulturen, in denen die Menschen noch kein Geld kannten. Denn überall sind wir sogleich mit der Unterstellung bei der Hand, wir dürften daraus, dass Leute mit Gütern und Vermögen, Metallen und Münzen umgingen, zwingend schließen, sie wären auch mit Geld umgegangen und hätten entsprechende Wörter im Sinne von »Geld« verwendet. Dabei ist die Frage der Übersetzung nie bloß eine Frage der Übersetzung. Wir missdeuten in diesem Fall nicht nur Wörter, sondern missverstehen die Zeiten und Kulturen auch selbst, wo sie in Gebrauch waren. Und mehr noch: Wenn wir Geld so konsequent und falsch in Kulturen hineindeuten, die kein Geld kannten, misskennen wir offenbar auch das Geld selbst.
Wenn wir im Mittelalter etwas für Geld halten, was nicht Geld war, fehlt uns offenbar das klare Wissen davon, was Geld ist. Wenn es im Mittelalter unter anderem Münzen gibt, die man gegen andere Dinge tauschen, mit denen man andere Dinge also kaufen konnte, so sind sie damals, wie wir zur Kenntnis nehmen sollten, kein Geld, wir aber, zu Unrecht, halten sie dafür. Tatsächlich will es uns ganz allgemein nicht gelingen, einen grundsätzlichen Unterschied zwischen mittelalterlichen Münzen und dem zu erkennen, was für uns Geld heißt. Diesen Unterschied jedoch muss es geben, da das Mittelalter kein Geld kannte, und wenn er sich unserer Kenntnis entzieht, dann entzieht sich unserer Kenntnis offenbar in seinem Kern auch das Geld selbst. Und das, wie es scheint, in zunehmendem Maße.
Denn dass es historisch erst spät zu Geld gekommen ist, läuft entschieden einer aktuell steigenden Neigung entgegen, die Entstehung des Geldes so früh wie nur möglich anzusetzen und es auf diese Weise letztlich zu verewigen. In den letzten Jahren war ein regelrechter Wettlauf darum zu beobachten, wer das Aufkommen von Geld immer noch älteren Zeiten zuschreiben mochte. Im Allgemeinen hatte man sich sehr lange mit der historischen Annahme begnügt, Geld wäre mit den Münzen aufgekommen, also rund sieben Jahrhunderte vor Christus. Schon das war bei weitem zu früh angesetzt, reicht aber dem gegenwärtigen Geschmack nicht mehr aus. David Graeber schwört inzwischen auf fünftausend Jahre, die das Geld hinter sich haben soll, nämlich diejenigen »ersten 5000 Jahre«, auf die Geld und Schulden gemeinsam zurückblicken würden.6 Aber umgehend wendet ihm ein anderer ein, »mit Verlaub«, 5000 Jahre seien doch »Peanuts«! Christoph Türcke erhöht gleich einmal auf 150 000 bis 200 000 Jahre, denn so viele habe der Homo sapiens nun einmal »auf dem Buckel« – von guten alten Bekannten spricht man gerne etwas salopp – und so lange wie den Homo gäbe es selbstverständlich auch Geld.7 Dabei hatte bereits Graeber einen Moment lang noch tiefer in die Geschichte geblickt und zu dem Ausruf gefunden: »So gesehen ist Geld wahrscheinlich so alt wie das menschliche Denken.«8 Nur war es mit »wahrscheinlich« und »so gesehen« für den noch moderneren Denker nicht getan. Er blickt den Hominiden der Vorzeit mit der Tiefenpsychologie des 20. Jahrhunderts direkt ins vertraute Innere. Türcke sieht es unmittelbar vor sich, das »Wünschen und Denken« der Menschen und Menschenartigen: Ihm beweist, was Freud an Zeitgenossen feststellt, die bereits ein wenig mit Geld Umgang gehabt haben dürften, dass dieses schon Jahrhunderttausende früher das menschliche »Wünschen und Denken« erfüllt hätte.9 So geht das beim Geld mit dem modernen »Gespür für seine historischen Proportionen«, auf welches sich Türcke beruft: Man setzt die ewige Konstanz der menschlichen Psyche voraus und beweist so die ewige Konstanz der menschlichen Psyche.
Was schon fürs Mittelalter nicht gilt, nämlich dass die Menschen damals so gewünscht und gedacht hätten wie heute, es soll gar zu allen Zeiten gegolten haben. Gegen jede Einsicht in das historisch so tief Veränderliche menschlicher Gegebenheiten und deren Wirkung auf das Denken, eine Einsicht, die einmal mühsam gewonnen wurde, dekretiert unser Heute rabiater denn je über sämtliche früheren Zeiten: Auch sie müssen gedacht haben wie wir! Auch für sie muss es Geld und ein Denken in Geld gegeben haben wie für uns! Ein weiterer Fachmann etwa widerlegt auf über tausend Seiten sämtliche bestehenden Theorien zum Geld, nur um schließlich als unwiderlegliche Theorie dagegenzusetzen, Geld wäre aufgekommen, als Menschen zu rechnen begannen.10 Und wieder also wäre Geld so alt wie das menschliche Denken.
Offenbar nötigt das Geld zu diesem spezifischen Fehler: es überall hineinzusehen, auch dort, wo es historisch nichts verloren hat. Mit wachsendem Eifer unterstellen wir es sämtlichen Ur-, Vor- und sonstigen Zeiten, weil es uns offenbar immer weniger gelingt vom Geld abzusehen. Im selben Maß, wie es unsere Welt heute beherrscht, beherrscht das Geld auch unser Denken, und so tief prägt es ihm seine Formen ein, dass wir sie zwanghaft selbst dort zu entdecken glauben, wo es noch nichts von ihnen gegeben hat. Es ist, als hätte uns das Geld ein Muster ins Auge geätzt, und nun erscheint uns alles, was wir sehen, genau so gemustert.
Anfang
Um hier endlich der Täuschung zu entgehen, brauchen wir zuerst wenigstens einen Hinweis darauf, auf welche Weise das Geld diesen Zwang über unser Denken ausübt. Und das lässt sich nicht zufällig gerade anhand der Frage nach Anfang und Ursprung des Geldes am besten zeigen. Denn wie es historisch zu Geld gekommen sei, dafür gibt es neben dem Glauben an seine Ewigkeit eine allergängigste Erklärung, die sich uns unwillkürlich aufdrängt, die schon von den höchsten Kathedern herab gelehrt wurde und die doch zuverlässig falsch ist: indem sie ebenjenem Denkmuster gehorcht, das uns das Geld aufnötigt. Es ist die Erklärung, die Menschen hätten Geld erfunden, um damit einen früheren Tauschhandel von Gut gegen Gut zu vereinfachen und zu verbessern.
Das gilt für derart einleuchtend, dass es von wissenschaftlicher Seite gar als Musterfall für eine zuverlässige und über jeden Zweifel erhabene Ursprungserklärung angeführt wird. Professor Heringer meint etwa, anders als bei der Sprache, über deren Ursprung »populäre Irrtümer« kursieren, solle »man sich am Beispiel der Entstehung des Geldes klarmachen«, wie ein solcher Ursprung richtig erklärt werde. Nämlich so:
»Grundlage des Tauschhandels ist, dass ein Individuum A ein X besitzt und dieses X nicht braucht. Es tauscht es gegen ein Y, das es braucht. Sein Partner B hat hingegen Y und braucht X. Unter dieser Voraussetzung werden beide mit einem Tausch zufrieden sein. Stellt man sich eine Gesellschaft mit Tauschhandel vor, so wird derjenige öfter in einer schlechten Situation sein, der mehrere Xe besitzt, die nicht so gefragt sind, dafür aber ein gefragtes Y haben möchte. Für ihn wird es nun schon interessant sein, wenn er nicht ein Y eintauscht, sondern ein Z, das er zwar nicht braucht, das ihn aber dem Y näherbringt, insofern es leichter gegen Y eintauschbar ist als sein X. Wer so verfährt, wird auf lange Sicht wirtschaftlich erfolgreicher sein. Und die andern werden es merken und ihm gleichtun. Die Zs sind nun offenbar keine reinen Tauschgegenstände mehr, sondern Werte, bestimmt durch ihre Rolle im Tauschspiel. Bedenkt man nun noch, dass in der Praxis des Spiels die Erfahrung bald lehren wird, dass die Zs möglichst haltbar, gut teilbar, leicht transportierbar und gut absetzbar sein sollten. so sieht man sie zu Geld werden.«11
So leuchtet es uns ein: Menschen hätten Geld für etwas gut befunden und hätten es dafür auch erfunden. Dass dies außerdem in einer »Gesellschaft mit Tauschhandel« vor sich gegangen wäre, in der jeder »wirtschaftlich erfolgreicher« sein muss als die anderen, ist dann nicht minder einleuchtend, daher »stellt man sich eine Gesellschaft mit Tauschhandel vor«, ohne lange zu fragen, mit welchem Recht man eine solche Gesellschaft voraussetzt. Denn auch wie es zu dieser Art von Gesellschaft gekommen wäre sehen wir unwillkürlich vor uns, gemeinsam etwa mit Fachleuten vom Rang des Wirtschaftsnobelpreisträgers Paul Samuelson. Er schreibt: Dass die Menschen innerhalb einer Gesellschaft miteinander zu tauschen begannen, dafür seien wir »jenen beiden Affenmenschen zu großem Dank verpflichtet, die eines Tages die Entdeckung machten, dass sie sich gegenseitig nützen, wenn jeder jeweils auf etwas verzichtete, um dafür etwas anderes einzutauschen«.12
Und schon steht uns der Ablauf vollständig vor Augen: Zu Anfang hätten ganze zwei Urwesen mit ihrer Entdeckung dafür gesorgt, dass später im Laufe der Zeit jeder mit jedem etwas tauschte, was jeweils sein Eigen war und worauf er verzichten konnte, um zu bekommen, womit es einem anderen ebenso erging; und nachdem sich dieses Tauschen allgemein durchgesetzt und trotzdem als unsinnig kompliziert erwiesen hätte, wäre man auf die entscheidende Erfindung gekommen – ob als Hominide oder erst als Hochkulturgrieche, bleibe dahingestellt –, auf die Erfindung eines besonderen Tauschmittels: Geld.
Also hätte in dieser »Gesellschaft mit Tauschhandel«, bevor die Menschen aufs Geld gekommen wären, jeweils passgenau zusammenstimmen müssen, welche Ware der eine bekommen und welche der andere abgeben wollte. Jemand mit einem Faustkeil zu viel und einem Stück Mammutfleisch zu wenig wäre auf das außerordentliche Glück angewiesen gewesen, auf jemanden zu treffen, der umgekehrt ausgerechnet ein Stück Mammutfleisch zu viel und einen Faustkeil zu wenig hatte und der zudem willens war, das eine genau gegen jenes andere zu tauschen. Die geringe Wahrscheinlichkeit eines solch glücklichen Aufeinandertreffens hätte es für alle höchst beschwerlich gestaltet, ihr Leben mithilfe eines derartigen Tauschhandels zu bestreiten. Und so hätten sie unweigerlich auf das Geld verfallen müssen. Denn damit habe man für seinen Faustkeil erst Geld bekommen, das dann erst später und bei passender Gelegenheit wieder in eine gewünschte andere Ware getauscht werden konnte. Und zugleich habe man mit Geld nunmehr bequem gleich große Werte tauschen können, da sich Geld gut in einer zu jederlei Ware passenden Menge abzählen lässt. Also: eine großartige Erfindung – so wird es bis heute grundsätzlich bejubelt.
Doch eine solche Erfindung des Geldes ist selbst reine Erfindung. Das wurde vereinzelt schon vor längerer Zeit festgestellt, spätestens durch Graebers Schulden-Buch jedoch dürfte es auch allgemeiner bekannt geworden sein.13 Keine Widerlegung aber hat je etwas daran zu ändern vermocht, dass weiterhin geglaubt und gelehrt wird, so wäre das Geld entstanden, einfach weil es uns unwillkürlich so einleuchtet. Betrachten wir daher, was uns dabei derart überzeugend täuscht.
Aus einem Tauschhandel, wie wir ihn in dieser Herleitung voraussetzen, kann Geld schlicht deshalb nicht entstanden sein, weil es dort bereits entstanden ist. Was wir uns da an Gesellschaft vorstellen, ist trotz eines geldlos gedachten Tauschhandels bereits so eingerichtet, wie es dem Geld entspricht, und nur deshalb läuft dann alles mit solcher Notwendigkeit auf Geld hinaus. Eine Gesellschaft nämlich, deren Mitglieder einander grundsätzlich abkaufen, was sie zum Leben brauchen, hat es historisch niemals ohne Geld gegeben: Eine »Gesellschaft mit Tauschhandel«, wie wir sie dort voraussetzen, ergibt sich immer nur im Zusammenhang mit Geld. Wenn wir also aus ihr in Gedanken lediglich das Geld wegkürzen und damit glauben die Vorzeit des Geldes vor Augen zu haben, ist es, als würden wir uns beispielsweise ein Neandertal mit lauter Münzautomaten vorstellen, aber annehmen, ursprünglich hätten die Münzen dazu gefehlt – weshalb die Neandertaler irgendwann darauf gekommen wären, Münzen zu erfinden. Sowenig es aber Münzautomaten ohne Münzen gibt, so wenig gibt es eine Gesellschaft ohne Geld, in der die Menschen untereinander von Tauschhandel leben.
Diese geläufigste Erklärung, wie Geld entstanden wäre, ist also nicht nur falsch, sie ist keine Erklärung. Sie leitet nicht her, wie das Geld aus früheren Verhältnissen hervorgeht, die noch kein Geld kannten, sondern setzt bereits die späteren Verhältnisse voraus, die wir vom Geld her kennen. Sie erklärt nicht aus etwas, das einmal war, das, was heute daraus wurde, sondern erklärt umgekehrt, was heute geworden ist, zu dem, was einmal gewesen wäre. Selbst wenn wir uns die Welt versuchen ohne Geld vorzustellen, unterstellen wir dabei unwillkürlich Verhältnisse, wie sie nur mit Geld bestehen. Wenn nämlich der Tausch zwischen zwei Menschen oder menschenähnlichen Wesen, die wir uns da vorstellen, zuletzt zu der Erfindung von Geld geführt haben soll, setzen wir damit, ohne uns dessen bewusst zu sein, bei weitem mehr voraus als den harmlosen Tausch zwischen diesen beiden.
–Wir stellen uns zwar nur je zwei Leute vor, die miteinander tauschen, setzen aber voraus, dass nicht nur sie, sondern dass grundsätzlich alle innerhalb einer Gesellschaft tauschen. Denn nur bei einem Tauschhandel unter mehr oder weniger allen hätte es Sinn, dafür Geld einzuführen. Zwei einzelne Tauschende könnten niemals Geld gebrauchen. Also haben wir vorausgesetzt, dass in einer solchen Gesellschaft ganz allgemein Käufe und Verkäufe vollzogen werden.
–Des weiteren setzen wir voraus, dass dort jeder tauscht, weil er braucht, was er über Tausch bekommt, nämlich um es über Tausch zu bekommen. Alle wären sie auf den Tausch mit anderen angewiesen, nur deshalb hätten sie ja jeweils die mühsame Suche nach einem passenden Tauschpartner auf sich genommen. Also setzen wir auch voraus, dass die Versorgung in einer solchen Gesellschaft allgemein von Käufen und Verkäufen abhängig gewesen wäre: von einem gesellschaftsweiten Markt.
–Da der so vorausgesetzte Gütertausch später mit Geld getätigt worden sein soll, setzen wir damit drittens voraus, man hätte die getauschten Güter schon immer als gleiche Werte getauscht: Gut gegen Gut als Wert gegen gleiche Menge Wert. Es wäre jeweils bereits um eine Menge desselben Werts in allen unterschiedlichen Gütern gegangen. Dieser eine Wert in allen Gütern aber wäre schon so gut wie Geld: Jede Ware, die man als Wert gegen eine andere von gleich viel Wert tauschen wollte, würde bereits als Geld fungieren. In einer Gesellschaft, wie wir sie zu seiner Herleitung voraussetzen, wäre das Geld also bereits da und müsste gar nicht mehr erfunden werden: Es bräuchte nur ehrlicherweise noch diesen Namen.
Von all dem, was wir hier voraussetzen, legen wir nichts bewusst in unsere Vorstellung von den früheren Zeiten. Unwillkürlich setzen wir eine ganze Gesellschaft voraus, die von geldlosem Gütertausch gelebt hätte – und die es nie gegeben hat. Unwillkürlich setzen wir sie voraus, da wir sie heute um uns vorfinden, als ganze vom Geld geprägt und uns offenbar bis ins Unbewusste damit prägend. Dass es uns partout nicht mehr gelingen will, die Welt ohne Geld zu denken, hat seinen Grund darin, dass wir Geld unbewusst und unwillkürlich in der Form eines ganzen gesellschaftlichen Zusammenhanges voraussetzen, wie er uns heute bestimmt.
Deshalb fällt es uns so schwer, auch nur im Rückblick über Geld hinauszudenken und eine Vorzeit zu imaginieren, in der es ohne Geld zugegangen ist. Umso schwerer wird es uns daher, eine Zukunft ohne Geld zu denken. Und doch muss es einmal gelingen.
IGaben
Ferne Gegenwart
Was Geld ist, wissen wir erst, wenn wir es davon unterscheiden können, was einmal kein Geld war. Was mit dem Geld in die Welt kommt, kann nicht eher klar werden, als wir triftige Vorstellungen von der Welt gewinnen, in der das Geld noch nicht existiert. Deshalb liegt zunächst alles an der Kenntnis einer solchen Welt.
Ein Zustand ohne Geld ist für uns heute einerseits versunken in einer derart tiefen Vergangenheit, dass wir ihn mit Recht als archaisch bezeichnen können. Er gehört einem Anfang an, von dem uns inzwischen Abgründe trennen. Gleichwohl dürfen wir inzwischen annehmen, dass wir bereits wenn wir nur den Schritt zurück ins Mittelalter machen geldfreies Gebiet betreten. Eine Welt jenseits des Geldes bekommen wir nicht erst in den Blick, wenn wir Noahs Arche aufsuchen oder uns in die Psyche des Turkana-Jungen versenken. Überhaupt bemisst sich die Nähe oder die Distanz, in der Menschen zum Geld leben, nicht einfach an ihrem zeitlichen Abstand zu heute. Es gibt keinen Grundsatz, der besagen würde: Je weiter zurück in der Zeit, desto weiter weg vom Geld. Selbst heute mag sich in einem bislang übersehenen und nicht abgeholzten Winkel dieser Erde noch ein letzter Volksstamm verbergen, der von Geld nichts weiß, zeitgleich mit einer Finanzwelt, die das Jonglieren mit Derivaten bis zum Äußersten treibt.
Auch als das Geld bereits in den Ländern Europas und sukzessive in anderen Teilen der Welt seinen Einzug gehalten hatte, gab es für lange Zeit noch ganze Reiche, die entweder gar nicht mit Geld umgingen oder es nur im Austausch mit Abgesandten jener ersten Geldnationen zu verwenden hatten. Früher oder später war es mit ihrer Freiheit vom Geld zwar in jedem Fall vorbei, denn wo immer die Europäer der Neuzeit bei ihrer »Unterwerfung der Welt« hingelangten – so wird die europäische Expansion heute zutreffend genannt14 – haben sie dem geldlosen Leben dort gewaltsam ein Ende gesetzt. Immerhin aber waren sie häufig so aufmerksam zu dokumentieren, was sie vorfanden, bevor es durch ihr Auftreten zuverlässig vernichtet wurde. Und selbst in jüngster Gegenwart haben Ethnologen und Anthropologen noch Reste kleinerer Gemeinschaften studieren können, deren Zusammenleben zumindest in weiten Bereichen frei und unbeeinflusst von Geld verlief.
Was solche Beobachter allerdings in jüngerer wie in älterer Zeit von den »Wilden« und »Primitiven« wahrnahmen, haben auch sie regelmäßig nach dem Muster der Geldverhältnisse missdeutet, von denen sie selbst geprägt waren. Hinauf bis zu Größen wie Claude Lévi-Strauss oder Marcel Mauss, die den Fehler bereits erahnten und zu vermeiden suchten, vermochten sich ihm selbst strengste Forscher nie völlig zu entziehen. Umso bedeutender daher, dass dies einem Sozialanthropologen unserer Tage endlich und tatsächlich gelungen ist. Heinzpeter Znoj hat erkannt und aufgewiesen, wie hartnäckig die im weitesten Sinn ethnologische Wissenschaft auch solche sozialen Zusammenhänge, die entschieden nichts mit Geld zu tun hatten, nach dessen Kategorien interpretiert und damit grundsätzlich verfehlt hat. Diese verhältnismäßig junge Erkenntnis ist von unschätzbarer Bedeutung für einen nicht mehr entstellten Einblick in die Welt ohne Geld. Denn mit Znojs Analyse und mit seinen eigenen Beschreibungen geldfrei oder geldfern lebender Gemeinschaften lassen sich endlich auch die früheren Berichte zurechtrücken und richtig lesen.15
Distanz oder Nähe zum Geld bemessen sich nicht einfach anhand des zeitlichen Abstands zu heute. Sie bemessen sich allein daran, wie weit ein Volk, ein Stamm oder auch nur ein einzelnes Dorf einbezogen oder hineingezwungen ist in jene Art von Markt, nach der wir das Wirtschaften mit Geld heute zu Recht als Marktwirtschaft bezeichnen. Da kann zum Beispiel in der Hauptstadt alles über Geld laufen, über eine Währung, die weltweit Anerkennung findet, aber einige Dörfer weiter, in irgendeinem Hochland oder Dschungel, hat dasselbe Geld wenig oder gar nichts mehr zu sagen, einfach weil die Einbindung in jenen Markt fehlt. Und wo diese Einbindung und wo deshalb auch das Phänomen Geld fehlt, dort zeigen sich jederzeit und bis in unsere Gegenwart hinein Verhältnisse, die einander grundsätzlich gleichen. Was Znoj noch vor kurzem an geldfern lebenden Dörfern beschreiben konnte, zeigt Übereinstimmung auch mit dem Leben in Reichen, die lange vor dem Mittelalter und zu Zeiten bestanden, als es noch nirgends auf der Welt mit Geld zugegangen ist. Denn von ihnen haben wir natürlich ebenfalls Nachricht, dank einer Vielzahl unterschiedlicher Dokumente, die sich erhalten haben. Gerade zum Beispiel die Antike überliefert uns besonders klar, was es heißt, wenn es noch kein Geld gibt – auch wenn dem heute jeder zunächst wird widersprechen wollen. Es gilt nur auch diese Überlieferung endlich genau genug zu lesen.
Was uns daher von einer Ära ohne Geld noch gegenwärtig vor Augen treten kann, ist zwar verschwindend gering im Vergleich zu dem, was die Vergangenheit davon enthält. Aber wie sie kann es von einem Leben erzählen, das für uns – auf die eine oder die andere Weise – zurückliegt wie in weiter, weiter Ferne. Deshalb hat es seinen Sinn, ein Leben ohne Geld archaisch zu nennen.
Austausch
Fangen wir also an. Bevor es irgendwo und irgendwann zu Gesellschaften kommt, deren Mitglieder untereinander Tauschhandel treiben und von diesem Tauschhandel leben, sind Menschen ausschließlich in Gemeinschaften verbunden, die eine durchaus andere Art von Austausch pflegen. Es ist ein Austausch, von dem genau dies richtig gesagt ist: dass ihn diejenigen pflegen, die durch ihn verbunden sind. Uns ist er unendlich weit entrückt und es gibt fast nichts mehr, was wir davon kennen, aber immerhin: nur fast nichts mehr. In einem kleinen Rest hat sich erhalten, wie die Menschen früherer Zeiten oder, richtiger gesagt, in geldfernen Verhältnissen miteinander umgehen oder umgegangen sind. Es ist nur ein schwacher Nachklang, aber es gibt ihn und er vermittelt uns zumindest eine Ahnung von etwas, das sonst untergegangen ist.
Dieser archaische Rest, der sich bis in unser geldbestimmtes Heute gerettet hat, ist – klein und unauffällig – das Mitbringsel. Wenn wir bei jemandem eingeladen sind, wenn wir jemanden besuchen oder zu jemandem ans Krankenbett treten: Es gibt Gelegenheiten, da bringen wir denen, die wir aufsuchen, etwas mit. Das gehört sich so und wir tun es, weil es sich gehört – falls sich nicht auch das inzwischen verloren hat. Wir bringen Blumen mit, eine Flasche Wein, etwas Süßes oder sonst »etwas Kleines«. Bestimmte Anlässe, zu denen wir mit anderen zusammenkommen, schließen diese Verpflichtung zwischen uns und ihnen ein. Und eine solche Verpflichtung ist es, die den archaischen Umgang der Menschen miteinander ganz grundsätzlich charakterisiert – im Gegensatz zu einem Verkehr über Geld.
Bei einer Gelegenheit, die ein Mitbringsel erfordert, besteht diese Verpflichtung tatsächlich nicht nur auf einer Seite, sondern zwischen beiden. Die eine Seite hat die Verpflichtung, ein Mitbringsel zu überreichen, und die andere hat die Verpflichtung, es auch anzunehmen. Ebenso unhöflich oder unfreundlich, wie es wäre, wenn wir nichts mitbrächten, wäre es umgekehrt, wenn die anderen unser Mitbringsel nicht annehmen wollten. Es würde mehr bedeuten, als dass sie zum Beispiel nur die ewigen Pralinen nicht mehr sehen können und gerne auf sie verzichten. Es wäre eine Zurückweisung, die sich nicht auf das übergebene Ding beschränken würde, sondern eine Zurückweisung unserer Person. Es wäre ein Bruch des freundlichen Einvernehmens zwischen den Personen. Auf deren Einvernehmen nämlich richtet sich die Verpflichtung, um die es mit dem Mitbringsel geht.
Ein Mitbringsel, das diese Verpflichtung einlöst, setzt ihr daher nicht etwa ein Ende: Es löst sie ein, aber löst sie nicht auf. Die Verpflichtung besteht vielmehr fort, sie besteht auch bei einem nächsten Besuch, fordert einen Gegenbesuch und so weiter. Die Verpflichtung ist nicht mit einmal hin und einmal her erledigt, sie wird nie abschließend eingelöst, sondern mit jeder Einlösung nur weiter bekräftigt. Jeder Besuch, bei dem sich die Besucher und die Besuchten an die Verpflichtung halten, wird die Verpflichtung und das Einvernehmen zwischen ihnen bekräftigen.
Heute sind Verpflichtungen dieser Art nicht mehr besonders kraftvoll. Manch einer mag sie gar nicht mehr empfinden oder empfindet sie in einer Hinsicht schwächer und in einer anderen stärker, erwidert nur selten einen Besuch, aber bringt zu einer Einladung immer etwas mit. Und trotzdem bestehen solche Verpflichtungen im Allgemeinen auch noch für uns, und wo sie bestehen, binden sie uns noch immer an jemanden, mit dem wir Umgang haben. Sie sind in diesem doppelten Sinn verbindlich: Sie verbinden uns mit und verbinden uns gegenüber anderen. Wechselseitig verbinden diese Verpflichtungen diejenigen, die da miteinander zu tun haben, sie sind Teil der Verbindlichkeit einer Gemeinschaft. Und genau darin sind sie der Nachhall eines archaischen Umgangs der Menschen, eines Umgangs ohne Geld.
Ein Mitbringsel überreichen wir als Gabe, wir tauschen damit nicht gleich gegen gleich. Wir machen unseren Besuch, wir werden vielleicht bewirtet, aber wir tauschen nicht Mitbringsel gegen Bewirtung. Es geht nicht zu wie im Wirtshaus, wir bezahlen nicht mit unserer Gabe, was man uns vorsetzt, und sind danach quitt mit dem Wirt.16 Das Mitbringsel gehört zu der Gesamtheit des Besuchs, genauso wie der Empfang, den man uns bereitet, wie das Essen oder einfach die Gelegenheit, uns in einen Sessel zu setzen. Nichts davon soll durch das Mitbringsel abgegolten werden. Es wäre absurd, an der Haustür das Mitbringsel zu überreichen, den Kuchen dafür in Empfang zu nehmen und wieder abzuziehen, ja, es wäre eine Beleidigung für die Gastgeber und würde den Sinn des Mitbringsels, das freundliche Einvernehmen, ins Gegenteil verkehren. Der Austausch, den wir in Gestalt eines Besuches mit anderen pflegen, ist als solcher das Ziel der Veranstaltung, und alles, was dazugehört, Mitbringsel, Empfang, Bewirtung und Geplauder, es dient als integraler Bestandteil diesem Ziel.
Die Wechselseitigkeit, die berühmte Reziprozität solcher Verpflichtungen bezieht sich also keineswegs allein auf die mitgebrachten Dinge. Mit dem, was wir mitbringen, geht es uns nicht um jenes andere Mitbringsel, das wir bei einem Gegenbesuch erwarten können. Wir bringen nicht deshalb Pralinen mit, weil wir auf die Blumen scharf sind, die uns bei einem Gegenbesuch blühen. Es geht nicht um Ding gegen Ding und es geht nicht darum, dass wir eines dem anderen gleichsetzen würden. Selbst wenn uns heute, unter Geldverhältnissen, das eigene Mitbringsel zum Beispiel 14,99 Euro gekostet hat, verlangt das nicht, dass das Mitbringsel eines Gegenbesuchs genauso viel kostet. Vielleicht empfinden wir es sogar als kostbarer, wenn ein Mitbringsel gar nichts gekostet hat, da es in diesem Fall nicht bloß fertig gekauft, sondern eigenhändig gefertigt oder selbst gepflückt wurde. Ihre Geltung als Mitbringsel haben sie nicht, indem sie sich Ding um Ding entsprechen, sondern insofern jedes dem Anlass entspricht, dem es dient.
Diese Entsprechung zu beachten und ein Mitbringsel passend zu wählen, fällt dabei durchaus nicht schwer, auch ohne Geldquittung in der Hand. Denn dafür gibt es eine als angemessen anerkannte Auswahl von Dingen: Blumen, Wein und Ähnliches. Halten wir uns an diese Auswahl, so entsprechen wir auch der Verpflichtung. Bei einer Einladung zum Essen werden wir als Mitbringsel kein Diamantcollier überreichen, das wäre zu kostbar, aber auch keinen Schraubenzieher, der wäre unpassend, ja unverständlich, selbst wenn er uns exakt so viel gekostet hätte wie die Blumen, die wir stattdessen bringen. Selbstverständlich können wir auch mit dem Collier oder einem schönen Stück aus dem Baumarkt ankommen, doch wüssten wir dann eines sicher: Sie sind keine Mitbringsel. Denn Mitbringsel sind eben Gaben, nicht Geschenke.17
Der Unterschied besteht zum Beispiel darin, dass Geschenke ihrem Empfänger auf eine beliebige Weise zugestellt werden können. Ein Geschenk kann ich eigenhändig überreichen, aber ich kann es auch unter einen Baum gelegt haben oder einfach per Post schicken, Hauptsache ist, der Beschenkte hält es irgendwann in Händen. Ein Geschenk steht insofern als Ding für sich. Anders die Gabe: Sie gehört unablösbar in ihren verpflichtenden Zusammenhang. Bei einem Besuch etwa müssen wir sie persönlich und gleich zu Beginn überreichen, Blumen haben wir aus ihrem Papier zu wickeln, wir haben ein paar passende Worte dazu zu sprechen, ein freundliches Gesicht zu machen, sollten das Ganze als Selbstverständlichkeit behandeln und möglichst so tun, als erwarteten wir keinerlei Dank.
Der Unterschied zwischen Gabe und Geschenk berührt auch die Auswahl des überreichten Dings. Ein Geschenk sollte möglichst genau auf den Beschenkten zugeschnitten sein, während es bei Gaben nicht ernsthaft darauf ankommt, dass der Empfänger sie sich gewünscht hätte oder gut gebrauchen könnte. Ein exzellenter Wein wird uns als Mitbringsel zwar lieber sein als einer, den man nur wegschütten kann, trotzdem erfüllt auch dieser die Verpflichtung. Womöglich beurteilen wir den Geber danach, wie er seine Gabe wählt, und falls er es nachlässig tut, mag das unser Verhältnis trüben. Trotzdem, selbst wenn uns die ewigen Schnapspralinen längst zuwider sind, als Gabe haben sie ihre Geltung und als Gabe werden wir sie anerkennen. Aus Mitbringseln muss niemand Nutzen ziehen und – man ahnt vielleicht den Zusammenhang – von Mitbringseln wird erst recht niemand leben wollen: Das ist nicht ihr Sinn.
Ihr Sinn als Gabe, den wir noch immer empfinden können, ist die Art Verpflichtung, die es dabei einzulösen gilt. Über sie verrät unser harmloses Mitbringsel bereits erstaunlich viel. Im uneingeschränkt archaischen Zusammenhang umfasst diese Verpflichtung jedoch erheblich mehr.
Ein dritter Mann
Nach unserer Zeitrechnung sind die Māori vermutlich irgendwann vor 1300 auf Neuseeland eingewandert. Als im Laufe des 19. Jahrhunderts Europäer von der großen Insel Besitz ergreifen, treffen sie folglich auf die Māori als eingeborenes Volk. Und wie sie später feststellen, unterwerfen sie bei dieser Gelegenheit, wie es heißt, ›die letzte große Gemeinschaft der Erde, die unberührt und unbeeinflusst von der Außenwelt lebte‹. Heute gehören Māori zur solide verarmten Unterschicht Neuseelands und selbst ihre Sprache bedarf gezielter Pflege, um sie vor dem Aussterben zu bewahren. So steht es mit ihr wie mit allem Übrigen, was die Māori einmal ausgemacht hat.
Bereits gegen Ende des europäischen 19. Jahrhunderts sind sie stark dezimiert. Nur die Art, wie die Māori zusammenlebten, hatte sich nicht ganz so schnell verflüchtigen können und wird von den Eindringlingen noch ausgiebig studiert. Da sie rasch über die Sprache der Māori verfügen, können sie sich vieles von ihnen auch beschreiben lassen, was die Māori in ihrer schriftlosen Sprache nicht überliefert hätten. So kommt es unter anderem zu einem berühmten, von Ethnologen oft interpretierten Interview, in dem ein Māori namens Tamati Ranapiri auch über das Gabenwesen Auskunft gibt: über jene Form von Austausch, die wir archaisch nennen.
Was die Māori bei diesem Austausch überreichen, sind taonga. Das ist ihr Wort für alle Dinge, die für sie Nutzen und Bedeutung haben, Dinge, die sie schätzen. Im Deutschen nennen wir sie, abgeleitet vom Wort »gut«, passenderweise »Güter«. Und wenn nun Māori solche taonga übergeben, geht es um etwas, das in ihrer Sprache kurz und knapp hau genannt wird. Das Wort hat ein weites Anwendungsfeld, so dass zum Beispiel auch der Wind hau heißen kann, als »das hau, das weht«. Dasjenige hau, welches bei Gaben eine Rolle spielt, heißt dagegen »hau des Waldes«. Was es damit auf sich hat, erklärt Ranapiri so:
»Jetzt über das hau des Waldes. Dieses hau ist nicht das hau, das weht. Nein. Ich werde es dir sorgfältig erklären. Also, du hast ein taonga, das du mir gibst. Es geht nicht um eine Zahlung zwischen uns. Jetzt gebe ich es weiter an einen anderen. Dann vergeht eine lange Zeit und dieser Mann denkt daran, er hat das taonga, er sollte mir etwas dafür geben, und das tut er. Und dieses taonga, das mir jetzt [von ihm] gegeben wurde, ist nun das hau desjenigen taonga, das mir vorher [von dir] gegeben worden war. Ich muss es dir geben. Es wäre nicht richtig von mir, wenn ich es für mich behalten würde. Egal, ob es nun etwas sehr Gutes oder Schlechtes ist, dieses taonga muss dir von mir gegeben werden. Weil dieses taonga ein hau des anderen taonga ist. Wenn ich dieses taonga für mich behalten wollte, dann würde ich mate (krank werden oder sterben). Das also ist das hau – das hau der taonga, das hau des Waldes.«18
Das hau des Waldes ist auf diese Weise gewiss sorgfältig erklärt, aber für uns nicht leicht zu verstehen. Wir hören: »Weil dieses taonga ein hau des anderen taonga ist«, muss seine Übergabe mit der eines anderen taonga auch erwidert werden. Für uns liegt sogleich die Deutung nahe: Wenn ein taonga das hau eines anderen ist, wäre hau notwendig der Wert beider taonga. Dergleichen kann Ranapiri allerdings nicht gemeint haben, sonst hätte er eine andere und viel simplere Geschichte erzählen müssen, nämlich: Du gibst mir ein taonga, ich gebe dir dafür ein anderes taonga und dieses ist dann das hau des deinen. Es wären genau zwei Leute beteiligt, die zwei Dinge als dasselbe hau gegeneinander tauschen würden, das also den gleichen Wert darstellen würde wie das andere – so entspräche es unserer Vorstellung und so wurde Ranapiri tatsächlich gedeutet. Der Māori jedoch erzählt von etwas anderem. In seiner Erzählung kommen zwar nur zwei verschiedene taonga vor, aber mehr als nur zwei Leute, die mit ihnen hantieren: Es gibt noch einen Dritten. Und der ist offenbar entscheidend für das hau, nur durch ihn kommt es zustande.
Gehen wir das Ganze noch einmal durch. Es kommt zu einer ersten Gabe, von dir an mich. Diese Gabe bleibt zunächst unerwidert. Dennoch wirkt sie weiter, nur eben nicht in der Richtung zurück zu dir, sondern weiter voran. Sie nimmt sozusagen Schwung auf und bewegt sich weiter in Richtung eines Dritten: Das von dir überreichte taonga behalte ich nicht für mich, sondern überreiche es weiter an einen Dritten. Dann vergeht erst einmal »lange Zeit« – und die muss wichtig sein, da Ranapiri sie eigens erwähnt. Erst nach geraumer Frist also denkt jener dritte Mann daran, meine Gabe zu erwidern. Und nun sagt Ranapiri nicht etwa, die Gegengabe des Dritten an mich sei das hau derjenigen Gabe, die er von mir bekommen hat und die er erwidert. Nein, auch in dieser umgekehrten Richtung, von dem Dritten zurück zu mir, kommt ein weiterer Mann ins Spiel, und das bist wiederum du, der erste Geber in dieser Erzählung. Es heißt ausdrücklich und muss seine Bedeutung haben: Die Gabe, die jetzt von dem dritten Mann an mich geht, ist das hau jener Gabe, die du vorher an mich gegeben hast. Das ist der Grund dafür, dass die Gegengabe des Dritten wiederum von mir an dich weitergegeben werden muss, an den Überreicher der ersten.
Kompliziert – und komplizierter, als uns einleuchten will. Vor allem eines muss uns erstaunen: Die Gabe, die ich weitergebe an den Dritten, ist ja dieselbe, die ich von dir bekommen habe. Trotzdem heißt es, die Gegengabe des Dritten an mich sei nicht das hau der Gabe, die ich ihm gab, sondern der Gabe, die du mir gegeben hattest – obwohl das taonga, um das es sich dabei handelt, dasselbe ist. Also kommt es offensichtlich darauf an: Eine Gegengabe ist nicht das hau einer direkt erwiderten Gabe, sondern einer Gabe, sofern sie vorher bereits weitergereicht wurde. Nicht in direkter Erwiderung einer Gabe entsteht hau, es entsteht allein, wenn eine Gabe nicht bloß als die einmal überreichte, sondern wenn sie als weitergereichte erwidert wird.
Hau bestimmt den Austausch von Gaben unter den Māori und treibt ihn an. Auch ohne die Lebensverhältnisse der Māori insgesamt zu verallgemeinern, verstehen wir das Wesen eines geldfernen Austauschs allgemein besser, wenn wir ihr hau richtig verstehen: Gaben müssen zwar erwidert werden, werden aber nicht direkt erwidert. Darin nämlich liegt zugleich der Sinn jener ›langen Zeit‹, die erst vergehen muss, bevor der dritte Mann an seine Verpflichtung zur Gegengabe denkt. Jede Gabe muss jeweils erst weiter als Gabe wirken. Das verhält sich beim heutigen Mitbringsel anders, da wäre es umgekehrt höchst peinlich, wenn jemand merkt: Wir reichen eine Pralinenschachtel, mit der uns letzthin die Tante bedacht hat, einfach weiter. Für uns gilt, dass die Gabe nur einmal von Geber zu Nehmer wechseln darf; unsere moderne Gabe ist streng dyadisch: Sie nimmt ihren Anfang beim Geber und findet ihr Ende beim Empfänger.
Die archaische Gabe dagegen wird bedeutungsvoller, je mehr sie bereits weitergegeben wurde, denn umso mehr versammelt sich in ihr an hau. Es meint offenbar etwas wie Bewegung, einen Schwung und impetus, mit dem jeder das taonga zusätzlich auflädt, indem er es empfängt und weitergibt. Die weiterwirkende Verpflichtung, sie ist hau: eine Kraft, die jene Dinge voranträgt, in denen sie wirkt, und die sich, solange sie in ihnen wirkt, als die durch den Geber aufgewandte Kraft erhält. So ist eine Gabe durch hau jeweils an ihn zurückgebunden und muss deshalb an ihn erwidert werden. Der Wind ist als hau der Schwung und impetus, der weht und die Luft bewegt. Der Schwung und impetus als hau des Waldes aber ist einer der Materie, der Dinge. Für sie stellt der Wald die stoffliche Grundlage dar: Das lateinische Wort materia etwa meint Holz genau in der Hinsicht, dass Menschen es verwenden, um etwas daraus zu formen und zu bauen. Und von Materie in diesem Sinn wird hau als impetus empfangen, indem Menschen sie weiterreichen und durch dies Weiterreichen Menschen binden und verbinden. In langen Reihen, die vom einen zum anderen und von diesem zu wieder anderen weiterlaufen, zeigt und sieht sich jeder diesen anderen verbunden und sehen sich die Menschen nicht als einzelne Bäume, sondern, vor lauter Bäumen, als Wald – den Wald des hau.
Gemeinwesen
Bevor es zu Gesellschaften kommt, die mit Geld wirtschaften und deshalb über Geld vermittelt sind, ist für jeden Menschen entscheidend, dass er hineingeboren wird in einen Stamm, in eine Sippe, ein Dorf, eine civitas – allgemein: in eine Gemeinschaft. Und was solche Gemeinschaften betrifft, können wir nunmehr einen Schritt weitergehen. Sie bezeichnen etwas durchaus anderes als eine Gesellschaft, wie sie heute heißt und wie wir sie wieder zu Unrecht selbst frühesten Urzeiten unterstellen. Anders als Gesellschaften zeichnen sich archaische Gemeinwesen dadurch aus, dass in ihnen jeder seine Versorgung zusammen mit der Gemeinschaft erlangt. Die Einzelnen mögen darin unterschiedlich hoch gestellt sein, dennoch wirken sie alle mit an der Versorgung ihrer res publica, ihrer »gemeinsamen Sache«, und kommen sie dadurch zur eigenen Versorgung. So allgemein wie jeder – jeweils seiner Stellung angemessen – zur Versorgung seiner Gemeinschaft beiträgt, so allgemein ist jeder auch in ihre Versorgung eingeschlossen. Es geht dort also gerade nicht so zu, wie es ein modernes Märchen von den ersten Menschenhorden behauptet: jeder für sich und alle gegen alle. Im Gegenteil, der Versorgung in archaischen Gemeinschaften widerspräche es bereits aufs Entschiedenste, wenn jeder darin nur über Tauschhandel bekäme, was er von anderen braucht. Innerhalb einer solchen Gemeinschaft wäre das ebenso unsinnig, wie wenn eine Familie beim Abendbrot sitzt, einer würde den anderen um die Butter bitten und der würde fordern: »Nur wenn du mir dafür deinen Gürtel gibst.«
Die solidarische Gemeinsamkeit der Versorgung bricht erst und einzig in Fällen gemeinsamer Not. Wenn etwa die Ernte missrät oder ein anderes Unglück die Vorräte vernichtet und wenn also der gesamten Gemeinschaft Hunger droht, nur dann reißt die Verpflichtung untereinander ab und werden diejenigen, die sich durchsetzen können, auf ihrer Versorgung bestehen und andere umkommen lassen.19 Sonst gilt jedoch: Es mögen nicht alle gleich reichlich versorgt sein, versorgt aber sind sie – innerhalb und zusammen mit ihrer Gemeinschaft. Voraussetzung dafür, dass sie so versorgt sind, ist dabei nur, dass sie der Gemeinschaft auch gültig zugehören. Jeder hat also den Verpflichtungen innerhalb der Gemeinschaft zu genügen, um in ihr seinen Ort zu haben, einen bestimmten Status zu bewahren oder einen bestimmten Status zu erringen. Um nicht im schlimmsten Fall aus der Gemeinschaft herauszufallen und der Versorgung in ihr verlustig zu gehen, sieht sich jeder unabdingbar vor der Verpflichtung, die Gemeinschaft selbst herzustellen und ihr verbindlich Gewähr zu leisten. Genau dem gilt auch die Allgemeinheit des Verhaltens, Gaben auszutauschen.
Entsprechend tief ist es offenbar in den Menschen angelegt. Wo es nicht durch mächtigere Zwänge verdrängt ist, zeigt es sich wirksam in Regionen des Unbewussten, die tiefer liegen als jede Konvention. Vor mir sehe ich das kleine Mädchen, keine zwei Jahre alt, das dem fremden Besucher ihr liebstes Stofftier hinhält. Sie wird nicht wollen, dass er es für sich behält, sonst wäre abends an kein Einschlafen zu denken. Aber sie hat es eigens herbeigeholt und sie überreicht es, ganz offensichtlich, um es zu überreichen. Niemand hat sie dazu angehalten, keiner hat es ihr vorgemacht, sie erwartet nichts dafür, streckt ihr Händchen nicht noch einmal hin, um selbst etwas zu bekommen. Sie blickt dem Fremden nur einen Augenblick ernst und erwartungsvoll auf die Hände, die ihre Gabe entgegennehmen sollen. Die Übergabe selbst hat ihre Bedeutung – und jeder, der dabei ist, nimmt es unmissverständlich wahr.
Die Praxis, über Austausch eine Gemeinschaft herzustellen, die alle einander bekunden und voneinander fordern, findet sich jedenfalls weltweit bei allen Völkern – solange es bei ihnen noch kein Geld gegeben hat. Berühmt ist etwa der Kula-Ring, der noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf den pazifischen Trobriand-Inseln lebendig war und sogar der Reihenfolge nach festlegte, wer wem eine Gabe zu überreichen hatte. Dort kreisten die Gaben gleichzeitig in beiden Richtungen, im Uhrzeigersinn waren es bestimmte Halsketten und im gegenläufigen Sinn Armreifen. Ein anderes bekanntes Beispiel ist das Volk der !Kung in der Kalahari-Savanne und ihr Hxaro, ein umfassendes Netz gegenseitiger Besuche, für die sie zum Teil große Entfernungen zurücklegten und die natürlich den Austausch von Gaben einschlossen. Hier liefen die Verbindungslinien nicht kreisförmig, sondern hatten die Beteiligten ihre Verpflichtung nur gegenüber einigen anderen, aber doch so, dass letztlich alle über solche Linien verbunden waren.
Dafür ist die Verpflichtung notwendig, Gaben auch weiterzureichen. Wir kennen sie heute nicht mehr, sie hat sich in unserem Mitbringsel nicht erhalten und deshalb scheint sie uns ein zusätzliches Erfordernis, das eigentlich nicht zu einer Gabe gehört. Im archaischen Austausch dagegen muss sie sein, und zwar weil Gemeinwesen, die ihn pflegen, auf einer entsprechenden Art von Besitz beruhen, die uns heute nicht nur unbekannt, sondern geradezu unvorstellbar ist.
Besitz in diesem archaischen Sinn hat seine Zeit: Was jemand zum Besitz erhält, bleibt nicht in seinem Besitz. Er muss es weitergeben, weil Besitz in solchen Gemeinschaften Besitz auf Zeit ist. Besitz unterliegt einer gemeinschaftlichen Zeit, einer Zeit, die von der Gemeinschaft abhängt, weil von ihr die Gemeinschaft abhängt. Was ein Einzelner besitzt, besitzt er dort in Gemeinschaft mit den anderen. Auch als sein Besitz unterliegt es der notwendig gemeinsamen Sorge um alles, was die Gemeinschaft braucht und was ihre Mitglieder nur in der Gemeinschaft zu leisten vermögen. Die Sorge des Einzelnen ist verflochten in die Sorge aller, weil er nur mit ihnen und mit ihrer Hilfe, also gemeinsam mit ihnen zu dem kommt, was er zum Leben braucht.
Deshalb gilt grundsätzlich und nicht nur bei Gaben: dass der Gemeinschaft nicht entzogen sein darf, was einer besitzt. Ein Einzelner kann es sinnvollerweise nicht ausschließlich für sich und damit ein für alle Mal besitzen, weil er nur mit einem letztlich gemeinsamen Besitz in einer Weise umgehen wird, die ihm und folglich der Gemeinschaft zuträglich ist. Es liegt im gemeinsamen Interesse aller, dass er beispielsweise ein Stück Land, das ihm gehört, zur rechten Zeit bebaut, dass er es nicht zu lange brach liegen lässt, dass er die richtigen Pflanzen darauf zieht und seine Ernte gemeinsam mit anderen einbringt, um umgekehrt auch bei ihrer Ernte helfen zu können. Solche Pflichten gegenüber dem eigenen Besitz zu vernachlässigen, kann und muss zu Bestrafung führen, eben weil der Besitz zugleich zum Bestand der Gemeinschaft gehört und ihm zu dienen hat. Vom frühen römischen Reich ist es so überliefert:
»Wenn einer seinen Acker verwildern ließ, ihn nachlässig bearbeitete und ihn weder gepflügt noch von Unkraut gesäubert hatte oder wenn einer seine Baumpflanzung und seinen Weinberg hatte verkommen lassen, blieb das nicht ohne Strafe, sondern war ein Vergehen, das die Ahndung durch den Zensor nach sich zog.«20
Die Sorge um den eigenen Besitz ist erforderlich für die Gemeinschaft und daher Voraussetzung dafür, dass jemand Teil der Gemeinschaft bleibt. Wäre es anders und hätten Einzelne zeitlich uneingeschränkte Verfügung über ihren Besitz, er wäre der Gemeinschaft dauerhaft und also insgesamt entzogen. Die Verpflichtung des Einzelnen gegenüber der Gemeinschaft wäre aufgehoben, sowohl zu deren Schaden, wenn jemand seinen Anteil an der Versorgung zu leisten versäumt, wie zu dessen eigenem Nachteil, wenn er damit die Verpflichtung der Gemeinschaft ihm selbst gegenüber zerstört. Der dauerhafte Besitz eines Einzelnen würde die Gemeinschaft insgesamt negieren, würde sie berauben, privare, wie das lateinisch heißt. Deshalb gehört es in einer solchen Gemeinschaft zum Besitz, dass er nicht völlig privat wird, sondern dass ihn alle irgendwann weitergeben. Caesar berichtet es von den Germanen seiner Zeit:
»Niemand hat bei ihnen ein bestimmtes Stück Ackerland oder eigenen Grund. Sondern die Anführer und Leute, die dafür eingesetzt sind, weisen den Geschlechtern und ihren Sippen sowie denen, die sich für die Feldbestellung zusammentun, jeweils für ein Jahr Land zu, in einer Menge und einer Lage, die sie für gut befinden, und zwingen sie im Jahr darauf, ein anderes Stück Land zu übernehmen. Dafür führen sie viele Gründe an, unter anderem: damit niemand versucht ausgedehnten Grund zu erwerben und damit so nicht die Mächtigeren die Schwächeren von ihren Besitzungen vertreiben.«21
Wie weit aber in einer archaischen Gemeinschaft der Besitz von Einzelnen ein Besitz in Gemeinschaft sein kann, das beschreibt Margaret Mead am schönsten an den Arapesch auf Neuguinea: