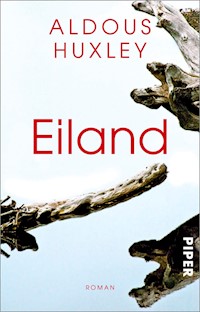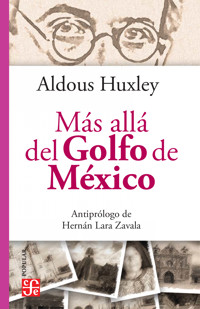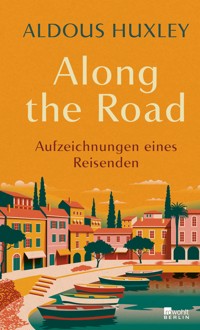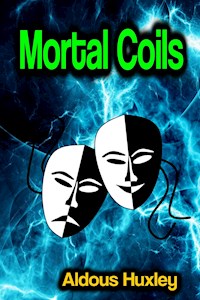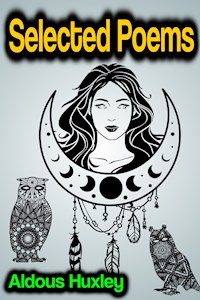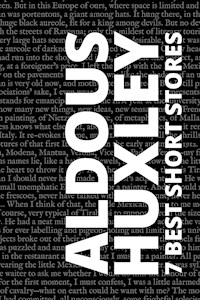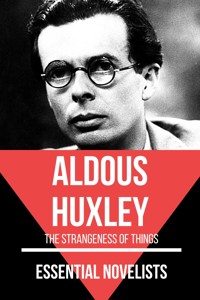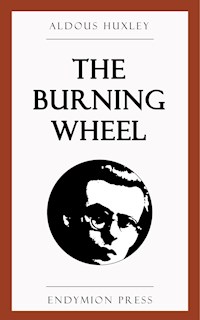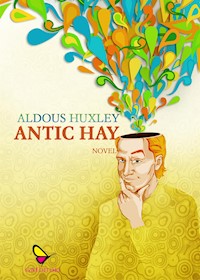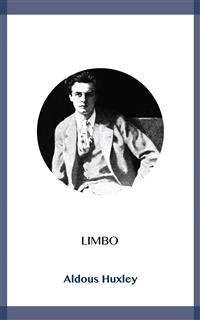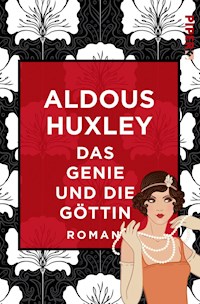
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Einer der letzten Romane von Aldous Huxley - ein Meisterwerk voller Humor, Sprachgewalt und intellektueller Gedanken »Das Genie und die Göttin« erzählt die Geschichte eines brillanten Professors, seiner wunderschönen Frau und einem jungen Mann, der ihre Welt in Stücke reißt. Huxley schafft es, seinen Figuren Ruhe, Hilflosigkeit, Liebe, Genialität, Humor und Zynik mit brachialer Harmonie zu geben. Ein Meisterwerk, das durch seine Unauffälligkeit glänzt, und als das Gegenstück zu Huxleys bekanntesten Roman »Schöne neue Welt» gilt. »Sollte Huxleys mit höchster Meisterschaft aufgebaute Erzählung eine Moral haben, so wäre es wohl die: daß der perfekte Gehirnmensch nicht nur am Leben vorbeilebt, sondern den Tod ausstreut und noch gar nicht einmal auf seine Opfer achtet.» (Christian E. Lewalter, DIE ZEIT)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Neuauflage einer früheren Ausgabe
Übersetzt aus dem Englischen von Herberth E. Herlitschka
ISBN 978-3-492-97653-4
© Piper Verlag GmbH, München 2017
© Mrs. Laura Huxley 1955
Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Genius and the Goddess«, Chatto & Windus, London 1955
© der deutschsprachigen Ausgabe Piper Verlag GmbH, München 1956, 1989
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: FinePic®, München
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
»Das Fatale an Romanen«, sagte John Rivers,»ist, dass sie zu viel Sinn ergeben. Die Wirklichkeit ergibt nie einen Sinn.«
»Nie?«, fragte ich zweifelnd.
»Vielleicht aus der Gottesperspektive«, räumte er ein.»Nie aus der unseren. Ein Roman hat Einheit, ein Roman hat Stil. Die Wirklichkeit hat weder das eine noch das andere. Im Rohzustand ist das Dasein immer eine verflixte Sache nach der anderen. Und jede der verflixten Sachen ist Thurber und zugleich Michelangelo, Mickey Spillane und zugleich Thomas von Kempen. Das Merkmal der Wirklichkeit ist ihre wesentliche Beziehungslosigkeit.« Und als ich fragte: »Worauf?«, schwenkte er seine breite, gebräunte Hand gegen die Bücherregale. »Auf, ›was das Beste ist geblieben, das je ein Mensch gedacht, geschrieben‹«, deklamierte er mit spöttischer Gewichtigkeit und fügte dann hinzu: »Seltsamerweise gelten die der Wirklichkeit am nächsten kommenden Romane als die am wenigsten wahren.« Er neigte sich seitwärts und tippte auf den Rücken eines zerlesenen Exemplars der Brüder Karamasoff. »Der da ergibt so wenig Sinn, dass er fast Wirklichkeit ist. Und das ist mehr, als sich von irgendeiner der wissenschaftlichen Arten von Romanen sagen lässt. Von den Romanen der Physiker und der Chemiker, von den Romanen der Historiker, den Romanen der Philosophen …« Sein anklagender Finger fuhr von Dirac zu Toynbee, von Sorokin zu Carnap. »Mehr sogar, als sich von den Romanen der Biografen sagen lässt. Hier hast du das neueste Exemplar dieser Sorte.« Er nahm von dem Tischchen neben sich ein Buch in einem glänzend blauen Schutzumschlag und hielt es mir zur Besichtigung her.
»Henry Maartens – Sein Leben«, las ich laut, ohne größeres Interesse, als man für einen zum Begriff gewordenen Namen aufbringt. Dann erinnerte ich mich, dass für John Rivers der Name etwas mehr und etwas anderes als einen Begriff bedeutet hatte.»Du warst sein Schüler, nicht wahr?«
Rivers nickte stumm.
»Und das hier ist die offizielle Biografie?«
»Der offizielle Roman«, verbesserte er. »Ein unvergessliches Bild des Rührstückwissenschaftlers – du kennst doch den Typ? – das blöde Kleinkind mit dem Riesenintellekt; das kranke Genie, das unbezwinglich gegen ungeheure Widrigkeiten ankämpfte; der einsame Denker, der doch der liebevollste Familienvater war; der vergessliche Professor mit dem Kopf in den Wolken, aber dem Herzen auf dem rechten Fleck. Die Wirklichkeit war leider nicht ganz so simpel.«
»Du meinst, das Buch ist ungenau?«
»Nein. Alles darin ist wahr – bis zu einem gewissen Grad. Darüber hinaus ist alles Quatsch – oder vielmehr gar nicht vorhanden. Und vielleicht«, fügte er hinzu, »vielleicht soll es gar nicht vorhanden sein. Vielleicht ist die vollständige Wirklichkeit immer zu würdelos, um verzeichnet zu werden, zu sinnlos oder zu grässlich, um nicht in einen Roman umgedichtet werden zu müssen. Immerhin ist's, wenn man zufällig die Wirklichkeit kennt, aufreizend, es ist sogar fast beleidigend, mit einem Rührstück abgespeist zu werden.«
»Also hast du die Absicht, es zu berichtigen?«
»Für die Öffentlichkeit? Gott behüte!«
»Für mich also. Privat.«
»Privat?«, wiederholte er. »Schließlich, warum nicht?« Er zuckte die Achseln und lächelte. »Eine kleine Orgie von Reminiszenzen, um einen deiner seltenen Besuche zu feiern.«
»Jeder Mensch würde glauben, du sprichst von einem gefährlichen Rauschgift.«
»Aber sie sind ein gefährliches Rauschgift«, antwortete er. »Man flüchtet in Reminiszenzen, wie man sich in Schnaps oder Amytal-Sodium flüchtet.«
»Du vergisst«, sagte ich, »dass ich Schriftsteller bin und die Musen die Töchter der Erinnerung sind.«
»Und Gott«, fügte er schnell hinzu, »ist nicht ihr Bruder. Gott ist nicht der Sohn der Erinnerung; er ist der Sohn der unmittelbaren Erfahrung. Man kann einen Geist nicht im Geist verehren, wenn man es nicht hier und jetzt tut. In der Vergangenheit zu schwelgen mag vielleicht gute Literatur sein, aber Lebensweisheit ist es nicht. Die wiedergefundene Zeit ist das verlorene Paradies, und die verlorene Zeit ist das wiedergewonnene Paradies. Lasst die Toten ihre Toten begraben! Wenn man jeden Augenblick leben will, wie er sich darbietet, muss man jeden anderen Augenblick absterben. Das ist das Wichtigste, was ich von Helen lernte.«
Der Name rief für mich ein blasses junges Gesicht herauf, eingerahmt von einer quadratischen Öffnung in einer Glocke dunklen, fast ägyptisch schwarzen Haars – rief auch die großen, golden leuchtenden Säulen von Baalbek herauf, vor dem blauen Himmel und dem Schnee des Libanons. Ich war damals Archäologe gewesen, und Helens Vater mein Vorgesetzter. Und in Baalbek hatte ich ihr einen Heiratsantrag gemacht und war abgewiesen worden.
»Wenn sie mich geheiratet hätte«, sagte ich, »hätte ich es dann gelernt?«
»Helen praktizierte, was zu predigen sie immer unterließ«, antwortete Rivers. »Es war schwer, nicht von ihr zu lernen.«
»Und meine Schriftstellerei? Und die Töchter der Erinnerung?«
»Es hätte sich ein Weg gefunden, sich das Beste aus beiden Welten zu nehmen.«
»Ein Kompromiss?«
»Eine Synthese. Ein dritter Lehrsatz, aus den beiden anderen abgeleitet. Tatsächlich kann man sich natürlich nie das Beste auch nur aus einer Welt nehmen, wenn man dabei nicht gelernt hat, sich das Beste aus der anderen zu nehmen. Helen gelang es sogar, sich das Beste aus dem Leben zu nehmen, während sie im Sterben lag.«
Vor meinem geistigen Auge wich Baalbek dem großen Hof der Universität Berkeley, und statt der lautlos schwingenden schwarzen Glocke war ein grauer Haarknoten da. Statt eines Mädchengesichts sah ich die schmalen, hageren Züge einer alternden Frau. Sie musste, überlegte ich, sogar schon damals krank gewesen sein.
»Ich war in Athen, als sie starb«, sagte ich.
»Ja, ich erinnere mich.« Und dann fügte er hinzu: »Ich wollte, du wärst hier gewesen. Um ihretwillen – sie hatte dich sehr gern. Und natürlich auch um deinetwillen. Sterben ist eine Kunst, und in unserm Alter sollten wir sie lernen. Es hilft einem, jemand gesehen zu haben, der wirklich wusste, wie. Helen wusste, wie man sterben soll, weil sie wusste, wie man leben soll – jetzt und hier leben soll, und zum größeren Ruhme Gottes. Und das bringt es notwendigerweise mit sich, dem Hier und Heute und Morgen und seinem eigenen, jämmerlichen kleinen Selbst abzusterben. Im Verlauf des Lebens, wie man es leben soll, war Helen in täglichen Raten gestorben. Als es zur letzten Abrechnung kam, war so gut wie nichts mehr zu zahlen. Nebenbei«, setzte Rivers nach einem kurzen Schweigen hinzu, »ich selbst war der letzten Abrechnung hübsch nahe im vergangenen Frühjahr. Tatsächlich wäre ich gar nicht mehr hier, wenn es kein Penicillin gäbe. Lungenentzündung, die gute Freundin alter Männer! Heutzutage bringen einen die Ärzte wieder hoch, damit man leben kann, um sich seiner Arterienverkalkung oder seines Prostatakrebses zu erfreuen. Du siehst also, dies alles ist völlig postum. Jedermann außer mir ist tot, und ich selbst lebe von erborgter Zeit. Wenn ich etwas berichtige, dann als Geist, der von Geistern redet. Und überhaupt ist heute Weihnachtsabend; also ist eine Geistergeschichte ganz am Platz. Überdies bist du ein sehr alter Freund, und auch wenn du es alles wirklich in einen Roman hineinbringst – was liegt schon daran?« Sein großes, von Falten durchzogenes Gesicht wurde von einem Ausdruck herzlicher Ironie erhellt.
»Wenn dir etwas daran liegt«, beteuerte ich ihm, »werd ich's nicht tun.«
Diesmal lachte er laut heraus.
»›Die stärksten Schwüre sind Stroh für das Feuer im Blut‹«, zitierte er. »Ich würde eher meine Töchter Casanova anvertrauen als meine Geheimnisse einem Romanschreiber. Literarische Feuer sind sogar noch heißer als sexuelle. Und literarische Schwüre sind sogar noch strohiger als die eheliche oder die klösterliche Spielart.«
Ich versuchte zu widersprechen, aber er winkte ab.
»Wenn ich es noch immer geheim halten wollte«, sagte er, »würde ich es dir nicht erzählen. Aber wenn du es doch veröffentlichst, unterlass, bitte, die übliche Vorbemerkung nicht. Du weisst schon – jede Ähnlichkeit mit einer lebenden oder verstorbenen Person ist nur zufällig. Aber gerade nur! Und nun zurück zu den Maartens! Ich hab irgendwo ein Bild.« Er stemmte sich aus seinem Lehnsessel hoch, ging zum Schreibtisch und öffnete eine Lade. »Wir alle miteinander – Henry und Katy und die Kinder und ich. Und wie durch ein Wunder«, fügte er, nachdem er einen Augenblick raschelnd zwischen Papieren in der Lade gesucht hatte, hinzu,»ist's, wo es sein soll.«
Er reichte mir die verblasste Vergrößerung einer Amateuraufnahme. Sie zeigte drei Erwachsene, die vor einem hölzernen Gartenhäuschen standen – ein kleiner magerer Mann mit weißem Haar und einer Hakennase, ein junger Riese in Hemdärmeln und, zwischen den beiden, blond, lachend, breitschultrig und vollbusig, eine prächtige Walküre, inkongruent in ein enges, kurzes Röckchen gekleidet; ihnen zu Füßen zwei Kinder, ein Junge von neun oder zehn Jahren und seine ein wenig ältere, Hängezöpfe tragende Schwester.
»Wie alt er aussieht!«, war meine erste Bemerkung. »Alt genug, um der Großvater seiner Kinder zu sein.«
»Und infantil genug, mit sechsundfünfzig, um Katys Bubi zu sein.«
»Ein recht komplizierter Inzest.«
»Aber er funktionierte«, beteuerte Rivers, »er funktionierte so gut, dass er zu einer regelrechten Symbiose geworden war. Henry lebte von Katy, und sie war dazu da, von sich leben zu lassen – die verkörperte Mütterlichkeit.«
Ich besah mir die Fotografie abermals.
»Was für eine fesselnde Stilmischung! Maartens ist reine Gotik. Seine Frau ist eine Wagner-Heroine, die Kinder sind geradewegs aus der Bibliothèque rose, und du, du …« Ich blickte zu dem kantigen, lederartigen Gesicht auf, das mir von der anderen Seite des Kamins entgegensah, und dann wieder auf die Fotografie. »Ich hatte vergessen, was für eine Schönheit du damals warst. Die römische Kopie eines Praxiteles.«
»Könntest du mich nicht zu einem Original machen?«, bat er.
Ich schüttelte den Kopf.
»Sieh dir die Nase an!«, sagte ich.»Sieh dir die Modellierung des Kinnbackens an! Das ist nicht Athen; das ist Herkulaneum. Aber zum Glück interessieren sich Mädchen nicht für Kunstgeschichte. Für alle praktischen amourösen Zwecke warst du das Wahre, der echte Griechengott.«
Rivers verzog das Gesicht.
»Ich habe vielleicht wie die Rolle ausgesehen«, sagte er, »aber wenn du glaubst, ich konnte sie spielen …« Er schüttelte den Kopf. »Für mich gab's keine Ledas, keine Daphnes, keine Europas. Damals war ich, vergiss das nicht, noch immer das unverfälschte Produkt einer bedauerlichen Erziehung. Der Sohn eines lutherischen Pastors und nach meinem zwölften Jahr der einzige Trost einer verwitweten Mutter. Ja, ihr einziger, obwohl sie sich für eine fromme Christin hielt. Klein-Johnny nahm den ersten, zweiten und dritten Platz ein; Gott war bloß unter den ›Ferner liefern‹. Und natürlich hatte der einzige Trost keine andere Wahl, als der Mustersohn zu werden, der Vorzugsschüler, der unermüdliche Stipendiengewinner, der sich seinen Weg durchs College und die höheren Prüfungen erbüffelte, ohne Muße für etwas Verfeinerteres als Fußball oder den Quartettverein zu haben, etwas Erleuchtenderes als die wöchentliche Predigt des Reverend Wigman.«
»Aber erlaubten dir die Mädchen, sie zu ignorieren? Mit einem solchen Gesicht?« Ich wies auf den lockenhäuptigen Athleten auf der Fotografie.
Rivers schwieg. Und dann antwortete er mit einer Frage.
»Hat deine Mutter dir je gesagt, das wundervollste Hochzeitsgeschenk, das ein Mann seiner Frau darbringen könne, sei seine Unberührtheit?«
»Glücklicherweise nicht.«
»Na, die meine ja. Und sie sagte mir das überdies auf den Knien, im Lauf eines Ex-tempore-Gebets. Darin war sie groß, im Ex-tempore Beten«, fügte er in Klammern hinzu. »Sogar noch größer, als mein Vater gewesen war. Die Sätze flössen noch gleichmäßiger, die Sprache war noch echter pseudo-altertümlich. Meine Mutter war imstande, mit genau den Phrasen der Epistel an die Hebräer unsere finanzielle Lage zu erörtern oder mich für meinen Widerwillen gegen Tapiokapudding zu tadeln. Als eine Leistung linguistischer Virtuosität war es ganz erstaunlich. Leider vermochte ich nicht, in diesen Begriffen daran zu denken. Die Virtuosin war meine Mutter und die Gelegenheit stets feierlich. Alles, was sie sagte, während sie zu Gott sprach, musste mit religiösem Ernst aufgenommen werden. Besonders, wenn es sich auf das große Unerwähnbare bezog. Mit achtundzwanzig, ob du's glaubst oder nicht, bewahrte ich noch immer dieses Hochzeitsgeschenk für meine hypothetische Braut auf.« Es folgte ein Schweigen.
»Mein armer John!«, sagte ich endlich.
Er schüttelte den Kopf.
»Wer arm war, das war meine Mutter. Sie hatte es sich alles so vollkommen ausgedacht. Eine Dozentenstelle an meiner alten Universität, dann eine Hilfsprofessur, dann eine Professur. Ich würde nie von daheim wegmüssen. Und wenn ich etwa vierzig wäre, würde sie für mich eine Heirat einfädeln, mit einem prächtigen lutherischen Mädel, von dem sie wie eine leibliche Mutter geliebt werden würde. Wenn Gott ihm nicht gnädig gewesen wäre, dort ginge John Rivers – und in die Binsen. Aber Gott war ihm gnädig – nur allzusehr, wie sich ergab. Eines schönen Morgens, ein paar Wochen nachdem ich meinen Doktor phil. gemacht hatte, erhielt ich einen Brief von Henry Maartens. Er war damals in St. Louis, arbeitete über Atome. Er brauche noch einen Assistenten, habe Günstiges von meinem Professor über mich gehört, könne mir zwar nicht mehr als ein skandalös kleines Gehalt bieten – aber würde mich die Sache interessieren? Für einen angehenden Physiker war's die einmalige Gelegenheit. Für meine arme Mutter war's das Ende von allem. Inständig, in größter Seelenqual, betete sie. Zu ihrem ewigen Ruhm hieß Gott sie, mich ziehen zu lassen.
Zehn Tage später lud mich ein Taxi vor der Schwelle der Maartens' ab. Ich erinnere mich, wie ich in kaltem Schweiß dastand und versuchte, meinen Mut hoch genug zu schrauben, um auf die Klingel zu drücken. Wie ein Schuljunge, der etwas angestellt hat und zum Direktor befohlen worden ist. Die erste Jubelstimmung über mein wundervolles Glück hatte sich längst verflüchtigt, und während der letzten paar Tage daheim und in den endlos langen Stunden der Reise hatte ich nur an meine Unzulänglichkeit gedacht. Wie lange würde ein Mann wie Henry Maartens brauchen, um einen Mann wie mich zu durchschauen? Eine Woche? Einen Tag? Wahrscheinlich eine Stunde! Er würde mich verachten; ich würde zum Gespött des ganzen Laboratoriums werden. Und außerhalb des Laboratoriums würde es ebenso schlimm sein. Ja, wahrhaftig, noch schlimmer. Die Maartens hatten mich aufgefordert, ihr Gast zu sein, bis ich eine eigene Wohnung fände. Wie außerordentlich gütig! Aber auch wie teuflisch grausam! In der unnachsichtigen hochkultivierten Atmosphäre ihres Heims würde ich mich als das enthüllen, was ich war – schüchtern, blöde, hoffnungslos provinzlerisch.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: