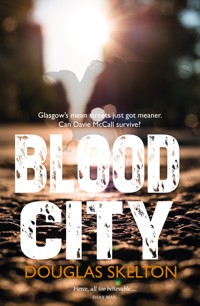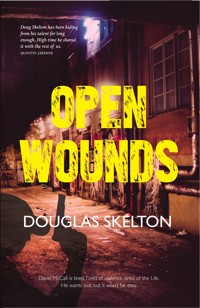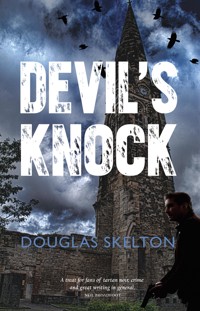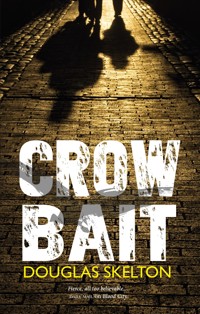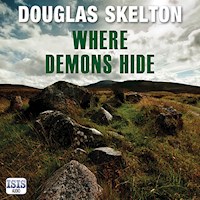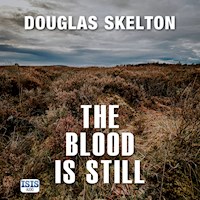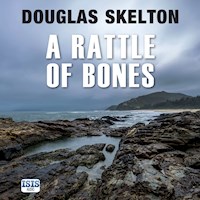8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Rebecca-Connolly-Reihe
- Sprache: Deutsch
Auf dem historischen Schlachtfeld von Culloden wird eine Leiche gefunden, in der Kluft eines Highlanders und von einem Schwert durchbohrt. Zur selben Zeit befindet sich die nahegelegene Stadt Inverness in Aufruhr: Die Bewohner protestieren gegen den Zuzug eines Sexualstraftäters. An vorderster Front stehen die Burkes, eine Familie mit zweifelhaftem Ruf, doch die Kontrolle über den wütenden Mob geht ihnen mehr und mehr an einen gefährlichen Rechtspopulisten verloren. Rebecca Connolly findet sich inmitten der Geschehnisse wieder: Bei der Aufklärung des Mordfalls arbeitet sie eng mit DCI Valerie Roach zusammen, während ihre Berichterstattung über die Proteste die Aufmerksamkeit der Familie Burke auf sich zieht. Als eine zweite Leiche in einer Redcoat-Uniform auftaucht, wird die Arbeit für Rebecca immer gefährlicher – und sie muss lernen, dass nicht alle Wunden der Vergangenheit wieder verheilen … Die Rebecca-Connolly-Reihe: Band 1: Die Toten von Thunder Bay Band 2: Das Grab in den Highlands Band 3: Das Unrecht von Inverness Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Auf dem historischen Schlachtfeld von Culloden wird eine Leiche gefunden, in der Kluft eines Highlanders und von einem Schwert durchbohrt. Zur selben Zeit befindet sich die nahegelegene Stadt Inverness in Aufruhr: Die Bewohner protestieren gegen den Zuzug eines Sexualstraftäters. An vorderster Front stehen die Burkes, eine Familie mit zweifelhaftem Ruf, doch die Kontrolle über den wütenden Mob geht ihnen mehr und mehr an einen gefährlichen Rechtspopulisten verloren.
Rebecca Connolly findet sich inmitten der Geschehnisse wieder: Bei der Aufklärung des Mordfalls arbeitet sie eng mit DCI Valerie Roach zusammen, während ihre Berichterstattung über die Proteste die Aufmerksamkeit der Familie Burke auf sich zieht. Als eine zweite Leiche in einer Redcoat-Uniform auftaucht, wird die Arbeit für Rebecca immer gefährlicher – und sie muss lernen, dass nicht alle Wunden der Vergangenheit verheilen …
© Douglas Skelton
Douglas Skelton wurde in Glasgow geboren. Nach mehreren Büchern über wahre Verbrechen schreibt er heute Kriminalromane. ›Die Toten von Thunder Bay‹, der erste Band der Reihe um die Reporterin Rebecca Connolly, stand auf der Longlist für den McIlvanney-Preis als bester Kriminalroman des Jahres. Douglas Skelton lebt im Südwesten Schottlands.
Ulrike Seeberger lebte zehn Jahre in Schottland, wo sie unter anderem am Goethe-Institut arbeitete. Seit 1987 arbeitet sie als freie Übersetzerin und Dolmetscherin in Nürnberg. Sie übertrug Autoren wie Lara Prescott, Philippa Gregory, Vikram Chandra, Alec Guinness, Oscar Wilde, Charles Dickens, Yaël Guiladi und Jean G. Goodhind ins Deutsche.
DOUGLASSKELTON
DASGRABIN DENHIGHLANDS
Ein Fall fürRebecca Connolly
Kriminalroman
Aus dem Englischenvon Ulrike Seeberger
Von Douglas Skelton ist bei DuMont außerdem erschienen:
Die Toten von Thunder Bay
Die Übersetzung wurde ermöglicht mithilfe des Publishing Scotland translation fund.
eBook 2022
DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2020 by Douglas Skelton
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Kossack, Hamburg.
Die englische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel ›The Blood is Still‹ bei Polygon, ein Imprint von Birlinn Ltd., Edinburgh.
© 2022 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Übersetzung: Ulrike Seeberger
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: Schafe © pidjoe / iStock by Getty Images; Himmel © plainpicture/Design Pics/John Short; Landschaft © plainpicture/JanJasperKlein
Satz: Fagott, Ffm
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-7126-1
www.dumont-buchverlag.de
»Es gibt offene Wunden, manchmal sind sie zur Größe eines Nadelstichs geschrumpft, aber es sind trotzdem noch Wunden.«
F. Scott Fitzgerald
1
Er liegt auf dem Rücken, die Arme ausgestreckt, die Beine weit gespreizt, die Augen sind offen und schauen zu, wie der weiche Schnee auf ihn zuschwebt. Er weiß, dass er stirbt, aber er kann nichts daran ändern – nicht so, wie er am Boden fixiert ist. Er spürt keinen Schmerz, nur eine Art Taubheit, von der er weiß, dass sie nicht nur vom feuchten Heidekraut herrührt. Ihm ist, als hätte man ihn örtlich betäubt, seinen Körper unempfindlich gemacht, aber seinen Verstand wachgehalten. Die Taubheit breitet sich schleichend in ihm aus, stiehlt ihm alles Gefühl, alle Beweglichkeit, alles Leben.
Doch sein Blut spürt er noch. Oder zumindest meint er zu spüren, wie es aus der Wunde sprudelt. Könnte er den Kopf bewegen, so wäre es ihm vielleicht möglich, den Blick nach unten zu richten und zuzusehen, wie es ungehindert rings um den kalten Stahl hervorströmt, seine Kleidung durchtränkt …
Nein, nicht seine Kleidung, das ist nicht seine Kleidung.
… und unter ihm in der Erde versickert. Dieser Erde ist Blut nicht neu. Sie ist damit durchtränkt. Das Blut ist zwar vor 275Jahren vergossen worden, doch es ist geblieben, hat sich mit den Wurzeln des Heidekrauts verbunden, hat sich zwischen den Felsbrocken und den Kieselsteinen und dem Sand da unten im Schlamm festgesetzt; sinkt vielleicht noch bis zum Mittelpunkt der Erde.
Ein feiner Dunst weht durch die Dunkelheit zu ihm, doch er spürt die eisige Liebkosung nicht. Er meint, in dem Wirbel Gestalten ausmachen zu können: nebelhaft, ohne Form oder Fleisch, aber trotzdem gegenwärtig. Längst verstorbene Männer, die noch immer an den blutgesättigten Boden gebunden sind, den sie nicht mehr unter ihren Füßen fühlen. Er spürt, dass sie sich um ihn scharen wie Sargträger, ihn mustern, seine Kleidung mustern …
Nein, nicht seine Kleidung …
Sie sind so vertraut und zugleich so ungeheuer fremd. In gewisser Weise versteht er ihre Verwirrung, denn er ist wie sie gekleidet, aber keiner von ihnen. Sein Gewand wurde erst in jüngerer Zeit geschneidert, sorgfältig so gestaltet, dass es wie selbst genäht aussieht. Und doch weiß er, dass die schemenhaften Gestalten bereit sind, ihn in der Welt aus Nebel und Schatten willkommen zu heißen, die sie nun ihr Eigen nennen.
Er hört Klänge – glaubt sie zu hören.
Gedämpft. Schwach. Dumpf.
Das Klirren von Metall auf Metall. Das Stottern von Gewehrsalven.
Und Stöhnen. Wildes Wut- und Schmerzgeschrei. Brüllen, als Fleisch von Eisen zerfetzt wird.
Tränen.
Männer, die weinen, während sie sterben oder ihre Brüder sterben. Hochlandstimmen, die Klagelaute stöhnen, als das Leben ihrer Kameraden in der klammen Luft dahinschwindet. Zähe Männer, deren Leben hart war und die nur mehr schluchzen, weil all das sinnlos ist. Er will mit ihnen weinen, um sie weinen. Doch er hat keine Tränen mehr. Er hat keine Zeit mehr. Er hat nichts mehr.
Er ist kein guter Mensch gewesen. Er hat das früher nicht gewusst – es wäre ihm nie in den Sinn gekommen. Aber jetzt weiß er es, jetzt, als er auf der kalten Erde liegt und auf einen Tod wartet, gegen den er nichts ausrichten kann. Er hat ihn akzeptiert, hat seinen Frieden gemacht. Ebenso gut könnte er versuchen, jede einzelne Schneeflocke daran zu hindern, auf den Boden aufzutreffen. Aber nein, er ist kein guter Mensch gewesen. Er war nicht böse, wenn er auch viele böse Menschen gekannt hat, doch er hat sein Leben nicht gut gelebt. Er fragt sich, ob er das alles irgendwie verdient hat.
Das taube Gefühl hat ihm beinahe alles geraubt. Die Gestalten treten näher zu ihm hin, warten. Sie wissen, dass seine Zeit von Fleisch und Knochen ihrem Ende entgegengeht. Auch er muss ein Wesen aus Nebel und Erinnerung werden. Sie werden ihm dabei helfen, das weiß er. Sie sind Fremde, durch Zeit und Sterben von ihm getrennt, aber sie sind seine Brüder im Tod. Der Schlachtenlärm verebbt. Er schaut zu, wie die Schneeflocken anmutig vom dunklen Himmel herabschweben, sich auf seinem Gesicht niederlassen. Er sieht, wie eine leichte Brise sie erfasst und sanft herumwirbelt – Ballerinen in Zeitlupe, die sich zu einer Musik drehen, die niemand vernehmen kann. Endlich, es ist nicht aufzuhalten, lässt er zu, dass die Kälte ihn umfasst, bis er eins mit ihr wird.
Sein Blut ist still.
2
In Sachen Demonstrationen würde diese Menschenansammlung den Gelbwesten wohl keine Konkurrenz machen. Es war nur eine einzige Warnweste zu sehen, und ihr Träger hatte sich wahrscheinlich in den CNN-Nachrichten von der Pariser Protestbewegung inspirieren lassen. Vielleicht war er aber auch nur ein Straßenarbeiter, der stehen geblieben war, um zu sehen, worum es bei der ganzen Aufregung ging.
Die Teilnehmer drängten sich um die kleine Frau, die unter einem Schild stand, auf dem in allen Einzelheiten die Parkbeschränkungen vor dem roten Backsteingebäude aufgeführt waren. Zu viele für eine Gruppe, nicht genug für eine Menschenmasse, dachte Rebecca Connolly. Einige Demonstranten hatten sich an das halbe Dutzend blauer Poller gelehnt, das um eine Parkverbotszone angeordnet war, die zusätzlich durch gekreuzte gelbe Linien auf dem Asphalt gekennzeichnet war. Rebecca erblickte eine Handvoll selbst gebastelter Schilder, auf denen mit Filzstift die Gründe dafür verkündet wurden, dass man sich hier an diesem kühlen, bedeckten Märzmorgen versammelt hatte. Über Nacht war ein wenig Schnee gefallen, der aber auf den Stadtstraßen nicht liegen geblieben war. Jenseits der schmalen Einfahrt standen ein paar Leute, hauptsächlich Passanten, die dort verweilten, um herauszufinden, was eigentlich los war. Im Obergeschoss der Pension entdeckte Rebecca an einem Fenster einen Mann, der mit erhobener Kaffeetasse alles beobachtete. Die Ereignisse vor dem Hauptgebäude der Bezirksverwaltung waren eindeutig interessanter als Die Immobilien-Jäger im Fernsehen.
Rebecca beobachtete, wie Mo Burke die Menge für sich begeisterte, und konnte nicht umhin, beeindruckt zu sein. In einem anderen Leben, in einer anderen Welt hätte diese Frau Politikerin sein können, zumindest aber eine führende Rolle in ihrer Gemeinde spielen sollen. Ihre Zuhörer wussten, wer sie in Wirklichkeit war, schenkten ihr aber trotzdem Aufmerksamkeit, applaudierten ihr, nickten zustimmend. Vielleicht machten sie das nur, weil Mo und ihre Söhne sie eindringlich darum gebeten hatten. Denn wenn einen ein Burke eindringlich um etwas bittet, kommt man dieser Bitte am besten nach. Vielleicht lag es nur daran, dass Mo ihnen genau das sagte, was sie hören wollten, dass sie ihren Gedanken eine Stimme verlieh, oder daran, wie sie ihre Worte durch eine kraftvolle energische Vortragsweise unterstrich, die nur zum Teil dem Mikrofon und dem Megafon geschuldet war. Eigentlich brauchte Mo beides nicht – ihre Stimme war mächtig genug, um ihre Worte weit hinauszutragen. Sie war keine massige Frau, aber sie hatte eine große Präsenz. Starqualitäten. Starqualitäten, gepaart mit blond gebleichtem Haar und einem vom Rauch aufgerauten Glasgower Akzent. Viele Jahre in den Highlands hatten die scharfen Kanten nur wenig abschleifen können.
Chaz Wymark stand in der vordersten Reihe, fotografierte Mo während ihrer Rede. Sie hatte ihn bereits mit ein paar misstrauischen Blicken bedacht. Im Allgemeinen war Medieninteresse ihr nicht gerade willkommen, aber sie hatte aus irgendeinem Grund der Presse die Tür geöffnet, und nun musste sie damit leben. Rebecca hatte mit ihrem Mobiltelefon auch schon ein paar Schnappschüsse von der Menge für ihren Artikel im Chronicle gemacht. Ihr Zeitungsetat reichte nämlich nicht mehr dazu aus, freiberufliche Fotografen wie Chaz zu beschäftigen. Sie war kein Profi, aber die Redakteure mussten eben nehmen, was sie ihnen lieferte. Nicht dass sie sich darum noch viele Gedanken machten. Aber Rebecca hatte darauf geachtet, dass Mo stets mit im Bild war.
Mo Burke, eigentlich Maureen, von manchen auch Ma genannt, war eine Drogenhändlerin, wenn auch nur Gerüchten zufolge, denn in Wahrheit war sie noch nie wegen eines Drogendeliktes in einem Gerichtssaal gewesen, jedenfalls nicht auf der Anklagebank. Rebecca hatte ihre Hausaufgaben erledigt, ehe sie sich zur Berichterstattung über diese Demonstration aufgemacht hatte. Also wusste sie, dass es mit Tony, dem Ehemann dieser Frau, eine ganz andere Bewandtnis hatte. Er saß im Augenblick wegen eines Überfalls mit schwerer Körperverletzung im Gefängnis, nachdem er eine Begegnung der schmerzhaften Art mit einem Edinburgher Ganoven namens Sammy Lang gehabt hatte. Sammy Lang hatte versucht, sich auf den Drogenmarkt von Inverness zu drängen. Sammy trug den Beinamen The Slug, weil er wie eine Nacktschnecke überall eine Schleimspur hinterließ. Rebecca war außerdem zu Ohren gekommen, dass er eine Vorliebe für Sex mit Minderjährigen hatte.
Besonders in Anbetracht dieser sexuellen Vorlieben hatte Rebecca Zweifel daran, ob es wirklich Zufall war, dass Mo Burke sich entschieden hatte, dieses spezielle Anliegen so tatkräftig zu unterstützen. Im Stadtteil Inchferry kursierte das Gerücht von Plänen der Bezirksverwaltung, dort in einer leer stehenden Wohnung einen verurteilten Sexualstraftäter unterzubringen. Wie zu erwarten, weigerte man sich von offizieller Seite, diese Nachricht zu bestätigen oder zu leugnen. Ebenso erwartungsgemäß wurde diese Weigerung unverzüglich als Bestätigung des Gerüchts gewertet. Nun hatte Mo Burke es in die Hand genommen, die Demo vor dem Gebäudekomplex des Highland Council in der Glenurquhart Road in Inverness zu organisieren. Rebecca erkannte Mos zwei Söhne in der Menge, die sich unter ihrer Fahne versammelt hatte, vielmehr unter einem Schild, das hinter ihr stand und in Großbuchstaben verkündete: »WIR SIND KEINE MÜLLKIPPE«. Als Schlachtruf war das wesentlich akzeptabler als das sehr viel krudere Motto, das jemand auf einem anderen Plakat in die Höhe reckte: »KEINE PERWERSEN HIR«.
Einige von Mos Unterstützern hatten sich ein wenig von der Menge abgesondert und lungerten in der Zufahrt zur Bezirksverwaltung herum, wurden aber sogleich von einem der drei diensthabenden Polizisten aufgefordert, sich wieder auf den Bürgersteig zurückzuziehen. In Anbetracht des Rufes der Familie Burke war Rebecca überrascht, dass so wenig Polizei hier war. Sie selbst hielt sich in einiger Entfernung auf der dem Eingang gegenüberliegenden Seite auf und hatte sich an eine im Gras aufgestellte Infotafel gelehnt, die das Logo der Bezirksverwaltung trug und verkündete, dies sei das Prìomh Oifis – der Hauptsitz. Rebecca fragte sich, wie viele der Demonstranten wohl Gälisch sprachen oder sich darum scherten, dass hier beinahe jedes offizielle Schild zweisprachig war. Nicht viele, vermutete sie.
»Die halten uns für blöd.« Mo sprach ins Mikrofon und fuchtelte mit dem Lautsprecher, den sie in der anderen Hand hielt, in die ungefähre Richtung des Gebäudes. »Die glauben, wir haben keine Ahnung, was die im Schilde führen. Aber wir wissen es. WIR WISSEN DAS!«
Das quittierte die Menge mit weiterem Nicken und ein paar gemurmelten »Aye« und »Genau« und einem »Da hast du recht, Mo!«. Mo schien mit dieser Reaktion zufrieden zu sein, drosch aber weiter auf ihrem Standpunkt herum.
»WIR SIND KEINE MÜLLHALDE«, brüllte sie, bis ein rückgekoppeltes Protestkreischen aus dem Lautsprecher sie zwang, ihre Lautstärke zu dämpfen. »Wir sind nur hier, um denen klarzumachen, dass wir kein Mülleimer für alle Perversen aus den Highlands sind. Wir lassen uns das nicht gefallen. Wir lassen nicht zu, dass die auch nur einen von denen in unsere Straßen bringen. Hab ich recht?«
Ihre Unterstützer reagierten mit »Auf keinen Fall« und »Verdammt recht hast du« und »Zeig’s ihnen, Mo«, begleitet von einem Sortiment von Grunzen und weiterem Kopfnicken.
»Wir wählen doch die Leute da drin. Und wir wählen die nicht, damit sie sich mit ihrem Hintern um einen Konferenztisch hocken und alle möglichen Spesen einsacken. Die sind da, um unsere Interessen zu vertreten, um das zu tun, was wir wollen. Hab ich nicht recht?«
Weitere Zustimmung aus der Menge.
»Und was wollen wir?«
»Perverse raus!«, brüllte jemand. Rebecca glaubte, dass es Nolan Burke, Mos ältester Sohn, gewesen war. Sie entdeckte ihn inmitten der Protestierenden. Er sah gut aus, Marke »Ben Affleck in seinen besten Zeiten«: Sein schwarzes Haar war perfekt gepflegt und seine Haut sonnengebräunt, ob von einem kürzlichen Besuch an wärmeren Gestaden oder im Sonnenstudio, konnte sie nicht sagen. Sie hatte ihn schon früher hin und wieder gesehen, wenn auch nicht von Angesicht zu Angesicht. Er war regelmäßig im Amtsgericht anzutreffen, im Allgemeinen wegen kleinerer Vergehen – Einbruch, geringfügige Gewalttaten –, obwohl man munkelte, dass er auch vor schwereren Vergehen nicht zurückschreckte. Er und sein jüngerer Bruder Scott tauchten so oft vor Gericht auf, dass einer von Rebeccas Kollegen einen alten Witz aufgewärmt und leicht verändert hatte: »Was ist ein Burke-Junge im Anzug? Der Angeklagte.«
Heute trug Nolan allerdings keinen Anzug, sondern eine schwere Pilotenjacke aus Schaffell. Rebecca überlegte, wo er wohl sein Doppeldecker-Flugzeug geparkt hatte. Nolan ertappte sie dabei, wie sie ihn anstarrte. Sie wandte rasch die Augen ab und suchte nach dem vertrauten Blondschopf seines Bruders. Scott musste hier auch irgendwo sein, das wusste sie. Er war ein hoch aufgeschossener Bursche, ähnelte aber ansonsten seiner Mutter. Nolan kam eher nach seinem Vater.
Kurz darauf entdeckte Rebecca Scott, der am Rand der Menge entlangspazierte. Er hatte ein seltsames kleines Lächeln auf dem Gesicht, die Hände in den Taschen seiner leichten Tarnjacke vergraben – wieso hatten die Burke-Brüder bloß so ein Faible für Militärkleidung? Die Kälte machte ihm offenbar nicht zu schaffen. Schließlich war er Scott Burke, ein zäher Bursche. Er war ein wenig schmaler als sein älterer Bruder, aber er hatte jede Menge Muskeln. Seine Gesichtszüge wirkten schwächer, nicht ganz so attraktiv, und sein Lächeln war einfach nur fies.
Rebecca hatte das Gefühl, beobachtet zu werden, und obwohl sie sich größte Mühe gab, es nicht zu tun, huschte ihr Blick wieder zu Nolan. Ja, er schaute sie noch immer an. Er hatte die Augen leicht zusammengekniffen, als versuchte er, sie einzuordnen, obwohl er sie bestimmt schon im Gerichtssaal gesehen hatte. Als er merkte, dass ihr Blick wieder zu ihm zurückgewandert war, nickte er und lächelte. Es war kein beunruhigendes Lächeln wie bei seinem Bruder, aber er war immer noch Nolan Burke.
Sie wandte ihre Aufmerksamkeit wieder seiner Mutter zu, als Mo gerade in die Richtung ihres Sohns schaute. »Ja, genau. Perverse raus. Wir wollen, dass unsere Straßen sicher sind. Wir wollen, dass unsere Kinder sicher sind. Keine Perversen in unserer Siedlung. Perverse raus! Perverse raus! PERVERSE RAUS!«
Die Menge reagierte nicht gerade ekstatisch. Ein paar Unentwegte griffen den Sprechgesang auf und begannen wie Mo ihre Fäuste in die Luft zu recken. Scott Burke versetzte einem widerwilligen Jüngling einen Rippenstoß und gab ihm mit einem Nicken zu verstehen, er solle sich beteiligen. Der junge Mann kam der Aufforderung nach, was seiner Gesundheit zuträglicher war.
Der halbherzige Sprechgesang kam ins Stottern und verstummte ganz, als ein Taxi vorfuhr und die Leute sich umdrehten und auf den großen Mann schauten, der ausstieg. Sein braun gebranntes Gesicht wirkte jünger, als sein dichtes weißes Haar es vermuten ließ. Er trug einen dunkelblauen Nadelstreifenanzug, ein blaues Hemd mit einem hellgelben Schlips und farblich passendem Einstecktuch, das sorgfältig in der Brusttasche arrangiert war. Zwei weitere Männer traten auf der Straße zu ihm – große, untersetzte Männer mit dem starren Gesichtsausdruck von großen, untersetzten Männern, die allen, die weniger groß und untersetzt sind als sie und die Unverfrorenheit besitzen, sich ihrem Arbeitgeber zu nähern oder ihn gar zu belästigen, einigen Schaden zufügen könnten und das höchstwahrscheinlich auch schon des Öfteren getan hatten. Die beiden hätten kaum auffälliger sein können, wenn sie T-Shirts mit der Aufschrift »Wir sind seine Leibwächter, also lasst gefälligst die Finger von ihm« getragen hätten. Die Menschen bildeten eine Gasse für die drei Männer. Rebecca brauchte die geflüsterten Bemerkungen nicht zu hören, um zu wissen, wer der elegant gekleidete Mann war. Sie hatte ihn bereits im Fernsehen reden sehen, war sogar selbst bei der Pressekonferenz gewesen, bei der er verkündet hatte, dass er für das schottische Parlament kandidieren wollte.
Finbar Dalgliesh … Sieh an, sieh an. Er war der Rechtsanwalt, der die ultra-rechte politische Bewegung Spioraid nan Gàildheal – Geist der Gälen – oder kurz Spioraid anführte. Diese Gruppierung war der festen Überzeugung, dass Schottland allein besser dastünde. Allerdings unterschied sich die Bewegung vom Mainstream der schottischen Nationalisten durch die Ansicht, dass Schottland noch besser dastünde, wenn hier nur weiße, eingeborene Schotten lebten. Keine Fremden, keine Schwulen, sogar Frauen waren suspekt. Die Bewegung war politisch so weit rechts, dass Attila der Hunnenkönig im Vergleich dazu wie Mutter Teresa aussah. Finbar Dalgliesh gab den Mann aus dem Volk – die komplette Nummer mit Bier und Kippen und leutseligen Reden –, war aber mindestens so schmierig wie die ölverpestete See rings um die Exxon Valdez. Und wenn er hier war, witterte er Wählerstimmen.
Mo war verstummt. Ebenso die Menschenmenge. Rebecca sah, dass sie Scott mit Blicken ohrfeigte. Es war offensichtlich, dass Dalglieshs Anwesenheit sie überrascht hatte, ganz im Gegensatz zu ihrem Sohn. Der zuckte nur mit den Schultern. Ob er damit seine Beteiligung an dieser Angelegenheit leugnete oder den Tadel abwehrte, konnte Rebecca nicht sagen.
Nun stand Dalgliesh neben Mo und winkte der Menge zu. Er legte ihr leicht eine Hand auf die Schulter und drehte sie ein wenig weg, um mit ihr ein paar leise Worte zu wechseln.
Rebecca stand einige Meter entfernt, aber es war deutlich zu sehen, wie Mos Wut beim Zuhören rasch anwuchs. Trotzdem nickte die Frau und trat einen Schritt zur Seite. Ihre Augen wanderten zu Scott zurück und funkelten eine Drohung in seine Richtung. Chaz richtete seine Linse auf Dalgliesh, der nun vortrat und sich an die Menge richtete; er ignorierte geflissentlich die Kamera, achtete aber sorgfältig darauf, ihr nur seine beste Seite zu zeigen. Seine beiden Beschützer stellten sich nah genug neben ihn, dass sie dazwischengehen konnten, falls jemand zu ungestüm wurde, hielten sich aber weit genug entfernt, um keine Aufmerksamkeit zu erregen.
Dalgliesh streckte die Arme aus, als wollte er die ganze Menge umarmen. Ein paar Leute schienen diese Liebe zu erwidern, während andere eher so aussahen, als würden sie lieber mit einem wildgewordenen Grizzlybären kuscheln.
»Meine Freunde«, sagte er nun. »Ich bin Finbar Dalgliesh.«
Rebecca verdrehte die Augen. Diese Nummer hatte sie bei ihm schon öfter gesehen. Jeder wusste, wer er war. Und er wusste, dass alle wussten, wer er war. Diese Andeutung, er könnte hier vielleicht nicht bekannt sein, müsse sich also mit Namen vorstellen, war nichts als Pose. Sobald irgendwo in Inverness ein Medienvertreter die Schutzkappe von der Kameralinse nahm, tauchte Dalgliesh früher oder später dort auf, fletschte die schönsten Zähne, die man mit Geld kaufen konnte, und schlachtete jedes Thema, völlig egal, was es war, zu seinen Gunsten aus.
Der »Braune im Anzug«, diesen Spitznamen hatten ihm die Presseleute gegeben, die ihn gleichzeitig missbilligten und kultivierten. Er war für die Presse ein gefundenes Fressen. Wo immer er hinging, gab es gute Zitate und Soundbites zu ernten. Und da war er nun und zog auf Mo Burkes Demo seine Dalgliesh-Nummer ab. Mo war offensichtlich unglücklich über diese Entwicklung – vielleicht würde sie der Felsen werden, an dem er zerschellte.
Trotzdem hatte Rebecca den Stift gezückt.
»Ich möchte MrsBurke zunächst dafür danken, dass sie mir gestattet hat, ein paar Worte an euch zu richten.« Seine Stimme war laut und fest, aufgeraut von Jahrzehnten voller Zigaretten und teurem Whisky. Rebecca musste zugeben, dass es eine gute Stimme war. Kultiviert, ja, aber immer noch deutlich als schottisch erkennbar. »Ich lasse euch nicht lange in der Kälte rumstehen, versprochen.«
Hier und da war ein Lachen zu hören, und Dalgliesh lächelte seinem Publikum leutselig zu. Finbar war ihr Kumpel. Er war einer von den Jungs. Er rauchte. Er trank. Er sagte, was er dachte. Dass sein Anzug wahrscheinlich mehr gekostet hatte, als die meisten von ihnen im Monat verdienten, schien keinem seiner Unterstützer in den Sinn zu kommen.
Finbars Lächeln erstarb. Es war, als hätte jemand die Sonne ausgeknipst. »Ich bin dankbar für die Gelegenheit, heute mit euch über diese wirklich ernste Angelegenheit zu reden. Als man mich über die Pläne informiert hat, einen …« Er legte eine Pause ein, um das richtige Wort zu finden, und ließ diese Bemühung deutlich auf seinem Gesicht durchscheinen. Natürlich wieder nur Pose. Er wusste haargenau, was er sagen würde. Wenn Finbar Dalgliesh mit etwas keinerlei Mühe hatte, dann damit, seine Meinung zum Ausdruck zu bringen. Er stieß einen dramatischen Seufzer aus. »Freunde, ich will ganz ehrlich sein. Lasst uns offen darüber reden, womit wir es hier zu tun haben. Wir reden hier von einem Perversling. Von einem sexuellen Raubtier. Und da drin …« Er wandte sich mit einer eleganten Bewegung um und deutete auf das Verwaltungsgebäude wie ein Schauspieler auf der Bühne. »Da drin gibt es Leute, die wollen diesen bösartigen Menschen in eurer Mitte ansiedeln. Ihn zu eurem Nachbarn machen. Ihm ungehinderten Zugang zu euren Kindern geben.«
Vielstimmiges Murmeln ertönte aus der Menge. Selbst diejenigen, die den Mann nicht leiden konnten, waren in dieser Sache seiner Meinung.
»Nun, ich will euch eines sagen, liebe Freunde. Ich wohne zwar nicht in Inchferry, das stimmt, aber ich weiß, dass ihr alle wunderbare Menschen seid. Freundliche, warmherzige und liebevolle Leute. Und es tut mir in der Seele weh, dass eure Gemeinschaft zu einer …« Er deutete auf das Banner hinter Mo Burke. »Ja, genau, zu einer Müllhalde für solche Monster wird. Im Gefängnis haben sie ein Wort für solche Leute. Tiere nennen sie die da. Und das sind sie. Tiere. Kranke, verderbte Wesen, die sich auf die Verletzlichen und die Wehrlosen stürzen, die ihre widerliche Lust an den jungen, den leicht zu beeindruckenden Menschen stillen.«
Er legte eine Pause ein, um seine dramatischen Worte wirken zu lassen. Er beäugte die Menge, wartete auf den richtigen Augenblick, um weiterzusprechen, schätzte die Temperatur ab. In der Politik, genau wie in der Comedy, ist Timing alles; das wusste Dalgliesh. Als er nach ein paar Sekunden weiterredete, entfesselte er die ganze Schallkraft seiner rauchgeschwärzten Stimme.
»Nun, ich sage NEIN!«
Jubel brach aus. Rebecca konnte nicht erkennen, ob Scott damit angefangen hatte, doch zweifellos gelang es Finbar, die Leute auf seine Seite zu ziehen. Er bestätigte ihnen ihre Vorurteile, erzählte ihnen, was sie hören wollten – und es funktionierte.
»NEIN, sage ich«, wiederholte er. »Er hat ein paar Jahre im Gefängnis gesessen, wahrscheinlich nicht einmal lange. Ich frage euch: Ist das eine Strafe?«
Es folgten ein paar halbherzige negative Antworten. Finbar war die Reaktion offenkundig nicht begeistert genug.
»Ich frage euch noch mal: Ist das eine Strafe?«
Diesmal waren die »Nein«-Rufe lauter. Sogar Mo Burke nickte hinter Dalgliesh zustimmend. Sie hatte ihn vielleicht nicht eingeladen, aber er unterstrich ihr Argument.
»Nein, das ist keine Strafe«, sagte Finbar, nun zufriedener mit der Reaktion der Menge. »Und dieser Perversling kommt jetzt aus dem Gefängnis und erwartet, dass das System ihn verhätschelt. Ist das richtig so? Soll es so sein?«
Die entrüsteten »Nein«-Schreie wurden stärker. Er hatte die Leute überzeugt.
»Wir müssen denen da eine Botschaft senden, und zwar gleich hier, gleich jetzt. Wir müssen es diesen Abgeordneten und Beamten und Sozialarbeitern sagen: Wir lassen uns das nicht gefallen. Wenn die glauben, dass dieser Mensch, dieser Päderast …«
Oh, gutes Wort, dachte Rebecca. Es kann nie schaden, wenn man die Massen daran erinnert, dass man ein, zwei Bücher gelesen hat, und trotzdem noch den Mann aus dem Volk gibt. Das hier war Dalgliesh in Höchstform.
»Wenn die glauben, dass dieser Päderast eine zweite Chance verdient hat, warum nimmt ihn dann nicht einer von denen bei sich auf?«
Weiteres Nicken in der Menschenmenge, weitere gemurmelte Zustimmung mit »Aye« und »Stimmt«.
»Warum suchen die ihm nicht in ihrem Viertel, in ihrer Straße eine Wohnung?«
Jetzt fraßen sie ihm aus der Hand.
»Aber nein, das machen die nicht, oder? Die muten euch diesen Perversling zu. Genauso wie sie und ihre Befehlsgeber in Holyrood und Westminster euch alles andere zumuten. Die spüren den Schmerz nicht, den ihr spürt. Die verstehen nicht, unter welchem Druck ihr steht. Die haben keine Ahnung, wie das wahre Leben aussieht. Keiner von denen. Die sind in ihrer kleinen Blase gefangen und denken nur an ihren eigenen Vorteil. Die arbeiten nur zum Wohl der Partei und zu ihrem eigenen Nutzen. Nicht für das Gemeinwohl. Die tun rein gar nichts, was nur dem Wohl der Wähler dient. Die machen nur, was für sie und ihre Freunde gut ist.«
Er unterbrach sich, um das sacken zu lassen. »Nun, liebe Freunde, wir wollen denen eine klare Botschaft senden. Wir wollen sichergehen, dass sie diesmal wirklich eure Meinung anhören! Erhebt eure Stimme, laut und deutlich, und sagt es ihnen: keine Perversen hier. KEINE PERVERSEN HIER!«
Der Sprechgesang schwoll an, lauter als bei Mo, die dieselben Worte gewählt hatte. Mehr Fäuste wurden wie Ausrufezeichen in den grauen Himmel gereckt, und auch die selbst gebastelten Schilder wurden mit beträchtlich größerer Energie geschwenkt. Finbar Dalgliesh hatte gemacht, was er immer machte: Er hatte das Establishment angegriffen und die Menschenmenge zum Rasen gebracht. Die Polizisten, die Wache hielten, wirkten ein wenig beunruhigt.
Chaz Wymark kam auf Rebecca zugehumpelt, die Kamera um den Hals, die Tasche in der einen Hand, während die andere einen elegant aussehenden Stock aus dunklem, poliertem Holz hielt. Er brauchte den eigentlich nicht mehr – sie hatte ihn oft genug ohne das Ding herumhoppeln sehen, wenn er auf der Jagd nach den besten Bildern war. Sein Freund Alan pflegte zu sagen, dass er einfach nur gern damit posierte. »Er kommt sich dann wie ein Flaneur auf einem Boulevard vor«, sagte er. »Als lebte er im Paris der Jahrhundertwende. Ich überlege mir, ob ich ihm einen Zylinder kaufen soll.«
Rebecca starrte Chaz an und stellte sich vor, wie er mit einem Zylinder anstelle der schwarzen Wollmütze aussehen würde, die er sich über sein blondes Haar gezogen hatte. Er würde ihm durchaus stehen. Andererseits sah Chaz so blendend aus, dass ihm alles gut stand. Selbst das Hinken und der Spazierstock verliehen ihm eine geheimnisvolle Aura.
»Das ist ja plötzlich ganz schön aufregend geworden, was?« Er deutete mit dem Kopf in Richtung Mo und Finbar, die sich inzwischen zum Verwaltungsgebäude umgedreht hatten und nun gemeinsam den Schlachtruf anführten. »Was meinst du? Passiert hier noch was?«
Die Stimmung war hitzig, das stimmte, Dalglieshs Rede hatte die Leute aufgestachelt. Es sah jedoch eher so aus, als vollführten sie eine Art rituellen Tanz und es würde nichts Ernsteres daraus werden. Rebecca schüttelte den Kopf. »Nein, ich glaube, das ist nur heiße Luft.«
Chaz musterte die Menge, beurteilte sie seinerseits. »Ich glaube, da hast du recht. Nun, ich hoffe es jedenfalls. Ich würde nur höchst ungern was verpassen.«
»Musst du noch woandershin?«
»Das Büro hat gerade angerufen.« Chaz arbeitete freiberuflich für eine in Glasgow ansässige Nachrichtenagentur. Ein Vermögen verdiente er damit nicht gerade – in der modernen Medienwelt gab es kaum gut bezahlte Jobs –, aber es finanzierte ihm immerhin seine Gehstöcke. Und er konnte machen, was er liebte. »Wann ist deine Besprechung?«, fragte er.
»Halb zwölf«, antwortete sie, und ihr schwand der Mut bei dem Gedanken. Die Pfennigfuchser in London hatten wieder mal einen Neuen geschickt, der dafür sorgen sollte, dass an der nördlichen Grenze ihres Imperiums alles reibungslos lief. Und mit »reibungslos laufen« meinten die für gewöhnlich »Sparmaßnahmen finden«. Projektmanager nannte sich diese Person. Im Zeitungsgeschäft schien es keine Chefredakteure oder Redakteure mehr zu geben. Man hatte sie durch Projektmanager, Fachverantwortliche, Content Manager und Teamleiter ersetzt. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis Reporter zu Content Creators wurden. Großer Gott, dachte sie, Lord Rothermere und Lord Beaverbrook würden im Grab rotieren. Rechts herum, versteht sich.
Aus dem Funkeln in Chaz’ Augen wurde ein strahlendes Lächeln: Sie wusste, dass er nun versuchen würde, sie vom rechten Weg abzubringen. »Hast du Lust auf eine kleine Spritztour nach Culloden?«
Chaz fuhr nicht mehr gern Auto. Nachts überhaupt nicht mehr. Auch nicht bei Regen. So weit reichte sein Mut noch nicht wieder. Seit dem Unfall auf Stoirm vermied er es, sich ans Steuer zu setzen, obwohl er es konnte, wenn es sein musste. Er sorgte einfach nur dafür, dass es nie sein musste.
»Zum Schlachtfeld?«, fragte sie. »Was ist da los? Noch eine Demo wegen der Wohnsiedlung? Bisschen spät, oder?«
Die vom Highland Council und der schottischen Regierung genehmigten Pläne für den Bau von Wohnhäusern mit Blick auf die historische Stätte hatten ungeheure Leidenschaften entfesselt. Rebecca konnte es den Gegnern dieser Pläne nicht übel nehmen, denn die ganze Sache schien doch sehr gedankenlos zu sein.
»Nein, man hat dort eine Leiche gefunden.«
Rebecca runzelte die Stirn. »Meinst du damit eine aus jüngerer Zeit? Keine von siebzehnhundert und irgendwas …«
»Siebzehnhundertsechsundvierzig«, ergänzte Chaz. »Herrgott, ich bin nicht mal Schotte, und ich weiß mehr über eure Geschichte als du.«
»Ach, Geschichte ist ein Ding der Vergangenheit.« Rebecca verzog das Gesicht. »Also, diese Leiche – die glauben nicht, dass sie eines natürlichen Todes gestorben ist?«
»Genau«, bestätigte Chaz und verstärkte seinen Akzent, der trotz seiner englischen Abstammung durch und durch schottisch war. »Es hat einen Morrrrd gegeben.«
Rebecca zuckte zusammen. »Bitte rede nie wieder so.«
»Hast du Zeit, mit mir hinzufahren? Bis zu deiner Besprechung sollten wir wieder zurück sein. Da springt bestimmt auch für dich was raus.«
Culloden lag knappe sechs Meilen von Inverness entfernt, ein wenig abseits von einer Nebenstraße nach Nairn. Um diese Tageszeit kam man recht schnell dorthin. Rebecca schaute auf Mo und Dalgliesh und nagte nachdenklich an der Unterlippe. Sie wollte von einem oder gleich beiden ein Zitat bringen. Sie sollte eigentlich noch hierbleiben, um ein Interview mit Mo Burke zu führen, und nun könnte sie auch noch was von Dalgliesh erfahren. Und dann war da ihr Chefredakteur. Mit dem hatte sie noch immer Probleme, weil sie entgegen seiner ausdrücklichen Anweisung im Jahr zuvor auf die Insel Stoirm gefahren war. Klar, es waren ein paar Storys dabei herausgesprungen – sogar Exklusiv-Storys –, aber über das, was wirklich geschehen war, würde sie nie berichten können. Sie hatte Barry alles erzählt – na ja, beinahe alles –, doch er hielt sie noch an der kurzen Leine.
Rebecca warf noch einen Blick auf Mo, die weiterhin Schimpfkanonaden gegen die nicht in Erscheinung getretenen Volksvertreter losließ. Sie sah keineswegs so aus, als würde ihr in näherer Zukunft die Puste ausgehen, und schien sich inzwischen auch mit der Beteiligung des Spioraid-Anführers abgefunden zu haben. Es würde noch eine ganze Weile dauern, bis Rebecca sie erwischen könnte, vorausgesetzt Mo wollte überhaupt mit der Presse reden.
Rebecca seufzte. Ihr Atem stand als Wolke in der kalten Luft zwischen ihnen. »Scheiße, du weißt, dass ich nicht Nein sagen kann.«
Er lächelte wieder. »So was sieht man sonst nur auf Toilettenwände gekritzelt.«
Sie erwiderte mit gespielter Wut: »Ja, gleich neben deinem Namen!«
Als sie sich von der Demonstration entfernten, riskierte Rebecca noch einen Blick auf Nolan Burke, doch dessen Augen waren wieder fest auf seine Mutter gerichtet.
3
Schon bei Sonnenschein war Culloden Moor für Rebecca ein trostloser Ort, doch an diesem kalten Montagmorgen, als Graupeln den grauen Himmel wie Pockennarben übersäten und die Luft einem eisigen, nassen Kuss glich, war es sogar noch unwirtlicher.
Das Schlachtfeld selbst war wenig spektakulär, kaum mehr als ein zerfurchtes, mit Heidekraut bewachsenes Areal. Es war von Pfaden durchschnitten, auf denen die Touristen über ein Terrain spazieren konnten, das so anmutete, als sei die Erde noch von dem vor über dreihundert Jahren vergossenen Blut getränkt. Die Stille an diesem Ort hatte Rebecca schon immer fasziniert; sie spürte sie auch heute, trotz all der Geschäftigkeit, die mit der Mordermittlung einherging. Sie hatte dieses Schlachtfeld als Kind zum ersten Mal besucht. Das war an einem strahlenden Sommertag gewesen, und damals war das Moor von Besuchern übersät gewesen, die auf die Gedenksteine an der Avenue of the Clans starrten und zwischen den vor dem kobaltblauen Himmel flatternden blauen und roten Fähnchen herumliefen. Ihr Vater hatte ihr von der Geschichte des Geländes erzählt, aber sie hatte nicht viel davon aufgenommen. Sie war acht Jahre alt gewesen, und Erzählungen von Rebellion und Thronfolge hatten sie kaum interessiert. Doch dann hatte ihr Vater sie gebeten, stehen zu bleiben und zu lauschen, und das hatte sie getan. Irgendwo in der Ferne hatten Vögel gesungen, und eine leichte Brise hatte im hohen Gras und im Heidekraut gestöhnt, als sehnte sie sich nach einem längst verstorbenen Geliebten. Aber sonst war da nichts gewesen. Die Stimmen der Touristen waren gedämpft gewesen. Sogar das Geschrei zweier kleinerer Kinder, die einander über die Weg jagten, war ihr seltsam unterdrückt vorgekommen. Ein Auto, das auf der Straße vorbeiglitt, hatte die lautlose Atmosphäre kaum gekräuselt.
Das geht mir immer wieder an die Nieren, hatte ihr Vater gesagt, diese Stille.
Jetzt erinnerte sie sich daran, wie er neben ihr gestanden und sich mit zusammengekniffenen Augen umgeschaut hatte, als könnte er die Nachwehen der Schlacht noch sehen: die Highlander, tot oder sterbend, die Sieger, die zwischen ihnen umhergingen und sie hinrichteten. Und das Blut, immer das Blut.
Vielleicht bilde ich mir das alles nur ein, hatte er gesagt, und ein Lachen war ihm in der Kehle hochgestiegen. Vielleicht schlägt hier meine keltische Erziehung durch. Aber dieser Ort geht mir jedes Mal an die Nieren. Diese Stille. Hier und in Glencoe, das ist beide Male dasselbe. Es sind diese leisen Orte. Spürst du das, Becks?
Sie hatte genickt, und das schien ihn zu freuen. Sie hatte es John Connolly immer recht machen wollen, zumindest damals noch. Das hatte sich natürlich geändert, als im Teenageralter die Hormone ihre Wirkung zeigten. Sie war nicht gerade wild gewesen, aber sie hatte ihren Eltern mehr Ärger als nötig gemacht. Jedenfalls hatten sie das alles überstanden, wie es Familien meistens tun.
Doch dann war er gestorben. Zu jung. Zu früh. Krebs, die Krankheit, über die man nur im Flüsterton spricht, als könnte die bloße Erwähnung unerwünschte Aufmerksamkeit auf den Sprechenden lenken. Hier würde sich diese Krankheit heimisch fühlen, an diesem Ort des Todes, wo alle Stimmen gesenkt und die Laute der Natur gedämpft sind.
Die leisen Orte, so hatte ihr Vater sie genannt. Rebecca hatte einmal gehört, dass jemand sie ganz anders beschrieb: Ein Kriminalschriftsteller, den sie interviewte, als er in Inverness Werbung für sein neuestes Buch machte.
Durchscheinende Orte.
Orte, an denen der Schleier zwischen dieser und der nächsten Welt fragil, beinahe durchsichtig ist, wo die Vergangenheit Schulter an Schulter mit der Gegenwart lebt. Durchscheinende Orte, an denen einige von uns mehr spüren, als man sehen, berühren oder schmecken kann. Auf Stoirm nennen sie diese Leute fey. Rebecca war sich nicht sicher, ob sie an derlei glaubte, doch bei jedem Besuch in Culloden oder Glencoe spürte sie tatsächlich einen Hauch von Jenseits, genau wie es ihr Vater erlebt hatte. Oder vielleicht bildete sie sich das nur ein, wie er auch angemerkt hatte. Vielleicht wollte sie, dass diese Orte sich wegen ihrer blutigen Geschichte und ihrer grausamen Tragödien anders anfühlten.
Die Polizei hatte den Eingang zum Schlachtfeld und die Hälfte der schmalen Straße abgesperrt. Dort winkte ein Polizist in Uniform den Verkehr abwechselnd in beide Richtungen durch. Rebecca brachte ihren Wagen so nah wie möglich an der Absperrung zum Stehen, sodass Chaz und sie am Straßenrand entlang zu der Stelle gehen konnten, wo zwei Polizeibeamte eine kleine Ansammlung von Gaffern zurückhielten, die fast alle ihre Telefone gezückt hatten und fröhlich Schnappschüsse machten. Die vorbeifahrenden Autos bremsten ein wenig ab, und einige der Insassen hatten die Gesichter zu der Stelle im Moor gewandt, wo man hinter bereits gelb blühenden Ginsterbüschen ein Zelt aufgeschlagen hatte. Helles Licht schimmerte durch den Stoff hindurch, und dunkle Schatten bewegten sich hin und her. Tatortspezialisten und Polizeibeamte gingen ein und aus, alle in Einwegoveralls gehüllt. Haare, Füße und Hände in Schutzkleidung, die nicht etwa die Elemente draußen, sondern mögliche Kontaminierung drinnen halten sollte. Hinter ihnen stieg das Moorland leicht an. Ein wenig weiter bergauf konnte Rebecca gerade eben den obersten Teil des Besucherzentrums erkennen. Am Straßenrand entdeckte sie ein, zwei Profifotografen und ein Fernsehteam der BBC. Dort sprach die hübsche, dunkelhaarige, winzig kleine Reporterin ihren Text in die Kamera. Hinter ihr war durch eine Lücke in der Ginsterhecke gerade eben das Zelt auszumachen. Der Kameramann, ein beinahe glatzköpfiger alter Hase mit einem langen weißen Bart, bat die Journalistin, ein wenig nach rechts zu treten, damit er mehr von den Polizeiaktivitäten ins Bild bekam. Sie folgte seinen Anweisungen. Optische Eindrücke waren auf dem Bildschirm genauso wichtig wie die gesprochene Information.
Chaz hatte ein langes Objektiv herausgesucht und fotografierte eifrig eine Reihe von Polizeibeamten in wasserdichter Kleidung, die weit über das Moorland ausgeschwärmt waren, um im Heidekraut nach Spuren zu suchen. Sie bewegten sich langsam, zeichneten sich scharf vor dem matten Horizont ab. Der Boden zwischen ihnen war dank des nächtlichen Schneefalls eine Flickendecke aus Weiß und Braun. Mit gesenkten Augen und langen Stöcken in den Händen suchten sie das Gestrüpp ab. Rebecca wusste sofort, dass dieses Bild am Morgen auf vielen Titelseiten auftauchen würde.
»Das ist die Dingsda von der BBC«, sagte Chaz, während er den Auslöser drückte.
»Lola McLeod«, erwiderte Rebecca.
»Lola? Meinst du, das hat sie sich ausgedacht?«
Rebecca hatte keine Ahnung. »Sie war mal ein Showgirl im Copacabana.« Sie wartete darauf, dass er lachen würde, aber er warf ihr nur einen verwirrten Blick zu. »Sag bloß, du kennst den Song von Barry Manilow nicht.«
»Was? Bloß weil ich schwul bin, soll ich alle Songs von Barry Manilow kennen?«
»Nein.«
»Soll ich alle Show-Nummern auswendig mitsingen können, willst du das etwa andeuten?«
»Nein, ich …«
»Und ich soll Judy Garland vergöttern, stimmt’s?«
Sie begriff, dass er sie aufzog. »Mistkerl«, sagte sie, und er lachte.
Sie erkannte einen der diensthabenden Beamten, einen jungen Polizisten, den sie schon bei Gericht und an anderen Tatorten gesehen und als halbwegs ansprechbar in Erinnerung hatte. Er betrachtete das Nachrichtenteam mit einigem Interesse, anscheinend vom Zauber des Fernsehens fasziniert. Die Reporterin hatte sich versprochen und lachte über ihren Fehler. Rebecca hörte, wie sie sich entschuldigte. Der Kameramann nickte nur und erwiderte ihr, die Kamera laufe noch. Sie wurde schlagartig wieder ernst, als hätte man einen Schalter umgelegt.
»Ganz schön kalt hier«, sagte Rebecca und folgte dem Blick des Polizisten.
»Aye«, erwiderte er.
Sie lauschte mit einem Ohr auf die Worte der BBC-Reporterin. Noch keine Einzelheiten verlautbart. Polizei wortkarg. Leiche kurz vor neun gefunden, nachdem sich der Morgennebel gehoben hatte.
Rebecca fragte: »Ich vermute, Sie können mir nichts Näheres über diese Sache sagen?«
Seine Augen wanderten von Lola und ihrem südländischen Aussehen zu Rebecca. Sie merkte, dass er sie wiedererkannte. »Da vermuten Sie richtig.«
Sie nickte. Sie hatte nichts anderes erwartet, aber Gott liebt einen jeden, der sich ernsthaft bemüht, wie man so sagt. »Wissen Sie, ob eine Pressekonferenz geplant ist?«
»Keine Ahnung. Da müssen Sie die Presseabteilung fragen. Oder die Chefin.«
»Wer leitet den KED?«
KED. Sie hatte immer das Gefühl, in Line of Duty mitzuspielen, wenn sie solche Abkürzungen benutzte, aber Chef vom Kriminal- und Ermittlungsdienst war ja auch ein schlimmes Bandwurmwort.
»Detective Chief Inspector Valerie Roach«, antwortete der Beamte.
Der Name sagte Rebecca nichts. »Ist sie neu?«
Er neigte leicht den Kopf. »Von Perth raufgekommen. Weiß genau, was sie tut, sagt man, aber ich habe sie selbst noch nicht kennengelernt.«
Rebecca warf einen gründlichen Blick auf die Szene auf dem Moor. Heute würde sie nicht einmal in die Nähe des Fundorts kommen, und das wollte sie auch nicht. Ihr Vater hatte in seiner Berufslaufbahn in vielen Mordfällen ermittelt und ihr stets gesagt, dass die Presse Hilfe und Hindernis sein konnte. Er hatte einmal selbst einen jungen Reporter verhaftet, der sich für Woodward und Bernstein in einer Person hielt und es geschafft hatte, sich unbemerkt an einen Tatort zu schleichen.
Werde nie so wie der, hatte er zu ihr gesagt. Schau, dass du an die Wahrheit herankommst, wenn du kannst, aber komm uns dabei nicht in die Quere.
An die Wahrheit herankommen – wenn sie konnte. Sie hatte herausgefunden, wie schwierig das war. Die Wahrheit kann ein schlüpfriges Geschöpf mit vielen Gesichtern sein. Für einen Rechtsanwalt ist Wahrheit das, was er vor Gericht beweisen kann. Für einen Polizisten ist sie alles, was zu einer Verurteilung führt. Für die Journalistin ist sie, was immer die Story gut verkauft. Und noch ein paar weitere dazu, wenn es sein muss. Und für Politiker ist sie etwas, das man um jeden Preis vermeiden muss. Rebeccas Gedanken wanderten wieder zu Finbar Dalgliesh, wie er zu der Menschenmenge sprach.
Sie schaute auf die Uhr und merkte, dass ihr die Zeit davonlief, wenn sie noch rechtzeitig zu ihrer Besprechung in Inverness sein wollte. Sie hatte zwar ein wenig Atmosphäre eingefangen – das Zelt, die Geschäftigkeit vor Ort, die Kette von Suchenden im Moor –, aber ihr war klar, dass sie hier nicht viel mehr herausfinden würde. Also trat sie von dem Polizeibeamten weg. Nach einem Blick auf Chaz, der gerade die Straße überquerte, um einen anderen Blickwinkel zu bekommen, zog sie ihr Telefon heraus. Sie schaute die neuesten Meldungen durch und suchte nach einer Erwähnung der Leiche, die man in Culloden gefunden hatte. Doch noch beschäftigten sich die Hauptschlagzeilen mit New Dawn, einer höchst undurchsichtigen Vereinigung, gegen die MI5 vergleichsweise geschwätzig wirkte. Diese Gruppierung hatte verdächtige Päckchen an die Adressen der wichtigsten Politiker in Holyrood und Westminster geschickt. Im Augenblick wusste noch niemand, ob sie Bomben oder gefährliche Substanzen enthielten. Erneut musste Rebecca an Dalgliesh denken, denn man munkelte, dass New Dawn im Grunde der paramilitärische Zweig von Spioraid war. Dalgliesh brachte es fertig, diese Gerüchte zurückzuweisen, ohne die Aktivitäten dieser Gruppe zu verurteilen.
Bisher hatte nur die BBC über den Mord berichtet, was Rebecca nicht überraschte. Die anderen würden jedoch nicht mehr lange auf sich warten lassen, New Dawn hin oder her. Wenn Rebecca in dieser Sache am Ball bleiben wollte, brauchte sie Infos, die sie und nur sie allein hatte. Sie scrollte ihre Kontaktliste durch und fand die richtige Telefonnummer. Beim dritten Klingeln wurde der Anruf angenommen.
»Bill, ich möchte Sie um einen Gefallen bitten«, sagte sie.
Am anderen Ende war ein Grunzen zu vernehmen. »Überrascht mich nicht. Aber nicht einmal ein ›Hallo‹ oder ein ›Wie geht’s?‹ Und ich dachte, ich wäre der knurrige Mistkerl.«
Sie lächelte. Bei ihrer ersten Begegnung hatte sie den ehemaligen Detective Sergeant Bill Sawyer nicht sonderlich gut leiden können. Sie hatte ihn nicht nur für einen Frauenfeind, sondern auch für einen korrupten Polizisten gehalten. Er hatte tatsächlich nicht besonders viel für Frauen übrig, für Männer allerdings auch nicht, behandelte also alle gleich schlecht. Rebecca hatte sich an sein Macho-Gehabe gewöhnt, nahm es sogar hin. Schließlich ist Gottes Garten groß. Auf Stoirm waren sie in entgegengesetzten Lagern gewesen, hatten sich seither aber schätzen gelernt. Es war erstaunlich, wie sehr die Tatsache, dass ein paar sehr unangenehme Zeitgenossen sie beide mit Misstrauen beäugten, Rebecca und Sawyer zusammengebracht hatte.
»Hallo, wie geht’s?«, fragte sie nun und lächelte vor sich hin.
»Das Bein tut weh, danke der Nachfrage. Das verdammte Wetter bekommt ihm gar nicht.«
Bill Sawyer hatte sich das Bein gebrochen, nachdem jemand ihn auf Stoirm von einem zu schnell fahrenden Auto abgeschüttelt hatte. Seither waren seine Bergwanderungen sehr eingeschränkt. Am selben Tag hatte auch Chaz seinen Unfall gehabt. In dem kleinen Inselkrankenhaus hatte für kurze Zeit ziemlicher Hochbetrieb geherrscht.
»Sie wissen schon, dass das zum größten Teil eine Kopfsache ist, oder?«
»Nein – ich weiß, dass es zum größten Teil mein Bein ist, Sie Klugscheißerin«, erwiderte er. »Und übrigens, so schmieren Sie mir nicht gerade Brei ums Maul, von wegen Gefallen.«
»Aber Bill, ich dachte, über das Brei-ums-Maul-Schmieren wären wir längst hinaus, Sie und ich.«
Sie hörte, wie er kurz auflachte. »Ich glaube nicht, dass wir dieses Stadium je erreicht haben, Schätzchen. Was haben Sie auf dem Herzen?«
»In Culloden ist eine Leiche gefunden worden.«
»Auf dem Schlachtfeld?«
»Nein, auf dem Kinderspielplatz. Natürlich auf dem Schlachtfeld.«
»Nun, da gibt’s ja auch noch das Dorf. Und ein Luxushotel. Ganz zu schweigen vom Moor selbst. Ich wollte nur, dass Sie präzise Angaben machen, mehr nicht. Ich dachte immer, es wäre die Aufgabe von Journalisten, detailgenau zu berichten …«
»Ja, ja. Ich brauche Infos dazu.«
»Und was soll ich Ihrer Meinung nach tun?«
Dieses Tänzchen hatten sie schon früher miteinander gemacht. Sie brauchte seine Hilfe, und er zierte sich. Sie sprach mit ruhiger Stimme weiter, hatte aber innerlich die Zähne zusammengebissen. Er konnte so verflixt irritierend sein.
»Vielleicht könnten Sie einmal schauen, was Ihre alten Kumpel Ihnen dazu zu sagen haben. Irgendwas, das die großen Zeitungen nicht wissen.«
Sie brauchte Exklusivinformationen – nur ein kleines Detail –, die sie online veröffentlichen konnte und die hoffentlich die Leute dazu bringen würden, am Ende der Woche den Chronicle zu kaufen. Früher hatten das Fernsehen, das Radio und die Tageszeitungen einen Vorteil gegenüber den Wochenblättern gehabt, weil sie unmittelbarer berichteten, doch das Internet hatte das alles ausgeglichen. Jetzt konnte sie eine Story vor den anderen lancieren, oder zumindest gleichzeitig. Sie brauchte nur eine einzigartige Meldung.
»Ist es Mord, Becca?«, fragte er.
»Das würde ich ja gern wissen. Bisher hat die Polizei nichts verlauten lassen, aber es ist ganz schön viel los hier. Die Chefin der Ermittlung ist eine gewisse DCI Roach. Sie ist neu in Inverness.«
Sawyer schwieg, versuchte den Namen einzuordnen. »Val Roach? Eine DCI aus Perth? Groß und schlank, kurze, dunkle Haare?«
Rebecca konnte weder Körperbau noch Frisur bestätigen, aber die anderen Angaben passten. »Sie kennen sie?«
»Nie gehört«, antwortete er lachend.
Hat einen Clown gefrühstückt, dachte Rebecca. »Sie meinen also, Sie könnten mir Infos beschaffen?«
»Aye, aber warum sollte ich das tun?«
Das war Teil ihres Tänzchens. »Wegen der guten alten Zeiten?«
»Unsere ›guten alten Zeiten‹ waren im vergangenen Herbst, Schätzchen. Das macht uns ja wohl kaum zu besten Freunden für alle Ewigkeit.«
»Bill, Sie wissen doch auch, dass Sie’s tun werden.«
»Ach ja? Und was macht Sie da so sicher?«
»Dass Sie mich mögen. Dass die Storys, die ich über die Sache in Stoirm geschrieben habe, Ihrem Ruf genutzt haben …«
Jahre zuvor war Sawyer, als er noch im Polizeidienst war, unter Verdacht geraten, er habe ein Geständnis gefälscht. Die Zweifel, die die Verteidigung an dem Schuldgeständnis äußerte, hatten dazu geführt, dass ein Mann in einem Mordverfahren aus Mangel an Beweisen freigesprochen wurde. Ein solches »Bastard-Urteil«, wie es häufig genannt wurde, war irgendwo im Schattenbereich zwischen schuldig und nicht schuldig angesiedelt. Manche meinen, dass die Geschworenen so dem Angeklagten mitteilen, dass sie ihn für den Täter halten, es aber nicht genügend Beweise dafür gebe. Andere verweisen darauf, ein solches Urteil sei ein Überbleibsel aus dem alten schottischen Rechtssystem, in dem man eine Anklage entweder für bewiesen oder für nicht bewiesen hielt und bei dem es nicht um die Unterscheidung zwischen schuldig und unschuldig ging. Rebeccas Story über die Geschehnisse auf Stoirm hatte angedeutet, dass der Mann doch für den Mord verantwortlich war. Sie hatte jedoch nicht die ganze Wahrheit über die Ereignisse des vergangenen Herbstes berichten können; das wussten sie beide, sie und Bill Sawyer. Ganz sicher waren Schuldige ungeschoren davongekommen. Manche Geheimnisse der Insel blieben eben ungelöst.
»Mein Ruf interessiert mich nicht die Bohne, das wissen Sie doch. Ich habe meine Rente und arbeite nebenher noch ein bisschen, also kann mir die Polizei gestohlen bleiben.«
Ihr war klar, dass das nur heiße Luft war. Das bisschen Arbeit nebenher war oft genug Ermittlertätigkeit – ab und zu verdiente er sich auch bei Elspeth ein paar Pfund –, und Rebecca wusste, dass ihre Storys Sawyer da geholfen hatten. »Aber Sie beschaffen mir trotzdem Infos, nicht wahr?«
Er seufzte. »Ich stelle ein paar Fragen, mehr kann ich nicht machen. Aber Sie kriegen von mir nichts, was die Ermittlung behindern könnte, klar?«
»Klar. Absolut.«
»Und Sie kriegen auch nichts, was nur aus einer einzigen Quelle stammen könnte. Ich habe nur noch einige wenige Kumpel bei der Polizei, und die will ich nicht in irgendeiner Weise kompromittieren. Klar?«
»Natürlich.«
Es trat eine Pause ein, in der er wohl seine Bedingungen überdachte. »Okay, gut. Überlassen Sie das mir. Aber dann schulden Sie mir einen Drink. Einen großen. Vielleicht sogar ein Essen.«
»Zweifellos. Ein Slush und ein Happy Meal sind bereits bestellt«, sagte sie und hörte ihn aufstöhnen. »Wofür halten Sie mich? Bin ich etwa The Sun?«
4
Während sie in Richtung Inverness fuhren, schickte Chaz bereits seine Fotos über den Laptop an die Bildagentur in Glasgow, ein wahres Wunder der Technik. Rebecca bemerkte seine regelmäßigen Blicke in den Seitenspiegel, wie flüchtig sie auch waren, kommentierte sie aber nicht. Er war sich nicht bewusst, dass er es tat, aber ihr war klar, dass ein Teil von ihm immer noch Ausschau nach einem Fahrzeug hielt, das er nie wiedersehen würde. Sie setzte ihn bei der Wohnung ab, die er zusammen mit Alan in der Nähe ihrer eigenen gemietet hatte, und fuhr dann so schnell, wie es die Geschwindigkeitsbegrenzung und der Verkehr erlaubten, zum Redaktionsbüro des Chronicle. Jahrzehntelang war das Hauptquartier der Zeitung ein zweistöckiges braunes Sandsteingebäude mit Blick auf den River Ness gewesen. Nach der Schließung der Druckerei wegen der Vergabe des Zeitungsdrucks an Außenstehende – womit die Drucker der Zeitung genauso in der Versenkung verschwanden wie vorher die Schriftsetzer und die Metteure und die Dinosaurier –, war man zu dem Schluss gekommen, diese Räumlichkeiten seien finanziell nicht mehr tragbar. Alle Reporter und Büromitarbeiter hatte man in ein Gewerbegebiet umgesiedelt. Ein Konkurrenzblatt hatte seine Geschäftsräume auch in der Nähe, aber das war heutzutage nicht mehr von Bedeutung, da kaum noch Leser – oder ›Endverbraucher‹, wie einer der zu Gast weilenden Superexperten sie nannte – den Weg in die Redaktion fanden. Rebecca hatte nie an der alten Adresse gearbeitet, wusste also nicht, wie geschäftig es damals dort zugegangen war, hatte nie die gespannte Atmosphäre erlebt, wenn die Pressen anliefen oder wenn man das erste gedruckte Exemplar in den Händen hielt. Elspeth hatte ihr einmal erzählt, dass früher ein stetiger Strom von Leuten zur Tür hereinkam, die über Storys reden oder Kleinanzeigen aufgeben wollten. Aber die Zahlenjongleure im Süden hatten entschieden, dass es nicht genügend Laufkundschaft gab, um die Betriebskosten für die damals bereits fast völlig verlassenen Geschäftsräume im Stadtzentrum zu rechtfertigen. Elspeth sagte, sie habe stets gegen den Umzug gekämpft, aber eigentlich immer gewusst, dass sie auf verlorenem Posten stand. Zumindest war der Chronicle noch in Inverness – bei der gleichen Umzugsaktion hatte man die Schwesterzeitungen aus Elgin und Grantown aus ihren Gemeinden gerissen und auch in den neuen Räumen angesiedelt.
Rebecca stieg die Treppen zu dem riesigen Großraumbüro hinauf. Zu ihrer Erleichterung hatte die Besprechung noch nicht angefangen. Es würde also in nächster Zukunft keinen Anpfiff von Barry geben. Die Reporterteams und die beiden »Content Manager« standen bereits am anderen Ende des Raums zusammen, wo Rebecca einen großen, eigens aufgestellten Flachbildfernseher ausmachen konnte. Da die Tür zu Barrys Büro geschlossen war, vermutete sie, dass er mit dem neuen Wunderheiler dort drinnen war. Hinter sich konnte sie hören, wie die Leute aus der Anzeigenabteilung die Treppe heraufkamen. Sie zog ihren Mantel aus, hängte ihn an den Garderobenständer hinter der Tür und ging zu den anderen Mitarbeitern.
»Was gibt’s bisher?«, fragte sie Hugh Jamieson, den ältesten Reporter im Team. Er war groß und klapperdürr und arbeitete seit den Achtzigerjahren bei der Zeitung aus Grantown.
»Barry ist jetzt schon eine halbe Stunde mit dem Typen in seinem Büro«, antwortete er. »Es sickert bisher kein Blut unter der Tür durch, das wollen wir mal als gutes Zeichen werten.«
»Wir kriegen einen Projektmanager. Das ist nie ein gutes Zeichen.«
»Da hast du recht«, meinte Hugh.
Rebecca starrte auf den dunklen Fernsehschirm. »Schauen wir uns einen Film an?«
Hugh verzog die Lippen zu einem grimmigen dünnen Lächeln. »Ich vermute eher, es wird eine Botschaft von Big Brother. Und damit meine ich nicht den aus dem Container.«
»Wie ist er denn so, der Neue?«
Hugh zuckte mit den Achseln. »Hab ihn noch nicht gesehen. Ich war gerade hinter dem Haus, um eine zu rauchen, als er angekommen ist.« Wegen der Nichtraucherbestimmungen mussten die Mitarbeiter, die noch den Glimmstängeln verfallen waren, nach draußen gehen. »Als ich zurückkam, stand der Fernseher hier, und die Bürotür war zu.«
Just in diesem Moment ging die Bürotür auf, und Barry erschien, wie üblich in Jeanshemd und -hose, dicht gefolgt von einem jungen Mann mit frischem Gesicht, der einen schicken Anzug trug und einen Laptop unter dem Arm hatte. Seine Haut war zart gebräunt, was jedoch die Spuren einer jugendlichen Akne nicht übertönen konnte. Sein Haar war hervorragend geschnitten, und Rebecca war sicher, dass seine Fingernägel ebenso hervorragend manikürt sein würden, wenn sie denn einen genaueren Blick erhaschen könnte. All das ließ den jungen Mann sehr geschäftsmäßig erscheinen, trotzdem sah er wie fünfzehn aus.
»Großer Gott«, flüsterte Hugh. »Hat seine Mami ihm eine Entschuldigung geschrieben, dass er heute in der Schule fehlen darf?«
Barry warf ihnen allen einen Blick zu, nickte zu Rebecca hin, um ihr anzudeuten, wie erfreut er war, sie hier zu sehen, und setzte sich dann auf die Kante des am weitesten entfernten Tischs. Der Neue würde also die Besprechung leiten. Irgendwie hatte sie das Gefühl, dass es nichts Gutes verheißen konnte, wenn Barry – der Chefredakteur aller Zeitungen in Nordschottland – so beiseitegeschoben wurde.
Der junge Mann steckte ein mit dem Fernseher verbundenes Kabel in seinen Laptop, den er mit dem Bildschirm zu sich auf den nächsten Tisch stellte.
Er hat eine PowerPoint-Präsentation, begriff Rebecca. Gott steh uns bei.
Er schaute sich kurz um und sprach dann. Sein Akzent war aus London, mit gerade so viel East End darin, um zu zeigen, dass er einer von den Jungs war. »Hallo miteinander, und danke, dass Sie heute alle gekommen sind.«
Als hätten wir die Wahl gehabt, dachte Rebecca.
»Ich heiße Les Morgan, und das Stammhaus in London hat mich hergeschickt, damit ich Ihnen allen helfend unter die Arme greife. Sie glauben vielleicht, dass das nicht nötig ist, aber wie Sie alle nur zu gut wissen, haben wir mit den Auflagen schwer zu kämpfen. Die Zeitungsindustrie steht vor der größten Herausforderung aller Zeiten. Tatsächlich habe ich während meiner ganzen Zeit in den Medien noch nie dergleichen erlebt.«
Rebecca hörte Hugh leise schnauben.
»Die Verkaufszahlen sind gesunken, die Einkünfte sind gesunken, und wir müssen Methoden finden, um sie zumindest abzufedern, wenn nicht gar für eine Steigerung zu sorgen. Ihre Jobs, all unsere Jobs hängen davon ab. Wir müssen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass diese großartigen alten Blätter noch viele Jahre den Menschen im Norden Schottlands und in den Highlands Nachrichten bringen, online und in der Printausgabe.«
Er legte eine Pause ein – seine Rede klang allmählich wie eine Pressemitteilung – und schaute zu Barry. Das Gesicht des Chefredakteurs war gelassen, aber er fuhr sich mit den Fingern durchs Haar, ein Zeichen dafür, dass er auf wackligem Boden stand. Das war auch kein gutes Omen. Rebecca bemerkte zum ersten Mal, dass Barry beim Frisör gewesen war. Am Vortag hatte er das Haar noch wie üblich vorne kurz und hinten lang getragen, doch nun war es insgesamt kürzer, wenn auch immer noch nicht modisch geschnitten. Er hatte Anstrengungen unternommen, um sich herauszuputzen. Irgendwas lag eindeutig in der Luft.
»Jetzt kommt’s«, flüsterte Hugh, als Les Morgan tief Luft holte.
5
DCI Val Roach starrte auf die Leiche im Heidekraut und wünschte sich, sie hätte eine Tasse Kaffee in der Hand. Sie hatte es sich angewöhnt, jeden Morgen, ehe sie das Haus verließ, einen ordentlichen Kaffee zu kochen und in eine Thermosflasche abzufüllen, um ihn bei der Arbeit zu trinken. Mit der Plörre, die man ihrer Erfahrung nach auf Polizeirevieren angeboten bekam, wollte sie ihr System lieber nicht verpesten, schönen Dank auch. Sie lechzte nach einem Koffeinschub, aber auf gar keinen Fall konnte sie ihre Thermosflasche an einen Tatort mitbringen. Sie erinnerte sich daran, dass sie als Kind im Fernsehen Columbo an einem Tatort herumlatschen, seine Zigarren rauchen und überall Asche verstreuen gesehen hatte. Oder Eierschalen, wenn man ihn frühmorgens rausgerufen hatte. Aber das war Fiktion gewesen, dies hier war die Wirklichkeit. Die Naturwissenschaften hatten inzwischen die Mordermittlungen erobert. Ein pensionierter Kriminalbeamter hatte ihr einmal erzählt, dass man in den Sechzigerjahren bei einem berüchtigten Mordfall Rekrutengruppen zum Tatort gebracht hatte, um ihnen die Leiche an Ort und Stelle zu zeigen, und alle – Detectives, uniformierte Polizisten, sogar Polizeianwärter – waren mit ihren Riesenschuhen am Tatort herumgetrampelt, hatten Beweismittel kontaminiert und Stiefelabdrücke in Größe 45 und Gott weiß was sonst noch hinterlassen. Die DNA-Analyse hatte das alles geändert. Über Kontaktspuren – die bloße Vorstellung, dass jeder entweder etwas von sich an einem Ort hinterließ oder etwas von dort mitnahm – wusste man nun seit Jahrzehnten Bescheid. Doch erst nachdem die Leute begriffen hatten, dass die Genetik ihre Fingerabdrücke überall hinterließ, hatten die Nerds endgültig die Oberhand gewonnen. Die DNA einer Person kann anscheinend in einem Radius von 5Metern herumfliegen, daher die Ganzkörperschutzanzüge: Damit ja kein zufälliges Härchen oder Hautschüppchen von den Ermittlern wegfliegt und alles durcheinanderbringt.
Sie brauchte jetzt wirklich dringend Koffein.
Ob sie vielleicht ein Koffeinproblem hatte? Steckte sie in den Fängen der Koffeinsucht? Sollte sie einen kalten Entzug riskieren? Oder – schlimmer noch – irgendeine grüne Flüssigkeit trinken, die wie das Kochwasser von Rosenkohl schmeckte?
Sie verbannte diesen Gedanken. Sie wusste, was ihr Unterbewusstsein da machte: Es kompensierte den Ort, an dem sie stand, und das, was sie da anschaute. Sie war nun seit zwanzig Jahren bei der Polizei und hatte den Tod in vielerlei Form zu Gesicht bekommen: friedlich, gewaltsam, jung, alt, vorzeitig, überfällig. Sie hatte Blut und Hirn und Körperflüssigkeiten und Kot gesehen, verschmiert, vergossen und verspritzt. Als Streifenpolizistin hatte sie einmal in einer Toilettenkabine die Leiche einer Drogensüchtigen gefunden, die beim Entleeren ihres Darms an einer Überdosis gestorben war und die Spritze noch im Arm stecken hatte. Ein andermal hatte sie einen Kopf aus einem Abwassergraben gefischt, nachdem ein Motorradfahrer in einen Lastwagen geschleudert war. Sie hatte mit Mühe einen Säugling aus den Armen einer Frau gelöst, die noch mit dem Kind redete, es noch wiegte, obwohl es schon über eine Woche tot war.
Diese Begebenheiten waren traurig. Sie waren schrecklich.
Aber das hier?
Das hier war beides, aber auch einfach schauerlich.
Jemand zog von außen den Reißverschluss des Schutzzeltes auf, und Detective Sergeant Paul Bremner duckte sich durch die Öffnung herein. Er war ähnlich wie sie in einen Einwegschutzanzug gehüllt, hatte eine Maske vor Mund und Nase und eine Schutzhaube auf dem Kopf, obgleich es unwahrscheinlich war, dass er Haare am Tatort hinterlassen würde. Er war nämlich kahl wie eine Kegelkugel, was ihm den Spitznamen Yul Bremner eingebracht hatte. Den hatten ihm die älteren Kollegen verpasst, die Die glorreichen Sieben