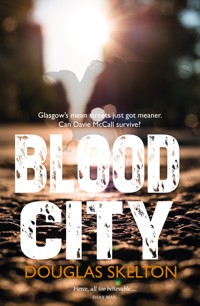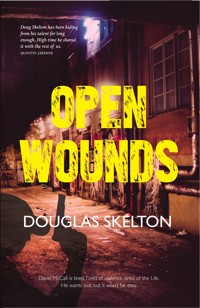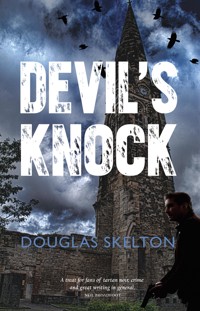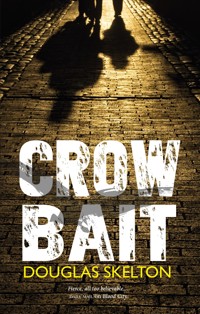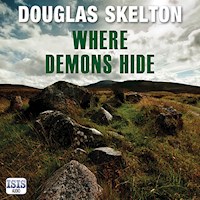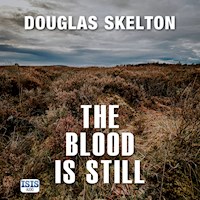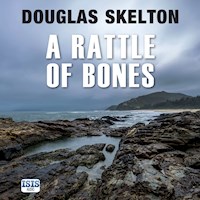8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Rebecca-Connolly-Reihe
- Sprache: Deutsch
Seit zehn Jahren sitzt der junge James Stewart wegen des brutalen Mordes an seinem Geliebten, dem Anwalt und Politiker Murdo Maxwell, im Gefängnis – doch eine neue Aussage weckt Zweifel an seiner Schuld. Unterstützer, die von seiner Unschuld überzeugt sind, behängen bei einer Protestaktion die historische Grabstätte seines Namensvetters James Stewart of the Glens mit Bannern. Die Verurteilung des ehemaligen Clanführers durch die britischen Regierungstruppen gilt in den Highlands noch heute als großer Justizirrtum. Geschieht auch dem jungen James Stewart Unrecht? Rebecca Connolly weiß, dass es den Druck der Öffentlichkeit braucht, um den Fall neu aufzurollen, und beginnt zu recherchieren. Je mehr sie über die Tat herausfindet, desto mehr Leute scheinen in den Fall involviert zu sein: Der Vater des Verurteilten war ein erklärter Gegner von Murdo Maxwells politischer Agenda, die Polizei führt Ermittlungen in den eigenen Reihen durch, und auch eine zwielichtige Gestalt aus Glasgow interessiert sich brennend für ihre Nachforschungen … Die Rebecca-Connolly-Reihe: Band 1: Die Toten von Thunder Bay Band 2: Das Grab in den Highlands Band 3: Das Unrecht von Inverness Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Seit zehn Jahren sitzt der junge James Stewart wegen des brutalen Mordes an seinem Geliebten, dem Anwalt und Politiker Murdo Maxwell, im Gefängnis – doch eine neue Aussage weckt Zweifel an seiner Schuld. Unterstützer, die von seiner Unschuld überzeugt sind, behängen bei einer Protestaktion die historische Grabstätte seines Namensvetters James Stewart of the Glens mit Bannern. Die Verurteilung des ehemaligen Clanführers durch die britischen Regierungstruppen gilt in den Highlands noch heute als großer Justizirrtum. Geschieht auch dem jungen James Stewart Unrecht?
Rebecca Connolly weiß, dass es den Druck der Öffentlichkeit braucht, um den Fall neu aufzurollen, und beginnt zu recherchieren. Je mehr sie über die Tat herausfindet, desto mehr Leute scheinen in den Fall involviert zu sein: Der Vater des Verurteilten war ein erklärter Gegner von Murdo Maxwells politischer Agenda, die Polizei führt Ermittlungen in den eigenen Reihen durch, und auch eine zwielichtige Gestalt aus Glasgow interessiert sich brennend für ihre Nachforschungen …
© Douglas Skelton
Douglas Skelton wurde in Glasgow geboren. Nach mehreren Büchern über wahre Verbrechen widmet er sich heute Kriminalromanen. Der erste Band der Rebecca-Connolly-Reihe, ›Die Toten von Thunder Bay‹ (2021), stand auf der Longlist für den McIlvanney-Preis als bester Kriminalroman des Jahres, mit ›Das Unrecht von Inverness‹ ist der Autor erneut nominiert. Douglas Skelton lebt im Südwesten Schottlands.
Ulrike Seeberger, lebte zehn Jahre in Schottland, wo sie u. a. am Goethe-Institut arbeitete. Seit 1987 arbeitet sie als freie Übersetzerin und Dolmetscherin in Nürnberg. Sie übertrug Autoren wie Lara Prescott, Philippa Gregory, Vikram Chandra, Alec Guinness, Oscar Wilde, Charles Dickens, Yaël Guiladi und Jean G. Goodhind ins Deutsche.
DOUGLASSKELTON
DASUNRECHTVONINVERNESS
Ein Fall fürRebecca Connolly
Kriminalroman
Aus dem Englischenvon Ulrike Seeberger
Von Douglas Skelton sind bei DuMont außerdem erschienen:
Die Toten von Thunder Bay
Das Grab in den Highlands
Deutsche Erstausgabe
eBook 2022
DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2021 by Douglas Skelton
Die englische Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel ›A Rattle of Bones‹ bei Polygon, ein Imprint von Birlinn Ltd., Edinburgh.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Kossack, Hamburg.
© 2022 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Übersetzung: Ulrike Seeberger
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: Himmel © plainpicture/Design Pics/John Short; Landschaft © istock/grafxart8888
Satz: Fagott, Ffm
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN
1
Nahe Ballachulish in den schottischen Highlands, 1755
Der Soldat im roten Rock zeichnete sich wie ein Blutfleck vor dem mattgrauen Himmel und dem graubraunen Gestrüpp am Berghang ab.
Dieser trostlose Brocken Erde oberhalb des Wassers hatte tatsächlich einen Namen, ein schreckliches Gebräu aus schottischen Lauten, aber er konnte ihn, verdammt noch mal, nicht aussprechen. In seinen Augen war er kaum mehr als ein pockennarbiger Erdhaufen, der Wind und Wetter anzog wie eine Heckenhure ihre pickeligen Freier.
Das Wasser des Sees schien zu schaudern, als eine kalte Brise den Hang hinaufwehte und die einsame Gestalt fand, die dort Posten stand. Der Gefreite Harry Greenway mummelte sich tiefer in seinen Uniformrock und beobachtete die kleine Fähre, die gerade über die Meerenge gerudert wurde. Er wünschte, er wäre in seinem Quartier, mit einem Becher heißen Grog in der einen und einer ofenwarmen Hammelpastete in der anderen Hand. Dieses Wachestehen war eine sinnlose Aufgabe, seine Strafe dafür, dass er sich nicht sorgfältig genug um die Brown Bess gekümmert hatte, seine Muskete, die er nun lose im Arm hielt. Sein Sergeant wäre nicht erfreut, wenn er sehen könnte, wie achtlos er das Gewehr behandelte. Aber hier gab es ja keine Zeugen, außer den verflixten Elementen und dem, den er bewachte. Und den kümmerte nichts mehr, da würde Greenway jede Wette eingehen. Warum die Muskete so makellos sauber sein musste, begriff er einfach nicht. Schließlich waren sie nicht auf dem Schlachtfeld, denn inzwischen waren diese Heiden ja besiegt. Und doch stand er hier, auf diesem gottverlassenen, vom Wind gepeitschten Berg mit Blick auf zwei Seen. Der Gefreite Greenway weigerte sich, diese Gewässer auch nur in Gedanken mit dem schottischen Begriff Loch zu bezeichnen, selbst wenn er das dazu nötige kehlige Krächzen fertiggebracht hätte, das in seinen Ohren so klang, als versuchte jemand, einen Klumpen Schleim hochzuwürgen.
Die aufgehende Sonne hatte den grauen Himmel noch kaum erhellt. Obwohl sein Uniformrock dick war, fürchtete Greenway, er könne tatsächlich Gefahr laufen, sich seine edelsten Teile abzufrieren. Das käme ihm gar nicht gelegen, denn er hegte die Hoffnung, diese schon bald bei der jungen Eilidh zum Einsatz zu bringen. Sie war die Tochter eines Gastwirts in der Nähe der Kaserne und wohlbekannt dafür, dass sie für ein, zwei Pennys den Rock schürzte. Ein keckes kleines Ding, und er rechnete fest damit, mit ihr das Tier mit den zwei Rücken zu machen, ehe die Woche vorüber war.
Er verdrängte das Bild ihrer festen Rundungen aus seinen Gedanken und stampfte auf den harten Boden, um wieder ein wenig Gefühl in die Füße zu bekommen, die wie Eisklötze in seinen eckigen schwarzen Stiefeln steckten, doch auch, um irgendwie gegen die Beule unter seiner Hose anzukämpfen. Im Wasser unten lagen Inseln, als ob sie verankert wären, nichts als schwarze Klumpen. Diejenige, die sie Isle of the Dead, Insel der Toten, nannten, schien dunkler als die anderen zu sein. Auch sie hatte einen Namen in dieser kehligen Sprache, doch Greenway erinnerte sich nur an die korrekte englische Bezeichnung für den Ort, an dem diese Heiden ihre Clan Chiefs bestatteten. So, wie sie da buckelig und finster aus dem Wasser aufragte, erinnerte sie ihn an das, was sich hinter ihm befand. Während der trostlosen Nachtstunden war es ihm leichtgefallen, den Blick nicht darauf zu richten. Er war auf und ab gegangen, um die ewige, teuflische Kälte abzuwenden, die hier die Norm zu sein schien. Er hatte auch darauf geachtet, das Gesicht stets abzuwenden, falls plötzlich ein verirrter Mondstrahl das Bild erhellen sollte. Allerdings war das nicht sehr wahrscheinlich, denn ein Leichentuch aus Wolken verhüllte jeglichen Schein am Himmel. Jetzt, da der Tag dämmerte, so matt und leblos er auch sein mochte, gab sich Greenway alle Mühe, stets auf das Wasser unten und die Berge dahinter zu blicken. Es bestand keine Notwendigkeit, den Gegenstand seiner Bewachung im Auge zu behalten, denn er – es – würde sicher nirgends mehr hingehen.
Früher einmal war es ein Mann gewesen, doch nun war es keiner mehr. Das Fleisch war verschwunden, von Nebelkrähen und dem wilden schottischen Wetter sauber abgerupft und abgenagt. Jetzt war es nur noch ein Gestell aus verwitterten Knochen, an denen einmal Muskeln und Fleisch und Sehnen festgemacht gewesen waren. Drei Jahre hing es jetzt an diesem Galgen. Mindestens einmal sei es aus seinen Fesseln geschlüpft, hatte ihm ein Corporal mit einer gewissen Genugtuung mitgeteilt. Aber man habe es wieder aufgefädelt und erneut aufgehängt. Als Warnung, hatte der Corporal mit seinem starken West-Country-Akzent gemeint, an diese Schotten, denen vielleicht immer noch ein wenig der Sinn nach Rebellion stand.
Greenway wusste nicht, was der Mann angestellt hatte, um ein solches Schicksal zu verdienen – außer, dass er ein verräterischer Jakobiter war, was wohl ausreichte. Aber es war ihm nicht sonderlich wichtig. Wache bei den Knochen eines Toten zu halten, das war lediglich eine Pflichtübung, eine Erinnerung daran, dass er sich in Zukunft besser um seine Waffe kümmern sollte. Und doch brachte es ihn aus der Ruhe. Seine Mutter zu Hause in Spitalfield hatte ihm den Kopf mit allen möglichen Geschichten von Gespenstern und Rache von jenseits des Grabes angefüllt, und in der trostlosen Hochlandnacht hatte er sich eingebildet, er hätte diesen Knochenmann mit den Gebeinen klappern hören, als er vom Galgen stieg, um das Unrecht zu rächen, was ihm seiner Meinung nach widerfahren war.
Trotz seines dicken Uniformrocks schien die Brise durch Greenway zu wehen, als wäre er gar nicht da, um sich dann um den hölzernen Galgen zu schlingen wie ein alter Freund, der gekommen war, um dem Toten Respekt zu zollen. Die Kette schrammte quietschend am Pfosten, und es klang wie ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Der junge Soldat wandte sich um, wollte sich vergewissern, dass seine Schreckgespenster der Nacht nicht Wirklichkeit geworden waren.
Die alte Frau sah er hier zum ersten Mal.
Sie stand am Fuß des Galgens und starrte wie flehentlich hinauf. Er hatte nicht gehört, wie sie den Hang hinaufkam. Aufgeschreckt schwang er die Brown Bess in eine schussbereite Position herum.
»Zurück!«, befahl er und legte so viel Autorität in seine Stimme, wie er aufbringen konnte, obwohl seine Stimme vor Kälte bibberte. Seine Worte kamen schwach und ängstlich hervor und verkümmerten im Hauch der Brise.
Die Alte nahm seine Worte weder zur Kenntnis, noch befolgte sie seinen Befehl. Sie blieb einfach weiter unter dem Skelett stehen und starrte hoch, als hinge dort der gekreuzigte Christus und nicht irgendein dreckiger Rebell, der sich gegen seinen König gestellt hatte. Der junge Gefreite kam ins Grübeln. Hatte nicht auch ihr Heiland sich im Heiligen Land gegen die Obrigkeit gestellt? War er nicht selbst ein Rebell gewesen? Solche Gedanken waren jedoch nur was für die Gelehrten und nicht für einen Wehrpflichtigen, der in den Freudenhäusern Londons aufgewachsen war. Also verbannte er sie aus seinem Kopf. Er trat ein paar Schritte näher zu der Frau hin, bemühte sich nach Kräften, nicht auf das Knochengestell zu blicken, das sich in der Brise wiegte. Er nahm die Waffe quer vor die Brust, bereit, sie anzuheben, sobald er es für nötig hielt. Schon diese Bewegung stärkte seine Entschlossenheit und verlieh seiner Stimme stählerne Härte.
»Hört ihr mich, Frau? Zurück da!«
Die Frau wandte den Kopf zu ihm, und er sah, wie alt sie war. Ihr Gesicht war von einem zerlumpten Wollschal umrahmt und kreuz und quer von Falten durchzogen, die sich tief in das Fleisch gegraben hatten, das vom Wüten zu vieler Winter wettergegerbt war. Als ihre Augen auf die Muskete fielen, die er wie einen Schild vor die Brust hielt, warf sie ihm ein leises Lächeln zu, kaum mehr als das Aufklaffen eines schwarzen Schlunds. Doch als sie sprach, klang ihre Stimme stark, war so rau und schartig wie ihre Haut.
»Hast wohl Angst, tapferer Soldat?«
»Nein, Mütterchen«, antwortete er sanft, während er die Waffe senkte. Die ständigen Ermahnungen seiner Mutter, allen Frauen Respekt zu zollen, waren tief in seiner Seele verwurzelt. Peggy Greenway hatte in ihrem Leben nicht viel Respekt erfahren, nachdem ihre Mutter sie im Alter von vierzehn Jahren in die Freudenhäuser von Southwark in den Dienst gegeben hatte. »Ihr dürft nur nicht zu nah herantreten«, warnte Greenway die Alte. »Es ist nicht sicher.«
Sie schaute auf den Galgen zurück, und ihr Lächeln wurde traurig. »Seumas würde mir niemals ein Leid antun. Niemals im Leben und niemals im Tod. Wir sind durch Blutsbande verbunden, er und ich.«
Greenway war schon lange genug in diesem elenden Land, um zu wissen, dass Seumas das schottische Wort für James war. Der Mann, der einmal mit diesen Knochen herumgelaufen war, hieß James Stewart und war ein Verräter und Mörder. Dem Soldat war der Mann, der das einmal gewesen war, recht gleichgültig, aber so viel wusste er doch.
»Ihr seid mit ihm verwandt?«
Eine knotige Hand, die Gelenke angeschwollen und verformt, streichelte zärtlich über die ausgebleichten Fußknochen des Gehenkten. »Aye, ich bin verwandt mit ihm, wie viele hier in Appin. Blutsverwandt und verschwägert. Selbst wenn wir das nicht wären, hätten wir ihn geliebt, denn er war ein guter Mann. Ganz anders als die, die ihm dieses Ende bereitet haben – und diejenigen, die ihn hier verrotten ließen.«
Greenway war für derlei Debatten über die Gerechtigkeit der Situation nicht gut gerüstet.
»Trotzdem kann ich nicht zulassen, dass ihr so nah herantretet. Der Galgen ist nicht sicher. Außerdem lautet so mein Befehl: Niemanden nah herantreten lassen an die …« Er legte eine Pause ein, während er in Gedanken das richtige Wort suchte. »Überreste.«
Das Lachen der Frau traf ihn so scharf wie eine Ohrfeige seiner Mutter. »Ach, wäre deinen Leuten doch nur so sehr am Wohlergehen meines Verwandten gelegen gewesen, als euresgleichen ihn so grausam behandelt haben.«
Greenway konnte es sich nicht verkneifen, darauf zu antworten: »Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan.«
Nun wirbelte ihr Kopf mit einer Geschwindigkeit zu ihm herum, wie er sie bei einem so alten Menschen nicht für möglich gehalten hätte. »Gerechtigkeit, sagst du? Gerechtigkeit?« Sie spuckte etwas Dickes, Schleimiges auf den Boden zwischen ihnen beiden. »Das halte ich von eurer englischen Gerechtigkeit.«
Aus ihrem Mund klang das Wort »englisch« so, als wäre es etwas, das sie nicht einmal den Schweinen vorsetzen würde.
»Mütterchen, ich muss euch verwarnen.«
Sie wedelte ihre klauenartige Hand vor ihm hin und her. »Ach was, mein Junge. Ich bin viel zu weit im Leben fortgeschritten, für mich haben deine Worte keine Bedeutung mehr. Welche Strafe könntet ihr denn einer Frau auferlegen, die ihre Meinung sagt? Einer alten Frau, die miterleben musste, wie ihre Söhne und Enkel im Aufstand umgekommen sind? Und deren Tochter sich vor Kummer um ihr Kind verzehrt, das man auf dem Rückzug aus England einfach erfrieren ließ? Einen Jungen von sechzehn Sommern, gestorben an einem Fieber, das er sich bei diesem nutzlosen Feldzug geholt hat, im Kampf für einen Trunkenbold und Verschwender, der sich keinen Deut um dieses Land schert, aus dem er geflohen ist wie ein geprügelter Hund.«
Greenway hatte während des Aufstands von 1745 nicht für seinen König unter Waffen gestanden, wusste jedoch, von wem die alte Frau sprach: von Prinz Charles Edward Stuart. Den man auch The Young Pretender nannte, und der unter den schottischen Clans die Revolte angefacht und seine Armee nach Süden geführt hatte, um den Thron an sich zu reißen. Bis Derby waren sie gekommen, ehe sie kehrtmachten und sich in die Heimat zurückzogen. Die bloße zahlenmäßige Überlegenheit der Regierungstruppen, die Gerissenheit Seiner Königlichen Hoheit Prinz William Augustus, des Herzogs von Cumberland, und die angeborene Feigheit von Charles Stuart führten dazu, dass der Aufstand auf dem Moorland bei Inverness ein tödliches Ende fand. Greenway hielt den Mund, denn er spürte, dass Schweigen der klügere Weg war. Seine Augen huschten immer wieder zur Bergkuppe, um sich zu versichern, dass dort keine Autoritätsperson angekommen war und die Worte der Frau mithören konnte – oder mitbekam, dass er die Alte für ihre verräterischen Reden nicht zur Rechenschaft zog.
Der Blick der Frau war zu dem Skelett zurückgekehrt, und erneut streichelte ihre Hand die Fußknochen mit offensichtlicher Zuneigung. »Das, was hier geschehen ist, hatte rein gar nichts mit Gerechtigkeit zu tun«, murmelte sie, halb für sich. »Nicht mit der Gerechtigkeit der Menschen und nicht mit der Gerechtigkeit Gottes. Das hier war Mord.«
Die Pflicht drängte den Gefreiten Greenway dazu, nicht weiter stillzuschweigen.
»Mütterchen, ich muss euch noch einmal verwarnen, ihr dürft wirklich nicht …«
Wiederum ergriff die unsichtbare kalte Hand des Windes die Knochen und ließ sie klappern. Unwillkürlich machte Greenway einen Schritt zurück, hob im Reflex die Muskete. Die alte Frau bemerkte die Furcht, die in seinem Gesicht aufblitzte, und lächelte erneut.
»Ja, das jagt dir Angst ein, mein Junge«, sagte sie. »Dieses Geräusch. Und das sollte es auch. Denn wenn auch das Fleisch verschwunden ist und nur noch diese nackten Knochen zurückgeblieben sind, lebt doch der Geist weiter. Du bist jung. Du weißt nichts von diesen Angelegenheiten. Aber hör mir gut zu, englischer Soldat, du wirst Ungerechtigkeit erleben und Grausamkeit und Niedertracht von denen über dir. Und dann musst du stillhalten und lauschen, denn dieses Geräusch – das Klappern der Knochen – wird durch die Jahre hinweg widerhallen.«
2
Inverness, Gegenwart
Das Lächeln des Mannes war ärgerlich und im Grunde sehr beunruhigend. Eigentlich war es kaum vorhanden, ein winziges halbherziges Grinsen, doch es spiegelte sich auch in den Augen wider. Schwere Lider; manche würden sie als schläfrig bezeichnen.
Rebecca Connolly war müde. Sie hatte in letzter Zeit nicht gut geschlafen. Das war an sich nichts Neues, aber heute war Samstag, und sie hatte die Woche über einiges zu tun gehabt. Von Rechts wegen hätte sie jetzt gemütlich im Schlafanzug zu Hause hocken und sich darauf freuen sollen, eine Folge von The Marvelous Mrs.Maisel nach der anderen anzuschauen, anstatt hier in der Altstadt von Inverness vor dem kleinen Büro der Nachrichtenagentur einem aufgebrachten Mann gegenüberzustehen, der einem Witz zu lauschen schien, den er allein hörte.
Er war plötzlich hinter ihr aufgetaucht, als sie die Tür zum Büro aufschloss. Wahrscheinlich hatte er draußen vor dem Haus gewartet und ihre Ankunft beobachtet, überlegte sie. Tatsächlich hatte sie seine Schritte hinter sich auf der Treppe gehört. Und sobald sie sich oben in der offenen Tür umdrehte, war er erschienen.
»Sind Sie Rebecca Connolly?«, fragte er im Gesprächston, wartete aber die Antwort nicht ab, sondern hielt gleich ein Boulevardblatt von vor zwei Tagen in die Höhe. »Und haben das hier geschrieben?«
Sie beugte sich vor und blickte im trüben Licht des Treppenhauses auf die Zeitungsseite. Eine Wolke von Rasierwasser wehte ihr entgegen wie eine Visitenkarte. Die Story, auf die der Mann mit dem Zeigefinger der anderen Hand tippte, war ein Bericht über eine Gerichtsverhandlung in Inverness, bei der es um eine Ausschreitung im Stadtbezirk Inchferry ging.
»Ja, ich bin Rebecca Connolly«, bestätigte sie ihm. »Aber diese Story habe ich nicht geschrieben.«
»Sie kam aber von Ihrer Agentur, stimmt’s?«
»Ja«, erwiderte sie und fragte sich, woher er das wusste.
Er ließ die Hand mit der Zeitung sinken und richtete seinen trägen Blick auf sie. »Ich bin gar nicht erfreut.«
Das überraschte Rebecca nicht. Beschwerden über Gerichtsberichte gingen wöchentlich ein, waren heute bei der Nachrichtenagentur so üblich wie damals, als Rebecca noch beim Highland Chronicle gearbeitet hatte. Derlei war sie gewöhnt.
»Worüber, Mr…?«
»Martin Bailey«, sagte er. »Das ist mein Junge, dessen Namen Sie da genannt haben.«
Rebecca war zwar tatsächlich bei dem Vorfall dabei gewesen als einige Leute während einer aus dem Ruder gelaufenen Demonstration randaliert hatten. Sie hatte zwar die Story nicht geschrieben, doch sie erkannte den Namen als den eines Angeklagten.
»Okay«, sagte sie.
Seine Augen wanderten zum Büro hinter der Türöffnung, als erwartete er, hineingebeten zu werden. Doch hier auf dem Flur, wo die Tür zur Schneiderei gegenüber offen stand, aus der ein Song von Katie Perry herüberschallte, fühlte sie sich wohler. So alltäglich diese Beschwerden auch für sie waren, irgendwas an diesem Mann mit seinem dünnen Gesicht und seinem leisen, monotonen Tonfall gab ihr ein ungutes Gefühl.
»Ich bin gar nicht erfreut«, wiederholte er. »Ich will nicht, dass mein Name in der Zeitung steht.«
»Nun, er ist Ihr Sohn.«
»Der heißt auch Martin Bailey. Und Sie haben auch noch meine Adresse abgedruckt. Ich glaube nicht, dass das in Ordnung ist.«
»Wohnt Ihr Sohn bei Ihnen, MrBailey?«
»Ja.«
»Dann haben die Zeitungen und wir in der Agentur jedes Recht, die Adresse zu nennen. Die ist allen öffentlich zugänglich.«
Er starrte sie noch einige Augenblicke an, und das Lächeln lag unverändert auf den Lippen. Ihr dämmerte vage, dass er diese Antwort bereits erwartet hatte. »Mein Anwalt sagt was anderes.«
Auch dieses Argument war alltäglich. Rebecca hatte zu zählen aufgehört, wie oft ihr Leute präsentierten, was ihnen angeblich ein Anwalt erzählt hatte, obwohl der ihnen höchstwahrscheinlich genau das Gleiche gesagt hatte wie Rebecca. Sie bezichtigte Bailey trotzdem nicht der Lüge. Es war immer besser, in solchen Situationen geschäftsmäßig vorzugehen.
»Ich kann nichts dafür, was er Ihnen gesagt hat, MrBailey. Tatsache ist, dass wir in einem Bericht über eine Gerichtsverhandlung den Namen und die Adresse des Angeklagten drucken dürfen. Die sind in öffentlichen Akten zugänglich.«
»Die Leute in meiner Nachbarschaft denken, dass ich das bin.«
»Das bezweifle ich, MrBailey. Wie alt ist Ihr Sohn?«
»Dreiundzwanzig.«
»Und das wird in der Story erwähnt. Sie sind nicht dreiundzwanzig, oder?«
»Nein.«
»Na bitte. Da werden die Leute kaum glauben, dass Sie es sind.«
Er nickte halbherzig, und wieder hatte sie den Eindruck, dass sie ihm nichts Neues sagte. Er fuhr sich mit der Hand durch das lange Haar, das er zu einer Art Vokuhila nach hinten gerafft hatte.
Es war ein warmer Frühsommertag, und er hatte die Hemdsärmel aufgerollt. Zwischen den dunklen Haaren auf seinem sehnigen Unterarm entdeckte sie ein Tattoo, das verdächtig wie die Zahl 88 aussah. Rebecca wusste, dass die Neonazis diese Zahl als Symbol für den Hitlergruß benutzten, weil H der achte Buchstabe im Alphabet ist. In Anbetracht dessen, worüber er sich im Augenblick beschwerte, hielt sie es für sehr unwahrscheinlich, dass es für dieses Tattoo einen anderen, unschuldigen Grund geben könnte.
Man hatte Baileys Sohn erst einige Monate nach den Ausschreitungen in Inchferry verhaftet. Die hatten damals angefangen, als die Menge nach einer Rede von Finbar Dalgliesh, dem Anführer der Gruppierung Geist der Gälen, außer Rand und Band geraten war. Die Gruppe zog natürlich die gälische Bezeichnung Spioraid nan Gael, kurz oft SG, vor, aber Rebecca hielt das für eine kulturelle Beleidigung. Denn diese Leute zeichneten sich durch sehr wenig Geist und sehr viel rechtsextremes Geschrei aus, während sie behaupteten, dass die Zukunft ihnen gehörte. An jenem Abend war Rebecca unter die Füße der Menge geraten, nachdem jemand sie zu Boden gestoßen hatte. Es war kein angenehmes Erlebnis gewesen.
Beim Anblick dieses Tattoos überlegte sie, ob der Mann vielleicht SG-Mitglied war, und der Gedanke bescherte ihr ein mulmiges Gefühl im Magen. Vielleicht gehörte er sogar zu New Dawn, dem noch extremeren Ableger der Partei, dessen Existenz im Augenblick sowohl Dalgliesh als auch die SG selbst abstritt. Zum Teufel, dieser Kerl war unter Umständen sogar an dem Abend dabei gewesen war vielleicht der Mistkerl, der sie umgestoßen hatte. Diese Leute waren völlig durchgeknallt.
Ihr Blick fiel über die Schulter des Mannes zur offenen Tür des Schneiderbetriebs. In Gedanken ging sie ein paar der Bewegungen durch, die ihre Selbstverteidigungslehrerin ihr beigebracht hatte. Augen, Nase, Hals und Schritt. Kräftig und schnell zuschlagen.
Er bemerkte ihren Blick, und es zuckte um seine Mundwinkel. Sie verfluchte sich, weil sie ihm damit verraten hatte, dass er sie eingeschüchtert hatte, wenn auch nur ein bisschen.
»Das sind alles Lügen«, erklärte er. »Was die vor Gericht gesagt haben. Da bekommt man nie die Wahrheit zu hören.«
Rebecca wusste sehr wohl, dass Gerichte sich mit dem befassen, was beweisbar ist, doch Lügen kommen ja immer irgendwo her. Und die Wahrheit liegt allzu oft in den Augen – und den Ohren – des Betrachters oder Hörers. Diesen saftigen Knochen würde sie ihm allerdings nicht vorwerfen, noch viel weniger über diese Aussage mit ihm debattieren.
»Tut mir leid, MrBailey, aber ich habe einen Termin, also …«
»Sie waren an dem Abend damals dabei«, sagte er.
Also war er tatsächlich in Inchferry gewesen. Wieder einmal hatte sie den Eindruck, dass er mit ihr seine Spielchen trieb.
»Ja«, erwiderte sie.
»Aye, hab Sie gesehen.« Er kniff die Augen zusammen. »Sie waren damals noch beim Chronicle.«
»Das stimmt, aber …«
»Finbar hat gesagt, Sie sind unser Feind.«
Finbar. Sie redeten einander mit dem Vornamen an. Das hatte an sich noch nicht zu bedeuten, dass er ein Busenfreund des SG-Anführers war. Dalgliesh war der Typ Mann, der mit den Leuten ein Bier trinkt und eine Zigarette raucht und jedem, der ihn vielleicht unterstützen könnte, anbietet, ihn Finbar zu nennen. Aber es bestätigte, dass Bailey SG-Anhänger war. Und sie war jetzt eine Feindin, nicht die Presse im Allgemeinen, sondern sie persönlich. Ein wenig erfreute sie das, allerdings nicht so sehr, dass es ihre Nerven entspannt hätte. Sie hatte Mühe, nach außen hin ruhig zu bleiben.
»Sie sind genau wie all die anderen. All diese Mainstream-Medien. Diese liberale Elite. Sie würden die Wahrheit nicht mal erkennen, wenn sie Sie in den Hintern beißt.« Er verzog die Lippen zu einem hämischen Grinsen, während seine Augen sie langsam von Kopf bis Fuß musterten. »Aber jetzt ändert sich das alles. Sie wären gut beraten, wenn Sie sich daran erinnern.«
Da wären wir also, dachte sie. Er hatte all die rechtsextremen Schlagwörter ausgepackt. Mainstream-Medien. Liberale Elite. Rebecca hatte das Gefühl, als wiederholte er Phrasen, die er bei einer SG-Versammlung gehört hatte, allesamt entweder Halbwahrheiten oder schamlose Lügen und Bestätigung alter Vorurteile. Es war immer stressig, wenn jemand sich über Berichte aus dem Gerichtssaal beschwerte, aber wenn ein SG-Mitglied diese Beschwerde vorbrachte, kam noch ein weiteres Level der Besorgnis hinzu. Irgendetwas an den Worten des Mannes, an der Art, wie er sie hervorstieß, wie er das Wort »Sie« betont hatte, wie er sich herausnahm, sie mit diesen halb geschlossenen, spöttischen Augen beinahe zu durchbohren, ließ ihren Geduldsfaden reißen. Mach was, das die anderen nicht erwarten, hatte ihr Vater ihr einmal geraten. Anstatt zurückzuweichen, geh näher ran. Manche Leute sind nichts als heiße Luft.
Sie trat einen halben Schritt vor, sicherte ihren Stand, wie die Selbstverteidigungslehrerin es ihr beigebracht hatte, und sagte: »MrBailey, das klang gerade in meinen Ohren wie eine Drohung.«
Er regte sich nicht. Sein Lächeln wurde nur noch breiter. »Keine Drohung, Schätzchen. Dieses Land ändert sich, und Leute wie ihr, ihr ändert euch am besten mit, mehr sage ich nicht. Wenn ihr wisst, was gut für euch ist.« Er machte einen Schritt von ihr weg, wandte sich zur Treppe, sah sich noch einmal um. Unverändert lächelnd, als würde in seinem Kopf weiter dieser kleine Witz erzählt, musterte er sie von Kopf bis Fuß, als hätte er gespürt, dass sie angespannt war, zur Flucht oder zum Kampf bereit. »Glauben Sie mir, Rebecca Connolly, die Sache ist noch lange nicht zu Ende.«
Sie versuchte, sich eine schlaue Antwort darauf einfallen zu lassen, doch es kam ihr keine in den Sinn. Stattdessen ließ sie ihn ohne ein weiteres Wort gehen, lauschte auf seine Schritte auf der Treppe und hörte, wie die Tür zur Straße zufiel. Erst dann holte sie tief Luft und stieß sie langsam wieder aus, wütend über das kleine Beben beim Ausatmen. Atme, befahl sie sich. Ein. Aus.
Ihr Telefon piepte. Sie öffnete die SMS und sah ein Bild: Auf einem Banner über einem Denkmal prangten die Worte »JAMES STEWART IST UNSCHULDIG«.
Dann klingelte das Telefon.
»Haben Sie das Foto bekommen?« Tom Muirs Stimme klang zittrig, fern. Rebecca wusste nicht, ob er aus einer Gegend mit schlechtem Empfang anrief oder ob sein Handy so alt war, dass es von Rechts wegen noch eine Wählscheibe hätte haben sollen. Fürs Erste verbannte sie also Martin Bailey aus ihren Gedanken.
»Ja, ich sehe es mir gerade an.«
»Ich weiß nicht, wie lange das da hängen bleiben wird. Irgendein Mistkerl wird es sicher runterreißen. Die gibt’s auch bei uns in Keil Chapel, wo James of the Glens begraben liegt, und in Lettermore, wo Colin Campbell ermordet wurde.«
Beides waren Orte, die mit einem Fall von vor beinahe 270Jahren zu tun hatten. Damals hatte man einen gewissen James Stewart dafür verurteilt, dass er angeblich einen Regierungsbeamten ermordet hatte. Rebecca kannte die Geschichte gut, denn ihr Vater hatte ihr vor langer Zeit davon erzählt.
Doch diese Banner bezogen sich nicht auf irgendeine historische Gestalt. Dieser James Stewart lebte eindeutig in der Gegenwart.
»Okay, Chaz wartet vor der Tür auf mich«, sagte sie. »Wir kommen wahrscheinlich am frühen Nachmittag bei Ihnen an. Ich gehe zuerst noch zu MrsStewart.«
»Ich habe für Sie bei Afua den Weg bereitet, so gut ich eben kann«, sagte die Stimme am anderen Ende der Leitung. »Aber ich hoffe doch sehr, dass Sie Ihre Unerschrockenheitspillen genommen haben, meine Liebe.«
»Gleich früh am Morgen, wie jeden Tag«, sagte sie, und ihre Gedanken wanderten wieder zu Martin Bailey und seiner letzten Aussage. Irgendwie wusste sie, dass es mehr als eine Drohung gewesen war.
Es war ein Versprechen.
3
Rebecca schnappte sich ein neues Notizheft und ein paar Stifte, schloss das Büro ab und folgte den Schwaden von Baileys Rasierwasser zur Straße hinunter. Verglichen mit der Kühle des schäbigen Treppenhauses war die Hitze des Tages hier draußen beinahe sengend. Das Schloss der Haustür war nicht ganz richtig eingeschnappt, also zog sie kräftig, bis sie hörte, wie es einrastete. Sie hatte schon länger vorgehabt, Schmieröl zu kaufen, es aber immer wieder vergessen. Sie nahm sich vor, gleich beim nächsten Besuch im Supermarkt welches mitzunehmen.
Chaz Wymark lehnte an der Wand zwischen der Haustür und einem Café, hatte ein Bein angewinkelt und stützte sich mit dem Fuß am Mauerwerk ab, das Gesicht in die Sonne gereckt. Er öffnete ein Auge und blinzelte in ihre Richtung.
»An das Wetter könnte ich mich echt gewöhnen«, sagte er.
»Wir sind in Schottland«, erwiderte sie. »Das hält nicht.«
Er ließ das erhobene Bein sinken und beugte sich nach unten, um seine Kameratasche hochzuhieven, die wie ein geduldiger Hund zu seinen Füßen gewartet hatte. »Großer Gott, verdirb mir ruhig die gute Laune.« Er legte sich den Trageriemen der Tasche über die Schulter. »Was hat dich so lange aufgehalten?«
»Tut mir leid, ich musste erst noch was regeln.«
Die Strahlen der Sonne waren ihr willkommen. Der Winter war lang gewesen, und dieser Frühsommer war eine Wucht. Es waren bereits ein paar Touristen unterwegs, obwohl es gerade erst kurz nach neun war. Eine Gruppe wurde von einem Fremdenführer die Straße entlang in Richtung Church Street geleitet, vielleicht zur Old High Kirk. Rebecca überlegte, wie diese Leute sich wohl fühlen würden, wenn sie dort, wie es im Vorjahr geschehen war, vom Anblick eines Mannes im roten Uniformrock der Regierungssoldaten von 1746 empfangen würden, dem man die Kehle durchgeschnitten hatte und dessen Leiche über einen flachen Grabstein gebreitet lag. Sie hatte es selbst nicht gesehen, aber sie hatte mit einem Polizisten gesprochen, der vor Ort gewesen war. Schön war der Anblick wohl nicht gewesen, und heute hätte er sicherlich die Besucher so geschockt, dass sie ihre Reiseführer fallen ließen. Sie ließ die Gruppe vorbei, und eine Touristin, eine ältere Frau, lächelte ihr zu.
Rebecca nickte und erwiderte das Lächeln, das ihr jedoch verging, als sie bemerkte, dass Martin Bailey sie von der anderen Straßenseite aus beobachtete.
Sie spürte, wie sich ihre Stirn in Falten zog, und wandte sich rasch ab, damit Bailey das nicht sah.
»Was ist los?«, fragte Chaz, der ihren Gesichtsausdruck wahrnahm.
»Der Typ da drüben.«
Chaz verrenkte den Hals. »Welcher Typ?«
»Schau nicht so offensichtlich hin, Herrgott noch mal«, flüsterte sie.
»Entschuldigung«, sagte Chaz. »Ich wusste ja nicht, dass wir im Agatha-Christie-Modus sind.«
»Hast du ihn gesehen?«
»Hatte keine Gelegenheit, ehe du angedeutet hast, dass meine Agentenfähigkeiten ausbaufähig sind.«
Trotz ihrer Besorgnis musste sie lächeln. »Er ist auf der anderen Straßenseite. Hat vorhin darüber gejammert, dass ein Bericht über das Verfahren seines Sohnes in der Zeitung steht. Das hat mich aufgehalten.«
»Okay«, meinte Chaz. Diesmal blickte er weniger auffällig auf den anderen Gehsteig.
»Er ist auch SG-Anhänger. Glaube ich jedenfalls. Und er hat mir eben so nebenbei gedroht.«
Gar nicht so nebenbei, überlegte sie, als sie sich an seinen letzten Blick erinnerte.
»Wirklich?« Chaz’ Stimme verhärtete sich. Nun gab er jeden Vorwand auf, drehte sich um und warf dem Mann einen grimmigen Blick zu. Diesmal tadelte Rebecca ihn nicht. Er war wirklich ein Schatz, doch sie wussten beide, dass er wohl kaum die mittelalterliche Ritternummer abziehen würde. »Oh, das stimmt, ich habe vorhin gesehen, wie er unmittelbar nach dir ins Haus gegangen ist.«
Ohne sich umzudrehen, fragte sie: »Was macht er jetzt?«
»Steht einfach nur da und schaut zu uns hin.« Chaz verzog das Gesicht kein bisschen. »Ich bin mir nicht sicher, ob mein grimmigstes Clint-Eastwood-Starren ihn überhaupt in Sorge versetzt. Was für eine Drohung war das?«
»Ach, das Übliche. Eine Drohung, die eigentlich keine ist. Ihr werdet schon sehen, jetzt ist unsere Zeit gekommen, die Sache ist noch nicht zu Ende, bla, bla, bla. Es ist eher die Art, wie er es gesagt hat, als das, was er gesagt hat. O ja, und ich bin die Feindin.«
Chaz starrte weiter zu Martin Bailey hin. Er war vielleicht kein Clint Eastwood, aber Mumm hatte er. »Wessen Feindin? Seine?«
»Die der SG. Die von Finbar Dalgliesh.«
»Jeder, der ein halbes Hirn sein Eigen nennt, ist deren Feind. Meinst du, er ist gefährlich?«
Ihr nüchterner Verstand sagte ihr, dass der Mann ein Rabauke war, der Leute schikanierte. Und solche Kerle haben nur Erfolg, wenn man sich nicht gegen sie wehrt. Die Chancen standen nicht schlecht, dass sie nie wieder von ihm hören würde.
»Ach, lass schon«, sagte sie. »Komm, wir vergessen den. Der ist nichts.«
Sie gingen die Straße entlang auf den Bahnhof zu. Chaz’ Hinken, die Folge eines Autounfalls, bei dem sein Wagen von der Straße abgekommen war, war nun nicht mehr so ausgeprägt. Inzwischen hatte er auch den Stock, den er eine Weile mit sich herumgetragen hatte, aufgegeben. Eigentlich hatte er ihn ohnehin nie wirklich gebraucht. Rebecca schaute noch einmal über die Schulter zurück und sah, dass Bailey sie auf der anderen Straßenseite beschattete. Als er ihnen am Ende der Straße noch immer folgte, beschloss Rebecca, die Sache gleich im Keim zu ersticken.
»Warte hier«, sagte sie zu Chaz und überquerte unverzüglich die Straße, um dem Mann entgegenzutreten. Die Belustigung tanzte noch in seinen Augen, als er sie jetzt ansah, das selbstgefällige kleine Lächeln zuckte ihm weiterhin auf den Lippen.
»Haben wir ein Problem, MrBailey?« Sie sprach mit leiser Stimme, sodass die Passanten sie nicht hören konnten.
Zunächst sagte er nichts, sah sie nur mit diesem aufreizenden Grinsen an. »Ich geh nur hier lang, mehr nicht.«
»Ach ja«, erwiderte sie.
»Man wird ja wohl noch die Straße entlanggehen dürfen, oder?«
Sie schnaufte schwer. Sie hatte wirklich keine Antwort darauf. Er beugte sich ein wenig näher zu ihr und sagte leise: »Aber ich melde mich wieder.«
»Ich glaube nicht, dass wir noch etwas miteinander zu bereden haben, MrBailey.«
Er tat einen halben Schritt zurück, zuckte mit den Achseln, machte kehrt und ging in die entgegengesetzte Richtung. Rebecca schaute ihm einen Augenblick hinterher, gesellte sich dann wieder zu Chaz.
»Denkst du, der macht Ärger?«, erkundigte er sich.
Sie blickte zurück, doch Bailey war bereits außer Sichtweite. »Ich bin schon früher mit Leuten wie ihm fertiggeworden. Damals bei der Zeitung hat mich einer jeden Tag angerufen – auch wegen einer Reportage aus dem Gericht – und mich mit allen möglichen Schimpfnamen belegt. Aber das hier? Ich weiß nicht. Es fühlt sich irgendwie anders an.«
»Wenn du dir Sorgen machst, solltest du es der Polizei sagen. Vielleicht rufst du mal bei Val Roach an?«
Val Roach war eine Polizistin, die Rebecca bei den Ermittlungen in den Mordfällen vom Friedhof der Old Kirk und vom Culloden Moor kennengelernt hatte. Die ganze Angelegenheit hatte damit geendet, dass Rebecca beinahe eine Pistolenkugel abbekommen hätte. Sie hatte auch dazu geführt, dass Rebecca ihren Job beim Highland Chronicle aufgab und nun für die Presseagentur von Elspeth McTaggart arbeitete. Roach hatte sie während dieser Ermittlungen schwer enttäuscht, weil sie einer Verdächtigen erzählt hatte, Rebecca hätte sie verraten, obwohl sie das nicht getan hatte. Sie hatte auch damit gedroht, Rebecca zu verhaften, weil sie Informationen zurückhielt. Das machte ihr die Polizistin nicht gerade sympathisch, und sie hatten seither nicht miteinander geredet.
»Und was soll ich ihr sagen?«, fragte Rebecca. »Dass sich jemand bei mir beschwert, mir einen finsteren Blick zugeworfen hat und sich dann auch noch erdreistet hat, die Straße vor dem Büro entlangzugehen? Nein, wie gesagt, vergiss es. Typen wie der sind den erhöhten Blutdruck nicht wert. Komm schon. Jetzt gehen wir Afua Stewart besuchen.«
»Meinst du, sie wird mit dir reden?«
Rebecca warf ihm einen tadelnden Blick zu. »Hast du je erlebt, dass mir jemand ein Gespräch verwehrt hätte?«
Er ließ sie ein paar Schritte vorausgehen, ehe er antwortete: »Nun … ja.«
4
Mo Burke hatte im Barney’s ihren eigenen Tisch, schließlich gehörte ihr ja die Kneipe. Heutzutage verbrachte sie viel mehr Zeit in der schäbigen kleinen Bar in einer Gasse der Altstadt als in ihrem Zuhause in Inchferry. Hier war es, als hätte man eine Reise zurück in die Zeit gemacht, als in den Pubs nichts als Bier und Schnaps ausgeschenkt wurde und Wein nur was für die feinen Schnösel war. Mo beobachtete, wie die Leute kamen und gingen, während Midge, ihr West Highland Terrier, zu ihren Füßen auf einem großen Kissen lag. Sie liebte den kleinen Hund. Er war alles, was ihr noch geblieben war, zumindest bis man ihren Mann freiließ. Sie hatte zwei Söhne, aber einer war tot und der andere im Gefängnis. Während sie so schaute, trank sie Kaffee und gelegentlich Gin, und sie rauchte. Hier würde es niemand wagen, ihr das Anti-Rauch-Gesetz um die Ohren zu hauen, es sei denn, er hätte es darauf angelegt, selbst etwas viel Schmerzhafteres um die Ohren zu bekommen. Jeder aus ihrem Team, der mit ihr reden wollte, wusste, wo er sie finden konnte, und so strömten die Jungs stetig rein und raus, und jeder hatte das Gefühl, er müsse sich was an der Bar bestellen. Das trug auch zum Gewinn bei. Nicht dass Mo sich allzu sehr darum geschert hätte. Barney’s war nur Fassade, eine Möglichkeit, Geld zu waschen, das sie anderswo eingenommen hatte. Im Pub waren meistens nur Stammgäste, doch das bedeutete nicht, dass nicht einer davon den Gesetzeshütern etwas zuflüsterte. Also wurden alle Themen, die irgendwie heikel waren, in dem großen Keller besprochen. Mo Burke hatte sich nicht so lange im Geschäft gehalten, indem sie übermäßig vertrauensselig war.
Martin Bailey war kein Stammgast, aber er wusste, wo Mo zu finden war. Also war sie nicht überrascht, als er die Tür aufdrückte, schnurstracks auf ihren Tisch in der hintersten Ecke zukam, sich ohne Aufforderung hinsetzte, und, wie sie bemerkte, auch ohne unterwegs für einen Drink in die Tasche zu greifen. Wenn er darauf wartete, dass sie ihm einen spendierte, würde er in die Röhre gucken. Sein Rasierwasser schwallte über den Tisch hinweg zu ihr hin und stach ihr in die Nase. Großer Gott, wo fand der das Zeug?, fragte sie sich. Sie hätte ihm zu gern gesagt, die Siebzigerjahre hätten gerade angerufen und wollten den Duft und diese Frisur zurück.
»Hast du bekommen, was ich wollte?«, fragte er mit diesem halben Lächeln in der Visage. Der Schweinehund sah immer so verflixt selbstzufrieden aus, und das kotzte sie total an. Unter dem Tisch hob Midge den Kopf und schnüffelte. Er war ein freundlicher kleiner Hund, der gewöhnlich aufstand und die Leute begrüßte, die mit Mo reden wollten, doch auf Bailey bewegte er sich nicht zu. Mo fand, dass er damit gesunden Hundeverstand bewies. Sie mochte Bailey nicht, genauso wenig die Leute, mit denen er sich rumtrieb, aber sie schluckte ihren Ärger herunter. Sie konnte Bailey gut brauchen.
Sie langte in ihre Manteltasche – im Pub war es ihr immer zu kalt – und zog einen Zettel heraus. Sie schob ihn mit behandschuhten Fingern über den Tisch, und er nahm ihn, faltete ihn auf und sah ihn an.
»Hattest du denn Probleme, das zu kriegen?«, erkundigte er sich.
Sie schüttelte den Kopf. Mo Burke kannte viele Leute. Informationen zu bekommen, war für sie ein Kinderspiel. Wenn er argwöhnte, dass es nicht Mos Handschrift war, zeigte er es jedenfalls nicht. Sie würde ihm niemals irgendwas geben, das sich leicht zu ihr zurückverfolgen ließ.
»Schreib’s ab«, sagte sie und schob ihm einen Bleistift hin. »Unten ist Platz. Dann reiß den Streifen ab und gib mir das Original zurück.«
Er schaute zu ihr auf, wieder dieses spöttische Aufblitzen. »Im Ernst?«
»Im Ernst.«
Zunächst hatte es den Anschein, als wollte er darüber diskutieren, doch dann grunzte er ein halbes Lachen, nahm den Bleistift und schrieb Rebecca Connollys Adresse und Telefonnummer ab. Mo würde das Risiko nicht eingehen, dass man ihn mit dem Original in der Tasche erwischte, selbst wenn es nicht ihre eigene Handschrift war. Vorsichtsmaßnahmen. Sicherheitsebenen. Überleben des Schlauesten.
»Ich hab sie vor einer Weile in ihrem Büro besucht«, sagte er, während er sorgfältig den Zettel in der Mitte durchriss und ihr das Original zurückgab. »Einfach verdammter Dusel. Ich hab gerade diese Agentur ausspioniert, da kam sie an. Also habe ich schon mal den Ball ins Rollen gebracht.«
»Du hättest es an Ort und Stelle machen können.«
Er schüttelte den Kopf. »Nein, so arbeite ich nicht. Zu früh. Ich mach das auf meine Weise.«
Sie wusste, was »seine Weise« war. Sie hielt zwar nichts davon, aber es war ihr eigentlich egal. Es gab nicht viel, wovon Mo Burke nichts erfuhr, besonders in Inchferry. Sie war nicht von dort, aber sie lebte dort, seit sie ihren Mann Tony geheiratet hatte, und ihre Familie war untrennbar mit diesem Bezirk verwoben. Zumindest das, was ihr an Familie noch geblieben war.
Bailey hatte in Ferry auch einen Ruf. Er mochte Frauen nicht, ganz besonders Frauen, die ihn seiner Meinung nach schlecht behandelt hatten. Das Geld einer Frau nahm er jedoch gern, wenn es ihm angeboten wurde. Aber er hatte noch andere Gründe, Rebecca Connolly zu jagen. Bailey war bei der SG, und dort mochte man die Reporterin ganz und gar nicht. Obwohl sie kein Fan von Finbar Dalgliesh und seinen Kumpels war, nutzte Mo das nur zu gern zu ihrem Vorteil aus. Das war nämlich der eigentliche Grund für Baileys Hass. Sein Junge war ihm herzlich egal, aber sie hatte ihm dieses Argument eingeflüstert, um ihm mitzuteilen, dass es höchste Zeit wäre, dieser Connolly eine Lektion zu erteilen. Männer waren manchmal so leicht zu manipulieren. Es hatte nicht viel Überredungskünste gebraucht. Rebecca Connolly hatte über die SG geschrieben und hatte es sich zur Angewohnheit gemacht, Finbar immer wieder auf die Nerven zu gehen. Für jemanden wie Bailey war das schlicht untragbar, besonders von einer Frau.
»Sie ist ein unverschämt freches kleines Miststück.«
»Dann tu, was du gesagt hast. Ich will, dass sie für das zahlt, was sie angerichtet hat.«
Sein Grinsen wurde breiter. »Oh, sie wird zahlen, da mach dir mal keine Sorgen. Mit dieser Schlampe haben wir schon lange eine Rechnung offen. Jetzt ist die Zeit reif.«
Mo Burke hielt die Flamme ihres Feuerzeugs an eine weitere Zigarette und dachte an ihre Söhne. An den einen, der im Gefängnis saß, und den anderen, der in einem kühlen Grab lag.
Und für beides war Rebecca Connolly verantwortlich.
5
Die Couch sah teuer aus und fühlte sich auch so an, und der zweifellos hohe Preis wirkte sich merklich auf den Faktor Bequemlichkeit aus. Rebecca hatte das Gefühl, in einer watteweichen Wolke zu versinken. Ob die Besitzerin etwas dagegen hätte, wenn sie sich hier zusammenkuschelte, eine dieser unglaublich weich aussehenden Decken – kein Fünf-Pfund-Sonderangebot von Tesco für diese Lady–um sich breitete und ein bisschen Schlaf nachholte? Sie fragte lieber nicht. Die kühle Feindseligkeit in diesem geschmackvoll eingerichteten Raum war beinahe mit Händen zu greifen.
Die Frau hatte sie mit einem frostigen Nicken und einer knappen Geste begrüßt, die sie zum Eintreten aufforderte. Das war zumindest etwas. Jetzt saß sie ihnen sehr aufrecht auf einem Sessel gegenüber, hatte die langen Beine aneinandergeschmiegt und leicht zur Seite geneigt, die Hände im Schoß gefaltet. Es war ein sehr schöner Ohrensessel, blassgrün mit einer geraden Rückenlehne. Er war antik und hatte wahrscheinlich mehr gekostet als Rebeccas gesamte Sitzgarnitur. Plus Fernseher. Vielleicht sogar plus Teppiche. Der gesamte Raum war der Traum eines Designers von gutem Geschmack und verfeinerter Eleganz.
Afua Stewart war eine wunderschöne Frau. Sie würde auf den Fotos großartig aussehen, die Chaz, so hoffte Rebecca, von ihr machen würde, bevor sie gingen. Die äußere Erscheinung, immer die äußere Erscheinung. Sie musste über sechzig sein, schätzte Rebecca und würde jede Wette eingehen, dass ihr Lächeln noch immer die Männerherzen höher schlagen ließ. Ihr Sohn James war jetzt einunddreißig; zum Zeitpunkt seiner Verurteilung war er einundzwanzig gewesen. Afua Stewart war zehn Jahre lang Model gewesen, ehe sie heiratete und all das hinter sich ließ, um Ehefrau und Mutter zu werden. Ihre Haut war makellos, ihre Wangenknochen ausgeprägt, das Kinn noch fest, das schwarze Haar kurz geschnitten. Ihre Augen waren blassblau und unterstrichen die kühle Verachtung, mit der sie Rebecca und Chaz betrachtete. Hauptsächlich allerdings Rebecca. Vielleicht schaute die Frau immer so. Vielleicht war dieser Blick auch nur für Rebecca reserviert, die Afua früher schon einmal enttäuscht hatte.
Das Haus war groß und lag im Stadtbezirk Crown in einer ruhigen Straße mit Villen, sorgfältig gepflegten Gärten und Hecken und funkelnagelneuen Autos vor der Tür. Auf der Straße draußen war es still, nur ab und zu störte das Bellen eines Hundes die Ruhe des Samstagmorgens. Der Hund war wahrscheinlich im Park am Ende der Straße, vermutete Rebecca, und jagte hinter einem Ball her. Oder hinter einem Stöckchen. Oder er bellte einfach nur, weil ihm gerade danach war.
»Sie scheinen nicht recht bei der Sache zu sein, Ms Connolly«, sagte Afua Stewart in ihrem kultivierten schottischen Tonfall mit einem Hauch von Übersee. Ihre Familie stammte aus der Region Ashanti in Ghana, doch Rebecca wusste, dass Afua selbst in Edinburgh geboren und aufgewachsen war und ihre Model-Laufbahn sie nach London und Paris geführt hatte. Den Sprung zum Supermodel hatte sie nie geschafft, war aber doch recht erfolgreich gewesen.
»Tut mir leid, MrsStewart. Mir ist gerade etwas anderes durch den Kopf gegangen. Und bitte nennen Sie mich Rebecca.« Sie mochte es gar nicht, wenn man sie als Ms oder Miss bezeichnete, obwohl sie selbst gewissenhaft darauf achtete, andere mit dem angemessenen Titel anzusprechen.
Die Frau quittierte diese Bitte mit dem leichten Zucken einer Augenbraue. Rebecca konnte daraus nicht ablesen, ob sie verärgert war, ihre kurze Unaufmerksamkeit akzeptiert hatte oder der weniger förmlichen Anrede zustimmte. Sie schlug jedenfalls nicht vor, Rebecca solle sie auch mit Vornamen anreden.
»Ich habe Sie gefragt, warum Sie sich so plötzlich für den Fall meines Sohnes interessieren, wo Sie das doch bisher nie getan haben.«
Und da war es.
»Ich habe mich immer für den Fall interessiert, MrsStewart. Seit mir Tom Muir davon erzählt hat.«
Rebecca hatte Tom Muir während der Ausschreitungen in Inchferry kennengelernt, die ihr Prellungen und aufgeschürfte Knie und Handflächen eingebracht hatten – und dem jungen Martin Bailey eine Gefängnisstrafe. Tom Muir hatte ihr die Story an genau dem Tag erzählt, als sie sich entschlossen hatte, den Highland Chronicle zu verlassen. Dass sie anschließend gezwungen war, James Stewarts Geschichte so lange unbeachtet zu lassen, behagte dessen Mutter gar nicht. Kampagnen schaffen es nur in die Nachrichten, wenn es etwas Neues zu berichten gibt, und die finanzielle Wirklichkeit verlangte von ihr, dass sie sich mit Arbeiten beschäftigte, die ihr halfen, die Miete zu zahlen. Sie hatte versucht, andere Redakteure für den Fall zu interessieren – bei Zeitungen, Zeitschriften, sogar bei Radio und Fernsehen –, aber die hatten auch nicht angebissen.
Die kühlen mandelförmigen Augen wurden sanfter. »Tom ist ein Fels in der Brandung.«
Das war Tom, unerschütterlich wie ein Fels. Er war Gewerkschaftler, Stadtrat und sozialer Aktivist. Er war ein Mann aus dem Volk, der sich für das Volk einsetzte, und er kämpfte bereits sein ganzes Erwachsenenleben lang gegen Ungerechtigkeit. Er gab selbst zu, dass er nicht immer recht hatte, versuchte aber, kein Unrecht zu tun. Er glaubte, dass James Stewart unschuldig war, und das war’s für ihn. Das reichte aus, um Rebeccas Nachrichtengespür anzuregen, doch sie brauchte mehr als nur blinden Glauben.
»Das Problem war, dass ich bei den Medien kein Interesse dafür wecken konnte. Ich habe Ihnen das ja bereits erklärt«, sagte Rebecca. »Was die Medien betrifft, die halten James für schuldig. Fälle, bei denen es um Justizirrtümer geht, brauchen sehr viel Zeit, und die Medien haben keinen sonderlich großen Appetit auf Dinge, die auf lange Sicht angelegt sind, es sei denn eine Dokumentar-Redaktion beim Fernsehen interessiert sich dafür. Ohne neue Beweise, ohne frische Informationen war die Story für sie schlicht gestorben.«
»Aber das hat sich jetzt geändert.«
Es war eine Aussage, keine Frage.
»Ja«, antwortete Rebecca. »Die Banner, die Tom aufgehängt hat, sind eine Story, reichen zumindest dazu aus, ein anfängliches Interesse zu wecken.«
Rebecca deutete zu Chaz, der neben ihr saß. »Wir fahren heute dort hin, um es uns selbst anzusehen, obwohl natürlich die Möglichkeit besteht, dass die Banner inzwischen entfernt wurden. Tom hat mir aber ein paar Fotos geschickt. Wie gesagt, das sollte langen, um die Sache ein wenig anzuheizen.« Sie legte eine Pause ein. »Aber Tom hat mir erzählt, Sie hätten einen weiteren Durchbruch erzielt. Er hat mir nicht verraten, worum es sich dabei handelt. Er meinte, das stehe ihm nicht zu.«
Rebecca ließ das in der Luft hängen, hoffte, dass ihre Gesprächspartnerin darauf eingehen würde. Doch Afua Stewart änderte lediglich ihre Sitzposition, schwang ihre Beine herum, lehnte sich zurück und legte die Hände auf die Armlehnen des Sessels. Ihre langen Finger liefen zu sorgfältig manikürten Nägeln aus, die in einem weichen Silberton lackiert waren. Jede ihrer Bewegungen war von anmutiger Leichtigkeit und zeugte von ihrer Zeit auf dem Laufsteg. Es mochte über dreißig Jahre her sein, dass sie vor klickenden Kameras auf und ab geschritten war und posiert hatte, aber sie hielt sich auch jetzt noch hervorragend. Sie wartete ab, dass Rebecca weiterreden würde, war offensichtlich nicht dazu aufgelegt, ihr die Sache leicht zu machen. Aber warum sollte sie auch? Sie traute der Presse nicht über den Weg. Zu viele Versprechungen und nicht genug Taten.
Die Banner sollten ausreichen, um etwas loszutreten, aber Rebecca wollte – nein, musste – mehr über die neuen Informationen herausfinden. War es möglich, damit eine neue Ermittlung loszutreten? Würde es ausreichen, um ein Berufungsverfahren zu erwirken oder zumindest die schottische Kommission zur Überprüfung von Strafsachen auf den Plan zu rufen?
Als Rebecca jedoch nun Afua Stewarts ungerührte Miene betrachtete, spürte sie, dass sie diese Informationen hier nicht bekommen würde. Unter den Augen dieser Frau fühlte sie sich wie in einer kalten Nacht am Polarkreis ohne Unterhemd. O ja, Afua Stewart würde unbequem bleiben.
»MrsStewart«, sagte Rebecca und beugte sich vor, soweit es ihr auf dem traumhaft weichen Sofa gelang, das sie wie in einer Umarmung umfing. Wenn sie hier das Eis brechen wollte, musste sie den Abstand verringern, ohne der Frau zu nahe zu treten. Sie hätte auch aufstehen können, aber das wäre ein sehr unelegantes Manöver geworden, also entschied sie sich dafür, auf den vordersten Rand der Kissen zu rutschen. »Ich bin hier, um zu helfen, wenn ich kann.«
Ein Aufblitzen, ein wenig Feuer im Permafrost dieser blauen Augen. »Sie sind hier, weil Sie eine Story wittern.«
»Aber damit kann ich Ihnen helfen.«
»Ihnen liegt nichts an meinem James.«
»Ich kenne ihn nicht. Aber mir liegt etwas an Gerechtigkeit.«
Sobald sie die Worte über die Lippen gebracht hatte, war Rebecca klar, wie aufgeblasen und ichbezogen sie klangen. Auch bei Afua Stewart kamen sie nicht sonderlich gut an.
»Gerechtigkeit?« Rebecca spürte, dass die Frau geprustet hätte, wenn es nicht so unziemlich gewesen wäre. Wenn sie eines über Afua Stewart wusste, dann, dass sie stets die Contenance wahrte. Das war nicht nur in ihrer Modelvergangenheit begründet, ihr lag diese gefasste Haltung wohl in der DNA, sie reichte bis weit zu ihren Ashanti-Vorfahren zurück. Stolz. Zäh. Entschlossen. Prusten käme bei ihr niemals infrage. »Wo war denn die Gerechtigkeit, als das Verfahren gegen meinen James vor zehn Jahren durchgepeitscht wurde, mit euch Presseleuten als Helfershelfern? Niemand hat seine Version der Geschichte geglaubt. Er wurde von der Presse schon schuldig gesprochen, ehe die Geschworenen sich überhaupt zur Beratung zurückzogen.«
Rebecca hatte die Presseberichte gelesen, zumindest so viele, wie sie konnte. Man hatte James Stewart des Mordes an Murdo Maxwell für schuldig befunden. Maxwell, ein Rechtsanwalt und Umweltaktivist, hatte die schottische Regierung und die Regierung in Westminster beraten – und konfrontiert. Man hatte ihn erschlagen in seinem Landhaus Kirkbrig House in Appin aufgefunden, da, wo das Land sich ins Loch Linnhe hinein und am Wasser entlang in weitem Bogen nach Oban streckt. Man hatte James Stewart nackt und bewusstlos im Hauptschlafzimmer gefunden, mit Blut an den Händen und den Bettlaken und mit dem schweren Schürhaken, mit dem Maxwell ermordet worden war, neben sich auf dem Boden. Er und der fünfundfünfzigjährige Mann waren ein Liebespaar gewesen. Maxwells Sexualität war keineswegs ein Geheimnis gewesen, denn er hatte sich oft an Kampagnen für Schwulenrechte beteiligt, aber die Boulevardpresse hatte die Enthüllung seiner Affäre mit einem viel jüngeren Mann genüsslich ausgeschlachtet.
»Das ist mir klar«, sagte Rebecca, »und in gewisser Weise ist es auch wahr …«
»In gewisser Weise? Die haben meinen Jungen gekreuzigt! Er war schwul, außerdem schlief er mit einem älteren Mann, und was wohl noch schlimmer war, er war kein Weißer. Das hat sie an ihrer empfindlichsten Stelle getroffen. Für sie war er schuldig, und das war’s.«
Die Frau war verständlicherweise wütend, aber jetzt wurde sie unfair. Ja, gewiss, bestimmte Zeitungen hatten die Nase gerümpft, aber die Qualitätsblätter hatten ausgewogen und ohne Vorverurteilung berichtet. Natürlich brachte kein Bericht alles, was vor Gericht gesagt wurde. Da ging es um den schnellen Treffer, die griffige Schlagzeile, den Titel, der die meisten Clicks bringt, aber man achtete immer noch sorgfältig darauf, die Argumente der Anklage und der Verteidigung ausgewogen darzustellen, auch wenn man nicht über jeden Schluckauf und Rülpser berichtete. Auf James Stewarts Hautfarbe hatte man nirgends direkt Bezug genommen, aber Rebecca musste zugeben, dass sie in einigen Berichten einen gewissen Unterton bemerkt hatte.
»Ich verstehe, was Sie meinen, MrsStewart, aber Tom hat Ihnen sicher auch gesagt, dass ich nicht so bin.«
Afuas angespannter Kiefer wurde lockerer, aber nur ein wenig. »Ja, er spricht sehr lobend über Sie. Er glaubt, Sie seien anders als die anderen. Aber was können Sie tun, um uns zu helfen?«
»Wir sind eine kleine Presseagentur, aber meine Chefin, Elspeth McTaggart, hat sehr viele Kontakte.«
»Tom meinte, sie hätte aufgehört und Ihnen das Geschäft überlassen.«
»Sie hat sich ein wenig zurückgezogen, das stimmt, aber sie ist noch immer gut vernetzt. Im Grunde mache ich die Arbeit, und sie streicht den Gewinn ein.« Rebecca lächelte beinahe unmerklich. Das Lächeln wurde nicht erwidert. »Sie schreibt jetzt mit meiner Hilfe ein Buch über die Mordopfer, die man in Culloden und bei der Old High Kirk gefunden hat. Erinnern Sie sich?«
Afuas Miene verriet nicht, ob sie sich erinnerte oder nicht. Der Fall hatte einige Wellen geschlagen, also musste sie davon wissen. »Und deswegen sind Sie hier? Sie wollen wohl noch ein Buch schreiben?«
»Ich will nicht lügen, MrsStewart, das ist durchaus möglich. Aber zuerst einmal sollten wir bei der Justiz den Ball ins Rollen bringen. Und dazu brauchen Sie die Medien. Ich stimme Ihnen zu, vor zehn Jahren waren die nicht gerade hilfreich, aber jetzt können sie Ihnen helfen. Die Medien brauchen eine Story, und Sie brauchen jemanden, der Ihnen helfen kann, den Medien diese Story zuzuspielen.«
»Sie zu steuern?«
Rebecca schüttelte den Kopf. »Nein, ich werde die Fakten nicht steuern, MrsStewart. Ich werde die Sache nachverfolgen, soweit ich kann, aber ich werde nichts manipulieren und nichts unterdrücken. Um es ganz unverblümt zu sagen: Sollte ich etwas finden, das Ihrem Sohn nicht hilft, so werde ich es nicht ignorieren. Ich will nichts als die Wahrheit, oder das, was der Wahrheit am nächsten kommt.«
»Und Sie glauben, dass Sie die Wahrheit erkennen werden, wenn Sie sie sehen?«
Rebecca legte eine Pause ein und versuchte krampfhaft, sich an Worte zu erinnern, die sie einmal in einem Buch gelesen hatte. »Ich möchte Ihnen etwas über die Wahrheit erzählen, MrsStewart. Erinnern Sie sich an den Zauberwürfel?« Die Frau nickte. »Nun, die Wahrheit ist wie dieser Zauberwürfel. Wenn man den zum ersten Mal sieht, scheint alles richtig und in Ordnung zu sein. Alles ergibt einen Sinn, ist am richtigen Platz, alle Farben passen zusammen. Dann kommt jemand und dreht daran, und alles sieht auf einmal nicht mehr so wohlgeordnet aus. Die Farben sind noch da, aber sie sind verschoben. Ein paar weitere Drehungen, und es ist sogar noch schlimmer. Es ist vielleicht noch ein Muster erkennbar, auf eine abstrakte Weise sieht es auch noch gut aus, aber es ist nicht mehr wie zuvor. Wenn man kein Experte ist oder wirklich Mühe darauf verwendet, bekommt man es vielleicht nie wieder so hin wie am Anfang.«
»Was wollen Sie damit sagen?«
»Dass ich vielleicht nur eine oder zwei Seiten der ursprünglichen Version des Würfels hinbekomme. Der Rest könnte völlig chaotisch bleiben.«
»Mit anderen Worten, Sie haben das Gefühl, dass wir niemals die ganze Wahrheit herausfinden werden?«
»Mit anderen Worten, MrsStewart, ich bin bereit, den Versuch zu unternehmen.«
Eine gefühlte Ewigkeit saß Afua Stewart schweigend da und starrte Rebecca mit ihren kühlen blauen Augen an. »Dann bemühen Sie sich, das zu tun, Ms Connolly.« Sie war ein wenig aufgetaut, aber nicht so sehr, dass sie Rebecca beim Vornamen nannte. »Mein Sohn sitzt lange genug im Gefängnis.«
6
Ich schreibe dieses Tagebuch auf Anraten einer Betreuerin. Sie glaubt, wenn ich meine Gedanken zu Papier bringe, könnte mir das vielleicht helfen, in dem Chaos in meinem Kopf einen Sinn zu entdecken. Ich hasse es hier. Ich hasse, was mit mir geschehen ist. Ich hasse, wie die Zeit innerhalb dieser Steinmauern vergeht. Ich habe schon früh herausgefunden, dass die Zeit hier drinnen gleichzeitig unwesentlich und wichtig ist. Im Großen und Ganzen gesehen ist der unaufhaltsame Marsch der Stunden hinter diesen Gittern und Mauern abstrakt; seine einzige Auswirkung auf mein Leben ist, dass es mich langsam, Minute für Minute, Stunde für Stunde, Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für unendliches Jahr näher ans Ende meiner Strafe bringt. Im Kleinen ist mein Tag reglementiert, in einen Stundenplan gepresst: wann ich aufstehe, wann ich esse, wann ich arbeite, wo ich arbeite, wann ich spazieren gehe, rede, pisse, scheiße. Alles wird mir diktiert. Ist meiner Kontrolle entzogen.
Zuerst wollte ich mich wehren, so wie ich das draußen getan hätte. Ich wollte um mich schlagen. Ich wollte wüten und schreien und alle und jeden anblaffen.
Aber ich wusste, dass ich das nicht konnte. Es hätte mir nur Einzelhaft eingebracht. Also habe ich mich beherrscht. Jetzt sitze ich hier und lasse das geschriebene Wort ausdrücken, was meine Zunge nicht sagen darf. Vielleicht hilft es ja doch.
Nur meine Schlafstunden sind noch mein eigenes Reich, denn wenn ich allein auf meinem Bett liege und den Geräuschen des Gefängnisses ringsum lausche – irgendwo werden Türen geschlossen, Schritte auf dem Korridor und auf den Treppen, Männer, die sich zur Ruhe legen und schnarchen und stöhnen und furzen –, erst dann bin ich Herr über meinen Körper, meine Gedanken, mein Schicksal. Ich kann schlafen oder nicht schlafen. Ich habe die Wahl, und niemand kann mich zwingen.
Seltsamerweise erfüllt mich die nächtliche Sinfonie jetzt mit einem Gefühl der Zugehörigkeit, als steckten wir alle zusammen in dieser Sache. Aber das stimmt nicht, überhaupt nicht. Denn die anderen Männer hier sind schuldig, und ich bin es nicht.
7
Joseph McClymont hasste es, wenn man ihn Wee Joe nannte. Er konnte es nicht leiden, wenn man ihn mit irgendeiner Verkleinerungsform anredete, zog es vor, Joseph genannt zu werden. Natürlich sprach ihn niemand von Angesicht zu Angesicht mit Wee Joe an; nicht einmal die, die ihn hassten. Sie wussten es besser. Er war 1,75 m groß, er war schlank und blass, er trug eine Brille, aber für klein hielt er sich nicht. Allerdings machte es die Sache auch nicht besser, dass sein Vater als Big Rab bekannt war. Sein ganzes Leben lang hatte sein Vater übermächtig über ihm aufgeragt, nicht nur, weil er eine kraftvolle Gestalt war, sondern weil er so viel erreicht hatte. Und wenn ihn die Leute Wee Joe nannten, hatte er das Gefühl, als wollten sie seine eigenen Leistungen schmälern. Schließlich war er es doch gewesen, der so vielen ihrer Unternehmungen eine legitime Fassade verliehen hatte, ihnen das solide Furnier der Ehrenhaftigkeit gegeben hatte, das nur ein ganzes Heer forensischer Buchhalter durchdringen konnte.
So groß war sein Vater heute nicht mehr, wie er da auf seinem Sessel hockte und durch das Fenster in den Garten hinter ihrem großen Haus starrte. Das Alter hatte ihn schrumpfen lassen. Die Muskeln waren geschwunden, die Haut hatte sich gestrafft. Nur der dichte Haarschopf war geblieben, früher dunkel, heute mattgrau. Ein Schlaganfall hatte ihn weiter geschwächt. Er konnte sich zwar im Haus bewegen, aber er war nicht mehr der Mann, der er einmal gewesen war. Seine Augen waren müde und hatten einen gehetzten Ausdruck. In den meisten Nächten suchten ihn Albträume heim, und Joseph hörte ihn Namen von längst verstorbenen Männern rufen.
Das Telefon in Josephs Hand vibrierte, und er schaute auf das Display. Der Anrufer hielt sich sonst streng an die Bürozeiten, also musste das, was immer es sein mochte, wichtig sein, wenn er an einem Samstagmorgen anrief.
»MrWilliams«, sagte er. Sie hielten ihre Kontakte streng geschäftsmäßig, dieser Mann und er: MrWilliams und MrMcClymont, wie es sich zwischen einem Mann und seinem Anwalt gehörte.