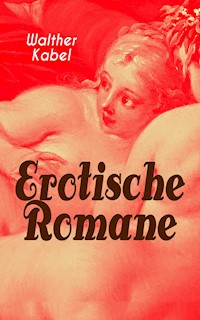Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Das Haus der Geheimnisse" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Walther Kabel (1878-1935) gilt als einer der meistgelesenen deutschen Schriftsteller der 1920er Jahre. Aus dem Buch: "Jane Wellesleys wahnwitziger Schrei, hervorgerufen durch namenlose Wut und Enttäuschung, war in demselben Moment fast erklungen, als die zweite Kugel über den blitzschnell samt dem Lehnsessel verschwindenden Fürsten hinwegpfiff. Sergius Ulminski hatte diesen versenkbaren Stuhl durch Gunnar Börtgen herstellen lassen, damit er, falls die Logenbrüder vielleicht einmal während einer Sitzung aus irgend einem Grunde sich gegen ihn auflehnen sollten, jeder Zeit in der Lage wäre, sich heimtückischen Angriffen zu entziehen. Er kannte eben die Wandelbarkeit der menschlichen Seele, kannte menschliche Schwächen, wußte, daß es vielleicht nur eines kleinen Anstoßes bedurfte, um die Männer, die seine gehorsamen Werkzeuge waren, völlig umzustimmen. Er versank durch den Druck auf die Rosette samt dem geschnitzten Sessel, und über ihm klappte dann der Fußboden wieder hoch, als ob hier nie ein Sessel gestanden hätte. Ulminski eilte sofort durch den kleinen Raum und einen schmalen Gang bis zu einer steilen Treppe, erklomm diese und drückte oben an der Decke eine Falltür auf, die ihm in den Vorraum der unterirdischen Halle brachte. Kaum hatte er die Falltür wieder geschlossen, als Cesare Chivarri hier erschien. Der Italiener kehrte nach oben zurück, holte John, der gerade den Wagen hinausgelassen hatte, und meldete nun dem Fürsten, daß Dannick und die anderen Brüder zwei Spitzel festgenommenen hätten, die jetzt im Stalle lägen. Ulminski beriet sich mit Chivarri und John."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 556
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Haus der Geheimnisse
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel Wie Lori den Vater ganz verlor
Ein lauer, köstlicher Vorfrühlingsabend war’s. Selbst in den so stillen Straßen des Berliner Westens herrschte heute ein ungewohnt lebhafter Verkehr. Nach neuester Mode gekleidete Damen und Herren, die Bewohner dieses reichen Viertels, schlenderten jetzt gegen ein halb zehn Uhr dem nahen Kurfürstendamm zu, um dort in einem der zahlreichen Cafés den Abend zu verbringen.
Niemand von all diesen sorglosen Menschen achtete an diesem Abend des 25. April auf das ärmlich gekleidete junge Mädchen, welches mit einem länglichen Paket im Arm die Siegfriedstraße entlang hastete und dann im Hause Nummer 19 verschwand. Die Haustür war noch offen, da der Portier gerade damit beschäftigt war, die Treppenläufer abzunehmen, die morgens geklopft werden sollten.
Portier Minzlaff kannte Lori Battner von Ansehen schon und erwiderte ihren Gruß mit den freundlichen Worten:
„Die Jnädige is daheim, Fräulein. Arbeiten Sie noch immer für die olle Nepphenne?!“
„Ich muß ja,“ klang es leise zurück.
Dann war Lori Battner oben im vierten Stock angelangt und hob den Glockengriff an der rechten Flurtür. Hier war ein Messingschild mit der Aufschrift ‚von Rabinski‘ befestigt. Während das junge Mädchen nun wartete, dachte sie über Portier Minzlaffs gallige Worte nach. Eine ungeheure Bitterkeit stieg in ihr hoch. Der Portier hatte ja nur zu recht, wenn er die Freifrau von Rabinski als Nepphenne bezeichnete. Lori wußte recht gut, daß die Dame für die gestickten Taschentücher und künstlerischen Schleier, die Loris fleißige Finger herstellten, gut das Doppelte von dem erhielt, was sie ihr und den anderen Frauen und Mädchen bezahlte, die sie durch verheißungsvolle Zeitungsannoncen anzulocken verstand. Aber um diese schamlose Ausnutzung fremden Fleißes kümmerte sich niemand. Im Gegenteil, die Rabinski tat stets noch so, als ob es ihr sehr schwer fiele, die Stickereien unterzubringen, und sorgte in raffiniertester Weise dafür, daß die armen Geschöpfe, die aus bitterster Not Tag und Nacht emsig die Nadel handhabten, nur um nicht in diesen trüben Zeiten verhungern zu müssen, die Angst nie loswurden, der karge Verdienst könnte plötzlich wieder ganz aufhören.
Die Flurtür öffnete sich, und eine hagere Dame mit kalten, hochmütigen Zügen ließ Lori Battner eintreten.
Es war die verwitwete Freifrau Xenia von Rabinski selbst, und Lori packte nun sofort im Flur auf einem kleinen Tischchen die sechs Taschentücher und die vier Schleier aus, wobei sie mit verstärkter Bitterkeit feststellte, daß aus der Küche lockende Bratendüfte bis hier in den Flur gedrungen waren.
Die Rabinski merkte offenbar nichts von der Not der Zeit! Und Loris Abendbrot hatte in ein paar kalten abgekochten Kartoffeln bestanden.
Die Freifrau begann jetzt wie stets die Ausführung der Arbeiten zu bemängeln.
„Sie lassen in Ihren Leistungen sehr nach, gnädiges Fräulein,“ meinte sie, indem sie das an einer goldenen Kette befestigte Lorgnon nicht von den Augen ließ. „Ich werde Ihnen Schleier zum Besticken nicht mehr anvertrauen können. Überhaupt, vorläufig habe ich kaum wieder Arbeit für Sie!“
Lori griff unwillkürlich mit der Hand nach dem Herzen.
Daheim der schwerkranke Vater, der Arzt, der bezahlt sein wollte, die Medikamente! Und – keinen Verdienst mehr!
„Mein Gott,“ rief sie in besinnungslosem Schreck, „dann – dann –“. Sie schwieg, wußte gar nicht, was sich ihr eigentlich an Worten wilder Angst hatte über die bebenden Lippen drängen wollen.
Ein lauernder Blick des hageren, trotz der fünfzig Jahre noch immer recht begehrenswert erscheinenden Weibes streifte Loris blasses, schmales Gesichtchen, dem die langbewimperten dunklen Augen einen ganz besonderen Reiz verliehen.
„Geht es Ihrem Vater denn schlechter?“ fragte die Rabinski nun mit gut geheucheltem Mitgefühl.
„Ja, sehr schlecht, Frau Baronin,“ schluchzte Lori auf. „Seien Sie barmherzig! Beschäftigen Sie mich weiter. Ich verlange auch keine bessere Bezahlung, obwohl –“. –
Sie konnte nicht weiter sprechen. Tränen erstickten ihre so köstlich wohllautende Stimme, die sich wie Musik ins Ohr schmeichelte.
„Haben Sie denn so gar keine Verwandten, die Ihnen helfen könnten?“ meinte die Rabinski mit einem erneuten lauernd prüfenden Blick, der offenbar jede Veränderung in Loris Zügen sofort herauszufinden trachtete.
Lori Battner schüttelte müde den Kopf. „Niemanden, Frau Baronin. Wir wohnen ja auch erst ein Jahr in Berlin, haben nicht einmal Bekannte, die sich unser annehmen würden.“
„Und – wo wohnten Sie früher?“
Lori zögerte etwas mit der Antwort. Beinahe wäre ihr die Wahrheit entschlüpft. Dann aber erinnerte sie sich noch zur rechten Zeit an die eindringlichen, so seltsam geheimnisvollen Worte ihres Vaters und erwiderte mit flüchtigem Erröten:
„In dem jetzt polnisch gewordenen Dorfe Seskowzo an der westpreußischen Grenze. Ich glaube, ich habe dies Frau Baronin schon einmal erzählt.“
„Möglich,“ sagte die Rabinski zerstreut. Sie hatte sehr wohl Loris leichte Verlegenheit bemerkt und war jetzt überzeugt, daß Lori Battner soeben gelogen hatte.
Sie überlegte rasch. Wenn sie den übernommenen Auftrag, der ihr hohen Gewinn abwerfen konnte, erfolgreich ausführen wollte, mußte sie unbedingt Loris Vater persönlich kennenlernen.
So erklärte sie denn nun mit gut geheuchelter Herzlichkeit, sie wolle unter diesen Umständen auf Loris Notlage Rücksicht nehmen und ihr ein neues Dutzend Batisttaschentücher und Schleier mitgeben.
Während sie dann Lori das Geld aufzählte, im ganzen sechshundert Mark, fügte sie hinzu:
„Ich werde Sie morgen mittag einmal besuchen, liebes Fräulein Battner. Ich habe da von einer reichen Dame einige Eßwaren zur Verteilung an wirklich Bedürftige erhalten. – Oh, danken Sie mir nicht. Ich helfe gern, wenn ich es kann. Leider lebe ich selbst in den bescheidensten Verhältnissen, wie Sie wissen. Auf Wiedersehen also –“. –
Inzwischen hatte Portier August Minzlaff eine recht merkwürdige Beobachtung gemacht, die ihn jetzt, als Lori die Treppen wieder herabkam, veranlaßte, ihr zuzuflüstern:
„Fräulein, entschuldigen Sie man, daß ick mir in Ihre Sachen einmische. Aber – nischt for unjut – da draußen treibt sich auf der andern Straßenseite wieder derselbe bucklige alte Kerl herum, den ich schon vor fünf Tagen sah, als Sie oben bei der Nepphenne waren. Wat is det eijentlich forn Kerl, Fräulein? Hat er Sie schon mal belästijt? Sie sind ja mit ’n mal janz schwach auf die Beene jeworden und so blaß – so blaß!“
Lori hatte sich wirklich an das Geländer gelehnt. Ein Zittern lief ihr über den Leib hin. Sie starrte Minzlaff so entsetzt an, daß der nun brummte:
„Soll ick den Kerl mal so ’nen kleenen Wink mit ’n Zaunpfahl jeben, daß er verschwindet, Fräulein? Ick tu’s jerne. Mir macht det nischt.“
„Nein, nein!“ rief Lori leise. „Der Mann ist mir ja noch nie zu nahe getreten. Nur – nur seit etwa vierzehn Tagen tauchte er stets in meiner Nähe auf, wenn ich ausgehe –“.
„Hm,“ meinte der Portier. „Det sieht ja jrade so aus, Fräulein, als hätten Sie wat berissen, und der Kerl wär’ ’n Kriminaler, wat man so ’nen Polizisten in Zivil nennt!“ Er schmunzelte dazu. „Ne, ne, ick weeß ja, daß dat nich stimmt, Fräulein. Ihnen braucht man bloß in die Augen zu sehn. Ihnen traut keener was Schlechtes zu!“
Lori hatte sich wieder gefaßt, nickte Minzlaff freundlich zu und erwiderte: „Ich bin ja nur durch die viele Arbeit so nervös geworden. Ich habe ja eigentlich gar keinen Grund, den Fremden irgendwie zu fürchten, zumal ich ja ganz in der Nähe, in der Gudrunstraße, wohne. Gute Nacht, Herr Minzlaff.“
Sie eilte die letzten Stufen hinab und zur Haustür hinaus.
Als sie sich auf der Straße flüchtig umschaute, bemerkte sie den Buckligen nirgends. So schritt sie denn auch nicht allzu schnell weiter, atmete tief die von Lenzesahnen erfüllte Abendluft ein und gedachte in stiller Dankbarkeit der Freifrau von Rabinski, von deren Charakter sie heute ein so ganz anderes Bild erhalten. Sie schämte sich fast, diese Dame bisher so falsch beurteilt zu haben, die nun doch aus reiner Nächstenliebe für den kranken Vater sorgen wollte. –
Die Gudrunstraße war die nächste Parallelstraße der Siegfriedstraße. Hier bewohnte Albert Battner mit seinem einzigen Kinde in einem modernen Miethause fünf Treppen hoch nach vorn heraus ein Mansardenstübchen und eine schräge Dachkammer, die gleichzeitig als Küche diente. Nur die Wohnungsnot hatte aus diesen beiden Bodenräumen eine menschliche Behausung gemacht. Ein Zufall war’s gewesen, daß Albert Battner vor einem Jahr den Hauseigentümer kennenlernte, der ihm dann aus Mitleid das Stübchen und die Kammer überließ, die bisher nie bewohnt gewesen.
Das Haus Gudrunstraße Nummer 20 machte schon von außen einen sehr vornehmen Eindruck. Nur im Erdgeschoß und im vierten Stock gab es je zwei Wohnungen. Die übrigen Etagen enthielten jede nur eine Achtzimmerwohnung, so daß im Vorderhause neun Familien, Battners mitgerechnet, wohnten.
Die Treppen waren mit hellgrauen Plüschläufern belegt. Der Fahrstuhl, reich verziert und stets in Ordnung, war für Lori Battner freilich wertlos, da der Portier Huberke, ein ganz anderer Mann als der gemütliche Minzlaff, ihr die Benutzung verboten hatte. Emil Huberke trug es den beiden Battners noch immer nach, daß er die Mansardenstube, wo er allerlei alte Möbel untergestellt gehabt, ihretwegen hatte freimachen müssen.
Als Lori die Treppen emporeilte, begegnete sie dem Mieter der Frau Rechnungsrat Prutz aus dem vierten Stock rechts, dem Engländer Stuart Jameson, der sie immer höflich grüßte und Lori nun mit seinen harten grauen Augen scharf ins Gesicht sah.
Lori dankte nur sehr kühl. Sie konnte Jameson nicht recht leiden, obwohl sie nicht wußte, weshalb.
Nun schloß sie die eiserne Vorbodentür auf und betrat gleich darauf das Stübchen, in dem nur ein winziges Petroleumsparlämpchen brannte.
Links neben der Tür lag Albert Battner, ein greisenhaft wirkender bärtiger, totenblasser Mann, in einem eisernen Feldbett. Lori setzte sich sofort auf den Stuhl am Kopfende des Bettes, nahm des Vaters kalte Hand und fragte ängstlich, ob er sich noch immer so schwach fühle.
Battner hüstelte röchelnd und quälte mühsam die Worte hervor: „Nein, Kind, etwas besser fühle ich mich, – etwas!“
Lori merkte, daß der Kranke sie nur beruhigen wollte.
Ein Schauer lief ihr über den Leib. Des Vaters eisige Hand fühlte sich wie die eines Toten an.
„Kann ich dir irgend etwas Warmes zubereiten?“ fragte sie sanft. „Vielleicht Tee, Vater? Friert dich etwa?“
„Nein, meine Lori –“. Er drückte ihre Hand voll inniger Zärtlichkeit. „Spare nur das Gas, Kind. Mir brauchst du keinen Tee aufzubrühen –“. Ein neuer Hustenanfall erstickte das, was er noch hinzufügen wollte.
Lori füllte schnell einen Eßlöffel aus einem Medizinfläschchen, stützte den nach Luft Ringenden und flößte ihm die beruhigenden Tropfen ein.
Nun lag Albert Battner ganz still in den Kissen. Seine Tochter hielt wieder seine Hand. Aus der vierten Etage, aus der Wohnung der Filmdiva Erna Maletta, drang Klavierspiel bis in das Stübchen hinauf, ein leichtsinniger Walzer.
„Vater, morgen wird die Baronin Rabinski zu uns kommen und dir allerlei Lebensmittel bringen,“ sagte Lori.
Albert Battner lächelte trübe. – Morgen – morgen?! Für ihn gab es kein ‚morgen‘ mehr! Er fühlte ja, wie die Eiseskälte von den Beinen immer höher kroch – höher zum Herzen hinan. Und trotzdem fühlte er eine so traumhafte, beseligende Ruhe im ganzen Körper, so etwas von überirdischem Wohlbefinden. Er wußte, daß dies die Vorboten des nahen Todes waren.
Wieder drückte er seines Kindes Hand, flüsterte dann: „Lori, hole mir den Koffer, den gelben Koffer –“.
Eine seltsame Erregung durchzitterte seine Stimme.
„Zünde auch die Gaslampe an –“ flüsterte er weiter. „Ich will zum letzten Male das sehen, was – was du noch nie – nie geschaut hast. Hole den Koffer!“
Das Gas puffte auf. Es wurde hell in dem ärmlichen Stübchen.
Dann mußte Lori den großen gelben Lederkoffer aufschließen. Er war leer.
„Hebe den Boden heraus, Kind,“ flüsterte Battner. „In der einen Ecke wirst du einen Messingknopf bemerken. Schiebe den Knopf zur Seite –“.
Lori schaute den Kranken überrascht an. Bisher hatte sie nie geahnt, daß der Koffer einen doppelten Boden hatte.
Der schnellte jetzt von selbst nach oben. In dem flachen Versteck lagen drei Bündel Papiere und ein länglicher schwarzer, ganz flacher Kasten.
„Gib ihn mir,“ hauchte Battner.
Er öffnete ihn.
Lori stieß einen leisen Schrei aus.
Der Kasten war mit schwarzer Seide gepolstert, und auf dieser schwarzen Seide gleißte und sprühte es in allen Farben.
„Diamanten,“ röchelte Battner und wühlte mit den bebenden Fingern in den losen Steinen.
„Diamanten – alles wasserklare Diamanten – heute wohl Millionen wert –“ raunte der Sterbende mit erlöschender Stimme.
Lori regte sich nicht. Wie gebannt starrte sie auf diese Juwelenpracht.
Da schlug Battner den Deckel wieder zu.
„Lori – nimm jetzt die Papiere aus dem Koffer,“ sagte er mit kaum noch verständlicher Stimme. „Verbrenne sie dort im eisernen Ofen – sofort – sofort! Gehorche, Kind! Nachher will ich dir die – die Geschichte dieser Diamanten erzählen.“
Das junge Mädchen schüttelte den lähmenden Bann von sich ab, warf die drei Bündel Papiere in den Ofen und steckte sie mit einem Streichholz in Brand.
Gierig fraßen die Flammen weiter.
Lori wandte sich dem Bett wieder zu. Da glitt der schwarze Koffer langsam von dem Zudeck herab, polterte auf den Fußboden.
Albert Battner bäumte sich noch einmal im Todeskampf empor, sank zurück.
Mit einem jammervollen Aufschrei fiel Lori vor dem Bett in die Knie, gab dabei dem schwarzen Kasten unbeabsichtigt einen Stoß, daß er bis hinten an die Wand weiterflog.
Sie tastete nach der Hand des Vaters, sie fühlte keinen Pulsschlag mehr.
„Tot – tot!“ wimmerte sie. „Nun bin ich allein, ganz allein!“ Ihre Tränen perlten auf die magere Totenhand.
Dann erhob sie sich langsam. Unklar kam ihr zum Bewußtsein, daß sie jetzt Pflichten hätte, daß sie einen Arzt holen müsse, der den eingetreten Tod bescheinigen sollte.
Der harte Daseinskampf des letzten Jahres hatte aus der einst so sorglos – fröhlichen Lori Battner ein selbständiges, zielbewußtes junges Weib gemacht. Sie stellte den gelben Koffer bei Seite. Sie dachte wohl an den schwarzen Kasten mit den Diamanten, an dieses Geheimnis, das nun vielleicht für immer Geheimnis bleiben würde. Mochte der Kasten vorläufig dort unter dem Bett liegen. Nachher würde sie ihn wieder in dem Koffer verbergen.
Vor der Haustür aber prallte sie zurück. Sie war gegen einen Menschen gelaufen, der hier durch die Türscheiben auf die Straße hinaus gespäht und sie nicht kommen gehört hatte.
Ein greller Lichtschein flog über ihr Gesicht hin, erlosch wieder, und der Engländer Stuart Jameson sagte, indem er an den Hut faßte:
„Entschuldigen Sie, Fräulein Battner. Ich wollte gerade die Tür aufschließen,“ – er klapperte mit den Schlüsseln und öffnete die Tür halb. „Haben Sie noch eine Besorgung vor?“ fragte er dann. Er sprach das Deutsche recht fließend.
„Mein – mein Vater ist soeben – gestorben,“ schluchzte Lori. Und abermals überkam sie nun der ganze Jammer ihrer plötzlichen Vereinsamung. Weinend eilte sie an Jameson vorüber und quer über die Straße, wo in Nummer 106 der Sanitätsrat Doktor Brunn wohnte, der ihren Vater behandelt hatte.
Sie sah nicht, daß im Schatten einer Haustür derselbe graubärtige Bucklige stand, der sie in letzter Zeit so hartnäckig verfolgt hatte. Sie preßte das Taschentuch gegen die Augen, und unwillkürlich rief sie im Übermaß ihres Schmerzes halblaut vor sich hin:
„Allein bin ich jetzt – ganz allein!“ –
Doktor Brunn war daheim und bat Lori zu warten. Er würde sofort mitkommen.
Fünf Minuten später schritt er mit ihr dem Hause Nummer 20 zu, tröstete sie und fragte, ob sie wünsche, daß die Leiche sofort weggeschafft würde, da die Wohnung doch so eng sei.
„Nein,“ meinte Lori. „Nein, Herr Doktor. Ich habe meinen Vater viel zu lieb gehabt, als daß ich mich jetzt, wo er tot ist, vor ihm fürchten sollte.“
Dann stiegen sie die Treppen empor, dann schloß Lori die Tür des Stübchens auf. Die Gaslampe brannte noch.
Aber – ein Blick nach dem Bett hin ließ Lori fast erstarren.
Das Bett war leer.
Doktor Brunn schaute Lori fragend an, lächelte. „Ihr Vater dürfte doch wohl –“. – Er schwieg. Lori war in ihre Kammer geeilt, hatte ein Streichholz angezündet.
Nichts – nichts! Nur das eiserne Bett, der Herd und die anderen Möbelstücke. Auch hier war der Vater nicht. –
Brunn begann Lori auszufragen. – „Wir haben nur einen Türschlüssel,“ erklärte sie. „Die Fenster sind von innen verriegelt, Herr Doktor, wie Sie sehen. Und – der Vater war tot! Das weiß ich bestimmt. Jedenfalls – man kann seine Leiche nur gestohlen haben. Wie sollte er sich entfernt haben, Herr Doktor?!“ – Sie sagte all das mit fast unnatürlicher Ruhe. Sie sprach die Worte wie mechanisch vor sich hin und dachte dabei nur an all die Geheimnisse, die mit der Person des Toten verknüpft gewesen, besonders an das letzte Geheimnis, das der Diamanten in dem schwarzen Kästchen.
Das schwarze Kästchen!
Ob es etwa auch verschwunden war?! Ob es noch unter dem Bett hinten an der Wand lag?!
Wie gern hätte Lori sich davon überzeugt! Aber sie durfte es nicht! Sie hätte sonst ja dem menschenfreundlichen Doktor Brunn mitteilen müssen, was es mit diesem Kästchen auf sich hatte. Aber eins tat sie jetzt doch. Sie erzählte ihm von dem buckligen alten Manne, der ihr in letzter Zeit nachgeschlichen war und den auch der Portier Minzlaff aus der Siegfriedstraße bemerkt hatte.
Doktor Brunn erklärte darauf mit einer gewissen Erregung, daß man den Vorfall hier, das Verschwinden Battners, unbedingt sofort der Polizei melden müsse. „Kommen Sie also mit,“ fügte er hinzu, indem er Lori aufmunternd zunickte. „Ich will jetzt so etwas für Sie sorgen, liebes Fräulein Battner. Sie sollen sich nicht so verlassen fühlen. Sie kennen ja auch meine Frau bereits. Auch bei ihr werden Sie jeder Zeit Rat und Hilfe finden.“
2. Kapitel Baron Rabinskis Tod
Lori bedankte sich mit Tränen in den Augen. Aus dem klugen Gesicht des bereits bejahrten Arztes strahlten ihr so viel reine Güte und inniges Mitgefühl entgegen, daß sie sich jetzt plötzlich wie geborgen fühlte.
Abermals verschloß sie nun den Stubeneingang und die eiserne Vorbodentür auf das sorgfältigste und folgte dem Sanitätsrat die Treppen hinab.
Als sie den Treppenabsatz des vierten Stocks erreicht hatten, blieb Lori stehen und tastete nach dem Knopf der elektrischen Nachtbeleuchtung.
In demselben Moment erscholl aus der Wohnung der Filmschauspielerin Erna Maletta ein so wahnwitziger Schrei, daß Lori vor Entsetzen dem Sanitätsrat in die Arme taumelte.
Dann wurde die Flurtür linker Hand aufgerissen, und im hellen Lichtschein der Flurlampe stürzte die bekannte Filmdiva mit schreckverzerrtem Gesicht in das Treppenhaus.
„Mord – Mord – zu Hilfe!“ gellte ihr Schrei durch das stille Gebäude.
Plötzlich gewahrte sie die beiden rechts neben dem geschlossenen Türflügel stehenden Gestalten Loris und des Sanitätsrats, fiel gegen die Tür zurück und brach ohnmächtig zusammen.
Zitternd umklammerte Lori den Arzt. „Welch furchtbare Nacht,“ flüsterte sie und schaute mit weiten, vor Grauen halb verschleierten Augen auf die bewußtlose Filmdiva, deren kostbarer Spitzenmorgenrock sich verschoben hatte und den zierlichen, mit Seidenflorstrumpf und rotem Saffianschuh bekleideten Fuß und den wundervoll geformten Wadenansatz sehen ließ.
Doktor Brunn machte sich sanft aus Loris Armen frei.
„Fassen Sie sich, mein Kind!“ sagte er mit freundlichem Ernst. „Hier haben Sie meinen Hausschlüssel. Verlangen Sie nur getrost bei mir Einlaß und bitten Sie meine Frau, daß sie Ihnen für die Nacht ein Bett herrichtet und die Polizei sofort telephonisch verständigt. Ich muß vorläufig hier bleiben. Gehen Sie, Kind. Es sollen an die Spannkraft ihrer Nerven nicht noch mehr Anforderungen gestellt werden.“
Lori zauderte. Wieder kam ihr das flache, schwarze Diamantkästchen in den Sinn. Durfte sie die kleine Mansardenwohnung die ganze Nacht über ohne Aufsicht lassen? Sollte sie nicht lieber des Arztes gütiges Angebot ablehnen? Aber – wie konnte sie diese Ablehnung nur begründen?!
Dann fiel ihr ein, daß die Polizei ja fraglos sehr bald Zutritt zu dem Stübchen verlangen würde, aus dem ihres Vaters Leiche soeben verschwunden war.
„Herr Sanitätsrat,“ erklärte sie daher hastig, „Sie können ja das Telephon Fräulein Malettas zu der Meldung benutzen. Die Polizei wird doch daraufhin sehr bald hier erscheinen, und dann muß ich dabei sein, wenn die Beamten sich unsere Wohnung ansehen wollen. Ich werde wieder nach oben gehen und Sie dort erwarten.“
Brunn blickte sie forschend an. Er hatte sehr wohl bemerkt, daß Lori Battner nach Gründen gesucht hatte, um seinen Vorschlag, die Nacht über sein Gast zu sein, mit Anstand ablehnen zu können. Ein unbestimmtes Mißtrauen gegen das junge Mädchen regte sich plötzlich in seiner menschenkundigen Seele. Das Verschwinden ihres Vaters, der angeblich tot gewesen sein sollte, erschien ihm mit einem Male in ganz anderem Lichte. Er hatte ja als Arzt längst gemerkt, daß die Vergangenheit dieses Mannes dunkle, merkwürdige Rätsel bergen müsse. Nie hatte Battner über sein früheres Leben sich irgendwie geäußert. Und auch seine Tochter hatte in dieser Beziehung sich sehr verschlossen gezeigt.
All dies schoß dem Sanitätsrat jetzt blitzschnell durch den Sinn. Dann erwiderte er in kühlerem, nicht mehr so väterlich gütigem Tone.
„Sie haben ganz recht, Fräulein Battner. Es ist der Polizei wegen wirklich besser, wenn Sie jetzt in Ihrer Wohnung bleiben. Auf Wiedersehen –.“
Lori empfand deutlich die plötzliche Kälte in seinem Benehmen. Ach – wie unendlich schmerzte sie dieses veränderte Wesen. Tränen traten ihr in die Augen. Beide Hände preßte sie auf ihr armes, einsames Herz, das jetzt in so dumpfen, verzweifelten Schlägen rascher und rascher pochte. Und doch – sie konnte Doktor Brunn ja niemals erklären, weshalb sie lieber allein in dem ihr jetzt unheimlichen Mansardenstübchen weilen wollte, als von seiner Gastfreundschaft Gebrauch zu machen! Sie durfte es nicht! Und nie, nie würde ihre Zunge über diese düsteren Rätsel sich äußern dürfen, die ihres Vaters Person einhüllten wie ein schwarzer, undurchdringlicher Mantel.
„Auf Wiedersehen,“ sagte sie ebenfalls, aber leise, klagenden Tones.
Dann schlich sie die Treppe zum Boden hinan, öffnete die eiserne Tür, schloß hinter sich ab und tastete nun im Dunkeln nach dem Schlüsselloch der Stubentür.
Sie mühte sich lange umsonst.
Da – plötzlich ging die nach innen schlagende Tür von selbst auf.
Loris Arme sanken schlaff herab. Ihre Augen glitten mit einem Ausdruck schreckhaften Staunens über die Gestalt hin, die jetzt vor ihr stand.
Dann stammelte sie kaum verständlich: „Oh mein Gott, was – was tun Sie – gerade Sie hier –?!“ –
Der Sanitätsrat hatte die Filmdiva mit Hilfe des inzwischen infolge der gellenden Rufe ebenfalls herbeigeeilten Grafen von Bruchsal, eines der Bewohner der dritten Etage, in das Schlafzimmer getragen, wo er sich nun um die Ohnmächtige bemühte, während der junge Graf auf seine Bitte hin das nächste Polizeirevier telephonisch anrief.
Erna erwachte. Mit einem Ruck richtete sie sich auf. Der Arzt stützte sie, fragte sanft:
„Was ist denn eigentlich geschehen, Fräulein?“
Die nachtschwarzen Augen des schönen, verführerischen Weibes irrten mit scheuer Angst nach der halb offenen Tür des Balkons hin, der nach dem Hofe hinaus lag und hier in Nummer 20 in jedem Stockwerk zu einem der Hinterzimmer gehörte.
„Dort – dort liegt er,“ flüsterte sie und streckte die mit blizenden Brillantringen besetzten, stark gepuderten Hände wie abwehrend nach jener Tür aus.
„Wer denn, Fräulein?“ forschte Doktor Brunn gespannt.
„Der – der Baron Hektor von Rabinski, der Sohn der Baronin Rabinski!“ stieß sie aufschluchzend hervor, schlug die Hände vor das Gesicht, brach in einen Strom von Tränen aus und jammerte mit wehen Lauten:
„Oh – wir hatten uns gezankt, Hektor und ich. Er ist so eifersüchtig! Er war furchtbar erregt und lief aus dem Salon hier ins Schlafzimmer, rief mir noch zu: ‚Laß mich eine Weile unbehelligt! Ich will auf dem Balkon frische Luft schöpfen! In dieser lasterhaften, parfümgeschwängerten Umgebung ersticke ich!‘“
Sie weinte stärker. –
Der Graf Udo von Brucksal hatte jetzt im Flur das Telephongespräch beendet und schlich lautlos auf die nur angelehnte Tür des Schlafzimmers zu.
Der Graf war ein schlanker Mann mit einem so mageren Gesicht, daß es bei seiner tiefen Blässe und den stets schwarz umschatteten Augen einem Totenkopfe glich. Er mochte etwa dreißig Jahre alt sein, hatte nur noch sehr spärliches Haar und trug ein Monokel ohne Fassung, das er jetzt mit dem Seidentuch dicht an der Tür zu putzen begann.
Immer weiter schob er den Kopf vor, um Erna Malettas Worte besser verstehen zu können.
Ganz regungslos verhielt er sich. Seine Körperhaltung verriet gespannte Aufmerksamkeit.
„Und dann?“ fragte des Sanitätsrats tiefe Stimme im Schlafzimmer. Er hatte sich auf den Rand des breiten französischen Bettes gesetzt, dessen Kissen und Decken mit mattgelber Seide überzogen waren, während über dem Bett eine farbige Seidenampel das mit raffiniertem Luxus ausgestattete Gemach mit einem milden, wollüstigen Licht übergoß.
„Dann – dann folgte ich Hektor nach einer Weile auf den Balkon,“ sagte die Filmdiva scheu. „Und – und da fand ich ihn – mit zerschmettertem Kopf – in seinem Blute schwimmend.“
„Waren Sie beide allein in der Wohnung?“ forschte der Sanitätsrat mit jäh erwachtem Argwohn.
„Ja. Ich hatte meine Köchin und mein Stubenmädchen heute abend beurlaubt.“
Doktor Brunn stand auf. „Ich werde mal nach dem Baron sehen,“ meinte er. „Er wird vielleicht nur verletzt sein –“.
Er ging auf den Balkon hinaus.
Wirklich, da lag ein Mann in einer großen Blutlache mit dem Gesicht auf dem Zementboden, halb zusammengekrümmt.
Brunn rieb ein Zündholz an, beugte sich vor, ohne sich dem Baron noch mehr zu nähern. Und er sah neben Hektor von Rabinskis Kopf eine schwere, gußeiserne, reich verzierte Ofenkrücke in Form eines altertümlichen Schwertes in zwei Teile zerbrochen liegen.
Er richtete sich wieder auf, nachdem er nach dem Puls des Barons gefühlt hatte, ging in das von süßlichen Duftwellen erfüllte Schlafzimmer zurück, stellte sich an das Fußende des breiten, vergoldeten Bettes und sagte leise:
„Es hätte keinen Zweck, Ihnen die Wahrheit zu verheimlichen, Fräulein Maletta. Der Baron ist tot. Er ist der zweite Tote heute Nacht in diesem Hause, denn Fräulein Battners Vater ist vor einer halben Stunde gleichfalls oben in der Mansarde gestorben. – Das heißt,“ fügte er hinzu, „wahrscheinlich ist er gestorben, denn – seine Leiche ist verschwunden!“
Erna Maletta hatte mit einem wehen Aufschrei den Kopf in die Kissen gewühlt, krallte die Hände in die knisternde Seide und weinte – weinte so jammervoll, daß Doktor Brunn sich im stillen fragte: ‚Spielt sie wirklich Komödie?! Wenn ihr Schmerz ehrlich ist, – wer sollte dann wohl den Baron mit der Ofenkrücke niedergeschlagen haben?!‘ –
Graf Brucksal lauschte noch immer vor der Tür des Schlafzimmers. Erst als der Sanitätsrat erklärt hatte, Hektor von Rabinski sei tot, entfernte er sich mit katzengleich lautlosen Schritten und geschmeidigen Bewegungen von der Tür, betrat den erleuchteten Salon der Filmdiva und huschte auf eine hohe japanische Vase zu, die auf einer Marmorsäule zwischen den beiden Fenstern stand.
Hier blickte er sich nochmals mißtrauisch um und ließ dann schnell einen kleinen Gegenstand in die Vase hinein fallen, machte mit einem wahrhaft satanischen Hohngrinsen kehrt und wartete dann im Flur, bis er draußen auf der Treppe Stimmen und flüchtige Schritte hörte.
Er öffnete die Flurtür und ließ die drei Kriminalbeamten ein, stellte sich ihnen mit liebenswürdiger Nachlässigkeit vor und deutete auf das Schlafzimmer.
„Doktor Brunn befindet sich dort,“ sagte er leicht näselnd. „Auch die – die Filmdiva. Hm ja – sie war ohnmächtig. Die Herren brauchen mich wohl nicht mehr. Mein alter Vater ist schwer krank und daran gewöhnt, nur von mir bedient zu werden. Guten Abend, meine Herren.“ – Er verbeugte sich steif und verließ die Wohnung der Maletta, stieg die Treppe ins dritte Stockwerk hinab und öffnete die Flurtür mit einem Sicherheitsschlüssel.
An dieser Tür war ein blankes Messingschild mit dem Namen ‚von Brucksal‘ angebracht. Der alte Graf bewohnte die aus acht Zimmern bestehende Etage bereits seit vier Jahren zusammen mit seinem einzigen Sohne Udo, einer Köchin und einem älteren Diener.
Udo von Brucksal schritt rasch in das Schlafzimmer des alten Grafen, der hier in einem gestickten Nachthemd im Bett lag und bisher gelesen hatte.
Der Graf Oskar von Brucksal, früher Eigentümer großer Güter, war ein bartloser, greisenhafter Mann. Irgend ein körperliches und seelisches Leiden hatte in sein vornehmes Gesicht tiefe Runen gegraben.
„Was ist oben bei der Maletta geschehen, Udo?“ fragte er jetzt mit matter Stimme.
Der Sohn erstattete kurz Bericht, während er im Zimmer auf und ab ging.
„Furchtbar – furchtbar!“ flüsterte der alte Graf zusammenschaudernd. „Also auch jener Mansardenbewohner ist gestorben, Udo?“
„Ja, Papa. – Rege dich aber nicht weiter auf. Ich werde dir jetzt das Schlafpulver geben, damit du eine ruhige Nacht hast.“ –
Er trat an das am Kopfende des Bettes stehende Nachttischchen heran, nahm einen silbernen Eßlöffel, tat etwas Streuzucker hinein und griff nach dem Schächtelchen mit den Pulvern, schüttte ein Pulver auf den Zucker, warf einen prüfenden Blick auf den Kranken und – ließ aus einem Glasröhrchen hastig eine wasserklare Flüssigkeit in den Löffel rinnen, goß nun aus der Karaffe noch Wasser hinzu und sagte:
„So, Papa. Bitte –“.
Der alte Graf schob den Löffel in den Mund, spülte dann den Zucker und den sonstigen Inhalt des Löffels mit einem Schluck Wasser hinunter und – verzog schmerzvoll das Gesicht.
„Oh – wie das Pulver heute auf der Zunge brennt,“ meinte er schwer atmend.
„Das bildest du dir nur ein, lieber Papa,“ sagte Udo mit heuchlerischer Harmlosigkeit. „Gute Nacht, schlafe recht gut, Papa!“
Er drückte des Kranken Hand und wandte sich rasch der Tür zu, damit der alte Graf nicht das triumphierende Lächeln bemerkte, das um des Sohnes schmale, grausame Lippen spielte.
Udo ging jetzt in seine Räume hinüber. Sein Schlafzimmer lag unter dem der Filmdiva. Als er es kaum betreten hatte, schlüpfte der alte Diener Friedrich Blunk durch die Tür, drückte sie ins Schloß und schaute Udo fragend an.
„Geglückt!“ hauchte Udo. „Halte dich also bereit, Robb. Er wird sterben, und dann – dann haben wir gewonnenes Spiel!“
Das schlaue, faltige Fuchsgesicht Friedrich Blunks leuchtete einen Moment förmlich auf in diabolischer Freude.
„Siehst du, mein Junge,“ flüsterte er dann, „das war ein feines Plänchen. – Wo hast du den anderen?“
„Dort!“ Und Udo von Brucksal deutete auf einen großen Reisekoffer, der an der einen Wand stand.
„Aha,“ lächelte Friedrich, „schon halb verpackt!“
Er hob den Kofferdeckel etwas an.
Ein blasses, bärtiges, leidvolles Totengesicht schimmerte matt in der Tiefe des Riesenkoffers.
Die drei Kriminalbeamten, die jetzt Erna Maletta und den Sanitätsrat vernahmen, waren der Kriminalkommissar Doktor Hubert Fink, der Kriminalassistent Wrobel und der Polizeianwärter Philipp Brex.
Die Vernehmung fand im Salon statt. Während Doktor Fink und der dicke Wrobel am Tische saßen, schnüffelte Philipp Brex überall umher, bis der Kommissar ärgerlich sagte:
„Zum Teufel, Brex, Sie machen mich ganz nervös. Setzen Sie sich doch. – Entschuldigen Sie,“ fügte er für die Diva und den Arzt hinzu. „Das ‚zum Teufel‘ ist mir so im Eifer des Gefechts entschlüpft.“
Der kleine, dürre Brex, der noch vor einem Jahr in einem Städtchen Westpreußens Winkelkonsulent gewesen war, dann aber der neuen polnischen Herren wegen die alte Heimat verlassen und in Berlin bei der Kriminalpolizei ein Unterkommen gefunden hatte, trat an den Tisch heran und meinte zu Fink:
„Herr Kommissar, zuweilen soll es vorkommen, daß in Vasen Dinge verschwinden, die erst zur Geltung kommen, wenn sie wieder ans Licht treten, was hier soeben geschehen ist. – Bitte, dies fand ich in der Vase!“
Fink griff nach dem ganz zusammengefalteten Stück Papier.
„Ich habe es schon gelesen,“ erklärte Philipp Brex. „Es ist ein Brief, den Fräulein Maletta an den Baron – den jetzt ermordeten Baron Hektor von Rabinski geschrieben hat und in dem es zum Schluß heißt:
‚Wenn Du mich mit Deiner lächerlichen Eifersucht weiter zur Verzweiflung treibst, werde ich mich von Dir zu befreien wissen. Ich bin kein Lämmchen, das geduldig alles hinnimmt! Merke Dir das!‘“
Der Kommissar überflog den Brief.
Erna Maletta war wie in einem Anfall von Schwäche in dem Sessel zusammengesunken, war totenbleich geworden.
Doktor Fink schaute sie forschend an. Ihr jetziges Benehmen verstärkte noch seinen Argwohn, den die ganzen Begleitumstände dieses Mordes bereits wachgerufen hatten.
„Der Brief klingt wie eine sehr ernste Drohung, Fräulein Maletta,“ meinte er mit schneidender Stimme. „Rabinski ist mit einer zum Ofen ihres Schlafzimmers gehörigen Krücke erschlagen worden – von hinten, wie der Befund ergeben hat. Sie waren mit ihm allein in der Wohnung. Und hier nun noch ein Brief, der nichts anderes als eine Drohung ist. Ich muß Sie verhaften – wegen Mordverdachts!“
Die Maletta stieß einen heiseren Schrei aus und sank erneut ohnmächtig auf den Teppich.
Zwanzig Minuten später wurde sie in einem Auto nach dem Polizeipräsidium am Alexanderplatz gebracht.
Als sie von Wrobel und Brex dort eingeliefert worden war, sagte der dürre Philipp, wie seine Kollegen ihn nannten, händereibend zu dem dicken Wrobel:
„Die Verhaftung ist ein Unsinn aber in diesem Falle ein zweckmäßiger Unsinn, mein lieber Wrobel. Die Maletta ist keine Mörderin, nein, den Baron hat jemand anders auf dem Gewissen. Ich werde jetzt nochmals nach der Gudrunstraße Nr. 20 fahren und mir die andere Geschichte, das Verschwinden der Leiche, aus der Nähe ansehen, zumal jetzt noch die Tochter Albert Battners ebenfalls spurlos sich in Nebel aufgelöst haben muß, denn wir haben sie ja nirgends gefunden, als wir in die Mansarde hinaufgingen und dort sowohl die eiserne Tür als auch die Stubentür weit offen sahen! Mein lieber Wrobel, dieses Haus Gudrunstraße Nr. 20 ist ein Haus der Geheimnisse! Es interessiert mich. Ich, Philipp Brex, der Dürre bin nicht gerade auf den Kopf gefallen, wie Sie wissen. Ich werde diese Geheimnisse ergründen, und wenn ich Tag und Nacht dort in Nr. 20 auf der Lauer liegen müßte. Adieu, Wrobel. – Zu deutsch – mit Gott, Wrobel! Auf Wiedersehen!“
Der kleine ulkige Kerl mit dem verkniffenen Clownsgesicht verließ das Präsidium und fuhr nach dem Hause der Geheimnisse.
3. Kapitel Der ersten Liebe Seligkeit …
Brex hatte schon vorher von Kommissar Fink die Erlaubnis eingeholt, in den Wohnungen der Maletta und Albert Battners noch in dieser Nacht weitere Nachforschungen anzustellen. Er war im Besitz des Haustürschlüssels.
Gegen halb zwei Uhr morgens stand er nun wieder in der Gudrunstraße vor Nr. 20 und schaute die dunklen Fenster entlang. Nirgends brannte mehr Licht. Die Bewohner waren zur Ruhe gegangen. Die Leiche Hektor von Rabinskis lag jetzt im Schauhause.
Brex schloß die Haustür auf, sperrte von innen wieder ab und lauschte.
Minutenlang blieb er horchend stehen.
Ah – oben im Treppenhaus irgendwo ein Geräusch.
Brex streifte rasch die Schuhe ab, eilte die Stufen empor – horchte weiter nach oben – horchte mit allen Sinnen.
Da – wieder das Knarren von Treppenstufen, das Klappen einer Tür.
Und jetzt – jetzt plötzlich sauste es aus der Höhe herab wie ein Hagel kleiner Steine.
Dann ein dumpfer Krach.
Nun wieder Totenstille.
Brex war von einigen der Steinchen getroffen worden, war stehen geblieben, wartete – wartete auf neue Geräusche.
Nichts – nichts.
Er schaltete seine Taschenlampe ein, beleuchtete die Stufen, fuhr zurück.
Auf dem grauen Plüschläufer sprühte und funkelte es. Brex bückte sich, sammelte vier – fünf Edelsteine auf, prüfte sie mit maßlosem Erstaunen.
‚Es sind echte Brillanten,‘ dachte er. ‚Ja, ich habe recht! Dieses Haus birgt mehr Geheimnisse, als die Phantasie eines Dutzends von Schriftstellern ersinnen kann!‘
Sein Gedankenfaden zerriß jäh.
Von oben her ein leiser Schrei – ein Schrei aus weiblicher Kehle, dann die flehenden, heiseren Worte:
„Nein – nein – niemals! … Lassen Sie mich allein – ich verdiene –“.
Nun klappte eine Tür.
Und – wieder war alles totenstill wie in einem düsteren Grabe.
Der Kriminalbeamte Philipp Brex, der soeben unbemerkt Zeuge gewesen, wie eine unbekannte Person von oben eine Menge Diamanten in das Treppenhaus hinab geworfen hatte, wartete abermals eine volle Viertelstunde, bevor er nun mühsam und lautlos beim Scheine seiner Taschenlampe all die losen Edelsteine zusammensuchte.
Dies nahm gut zehn Minuten in Anspruch. Im ganzen fand er fünfzig lose, ungefaßte wasserklare Brillanten.
Bei dieser Arbeit war er allmählich bis in den vierten Stock gelangt. Er war überzeugt, daß nur von hier aus jemand die Edelsteine in das Treppenhaus hinab geschleudert haben könne. – Wer aber, wer?!
Hier wohnte links die jetzt verhaftete Maletta, rechts die Frau Rechnungsrat Prutz. Über deren Türschild hing noch eine Visitenkarte, auf der zu lesen war:
Stuart Jameson, Kaufmann
Brex wollte jetzt gerade die Flurtür der Maletta aufschließen, als er im dritten Stock das Öffnen einer Tür und Stimmen hörte. Dann flammte die Nachtbeleuchtung auf.
Er beugte sich über das Geländer und erkannte den jungen Grafen Brucksal und einen älteren, bartlosen Mann in Dienerlivree. Beide trugen einen sehr großen Reisekoffer die Treppen hinab, und der Graf sagte ganz laut, als sie sich nun einmal ausruhten:
„Ich werde nur vierzehn Tage in dem Sanatorium bleiben, Friedrich, nicht drei Wochen, denn die Sorge um meines Vaters Gesundheit wird mir in Dresden doch keine Ruhe lassen. Sie geben den Koffer also sofort nach Dresden auf und bringen mir die Fahrkarte mit. Der Zug geht um acht Uhr morgens ab. Dann kann ich dem Papa vorher noch lebewohl sagen.“
Brex interessierte sich für die beiden nicht weiter. Was ging ihn der Graf Brucksal an?! Er hatte an anderes zu denken! – Er hörte noch, wie vor dem Hause der Geheimnisse ein Auto vorfuhr. Dann schloß er leise die Flurtür der Maletta auf und betrat die dunkle, leere Wohnung, denn die Köchin und die Zofe der Filmdiva hatten auf des Kommissars Doktor Fink Befehl ein anderes Unterkommen suchen müssen.
Philipp Brex schlüpfte ins Schlafzimmer. Die Tür war nur angelehnt.
Da – ein Schatten glitt vom Ofen her zur offenen Balkontür.
Ein Schatten – ein Mann!
Brex sprang mit gewaltigem Satz hinterdrein, schaltete gleichzeitig mit der Linken die Taschenlampe ein und sah noch, daß der Mann ein schwarzes Trikot und eine schwarze Maske vor dem Gesicht trug.
Der Eindringling schwang sich mit verblüffender Gewandtheit an einem Seil empor, das vom Dache herabhing.
Brex konnte nur noch seinen linken Fuß packen, mußte ihn aber wieder loslassen, da der Mann ihm mit dem anderen Fuß einen solchen Stoß gegen die Stirn versetzte, daß der kleine dürre Brex zurücktaumelte. Gewiß, der gab die Verfolgung deswegen nicht auf. Auch er war geschickt und kräftig, auch er kletterte nun an dem Seil, indem er gleichzeitig rief:
„Halt – oder ich schieße!“
Der Andere hatte schon das Dach erreicht, rief seinerseits leise und drohend mit seltsam krächzender Stimme:
„Wenn Sie nicht sofort sich wieder hinab gleiten lassen, schneide ich das Tau durch, und Sie fallen vielleicht in den Hof hinab!“
Brex schaute empor. Ein Messer blinkte im Sternenlicht in der Hand des Maskierten. Da begann die Klinge auch schon, das Seil zu durchsägen.
Brex gehorchte. Was hätte es auch für einen Zweck gehabt, wenn er hier vielleicht durch einen Sturz auf die Fliesen des Hofes den Tod fand?! Das, was er jetzt wußte, war ja außerordentlich wertvoll. Ein Mann in dem berüchtigten Anzug der Hoteldiebe war in die Wohnung der Maletta eingedrungen! Vielleicht war es sogar der Mörder des Barons Rabinski! Vielleicht ließ sich diese Fährte sofort weiter verfolgen.
Brex rutschte nach unten, erreichte das Balkongeländer, sprang von dort herab und eilte auf die Straße.
In wenigen Minuten hatte er die Polizei alarmiert, ließ nun das ganze Viertel umstellen und nach dem Manne im Trikot fahnden. Er selbst mit zwei Beamten stieg auf das Dach von Nummer 20, suchte hier nach Spuren des geheimnisvollen Maskierten.
Nichts entdeckte er – nichts!
Der Morgen graute. Die Polizei zog sich wieder zurück. Kriminalkommissar Doktor Fink, der inzwischen ebenfalls in der Gudrunstraße erschienen war, schritt mit Philipp Brex durch die noch stillen Straßen.
„Dieser Diamantenregen ist vielleicht das Seltsamste bei alledem,“ sagte Doktor Fink. „Die Steine haben heute einen Wert von mindestens dreihundert Millionen. Es sind alles wundervolle Exemplare.“
„Ja, ja,“ nickte der dürre Philipp, „das Haus der Geheimnisse wird uns noch so manches Rätsel aufgeben.“ –
Bald schossen dann auch die ersten Sonnenstrahlen über das Häusermeer der Millionenstadt Berlin hin, drängten sich auch durch den Spalt der Vorhänge in das behaglich möblierte Zimmer hinein und trafen das blasse, zarte Gesicht Lori Battners, die, den Kopf mit dem nur lose aufgesteckten prächtigen aschblonden Haar in die Hand geschützt, in den Kissen eines weißlackierten Bettes ruhte und mit trostlosen, vom Weinen geröteten Augen in das flimmernde Sonnenlicht schaute.
Ach, wie unendlich schwer war ihr doch zumute! Sie kam sich vor wie eine Gehetze, die vor dunklen Rätseln besinnungslos geflüchtet war.
Immer wieder rief sie sich die Vorgänge ins Gedächtnis zurück, die sich oben in dem Mansardenstübchen abgespielt hatten, nachdem die Tür sich von selbst geöffnet und sie in dem dort vor ihr stehenden Manne den Engländer Stuart Jameson erkannt hatte.
Jameson hatte ihr leise zugeflüstert: „Fürchten Sie sich nicht, Fräulein Battner, wenn jemand es gut mit Ihnen meint, dann bin ich es. Treten Sie ein. Ich will Ihnen etwas anvertrauen.“ Er sprach das Deutsche jetzt ohne jeden Akzent, dieser seltsame Mann mit den seltsamen, harten, durchdringenden Augen. „Ich bin Privatdetektiv, Fräulein Battner, heiße in Wahrheit Horst Olden und bin in Danzig zu Hause. Hier ist mein Ausweis nebst Photographie. – Um mich vorerst nur kurz zu fassen, ich wohne hier als Stuart Jameson seit drei Monaten in ganz bestimmter Absicht. Ich weiß, wo die Leiche Ihres Vaters hingeraten ist, darf es Ihnen aber vorläufig nicht sagen. Wenn Sie wünschen, daß alles aufgeklärt wird, was die Person Ihres Vaters an Geheimnissen umgab, dann befolgen Sie meinen Rat und kommen Sie mit zu Frau Rechnungsrat Prutz hinab, halten Sie sich dort so lange verborgen, wie ich es für zweckmäßig erachte, und tun Sie nichts, ohne mich vorher zu befragen.“
Lori starrte dem schlanken, ernsten Mann zagend in das schmale, energische, bartlose Gesicht. Aber aus seinen blaugrauen Augen leuchteten ihr jetzt so viel Mitgefühl und heiße Zärtlichkeit entgegen, daß sie plötzlich etwas wie ein beseligendes Glücksgefühl empfand und mit einem Male begriff, daß das, was sie bisher bei sich für Abneigung gegen den stets so höflichen Mieter der freundlichen Frau Rat gehalten, in Wahrheit etwas ganz anderes war, nämlich das scheue Zurückweisen einer keuschen Mädchenseele vor dem einen Manne, dem das jungfräuliche Herz bereits in unbewußter, aufkeimender Liebe seit dem ersten Anblick gehörte.
Lori schaute verwirrt zu Boden. In jäher Welle war ihr das Blut ins Gesicht geschossen. Dann hauchte sie, indem sie seine Hand ergriff, die er ihr entgegengestreckt hatte: „Ja, ich habe Vertrauen zu Ihnen, Herr Olden!“
Lori durchzuckte es wie ein Schlag, als Oldens Finger die ihren so fest umspannten und als er dazu mit werbender Zärtlichkeit sagte:
„Fräulein Lori, Sie werden es nie bereuen, meinen Rat befolgt zu haben. Nie werde ich Ihr Vertrauen mißbrauchen!“ Dann fügte er ernster hinzu: „Ich werde jetzt auf der Treppe lauschen, damit Sie nicht überrascht werden können, wenn Sie das Nötigste an Wäsche zusammenpacken. Schnell, beeilen Sie sich!“
Lori war nun in dem Stübchen allein. Hastig bückte sie sich.
Ah – das schwarze Juwelenkästchen war noch da!
Rasch umhüllte sie es mit ihrem Mantel, nahm aus dem Schranke ein Kleid, Wäsche, Schuhe, und legte alles in den gelben Lederkoffer.
Absichtlich ließ Horst Olden dann beide Türen offen, als sie lautlos in die vierte Etage hinabhuschten.
Olden war Frau Prutz’ einziger Mieter. Die Rechnungsrätin war noch auf, schloß Lori nun mit mütterlicher Zärtlichkeit in die Arme und führte sie in ihr eigenes Schlafzimmer, nachdem Olden ihr mit innigem Händedruck gute Nacht gewünscht hatte.
Frau Prutz ruhte nicht eher, bis Lori noch ein Glas Tee getrunken und ein paar belegte Brötchen gegessen hatte. Dann zog auch sie sich zurück.
Lori wollte sich entkleiden und dann niederlegen. Sie war ja zum Umsinken müde. Aber jetzt, wo ihr Horst Oldens von heimlicher Zärtlichkeit durchglühte Blicke und der gütigen Frau Prutz liebevoller Zuspruch fehlten, – jetzt kam sie sich mit einem Male wieder so einsam und verlassen vor, daß sie in Tränen ausbrach.
Im Dunkeln saß sie auf dem Bettrand und überlegte mit wachsender Angst, ob sie sich nicht irgendwie der Diamanten entledigen sollte, die der Vater ihres Erachtens niemals auf redliche Weise erworben haben konnte.
Dann war sie endlich zu einem Entschluß gelangt, schlich auf Strümpfen in den Flur, hielt das schwarze Kästchen an die Brust gedrückt, schloß beim Scheine eines Zündholzes die Tür auf und trat an das Treppengeländer.
So stand sie im Dunkeln, öffnete das Kästchen, kippte es um.
Der Edelsteinregen ergoß sich in die Tiefe des Treppenhauses.
Lori ließ auch das schwarze Kästchen fallen. Aber es blieb mit dumpfem Aufschlag ein paar Stufen weiter unten liegen.
Dann – dann tauchte neben ihr schattengleich eine Gestalt auf.
„Lori, was tun Sie hier,“ flüsterte Horst Olden.
Das junge Mädchen sah nur das schwarze Trikot, die schwarze Maske, fuhr mit einem Schrei zurück.
„Lori, ich bin’s ja,“ flüsterte Olden wieder und stützte die Wankende, zog sie sanft an sich.
„Lori, sagen Sie mir, was Sie hier taten,“ flehte er, und seine Stimme zitterte vor Erregung.
„Nein, nein – niemals!“ rief sie da in all der Zerrissenheit ihrer gequälten Seele. „Lassen Sie mich allein – ich verdiene –“.
Seine Hand verschloß ihr den Mund. Er hatte unten das Aufblitzen der Taschenlampe Brex’ bemerkt.
Er drängte Lori in den Flur. Er hatte vorhin noch gerade das Aufschlagen des Kästchens gehört. Er ahnte, daß Lori etwas weggeworfen hatte.
Er brauchte nicht lange zu suchen. Er fand das Kästchen, nahm es mit, drückte die Flurtür lautlos ins Schloß und folgte Lori in das behagliche Schlafzimmer, ließ seine Taschenlampe aufleuchten und fragte mit nur schwer bewahrter Ruhe:
„Wo – wo sind die Diamanten geblieben? – Antworten Sie!“
Seine Stimme klang rauh und befehlend.
Lori war auf einen Stuhl gesunken, hatte das Gesicht mit beiden Händen bedeckt und schluchzte.
„Wo sind die fünfzig Brillanten des Fürsten Jussugoff?“ fragte der Detektiv noch eindringlicher.
Lori schwieg, weinte still in sich hinein.
Olden schaltete die Lampe aus.
„Von jetzt ab betrachten Sie sich als meine Gefangene!“ stieß er heiser hervor. „Wagen Sie nicht zu fliehen! Morgen, wenn Sie mir bei Tageslicht gegenüberstehen, werde ich die Wahrheit erfahren! – Gute Nacht, Lori!“ – Die letzten Worte klangen wieder weicher, fast innig.
Dann ging er hinaus, schloß Lori ein und zog den Schlüssel ab.
Gleich darauf kletterte er vom Dache aus auf den Balkon der Maletta hinab, verschaffte sich Eingang in das üppige, luxuriöse Schlafzimmer, mußte aber sofort wieder vor Philipp Brex fliehen.
Lori starrte noch immer in die gleißenden Sonnenstrahlen. Nicht eine Minute hatte ein wohltätiger Schlummer sie all ihrer Sorgen und Kümmernisse entrückt.
Wie sollte sie wohl auch einschlafen können, wie sollte sie unter dem Ansturm all dieser Gedanken im Traume Vergessen finden?
Dem Fürsten Jussugoff sollten die Diamanten gehören?! Jenem vornehmen, alten Herrn, der den Vater so oft heimlich besucht hatte?! Wie aber war ihr Vater in den Besitz der Edelsteine gelangt – wie nur?! Und was wußte Horst Olden von alledem? War der etwa der Verfolger ihres Vaters? War der also ihr Feind, der nur darauf ausging, das Andenken des Toten, der nun spurlos verschwunden war, vor aller Öffentlichkeit in den Schmutz zu ziehen, indem er dessen Verfehlungen aufdeckte?
Lori stöhnte qualvoll auf und preßte die Hände gegen die Schläfen. Der Kopf drohte ihr zu springen. Allzu viel an unklaren Befürchtungen und an frischen Erinnerungen an die Vorgänge dieser entsetzlichen Nacht durchzuckten ihr Hirn.
Was hatte sie nur alles in diesen wenigen Stunden durchlebt, seit sie von der Baronin Rabinski heimgekehrt war! Der Tod des Vaters, das Verschwinden der Leiche, der Mord an Hektor von Rabinski auf dem Balkon der Maletta – oh, ihr armer Kopf faßte das alles kaum mehr. Und dann ihr hartnäckiger Verfolger, jener bärtige, bucklige Mensch! Ob es etwa Horst Olden in einer Verkleidung gewesen?
Mit einem wehen Aufschluchzen vergrub sie den Kopf in den Kissen. Ihr schlanker Mädchenleib bebte wie im Schüttelfrost. Sie kam sich wieder so von aller Welt verlassen vor! Niemanden – niemanden hatte sie, zu dem sie mit ihren Kümmernisse flüchten konnte! Selbst der gütige Doktor Brunn mißtraute ihr ja! Und die Freundlichkeit der Frau Prutz konnte genau so Heuchelei sein, wie die Horst Oldens.
Hatte sie denn wirklich so gar niemand, der sie schützen und ihr helfen wollte? Wirklich niemand?! – Ihr war plötzlich die Baronin Rabinski eingefallen.
Sie richtete sich wieder auf, trocknete die Tränen und überlegte.
Wenn sie zu der Baronin eilte, wenn sie dort Schutz suchte?
Aber – sie war ja eingeschlossen! Und dieses Zimmer lag im vierten Stock nach der Gudrunstraße hinaus.
Mit einem Male verließ sie dann ganz leise das Bett. Sie war zu einem Entschluß gelangt. Die Angst vor Horst Olden trieb sie zu einem tollkühnen Wagnis. Es war nicht allein Angst – es war, als ob sie vor der Gewißheit fliehen wollte, daß der Mann, dem ihr Herz jetzt in bangem Sehnen entgegenschlug, mit ihr nur ein verwerfliches Spiel trieb!
Lautlos kleidete sie sich an, vermied auch das geringste Geräusch.
Frau Prutz hatte ihre Sachen in den Kleiderschrank gehängt. Als sie diesen nun öffnete, bemerkte sie zu ihrer Überraschung einige Herrenanzüge darin. Sie besann sich, daß der einzige Sohn der Rechnungsrätin im letzten Kriegsjahr gefallen war. Es konnten nur die Anzüge dieses Sohnes sein, die Frau Prutz aus Pietät hier aufbewahrt hatte.
Lori durchzuckte ein neuer Gedanken.
Und sie, die durch Leid und Sorgen zu früher Energie gereift, zauderte nicht, einen der Anzüge, den schlechtesten, anzuziehen. Er war ihr etwas zu weit. Aber die Länge paßte.
Aus dem Bettlaken und drei Handtüchern, die sie fest zusammenknotete, stellte sie einen Strick her. Dann steckte sie die sechshundert Mark zu sich, die sie von der Baronin für die Stickereien erhalten hatte, ebenso ihre silberne Uhr und ein paar Andenken an den toten Vater.
Als sie das Fenster behutsam geöffnet hatte und hinausblickte, sah sie, daß die Gudrunstraße zu dieser frühen Morgenstunde noch völlig einsam dalag. Sie schaute dann an der Hauswand hinab, beugte sich noch weiter vor.
Ah – dort gerade unter diesem Fenster war ein Flügel des Fensters im dritten Stock halb offen.
Welch glücklicher Zufall! Lori schien es, als ob das Schicksal ihr diesen Fluchtweg erleichtern wollte.
Jetzt befestigte sie den weißen Strick am Fensterkreuz.
Noch ein kurzes, inbrünstiges Gebet, ein Flehen um den Beistand dessen, der dort allmächtig über den Wolken thronte.
Eisiges Furchtgefühl lähmte ihr trotzdem die Glieder, als sie unter sich die schreckliche Tiefe sah.
Wenn die Tücher rissen, wenn ein Knoten sich löste, dann – dann würde sie dort unten in dem kleinen Vorgarten auf der Steingrotte mit zerschmettertem Leibe liegen oder gar von den Spitzen des Eisenzaunes aufgespießt werden!
Aber – barg der Tod denn wirklich noch irgendwelche Schrecken für sie?! Wäre er nicht vielleicht sogar für sie eine Erlösung gewesen? Was konnte das Leben ihr, der Einsamen, noch bieten? Nichts – nichts, nur Sorgen und Aufregungen!
Ihre Angst schwand. Mit fast unnatürlicher Ruhe, die nur der Gleichgültigkeit gegenüber dem Tode zuzuschreiben war, begann sie an den Tüchern hinabzuklettern.
Als sie sich etwas vom Fenster nach abwärts entfernt hatte, warf ein Windstoß den einen Flügel klirrend nach innen.
Lori erschrak darüber so sehr, daß sie beinahe die Hände gelockert hätte. Sie rutschte ein Stück, krampfte die Finger dann wieder fester zusammen und erreichte glücklich den Fenstervorsprung des dritten Stocks, kletterte durch den offenen Flügel, den sie weiter aufschob, hinein und zog den dichten Vorhang beiseite.
Es war ein Schlafzimmer. Undeutlich erkannte Lori rechts an der Wand ein Bett und in den Kissen ein blasses, bartloses Greisenantlitz.
Sie wußte, daß hier der Graf Oskar von Brucksal mit seinem einzigen Sohne Udo und einem alten Diener namens Friedrich Blunk die ganze Etage bewohnte und daß der alte Graf seit Wochen schwer krank war.
Regungslos stand sie noch immer am Fenster und starrte auf das bleiche Gesicht, das etwas unheimlich Leichenhaftes an sich hatte.
Abermals lief ihr ein Eisesschauer über den Leib. Sie lauschte. Sie hörte keine Atemzüge. Sollte der Graf plötzlich verstorben sein?
Schritt für Schritt näherte sie sich nun dem Bett. Sie hatte den Grafen nur selten und aus der Entfernung vor dem Hause, zuweilen auf der Loggia gesehen. Er hatte ihr stets freundlich zugenickt.
Sie überwand ihre Scheu und beugte sich über den stillen Schläfer.
Kein Zweifel – er war tot!
Dann fuhr sie jäh in die Höhe.
Sie hatte Schritte vernommen, die sich langsam der Tür näherten.
Ihr entsetzter Blick glitt durchs Zimmer.
Da stand vor der einen Fensterecke ein altes, hochlehniges Sofa.
Lori besann sich nicht lange. Hinter dem Sofa in der Ecke war genügend Platz für sie. Sie eilte hin und war mit einem Satz auf der Sofalehne, ließ sich hinab, stand auf den Füßen, duckte sich zusammen.
Im selben Augenblick öffnete sich die Tür und Graf Udo, der Mann mit dem abschreckenden Totenkopfgesicht, trat auf Fußspitzen ein.
Und im selben Moment geschah noch etwas anderes.
Horst Olden, der angekleidet im Zimmer neben Loris Schlafgemach in einem Sessel dem Morgen erwartet hatte, war durch das Klirren der Fensterflügel argwöhnisch geworden und rasch in Loris Zimmer hinübergegangen, nachdem er auf sein wiederholtes Klopfen keine Antwort erhalten hatte.
Mit einem Blick sah er, was geschehen.
„Törichtes, liebes Mädchen,“ murmelte er und zog die zusammengeknoteten Tücher nach oben. „Du bist in die Höhle eines Tigers geraten! Aber – auch so werde ich dich schützen!“
So kam es, daß Graf Udo die Tücher vor dem offenen Fensterflügel nicht mehr bemerkte.
4. Kapitel Ein fürstlicher Verbrecher
Am Abend, der dieser Nacht vom 25. zum 26. April vorausging, also an demselben Abend, als Lori Battner die fertigen Stickereien bei der Baronin Xenia von Rabinski, dem trotz ihrer fünfzig Jahre immer noch verführerischen Weibe, abgeliefert und dabei mit tiefer Bitterkeit festgestellt hatte, welch köstliche Bratendüfte aus der Küche in den Flur drangen, hatte sich in der eleganten Wohnung der Witwe gegen zwölf Uhr eine Gesellschaft von etwa zwanzig Personen zusammengefunden, unter denen aber nur sechs Damen in recht kostbaren Gesellschaftskleidern und mit stark gepuderten Gesichtern jene Art von holder Weiblichkeit vertraten, die in Berlin in allen ‚vornehmen‘, das heißt teureren Vergnügungsstätten anzutreffen ist, also jene Halbwelt, die auf die Straßendirnen mit derselben Verachtung herabblickt, wie etwa der reiche Neger Neuyorks auf den schwarzen Hafenkuli New Orleans.
Die Gesellschaft hatte dann kaum im Speisezimmer an der reich gedeckten Tafel Platz genommen, als es abermals an der Flurtür läutete und noch ein verspäteter Gast, ein hagerer Herr mit faltigem Schauspielergesicht, eintrat, der dem ihm öffnenden Stubenmädchen sofort befahl, die Baronin in das Schlafzimmer zu rufen.
Das ganze Auftreten dieses Mannes, hinter dessen runden Brillengläsern ein paar stets halb zugekniffene Augen argwöhnisch spähend hin und her schweiften, hatte etwas Gebieterisches und unsagbar Stolzes an sich.
Die Zofe beeilte sich denn auch, ihrer Herrin einen Wink zu geben, daß Fürst Ulminski sie im Schlafzimmer erwarte.
Der Fürst hatte sich hier auf die Ottomane gesetzt und seinen spiegelblanken Zylinder neben sich gestellt, streifte nun langsam die Handschuhe ab und enthüllte zwei schmale, tadellos gepflegte und mit kostbaren Ringen besetzte Hände.
Die Baronin trat hastig ein.
„Durchlaucht, ist irgend etwas geschehen?“ fragte sie, indem sie dicht vor ihm stehen blieb.
Er war sitzen geblieben, hatte sie nur durch ein flüchtiges Kopfnicken begrüßt und sagte nun, indem er sich mehr zurückbog und ihr Gesicht beobachtete:
„Ihr Stiefsohn ist vor einer Stunde in der Wohnung der Maletta ermordet worden.“
Sie fuhr zurück.
„Ermordet?!“ stammelte sie. „Weswegen denn? Hektor war doch ein so harmloser Mensch!“ Sie hatte überraschend schnell ihre Fassung wiedergewonnen. „Wer ist denn der Mörder, Durchlaucht?“ fragte sie dann.
„Die Maletta ist’s!“
Die Baronin schüttelte wie ungläubig den Kopf.
„Das kann wohl nicht sein, Durchlaucht,“ sagte sie zögernd. „Erna Maletta hat Hektor geliebt, wenn er ihr auch zuweilen durch seine Eifersucht unangenehm wurde.“
„Gerade deshalb hat sie ihn ermordet. Er war ihr lästig geworden,“ meinte er mit eisiger Gleichgültigkeit. „Die Polizei hat im Salon der Maletta in einer Vase eine Art Drohbrief gefunden, den die Filmdiva an Ihren Stiefsohn geschrieben hat. Auf diesen Brief hin wurde die Maletta wegen Mordverdachts verhaftet.“
Die Baronin war wie von einer Natter gestochen zusammengezuckt. Mit weit aufgerissenen Augen starrte sie in das unbewegliche, leidenschaftslose Gesicht des Fürsten Sergius Ulminski.
„Das – das ist ja der Brief, den – den ich – Hektor auf Ihr Geheiß stehlen mußte,“ bebte es über ihre zitternden Lippen.
Der Fürst erhob sich langsam. Seine Stimme sank zum Flüstern herab. Aber seine Augen hatten einen schillernden Glanz bekommen.
„Xenia, Sie haben nie einen Brief gestohlen, nie! Verstehen Sie mich! Streichen Sie diesen Vorgang für immer aus Ihrem Gedächtnis!“
Sie ließ wie wehrlos den Kopf sinken, hauchte nur ein leises: „Ja – ich werde vergessen!“
„Und – und auch das andere vergessen Sie, Xenia,“ fügte der Fürst hinzu. „Nämlich den Auftrag, den ich Ihnen gab. Sie wissen, Sie sollten sich mit jenem Albert Battner anzufreunden suchen, sollten ihn aushorchen. Das ist jetzt unmöglich geworden. Battner ist tot, ist an diesem Abend gestorben. Hier –“ – er holte eine Brieftasche hervor – „hier haben Sie trotzdem die versprochenen zehntausend Mark.“
Er reichte ihr die Banknote. Gierig griff sie danach und bedankte sich wortreich. Dieses Weib, das die verkörperte Geldgier darstellte, tat alles für Geld, alles!
„Werden Sie heute nicht hierbleiben, Durchlaucht?“ fragte die Baronin dann.
„Nein. Ich habe etwas anderes vor. Auf Wiedersehen, Xenia.“
Wieder nickte er ihr nur flüchtig zu und verließ dann die Wohnung, stieg die Treppen hinab, blieb mit einem Male stehen, lauschte eine Weile und machte kehrt, eilte die Treppen bis zur Bodentür hinan, lauschte abermals, öffnete die eiserne Bodentür mit einem verstellbaren Patentdietrich und befand sich gleich darauf auf dem Dach des Hauses.
Mit sicheren, lautlosen Schritten setzte er hier seinen Weg fort. Er mußte diesen Weg schon häufiger zurückgelegt haben. Jedenfalls gelangte er in kurzem über die Dächer der Gartenhäuser bis zur Parallelstraße der Siegfriedstraße, bis – zum Haus der Geheimnisse!
Hier verschwand er in der Dachluke des Hofgebäudes, tauchte auf der Treppe wieder auf, überquerte den Hof und stieg im Vorderhause bis zum zweiten Stock empor. Auch diese Etage bildete eine zusammenhängende Achtzimmerwohnung wie die dritte, wo der Graf von Brucksal wohnte.
An dieser Flurtür im zweiten Stock war ein Messingschild mit der Aufschrift ‚Frau Queißner‘ befestigt.
Der Fürst blieb vor der Tür stehen, horchte, schob schnell den Schlüssel ins Schlüsselloch und trat ein, schloß hinter sich ab, legte die Sicherheitskette vor und durchschritt den langen Flur, öffnete eine Zimmertür und sah sich dem Grafen Udo von Brucksal gegenüber, der in diesem eleganten Herrenzimmer in einem tiefen Klubsessel saß und behaglich eine Zigarette rauchte.
„Wie steht’s?“ fragte Ulminski kurz. Auch jetzt hatte seine Stimme denselben gebieterischen Klang.
„Ich habe meinem lieben Papa die Tropfen gegeben,“ erklärte Udo mit einem teuflischen Grinsen. „Sie werden ihm hoffentlich zweckentsprechend bekommen.“
„Und was tut die Polizei?“
„Ja, da ist vorhin etwas sehr Merkwürdiges passiert. Der kleine Kriminalbeamte Philipp Brex hat im Treppenhaus Edelsteine aufgelesen, die jemand offenbar von oben heruntergeworfen hatte. Ich beobachtete ihn dabei.“
„Ah – Edelsteine?! Was hat das nun wieder zu bedeuten?!“ Der Fürst warf sich in einen zweiten Sessel und bedeckte die Augen mit der rechten Hand, sann angestrengt nach und sagte dann: „Wo steckt dieser Brex jetzt?“
„Wahrscheinlich noch im Hause. Ich konnte nicht länger auf der Treppe bleiben. Es war zu gefährlich. Ich mußte auch Robb, meinem Diener –“ – er lächelte spöttisch – „helfen, den Koffer nach unten zu schaffen. Robb ist jetzt damit zum Bahnhof unterwegs.“
„Und ‚er‘ ist in dem Koffer?“
„Natürlich. Die Komödie nimmt einen glatten Verlauf.“
„Dann kehren Sie jetzt in Ihre Wohnung zurück,“ befahl Ulminski. „Diesen Brex übernehme ich. – Noch eins! Wo mag nur die Lori Battner geblieben sein? Ich konnte hierüber mit Ihnen noch nicht sprechen.“
„Keine Ahnung!“
Der Fürst sprang auf und ging auf dem kostbaren Perserteppich hin und her.
„Ihr Verschwinden kommt mir wie eine Warnung vor,“ sprach er grübelnd vor sich hin. „Wir dürfen uns nicht zu sicher fühlen, Udo. Jedenfalls ist allergrößte Vorsicht geboten. Der geringste Fehler, und all unsere Pläne sind gescheitert!“
Der Graf verabschiedete sich. Ulminski ließ ihn zur Flurtür hinaus. Dann huschte Udo schnell die Treppe empor.
Sergius Ulminski legte jetzt Mantel und Hut ab und betrat ein anderes Zimmer, das mit geradezu verschwenderischer Pracht, aber feinstem Geschmack als Damensalon eingerichtet war.
Hier lag auf einem mit einem Eisbärfell bedeckten Diwan ein junges Mädchen, fast noch ein Kind. Sie trug einen roten, goldgestickten Kimono und auf den nackten Füßchen pelzbesetzte Saffianlederpantöffelchen. Ihr schwarzes Haar war nur zu einem losen Knoten aufgesteckt und hing zum Teil etwas wirr um das schmale, liebreizende Gesicht. In dem Haarknoten schillerte ein Diadem aus Brillanten, und ebenso waren die Finger des jungen, kaum erblühten Weibes mit den kostbarsten Ringen bedeckt.
Mit einem Jubelruf war sie dem Fürsten um den Hals geflogen.
„Oh Papascha, endlich – endlich!“ rief sie. „Wie habe ich mich nur nach dir gesehnt! Werden wir jetzt zusammen zu Abend speisen, lieber Papascha?“