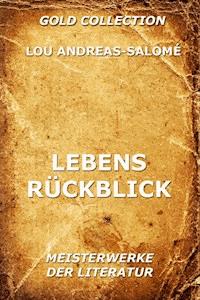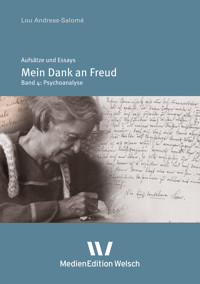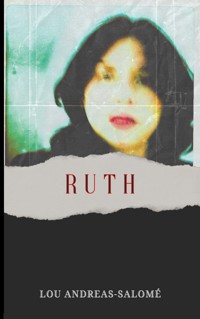Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Familiengeschichte handelnd Ende des vor-vorigen Jahrhunderts.
Das E-Book Das Haus wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Haus
Lou Andreas-Salomé
Inhalt:
Lou Andreas-Salomé – Biografie und Bibliografie
Das Haus
Erster Teil
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Zweiter Teil
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
Das Haus, Lou Andreas-Salomé
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849604264
www.jazzybee-verlag.de
Lou Andreas-Salomé – Biografie und Bibliografie
Schriftstellerin, Erzählerin, Essayistin und Psychoanalytikerin aus russisch-deutscher Familie. Eigentlich Louise von Salomé; gelegentliches Pseudonym „Henry Lou“, geboren am 12. Februar 1861 in St. Petersburg, verstorben am 5. Februar 1937 in Göttingen. Die Art ihrer persönlichen Beziehungen zu prominenten Vertretern des deutschen Geisteslebens – in erster Linie zu Friedrich Nietzsche, Rainer Maria Rilke und Sigmund Freud – war und ist bis heute Gegenstand unterschiedlicher Interpretationen. Ihr Vater Gustav Salomé stammte von südfranzösischen Hugenotten ab und kam 1810 als Kind mit seiner Familie nach St. Petersburg. Eine militärische Karriere führte ihn bis in den Generalstab der russischen Armee. 1831 wurde er durch Zar Nikolaus I. in den Adelsstand erhoben. Die Mutter, Louise, geb. Wilm war norddeutsch-dänischer Herkunft. Die beiden heirateten 1844, ihre Tochter Louise von Salomé kam als jüngstes von sechs Kindern und einziges Mädchen am 12. Februar 1861 in St. Petersburg zur Welt. Sie wuchs als Liebling des Vaters in einer wohlhabenden, kulturell vielseitig interessierten Familie auf, in der drei Sprachen gesprochen wurden: Deutsch, Französisch und Russisch. In der glücklichen und anregenden Kindheit sehen Biographen die Grundlage für ihre gleichbleibend starke intellektuelle Neugier, für ihre innere Sicherheit und Unabhängigkeit, auch für ihre Souveränität im Umgang mit mehr oder weniger bedeutenden Männern. Kurz vor ihrem Tod beschrieb sie ihr Lebensgefühl: „Es mag mir geschehen, was will – ich verliere nie die Gewissheit, dass hinter mir Arme geöffnet sind, um mich aufzunehmen“.
Einige Aufregung und Spannungen innerhalb ihrer streng protestantischen Familie verursachte Louise, als sie die Konfirmation durch den dogmatischen Pastor der zuständigen reformierten Gemeinde verweigerte und mit 16 Jahren aus der Kirche austrat. Als Achtzehnjährige war sie fasziniert von den Predigten eines anderen protestantischen Pastors in St. Petersburg, des Holländers Hendrik Gillot, der sie als Schülerin annahm und mit ihr philosophische, literarische und religiöse Themen besprach. Umfang und Intensität dieser Studien sind aus ihren Notizbüchern ablesbar. Es gehörten dazu: Vergleichende Religionsgeschichte; Grundvorstellungen der Religionsphänomenologie. Dogmatismus, messianische Vorstellungen im Alten Testament und der Glaubenssatz von der Dreifaltigkeit; Philosophie, Logik, Metaphysik und Erkenntnistheorie; das französische Theater vor Corneille, die klassische französische Literatur, Descartes und Pascal; Schiller, Kant und Kierkegaard, Rousseau, Voltaire, Leibniz, Fichte und Schopenhauer. Hier werden die Grundzüge jener umfassenden Bildung sichtbar, die, ebenso wie ihre rasche Auffassungsgabe, spätere Gesprächspartner immer wieder beeindruckte.
Gillot war 25 Jahre älter als sie und hatte zwei nahezu erwachsene Töchter. Nun kündigte er an, dass er sich von seiner Frau trennen wolle und machte seiner Schülerin einen Heiratsantrag. Von Salomé lehnte ab. An einer Ehe und einem sexuellen Verhältnis war sie nicht interessiert; sie war regelrecht enttäuscht und schockiert durch diese Entwicklung, blieb aber mit Gillot befreundet. Dieses Muster wiederholte sich häufig in ihrem Leben: Männer machten ihr weitgehende Angebote (körperliche Intimität meist eingeschlossen), sie nahm davon, was sie wünschte; sie bestimmte die Bedingungen. Mit Gillot unternahm sie noch eine Reise nach Holland. Dort ließ sie sich von ihm konfirmieren – sie hätte sonst keinen eigenen Pass bekommen – und wurde von ihm auf den Namen „Lou“ getauft.
Nach dem Tod des Vaters (1879) zog Lou von Salomé zusammen mit ihrer Mutter im Herbst 1880 nach Zürich und begann ein Studium an der dortigen Universität, die als eine von wenigen Hochschulen jener Zeit auch Frauen zum Studium annahm. Zuvor hatte sie einen Eignungstest zu bestehen, weil ihr der verlangte Schulabschluss fehlte. Sie hörte unter anderem Religionswissenschaften, Logik, Metaphysik, Archäologie und Geschichte. Ein Lungenleiden zwang sie zur Unterbrechung des Studiums, man empfahl ihr zur Heilung ein wärmeres Klima. Im Februar 1882 trafen Mutter und Tochter in Rom ein.
Ein Empfehlungsschreiben verschaffte Lou von Salomé Zugang zum Bekanntenkreis der Schriftstellerin, Pazifistin und Frauenrechtlerin Malwida von Meysenbug, die einst wegen ihrer offenen Sympathien für die Revolutionäre von 1848 aus Berlin ausgewiesen worden war und inzwischen in Rom einen Zirkel von Künstlern und Intellektuellen in der Tradition der Berliner Salons etabliert hatte. In diesem Kreis verkehrten der Philosoph Paul Rée, ein Freund Friedrich Nietzsches, und auch Nietzsche selbst. Rée verliebte sich umgehend in Lou von Salomé, hielt um ihre Hand an und wurde abgewiesen; zwischen beiden entwickelte sich aber eine enge Freundschaft. Als Nietzsche im April 1882 Rom erreichte, war er durch enthusiastische Briefe von Rée auf die Begegnung mit von Salomé vorbereitet. Auch er war von der „jungen Russin“ entzückt und machte ihr einen Heiratsantrag, ausgerechnet durch Rée als Vermittler. Auch er wurde zurückgewiesen, war aber als Freund, Lehrer und Gesprächspartner hochwillkommen.
Denn sie hatte inzwischen, ohne ihn persönlich zu kennen, das Wunschbild einer intensiven Arbeitsgemeinschaft (der von ihr so genannten „Dreieinigkeit“) mit Nietzsche, Rée und sich selbst entworfen. Man würde in Wien oder Paris freundschaftlich zusammenleben, studieren, schreiben und diskutieren. Diese ihre Idealvorstellung, die zu dritt eifrig besprochen wurde, ließ sich nicht verwirklichen. Sie scheiterte letztlich an der Eifersucht der beiden Männer – sie wollten sich nicht auf die ihnen zugedachten Rollen festlegen lassen (andererseits hatte Nietzsche mehrfach die Befürchtung geäußert, dass jede wirklich enge, dauerhafte Bindung ihn an der Vollendung seines Lebenswerkes hindern könnte). Die Freundschaft zwischen von Salomé und Paul Rée war relativ unkompliziert, dabei enger und vertrauter als die zu Nietzsche – man duzte sich, schickte sich Tagebuchblätter zu und beriet sich über den jeweiligen Stand der Dinge im Verhältnis zu Nietzsche, der von alledem nichts wusste.
Dessen Situation wurde zunehmend unbefriedigender. Anfang Mai 1882 hatte er allein mit von Salomé einen langen Ausflug am Sacro Monte di Orta in Oberitalien gemacht – seither Anlass für Mutmaßungen darüber, wie nahe sich die beiden dabei gekommen waren. Mitte Mai dann in Luzern ein neuer Heiratsantrag, der wieder abgewiesen wurde. Hier entstand das bekannte Foto, von Nietzsche selbst in allen Einzelheiten arrangiert, auf dem Von Salomé ihn und Rée vor ihren Karren spannt. Wenig später begann Nietzsches Schwester Elisabeth, sich in die Angelegenheiten ihres Bruders einzumischen. Sie berichtete ihm von dem angeblich „leichtfertigen“ und „skandalösen“ Verhalten seiner Freundin während der Festspiele in Bayreuth und unterrichtete auch ihre Mutter über die aus ihrer Sicht moralisch bedenkliche Affäre. Nietzsche war empört über die Einmischung seiner Familie, litt aber auch unter den Details, die ihm zugetragen worden waren.
Seine Beziehung zu Lou von Salomé endete nach einer letzten Begegnung mit ihr und Rée im Herbst 1882 in Leipzig, von wo von Salomé abreiste, ohne sich von ihm zu verabschieden. Danach änderten sich Nietzsches Einstellung und Verhalten beiden gegenüber. In einem Briefentwurf vom Dezember 1882 äußerte er Verzweiflung und Selbstmitleid: „An jedem Morgen verzweifle ich, wie ich den Tag überdaure … Heute Abend werde ich so viel Opium nehmen, dass ich die Vernunft verliere: Wo ist noch ein M(ensch) den man verehren könnte! Aber ich kenne Euch alle durch und durch“. In unbeherrschter Eifersucht machte er Rée und Lou schwere Vorwürfe und verstieg sich zu wilden Beschimpfungen und Beleidigungen auch gegenüber Dritten. Danach sah man sich nie wieder.
Später bedauerte Nietzsche in einem Brief an seine Schwester sein Verhalten – und zwar sowohl in Hinblick auf die verlorene Freundschaft, als auch aus grundsätzlichen Erwägungen: „Nein, ich bin nicht gemacht zu Feindschaft und Hass: und seit diese Sache so weit fortgeschritten ist, dass eine Versöhnung mit jenen beiden nicht mehr möglich ist, weiß ich nicht mehr, wie leben; ich denke fortwährend dran. Es ist unverträglich mit meiner ganzen Philosophie und Denkweise …“ Im Januar 1883 schrieb er in Rapallo den ersten Teil des Zarathustra, überwand so seine akute Krise und hatte sich, wie er anmerkte, „einen schweren Stein von der Seele gewälzt“. Aus den Kapiteln, die sich auf das Wesen der Frauen beziehen, kann man Spuren seiner Erfahrungen mit von Salomé herauslesen, zugleich aber auch Abschluss und Bewältigung dieser Episode seines Lebens. Er blieb bis zu seinem Lebensende allein; nach seinem völligen geistigen Zusammenbruch im Januar 1889 wurde er von Mutter und Schwester gepflegt, bis er am 25. August 1900 starb. In ihrem Buch „Nietzsche in seinen Werken“ von 1894 versuchte von Salomé, auf der Grundlage ihrer genauen Textkenntnis und ihrer persönlichen Erfahrungen mit dem schwierigen Freund, den „Denker durch den Menschen zu erläutern“. Anna Freud sprach später davon, Lou Andreas-Salomé habe mit diesem Buch über Nietzsche die Psychoanalyse vorweggenommen.
Lou von Salomé und Paul Rée lebten drei Jahre lang freundschaftlich zusammen in Berlin und trennten sich 1885. Reé kam 1901 bei einer Bergwanderung ums Leben; ungeklärt blieb, ob durch einen Unfall oder durch Suizid.
Im August 1886 lernte Lou von Salomé in Berlin den Orientalisten Friedrich Carl Andreas kennen. Er war fünfzehn Jahre älter als sie, dunkelhaarig, temperamentvoll und bald fest entschlossen, sie zu heiraten. Seine entschiedene Absicht unterstrich er durch einen Selbstmordversuch vor ihren Augen. Nach längeren inneren Kämpfen willigte sie 1887 in die Eheschließung ein, stellte aber Bedingungen. Die Hauptsache: sie werde sich niemals bereit finden, die Ehe sexuell zu vollziehen. Aus welchen Gründen Andreas dies akzeptierte, ist nicht bekannt. Falls er hoffte – wie meist vermutet wird –, dass sie es damit nicht dauerhaft ernst meinen werde, sah er sich enttäuscht. In den ersten Ehejahren gab es immer wieder Eifersuchtsszenen wegen ihrer Beziehungen zu anderen Männern. Dennoch lehnte Andreas es mehrmals ab, sich scheiden zu lassen. In Berlin bewohnte das Paar nacheinander verschiedene Wohnungen, zeitweilig hatte Andreas berufliche Schwierigkeiten und nur sehr geringe Einnahmen, so dass die ebenfalls recht begrenzten Einkünfte, die seine Frau als Schriftstellerin erzielte, dringend gebraucht wurden.
Lou Andreas-Salomés Leben bestand aus einer konventionellen, bürgerlichen Hälfte mit Ehemann, hausfraulicher Pflichterfüllung und geistiger Arbeit – und einem anderen Bereich, in dem sie weder Pflichten noch engere Bindungen akzeptierte und mit gelegentlichen, inoffiziellen Liebhabern unterwegs war. Gleichzeitig warf sie ihrem Mann anfangs dessen Beziehung zu ihrer Haushälterin Marie vor. Doch kümmerte auch sie sich um das Kind aus dieser Verbindung, nachdem die Mutter früh gestorben war, und setzte es später als Haupterbin ein. Auf lange Sicht erwies sich die schwierige, widersprüchliche Ehe als unerwartet haltbar. Seit Friedrich Carl Andreas im Frühjahr 1903 auf den Lehrstuhl für Westasiatische Sprachen an der Universität Göttingen berufen worden war, lebte das Paar dort im eigenen Haus (von ihr „Loufried“ genannt, wie schon ein früherer Aufenthaltsort) – er mit der Haushälterin im Erdgeschoss, sie im Stockwerk darüber. Sie betreute, wenn sie in Göttingen war, den Garten am Haus, sie baute Gemüse an und hielt Hühner, führte aber im Wesentlichen weiterhin ein unabhängiges, reisefreudiges Leben. In ihren Tagebuchnotizen erscheint dieser Lebensabschnitt, insbesondere das Verhältnis zu ihrem Mann, wesentlich entspannter als die Zeit zuvor.
Als Lou von Salomé in Berlin mit Paul Rée zusammenwohnte, also von 1882 bis 1885, bestand ihr gemeinsamer Bekanntenkreis hauptsächlich aus Wissenschaftlern—den Freunden und Fachkollegen Rées. Von Salomé war die einzige Frau in diesem Kreis, sie genoss die Verehrung der Männer und die Teilnahme an den philosophischen und naturwissenschaftlichen Diskussionen. 1885 erschien unter dem Pseudonym Henry Lou ihr erstes Buch, der Roman Im Kampf um Gott, Thema: „Was geschieht, wenn der Mensch seinen Glauben verliert?“ Mit dem Problem musste sie sich in ihrer eigenen Jugend schon beschäftigen. Die Kritiken waren gut, das Pseudonym schnell durchschaut, der Erfolg machte sie in weiteren Kreisen der Berliner Gesellschaft bekannt.
Nach ihrer Heirat mit Friedrich Carl Andreas ergaben sich neue Kontakte, insbesondere zum sogenannten „Friedrichshagener Dichterkreis“ und zum „Freundeskreis der Freien Volksbühne“ – beide personell zu großen Teilen identisch. Um 1890 hatte sich in dem idyllischen Berliner Vorort Friedrichshagen eine lose Vereinigung von Schriftstellern und Naturliebhabern zusammengefunden, mit dem Ziel, ein zwangloses Leben zu führen sowie Dichtung und Theater im Sinne des Naturalismus zu erneuern. Bruno Wille, einer der Initiatoren, gehörte 1890 zu den Gründern der „Freien Volksbühne“, die Arbeitern den Zugang zur dramatischen Kunst ermöglichen sollte. Zu den Mitgliedern oder Sympathisanten dieser Initiativen gehörten unter anderen Otto Brahm, Richard Dehmel, Max Halbe, Knut Hamsun, Maximilian Harden, Gerhart Hauptmann, Hugo Höppener (genannt Fidus), Erich Mühsam und Frank Wedekind, vorübergehend auch August Strindberg. Bald war Lou Andreas-Salomé mit einer Anzahl von ihnen befreundet oder gut bekannt, besonders Hauptmann und Harden waren von ihr beeindruckt. In der Zeitschrift „Freie Bühne“, die das Projekt Volksbühne begleitete, veröffentlichte auch sie Artikel und Rezensionen. In diesem Zusammenhang wuchs ihr Interesse an den Dramen von Henrik Ibsen, mit denen die Volksbühne eröffnet worden war. Sie untersuchte seine Darstellung von Eheproblemen mit der für sie selbst bedeutsamen Fragestellung: Wie muss eine Ehe beschaffen sein, um auch der Selbstverwirklichung, besonders der Frauen, Raum zu lassen? Ihr Buch „Henrik Ibsens Frauengestalten“ von 1892 zu diesem Thema erhielt ungeteilten Beifall und festigte ihren Ruf als beachtenswerte Autorin.
Rainer Maria Rilke hatte sich seit 1896 in München aufgehalten und war mit literarisch noch recht anspruchslosen Gedichten und Erzählungen einigermaßen erfolgreich. Als Lou Andreas-Salomé im Frühjahr 1897 von Berlin aus ihre Freundin Frieda von Bülow in München besuchte, wurde ihr Rilke bei Jakob Wassermann vorgestellt. Was sie zu jenem Zeitpunkt nicht wusste: Schon vorher hatte er ihr eine Reihe von anonymen Briefen mit beigefügten Gedichten zukommen lassen. Nun versicherte er ihr, wie überaus beeindruckt er von ihrem religionsphilosophischen Essay „Jesus der Jude“ gewesen sei, in dem sie „mit der gigantischen Wucht einer heiligen Überzeugung so meisterhaft klar ausgesprochen“ habe, was er selbst in einem Gedichtzyklus ausdrücken wollte; er lief „mit ein paar Rosen in der Stadt und dem Anfang des Englischen Gartens herum …, um Ihnen die Rosen zu schenken“, las ihr aus seinen Arbeiten vor, widmete ihr ein eigenes Gedicht – wenig später hatte er mit seiner intensiven Werbung Erfolg.
Es folgten einige gemeinsame Sommermonate in der Marktgemeinde Wolfratshausen im Isartal nahe München. Sie bewohnten drei Kammern in einem Bauernhaus und nannten die Unterkunft „Loufried“. Als Lou Andreas-Salomé zurück nach Berlin ging, folgte Rilke ihr dorthin. Er war 21 Jahre alt. Andreas-Salomé, die er als mütterliche Geliebte überschwänglich verehrte, war 36. Auch sie war heftig verliebt, behielt aber, ihrem Wesen entsprechend, gleichzeitig die Kontrolle über sich und die Situation. Sie veranlasste ihn, an seinem sprachlichen Ausdruck zu arbeiten, den sie als übertrieben pathetisch empfand. Ihrem Vorschlag entsprechend änderte er seinen eigentlichen Vornamen René zu Rainer. Sie machte ihn mit dem Denken Nietzsches bekannt und lenkte sein Interesse auf ihre Heimat Russland; er lernte Russisch und begann, Turgenjew und Tolstoi im Original zu lesen. Dies alles geschah vorwiegend in der engen Berliner Wohnung des Ehepaares Andreas-Salomé. Rilke hatte sich ganz in der Nähe eingemietet, hielt sich aber meist bei Lou Andreas-Salomé auf, die in der Küche ihren Wohn- und Arbeitsraum hatte, während ihr Mann im Wohnzimmer arbeitete. Andreas-Salomé stellte bald fest, dass die innere Abhängigkeit des jungen, psychisch labilen Dichters ihr gegenüber ständig zunahm – eine unerwünschte Entwicklung. So drängte sie ihn im Frühjahr 1898 zu einer Italienreise, auf der sie ihn nicht begleitete.
In den Jahren 1899 und 1900 unternahmen sie dann gemeinsam zwei Reisen nach Russland, die erste, kürzere (25. April bis 18. Juni 1899) noch in Begleitung von Andreas. Die zweite Reise dauerte vom 7. Mai bis zum 24. August 1900 und gilt als Wendepunkt in der Beziehung zwischen Andreas-Salomé und Rilke (Eine dritte Reise wurde für 1901 geplant, kam aber nicht zustande). Die Pfingstwoche verbrachten beide in Kiew. Die starken Eindrücke und Empfindungen dieser Zeit sollen ihren Niederschlag in seinem berühmten Stundenbuch gefunden haben (geschrieben 1899 bis 1903). Sie gaben ihm aber auch Anlass zu Weinkrämpfen, zu „Angstverfassungen und körperlichen Anfällen“, wie Andreas-Salomé sich in ihrem Lebensrückblick erinnerte. Sie war erschrocken und besorgt, vermutete als Hintergrund eine ernsthafte psychische Erkrankung. Während eines Abstechers im August 1900 zum Urlaubsort ihrer Familie in Finnland beschloss sie, sich von Rilke zu trennen. Tatsächlich beendete sie die Liebesbeziehung dann erst mit einem Abschiedsbrief vom 26. Februar 1901. In der Zwischenzeit bekräftigte sie ihren Vorsatz in Tagebuchnotizen: „‚Was ich will vom kommenden Jahr, was ich brauche, ist fast nur Stille, – mehr Alleinsein, so wie es bis vor vier Jahren war. Das wird, muss wiederkommen.‘ – „Mich vor R. mit Lügen verleugnet‘. – ‚Damit R. fortginge, ganz fort, wäre ich einer Brutalität fähig (Er muss fort!)‘“.
Die leidenschaftliche Beziehung ging über in eine enge Freundschaft, die bis zu Rilkes Tod im Jahre 1926 anhielt. 1937, in seinem Nachruf auf Lou Andreas Salomé erinnerte Sigmund Freud daran, „dass sie dem großen, im Leben ziemlich hilflosen Dichter Rainer Maria Rilke zugleich Muse und sorgsame Mutter gewesen war.“
Bei einem Aufenthalt in Schweden begann Lou Andreas-Salomé ein intensives Verhältnis mit einem 15 Jahre jüngeren Mann, dem Nervenarzt und Freudianer Poul Bjerre. Als er 1911 zum Kongress der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung nach Weimar fuhr, begleitete sie ihn und traf dort erstmals mit Sigmund Freud zusammen. Er wurde zur entscheidenden Bezugsperson ihrer letzten 25 Lebensjahre. Sie ahnte und hoffte, dass die neue Denkschule der Psychoanalyse – mit Freud als Vaterfigur – ihr Zugang verschaffen könnte zum Verständnis der eigenen seelischen Verfassung. Von Oktober 1912 bis April 1913 hielt sie sich in Wien auf, später folgten viele weitere Besuche. Sie hörte im Wintersemester 1912/1913 Freuds Vorlesung in der Psychiatrischen Klinik über „Einzelne Kapitel aus der Lehre von der Psychoanalyse“ und nahm an seinen „Mittwochssitzungen“ und „Samstags-Kollegs“ teil. Mit ausdrücklicher Zustimmung Freuds beteiligte sie sich aber auch an den Diskussionsabenden Alfred Adlers, der sich 1911 von der orthodoxen psychoanalytischen Schule Freuds distanziert und mit seinem Verein für Individualpsychologie eine eigene tiefenpsychologische Schule begründet hatte.
Sigmund Freud hielt sehr viel von seiner Schülerin. In einer engen, rein platonischen Beziehung wurde sie für ihn durch ihren Wissensdurst, ihre Neugier auf menschliche Verhaltensweisen und die intensive Suche nach deren Verständnis eine hochgeschätzte Diskussionspartnerin. Sogar ihre eigenwillige Ausdeutung psychoanalytischer Konzepte, denen sie eine vorwiegend poetische und literarische Form gab, akzeptierte er ohne Widerspruch. Er fand, sie sei die „Dichterin der Psychoanalyse“, während er selbst Prosa schreibe. In der „Schule bei Freud“ (so der Titel ihres postum veröffentlichten Tagebuches der Jahre 1912/1913) lernte Lou Andreas-Salomé, ihr eigenes Leben besser zu verstehen und zu beherrschen, darauf legte sie in Hinblick auf ihr fortgeschrittenes Alter besonderen Wert.
Freud riet ihr zum Beruf der Psychoanalytikerin. Sie schrieb Aufsätze für die psychoanalytische Zeitschrift „Imago“ und war schon 1913 Gastrednerin beim Psychoanalytischen Kongress in Berlin. 1915 eröffnete sie in ihrem Göttinger Wohnhaus die erste psychoanalytische Praxis der Stadt. 1921 wurde sie Mitglied der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung. Im selben Jahr begann ihre Freundschaft mit Anna, einer der drei Töchter Freuds. 1923 ging sie auf Bitten Sigmund Freuds für ein halbes Jahr als Lehranalytikerin nach Königsberg, fünf Ärzte absolvierten bei ihr eine Lehranalyse (die sie selbst nie durchlaufen hatte). Zum 75. Geburtstag ihres Freundes und Lehrers am 6. Mai 1931 schrieb sie den offenen Brief „Mein Dank an Freud“. Der Adressat antwortete ihr: „Es ist gewiss nicht oft vorgekommen, dass ich eine psa. [psychoanalytische] Arbeit bewundert habe, anstatt sie zu kritisieren. Das muss ich diesmal tun. Es ist das Schönste, was ich von Ihnen gelesen habe, ein unfreiwilliger Beweis Ihrer Überlegenheit über uns alle.
Erst im Alter von 74 Jahren beendete Lou Andreas-Salomé ihre Arbeit als Psychoanalytikerin. Sie war schon zuvor schwächlich und herzkrank, musste deswegen mehrmals im Krankenhaus behandelt werden. Ihr Ehemann besuchte sie täglich, eine beschwerliche Situation für den alten, ebenfalls kranken Mann. Nach einer vierzigjährigen Ehe mit gegenseitigen Kränkungen und lang andauernder Sprachlosigkeit waren die beiden sich nähergekommen. Sigmund Freud begrüßte das aus der Ferne: „So dauerhaft beweist sich doch nur das Echte“. Friedrich Carl Andreas starb 1930 an einem Krebsleiden. Lou Andreas-Salomé musste sich 1935 einer schweren Krebsoperation unterziehen. Am Abend des 5. Februar 1937 starb sie im Schlaf. Ihre Urne wurde im Grab ihres Mannes auf dem Stadtfriedhof in Göttingen beigesetzt.
Wenige Tage vor ihrem Tod konfiszierte die Gestapo ihre Bibliothek (nach anderer Quelle war es ein SA-Trupp, der die Bibliothek verwüstete, und zwar kurz nach ihrem Tode). Der Vorwurf: Sie sei Mitarbeiterin des Juden Sigmund Freud gewesen, habe eine „jüdische Wissenschaft“ betrieben und unter ihren Büchern fänden sich zahlreiche Werke jüdischer Autoren.
Ein Gedenkstein am neubebauten Grundstück ihres einstigen Wohnhauses, ein „Lou-Andreas-Salomé-Weg“ und der Name des „Lou-Andreas-Salomé Instituts“ für Psychoanalyse und Psychotherapie erinnern in Göttingen an die ehemalige Mitbürgerin.
Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. Im Gesamten ist dieser Text zu finden unter http://de.wikipedia.org/wiki/Lou_Andreas-Salom%C3%A9.
Das Haus
Familiengeschichte vom Ende vorigen Jahrhunderts
Erster Teil
I.
Das Haus lag an der Berglehne und überblickte die Stadt im Tal und langgestreckte Höhen jenseits davon. Von der Landstraße, die sich in großem Bogen den Bergwald hinaufwand, trat man gleich ins mittlere Stockwerk ein wie zu ebner Erde: so tief dem Berg eingebaut hatte das kleine weiße Haus sich.
Auf ihn gestützt aber sah es nach dem abfallenden Garten zu um so freier hinaus über die Weite; mit sehr vielen hellen Fensteraugen bis tief hinab, mit keck vorspringenden Erkern, Ausbauungen der ursprünglich zuwenig umfangreichen Gemächer, was ihm freilich eine etwas wunderliche Architektur, doch auch Anmut und Leichtigkeit verlieh – fast, als raste es da nur.
Über dem mittleren Erker schob sich zu oberst ein Altan breit vor ins baumbepflanzte, winterliche Gartenland, das eine Steinmauer, alt und bemoost, umschloß. Die Altantür stand trotz der frühen Morgenstunde schon weit geöffnet. Auf der Schwelle, das Gesäß vorsichtig ins warme Zimmer gedrückt, saß eine bejahrte kleine Hündin und blinzelte schläfrig nach den ab und zu schwirrenden hungrigen Vögeln, wie ein verwöhntes Hauskind sich bettelndes Gassenvolk betrachtet. In ihr selbst hatten sich zwar die verschiedensten Hundegeschlechter ein nichts weniger als aristokratisches Stelldichein gegeben, wie ihr Dackelgebein, ihr Mopsrumpf und ihr Terrierkopf verrieten – eine Vielseitigkeit, die noch vervollständigt wurde durch ein ferkelhaftes Ringelschwänzchen an ihrem anderen Ende. Weitaus das Merkwürdigste an dem kleinen Ungetüm jedoch blieb, daß es Salomo hieß. Jedermann erstaunte hierüber, außer der Tochter des Hauses, die auf diesem männlichen und königlichen Weisheitsnamen bestanden hatte, trotzdem Salomo ihr einst in hochträchtiger Verfassung zugelaufen war, worauf er vier gesunde Pinscher zur Welt brachte.
Die Vögel vollführten einen gewaltigen Lärm. Denn Finken und Blaumeisen, Rotkehlchen und Hänflinge, Grasmücken und andere noch scharten sich auf dem Altan um freihängenden – dadurch der Sperlingskonkurrenz enthobenen – Speck, sowie einen Napf mit Wasser, das wenige glimmende Kohlen in der Topfscherbe darunter vor dem Zufrieren schützten. An der Altantür aber stand die Hausfrau und warf überdies, fröhlich, emsig Körnerfutter hinaus.
Salomo trug seine richtiggehende Uhr im Leibe: nach der hatte man längst beim Morgenfrühstück zu sitzen. Glücklicherweise für ihn zog der Herr des Hauses jetzt seine aus der Westentasche: ins Zimmer tretend, gab er Salomos stummem Tadel entrüsteten Ausdruck.
"Na, Salomo, was sagst du dazu?! Über der Tochter Vogelvieh vergißt die Anneliese uns, ihre beiden hungrigen Hauptspatzen?"
Schon in einer Stunde mußte er unterwegs sein in die gynäkologische Klinik der Stadt. "Eine Pedanterie, sich nicht an den Frühstückstisch setzen zu wollen ohne seine Frau!" meinte er selber oft, aber er meinte auch: "Ärzte, diese Überbeschäftigten, müßten an einigen schönen Pedanterien festhalten, sonst würden sie unversehens wieder zu Junggesellen."
So holte er sich denn die Frau weg, um hinabzugehen in die unteren Wohnräume, wobei er seinen Arm durch den ihren schob. Anders – so wie es ehedem noch Mode gewesen, als sie einander fanden – hätte es sich weit schlechter gemacht: um ein so beträchtliches Stück war er kleiner gewachsen als sie.
Salomo folgte ihnen auf dem Fuß. In der Eßstube, vor deren Fenstern große Bäume verschneite Zweige wiegten, hatte er beim grün glasierten Kachelofen seinen Thron, einen umgestülpten Korb mit darauf befestigtem Kissen, denn Salomo saß gern hoch und übersah die Lage und nicht zum wenigsten den Eßtisch, der ihm schon morgens hocherfreulichen Anblick bot: wo reichlicher Imbiß des Hausherrn wartete, der an den Wochentagen erst abends Zeit fand zum Mittagsmahl daheim.
Anneliese hatte sich bereits gesetzt – da kehrte sie sich plötzlich um zum Manne, der neben ihr stand. Sie faßte nach seinem Arm, drückte ihr Gesicht daran, es unwillkürlich senkend. Als er sich niederbeugte und es zu sich emporhob, standen ihre Augen in Tränen.
"Lieselieb!" sagte er nur, aber der Kosename, der einzige, mit dem er sie rief seit ihrer Brautzeit, klang wie Bitte und Mahnung zugleich. Da schwieg sie von dem, was sie weinen machte.
Ein Tag des Gedenkens – der Geburtstag ihres dritten Kindes, das ihnen vor Jahren starb. Leise hatte er gehofft, sie würde sich nicht sogleich daran erinnern, als er vorhin ihr morgenhelles Gesicht gesehen – draußen im Vogelschwarm.
Seit der Trauer um Lotti ging Anneliese nur noch in grauen oder braunen Kleidern umher. Und doch sah er an ihrer blonden, kraftvollen Frauenerscheinung die frohen Farben am liebsten.
Neben den beiden Gedecken lag die Frühpost. Er reichte Anneliese den Brief, den er während des Wartens am Tisch gelesen hatte.
"Lies!" sagte er. "Lauter Gutes. Gitta schon auf dem Rückweg von den Verwandten, von ihrer ‹Examenbelohnung›, wie sie es im Brief stolz nennt. Trifft also wohl noch vor Balduin ein. Der allerdings sollte vielleicht noch mal kurz fortgehen – nach Weihnachten. Denn offenbar ist dies Erholungsheim gerade das Richtige für ihn gewesen. Nicht umsonst rühmten die Kollegen mir den leitenden Direktor so sehr."
Anneliese griff lebhaft nach dem Brief, sie bemerkte:
"Gestern, bei Professor Läuer, da sprachen sie auch so angenehm über unsern Balder. Ganz eingenommen hat er die alten Schulpäpste durch den Übereifer, womit er sein Abiturium nachholte! Jetzt begreifen sie's, daß du ihn zugabst, den kostspieligen Hausunterricht, für ihn, den schlechtesten ihrer Schüler! Der nun doch noch der jüngsten Studenten einer wird! Ich saß und tat beide Ohren auf und labte mich."
"Ja, ja. – Aber nun?! Warum labt er sich nicht an dem, was er hinterdrein mit so wütender Energie bei sich selbst durchgesetzt hatte? Warum im Handumdrehen wieder der Ekel daran? – Das ist nicht nur Überarbeitung. Ja – wenn der Junge stetig auszuschreiten verstünde anstatt hin und wider zu fliegen."
Man konnte sehen, wie die fröhliche Nachricht von der Tochter für den Augenblick zurücktrat vor der Sorge um den Sohn. Die Falten im bartlosen Gesicht vertieften sich, das sich ohnehin bereits reichlich durchfurcht ausnahm. Dennoch wirkte der ganze Mensch auch jetzt jung. Die Augen an ihm blickten jung, und auf wen sie sich richteten, an dessen Jugend schienen sie sich zu wenden.
Anneliese war ganz bei Gittas kurzem Brief, aber auch der unerwartet sorgenvolle Ton kam ganz bis zu ihr, und er riß sie förmlich fort davon, rief ihre eigne Hoffnungsbereitschaft zur Antwort auf.
"Ach, Frank, laß gut sein! Wer weiß –: vielleicht lernt mancher nur spät und schwer gehen, der einmal zu hohem Flug bestimmt ist –"
Eine Spur von Überschwenglichkeit klang mit – klang aus dem Gewählten, Geschwellten der Worte.
Und nicht nur aus den Worten. Ihr über die Teetasse gebeugtes Gesicht verriet es – diese verräterische Haut der rötlichen Blondinen, bei der man die Blutwellen kommen und gehen sieht selbst in der leisesten Erregung. Auf diesem Farbenspiel, das gewissermaßen noch weiterredete in die Stille zwischen ihnen, ließ der Mann den Blick ruhen. Und auf den beinahe mattvioletten Schatten, die das wellige Haar dazu am Stirnansatz warf und hinten über dem Nacken – was ihm immer von neuem so gut gefiel. Er meinte manchmal, es sei das allererste gewesen, was ihm an Anneliese aufgefallen war, als sie einander entgegentraten.
Seine Frau prüfte nur flüchtig die übrige Post, las eine Karte.
"Also Helmold geht wirklich fort. – Wird dir fehlen unten in deiner Klinik. – Ob auf so lange, wie er denkt? Ich glaube: er kommt wieder!"
Das pfiffige Gesicht, womit sie diese Behauptung aussprach, nach dem Pathos von soeben, machte ihn lachen.
"O Kupplerinnen! Selbst du!" antwortete er und stopfte sein Pfeifchen mit Türkentabak. "Aber ich fürchte sogar, als Backfisch schwärmtest du wirklich für Marlittsche Reckengestalten mit goldblonden Bärten. Daher vielleicht."
"Helmold hat mehr als blonden Bart und lange Beine. Und sollte Herr Doktor Frank Branhardt nicht selber den größten Narren an ihm gefressen haben?" fragte sie fröhlich. "Manchmal scheint er mir dir über deine leiblichen Kinder zu gehen – jedenfalls schon ‹ein Sohn› zu sein."
Branhardt konsultierte nochmals seine Uhr und erhob sich. "Frauenlogik! Eben darum! Darum soll er sich jedenfalls noch ganz gehörig Wind um die Ohren blasen lassen, ehe er den Kopf in die Schlinge steckt. Wird mal ein erstklassiger Chirurg! Unsinn, sich so früh zu binden."
Auf diese Ansichtsäußerung lachte Anneliese über das ganze Gesicht. Sie stand auf, und etwas von übermütiger Herausforderung, ihrer sonstigen Art sichtlich Fernliegendes, verfing sich in den Klang der Worte, mit denen sie dem Mann zum Abschied ihren Kuß gab.
"Frank, du Armer! Daß du dich gar so früh binden mußtest!"
Ihre Augen kreuzten sich mit den seinen in der gleichen, plötzlich hochschlagenden Erinnerung und Wärme. In beiden Menschen erstand der gleiche stolze Wunsch: Wie wir es gehabt, gradeso möge es unsern Kindern zuteil werden!
Ungern trennten sie sich.
Während Branhardt aber durch den Garten ging, dachte er bei sich: Vielleicht würde ja sein Interesse an dem jungen, tüchtigen Helmold nicht dermaßen väterlich groß sein, wenn er am eigenen Sohn einen bessern Erben der eigenen Tüchtigkeit erhoffen könnte. Oder täuschte er sich am Ende darüber nur? Sooft hatte er heiß ersehnt, Schüler, Söhne, Jünglinge um sich zu haben, denen er mitteilen, abgeben, schenken dürfte. – Ihm fehlte es an Zeit an allen Ecken und Enden, auch für einen akademischen Lehrstuhl. Er mußte lächeln: hundert Söhne sollte Lieselieb haben –.
Und doch ging es ihm vor allem um den einen –, o ja, das fühlte er schon, daß es sein einziger leiblicher war. Zum Greifen deutlich tauchte Balduins Jungengesicht vor ihm auf, die stumpfe Nase, die Sommersprossen. – Es hatte der Mutter zarten Farbenton, ihr Rotblond auch. Doch war's nicht erst der Umweg über Anneliese, wodurch es Branhardt Zug um Zug lieb ward.
Im Weitergehen stellte er sich vor, wie er dem Jungen die Hand um die Schultern legte, wie er "wir" von ihm und sich sagte.
Anneliese war indessen hinuntergestiegen zu den Wirtschaftsräumen des in den Berg eingebauten Untergeschosses. Beim Fensterchen an der Treppenbiegung blieb sie stehen: über den Vordergarten weg sah sie die Landstraße hinab zur Stadt eine kleine, untersetzte Gestalt gehen, die rasch und ruhig ausschritt.
Wie hatten sie doch miteinander glücklich gescherzt – nicht einmal Erwähnung getan hatten sie ihrer –: Lottis. Die Lebenden allein behielten recht – es fiel ihr aufs Herz.
Mein süßes Kind, mein Liebling: es ist dein Tag! dachte Anneliese.
Sie stand, die Stirn ans kleine Fensterglas gedrückt. Branhardts Gestalt wurde ferner, undeutlicher, entschwand hinter den kahlen Bäumen der Allee.
Gesund und rotwangig wie ein Apfel, so war Lotti acht Jahre alt geworden. Dann ein Sturz aus der Schaukel; Rückenverletzung, Qualen, Streckbett und endlich erlösend: der Tod.
Wenn Menschenkraft Anneliese durch diese Zeit hindurchgeholfen hatte, so war es die ihres Mannes gewesen und sein Beispiel. Litt er auch wie sie, er gab sich nicht wie sie der Trauer hin um das tote kleine Mädchen. Den Blick, der dem Kinde nachschauen wollte, hielt er unentwegt auf die Lebenden gerichtet, die ihn nicht missen konnten, und noch heute lag es daran – lag an seinem Kampf mit Unvergessenem, wenn er Lottis Tag zu vergessen schien.
Aber sein Tagewerk war auch so, daß es wohl vieles zurücktreten lassen konnte. Auch der Alltag muß so unalltäglich sein können, dachte Anneliese bei sich.
Da ging sie still an ihre häuslichen Pflichten.
*
Neben den Küchenräumen befand sich unten noch eine Miniaturwohnung nach dem abfallenden Garten hinaus: drin hauste ein sehr nützliches Ehepaar, Herr und Frau Lüdecke, sie, um die Küche, er, um den Garten zu versorgen, obschon er einst, als selbständiger Gärtner, bessere Tage gesehen. Frau Lüdecke kränkte an den veränderten Verhältnissen seltsamerweise am meisten der Umstand, daß ihr Mann im gleichen Hause arbeitete wie sie, weil sie es reizvoll gefunden haben würde, ihn feierabends abzuholen oder ihm mittags den Eßtopf zuzutragen, wie andere Frauen tun. Herr Lüdecke war gutmütig: des Sommers, bei extra schönem Wetter, tat er ihr den Gefallen und speiste etwas romantisch im allerentferntesten Gartenwinkel, wo eine Bretterbude mit Gerät stand. Abends aber, besonders bei Mondschein, spazierten sie dann immer noch ein wenig wie Liebesleute, und wenn ihnen solche begegneten, errötete Frau Lüdecke sogar im Dunkeln. Denn an ihr war nach fast zehnjähriger, kinderloser Ehe eine wunderbar zähe Bräutlichkeit haftengeblieben, und wenn Herr Lüdecke ihr Küchenholz kleinmachte oder den Wäschekorb trug, nahm sie das noch entgegen wie einen Minnedienst.
Die Nachricht von "Herrn Balderchens" Heimkehr zum Universitätsstudium stieß bei Frau Lüdecke auf größte Wärme, Studenten in Wichs waren ihr Höchstes. Und auch daß Gitta zurückkam, schien ihr an der Zeit. Wer konnte wissen, wie lange man sie noch behielt. "Ach! Gittachen einmal im Brautkranz! Herr Lüdecke sieht die Myrtenstöcke schon immer so an –"
Aus lauter Besorgnis, man könnte ihren Mann nach seiner Verschlechterung kurzweg "Lüdecke" titulieren, hatte seine Frau sich so daran gewöhnt, ihn ihrerseits als Herrn Lüdecke zu betonen, daß sie selbst in ihren inwendigen Gedanken kaum noch davon abging.
Vielleicht fiel Anneliese eine fatale Ähnlichkeit auf die Nerven zwischen Frau Lüdeckes Zukunftsschwärmereien für die Kinder und ihren eigenen am Frühstückstisch. Schauten sie nicht auf einmal wie Bilder von Konfektschachteln: "Braut im Kranz", "schmucker Student"? Nicht so ausführlich wie sonst hörte sie Frau Lüdeckes Morgenunterhaltung an, da unten in der kleinen Behausung mit den Tüllgardinen und dem Kanarienvogel, wo alles fast unnatürlich blank und neu blieb, als habe es eben erst den Laden verlassen, oder als sei Herr Lüdecke von Asbest. Seine Frau vermerkte es auch übel, als Anneliese zu bald sich nach ihrer tiefer stehenden Nebenbuhlerin im Dienst des Hauses, nach Frau Baumüller, umsah, die außen auf einer kurzen Leiter stand und Fensterglas klarrieb.
Frau Baumüller kam alle Morgen aus dem Dörfchen Brixhausen, das jenseits des Bergwaldes lag, und blieb tagsüber, worauf sie noch Speise mit heimbekam, denn das tat not. Sie besaß zehn lebendige Kinder und einen Leib, der es nicht mehr der Mühe wert hielt, sich zurückzuziehn: fast in jedem Jahr gebar sie und begrub auch ein Kleines – erst letzter Tage das letzte. Gesund geboren, starb es den übrigen nach, um die sich nie jemand recht kümmerte.
Als Anneliese sie wegen des kleinen Begräbnisses ansprach, fuhr sie sich zunächst mit dem Fensterwischtuch nach den Augen, hielt unterwegs jedoch inne und rieb kräftig weiter. Weinen, das war nicht nötig hier, wo man sie kannte.
Ihre Philosophie dabei hatte stets denselben Wortlaut: "Mit die Kleinen war's nicht anders, und die Großen kam's zugute." Ja: mütterlich froh im Herzen, tiefbefriedigt, daß kein Neuangekommenes nun einstweilen ihren Kindern das Brot vom Munde fortessen werde, blickte sie von ihrer Trittleiter zu Anneliese herab – so unverfallen, weiblich stattlich sogar –, in ihrer gebärtüchtigen Mächtigkeit eine nicht enden könnende, sich selbst im Wege stehende Kraft.
Gitta, die ein Patent auf Träume hätte nehmen können, hatte einmal geträumt, die Baumüllers fräßen jedesmal ihre kleinsten Kinder, davon würden sie derb und drall.
Sämtliche Söhne und Töchter waren Anneliese wohl vertraut, sie half die älteren versorgen, die jüngeren ernähren und auch noch die toten begraben. Ihre Beziehung zu den Hilfskräften ihres Haushalts ging wesentlich weiter, als unter ihren Bekannten üblich war; von diesen wohnte sie entfernt, enthielt sich wegen der Zeitknappheit ihres Mannes jeden Verkehrs und fand anstatt dessen in die Dörfer der Umgegend manchen Zugang von Baumüllers oder Lüdeckes aus: was ihr wertvoll vorkam.
Bei Frau Baumüllers Worten zog Anneliese der Kleinsten Schicksal das Herz weh zusammen; sie sah die paar Nächstjüngsten vor sich mit ihren grauen, greisenhaft ergebenen Gesichterchen.
Sie sah den Zug von Kindern – ungezählter, fremder, geliebter, vergessener –, die allein, vor der Zeit, ins große Dunkel zurückgehn aus Not. Dabei stand noch immer unverrückt vor allen ihren Sinnen Lotti.
Anneliese stieg noch einmal hinab in das Erdgeschoß. Dort war neben der Lüdeckeschen Wohnung und unterhalb einer kleinen Holzveranda ein heller Raum, die sogenannte Truhenstube, die nur Schränke und Truhen beherbergte und alles, was dem täglichen Gebrauch nicht mehr oder noch nicht diente. Von beidem – Altem und Neuem – entnahm Anneliese den Schubfächern und tat es in einen Handkorb zusammen, und als sie zu Wäsche und warmem Zeug auch noch Spielzeug hinzulegte, da war es Altes – und Neugebliebenes dennoch –
Bisher hatte sie's nicht weggeben mögen – aber nun sollte Lotti mit ihr gehen und beschenken.
Seit den Geburtstagen der Kinder hatte Anneliese die schöne Sitte angenommen, mit ihnen zugleich Bedürftigen aufzubauen. Die Kinder selbst beteiligten sich eifrig daran, nicht selten mit dem Geld für manches, was vorher auf dem Wunschzettel gestanden. Warum setzte es aus an Lottis Tag? Weil es kein Dankopfer mehr sein konnte der Eltern an ewig unbekannte Mächte? Aber wohnte denn diesem Tage nicht unverlierbar sein ewiges Geschenk inne? Immer, für immer, bedeutete er Besitz, nicht Verlust nur.
Aus diesem Zug der Kinder, die ins Dunkle gingen, rettete die Liebe die geliebtesten sich zurück, daß sie stehenblieben, ewig unversehrt.
Nicht darum allein waren die Kleinen der Baumüllers tot, weil sie gestorben waren.
Anneliese hatte den Weg eingeschlagen ins Dörfchen Brixhausen jenseits des Bergwaldes, von woher die Arbeitsfrauen mit ihren Rückenkiepen zum Tagewerk in die Stadt kamen.
Draußen begann es zu schneien. Aus der Stadt unten hatten sich Spaziergänger eingefunden mit vergnügten Gesichtern und vom lange erwarteten Schneewetter wie elektrisiert; erwachsene Menschen bewarfen einander mit Schneebällen, ein sonst ganz vernünftig aussehender alter Herr in großem Kragenmantel sang mit Innigkeit: "Trara, trara, trara! Der Winter, der ist da!" Jeder fühlte sich stolz, geehrt und erhoben, weil er weiß wurde und niemand wissen konnte, ob er nicht morgen wieder schwarz sein würde. Man ging wie zu einer Maskerade. Wie eine Verhüllte fühlte auch Anneliese sich. Ein Querpfad durchschnitt die bergan sich windenden Waldstege kurz und steil. Da oben ward es stiller. Tief verschneit lagen unter ihr die Hänge. Ruhiger, breiter Flockenfall darüber, ohne Wind, fast ohne merkbaren Frost. Geisterhaftes Hineingreifen in die reglose Luft wie mit weißen Fittichen, die alles hinwegtrugen aus ihr, was nicht höchste Reinheit war. Es schien: wenn das noch anhielte, dann öffneten die Wolken sich bald, und herniederstiege vom Himmel der große, weißeste Hauptengel selber.
Anneliese schritt langsam in ihrem Schneeflockenmantel. Der Hängekorb war umfangreich und drückte schwer den Arm.
Da lag vor ihr das Dörfchen, fast hinweggelöscht vom Wetter.
Von diesem Gang würde sie heute abend ihrem Manne erzählen können! dachte sie, wie an etwas Schönes.
Zwar hörte sie, wie er mahnte – am meisten durch sein Beispiel –, nicht sich zu schwächen in Trauer, nicht dem Toten nachzugehen. Und sie gab ihm recht. Aber wäre das nicht ein Armutszeugnis an Leben, wenn es nur tapfer wäre und nicht auch reich, und geizen müßte mit seiner lebendigsten Schenkkraft? Und von seinem Überfluß – von dem durfte doch wohl auch Lotti empfangen –, wie die Ärmeren empfingen hier aus diesem Korb.
Dies dachte Anneliese, als sie, ihren Korb am Arm, zum erstenmal ganz allein ging, auf einem Weglein zur Freude, das sie sich selbst erfand.
So stieg sie durch die ruhige Schneelandschaft hinunter in das Dörfchen Brixhausen.
II.
Wenn Branhardt abends heimkam, klang ihm schon eine Strecke vor dem Hause Musik entgegen.
Er freute sich eines jeden Males, wo er so empfangen wurde, und er wußte manchen Grund dafür. Vor ihrer Verheiratung, die seine Frau schon in ihrem siebzehnten Jahre schloß, hatte sie sich zur Musikvirtuosin ausbilden wollen, und ihr Mann empfand sehr wohl, daß die frühe Gebundenheit Anneliese von einer schönen Entwicklung abhielt. Wohl trat er niemals fordernd gegen etwas auf: doch sie, gegen sich selber, tat das –. Vielleicht aus Furcht, daß gar zu weit die Seele sich ihr verlieren könnte – zu weit fort vom Pflichtenkreis eines materiell sehr beengten und daher strengen Lebens, in das sie beide ziemlich lange Zeit hindurch gebannt blieben.
Als deshalb Anneliese, zögernd erst, dann immer länger und ernsthafter, ihren damaligen Stutzflügel wieder in Gebrauch nahm – als sie, von Jahr zu Jahr unbekümmerter und voller, den Unterstrom ihres inneren Lebens musikalisch freigab, da galt ihm das einer köstlichen Liebeserfahrung gleich: einer endgültig gefestigten Gebundenheit aneinander – einem Lautwerden gleichsam alles dessen, was sie und Branhardt verband. Anneliesens Musik: das war noch einmal Anneliesens Vermählung.
Trat Branhardt abends ins Haus, dann nahm er gewöhnlich gleich den Weg ins noch unerhellte Wohnzimmer; mit seinem leichten, nie lauten Gang kam er fast unmerklich, blieb fast unmerklich in einem der tiefen Sessel, aus denen er sich nicht weit heraushob. Dies war ihm das liebste Ausruhen, das er kannte.
Selbst unmusikalisch, auch durch Zeitmangel dem Hören von Musik ferngehalten, wurde er mit ihr nahezu ausschließlich durch Anneliese vertraut. Deshalb wirkte so vieles daran auf ihn allmählich wie eine Wesensäußerung Anneliesens selbst. Daß Musik ihm in gewisser Weise ebensoviel von seiner Frau erschloß wie diese von jener, darin bestand eigentlich der musikalische Reiz für ihn.
Und Anneliese lernte immer mehr und besser, sich auch noch anders, als er wußte, dessen zu bedienen: auf solchem Wege bis zu ihm zu gelangen mit manchem, was ihm sonst Überschwenglichkeit gehießen hätte. Sie verbrauchte einen starken Gefühlsschwung und war frisch und froh genug, um ihn sicher zu bewältigen. In ihres Mannes Schweigen, während der Flügel sprach, genoß sie nicht ohne seine Schalkhaftigkeit ein wortloses Ihn-Überreden, sein besiegtes Sie-Umfangen.
Rief dann Frau Lüdecke mit überbehutsamem Türöffnen zum Mittagsmahl und blickte in der unvermittelten Helle der Eßstube Branhardt auf seine Frau, dann lag auf ihrem Gesicht jedesmal das Herzensfreudige, Lebenleuchtende, das noch die schwermütigste Musik darüber zu breiten pflegte.
Und einem solchen Gesicht gegenüber erzählte es sich noch einmal so gut von des Tages Mühe und Arbeit.
Mit der ihr eigenen Unbedingtheit vergötterte Anneliese ihres Mannes Beruf, verwechselte ihn gewissermaßen mit ihm selbst; ob er nicht am Ende auch einen andern hätte ergreifen können, das hatte längst keinen Zugang mehr in ihren Vorstellungskreis. Zudem verknüpfte ja sein Berufsleben sich gleichzeitig mit seinem Eheleben so sehr, daß in allen entscheidenden Vorkommnissen der Frauenschaft oder Mutterschaft die Autorität des Mannes von der des Arztes sich nicht mehr trennen ließ. Und gern legte Anneliese sich die Dinge so zurecht, als ob in Branhardts ärztlichem Dasein wiederum etwas Feinstes, Menschlichstes ihm erst als eine Frucht erwachse ihres persönlichsten, gegenseitigen Verhaltens.
Jetzt, während der Abwesenheit der Kinder, konnte ihre Unterhaltung sich noch unbehinderter als sonst ergehen. Dennoch vermißten sie Tag für Tag "ihre beiden", wenn sie sich so gegenüber saßen zu zweien, gerade wie einst als junge, kinderlose Leute.
Nach der Mahlzeit, als sie noch bei Tisch verweilten, meinte Branhardt deshalb einmal: