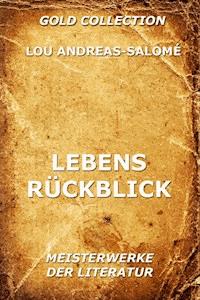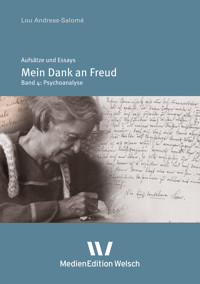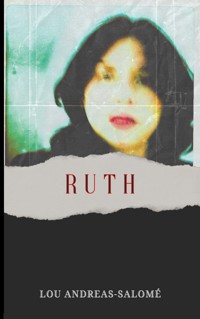0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NEXX
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Eheleute Brandhardt und die Eheleute Lüdicke bewohnen das Ober- bzw. das Untergeschoß eines Hauses. Der Roman schildert das Zusammenleben udn die Konflikte der Familien und deren zurückkehrender Kinder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Lou Andreas-Salomé
Das Haus
Impressum
Covergestaltung: nexx verlag gmbh, 2015
ISBN/EAN: 9783958705524
Rechtschreibung und Schreibweise des Originaltextes wurden behutsam angepasst.
www.nexx-verlag.de
Erster Teil
Erstes Kapitel
Das Haus lag an der Berglehne und überblickte die Stadt im Tal und langgestreckte Höhen jenseits davon. Von der Landstraße, die sich in großem Bogen den Bergwald hinaufwand, trat man gleich ins mittlere Stockwerk ein wie zu ebener Erde: so tief dem Berg eingebaut hatte das kleine weiße Haus sich.
Auf ihn gestützt aber sah es nach dem abfallenden Garten zu umso freier hinaus über die Weite; mit sehr vielen hellen Fensteraugen bis tief hinab, mit keck vorspringenden Erkern, Ausbauten der ursprünglich zu wenig umfangreichen Gemächer, was ihm freilich eine etwas wunderliche Architektur, doch auch Anmut und Leichtigkeit verlieh – fast, als raste es da nur.
Über dem mittleren Erker schob sich zuoberst ein Altan breit vor ins baumbepflanzte, winterliche Gartenland, das eine Steinmauer, alt und bemoost, umschloss. Die Altantür stand trotz der frühen Morgenstunde schon weit geöffnet. Auf der Schwelle, das Gesäß vorsichtig ins warme Zimmer gedrückt, saß eine bejahrte kleine Hündin und blinzelte schläfrig nach den ab und zu schwirrenden hungrigen Vögeln, wie ein verwöhntes Hauskind sich bettelndes Gassenvolk betrachtet. In ihr selbst hatten sich zwar die verschiedensten Hundegeschlechter ein nichts weniger als aristokratisches Stelldichein gegeben, wie ihr Dackelgebein, ihr Mopsrumpf und ihr Terrierkopf verrieten – eine Vielseitigkeit, die noch vervollständigt wurde durch ein ferkelhaftes Ringelschwänzchen an ihrem anderen Ende. Weitaus das Merkwürdigste an dem kleinen Ungetüm jedoch blieb, dass es Salomo hieß. Jedermann erstaunte hierüber, außer der Tochter des Hauses, die auf diesem männlichen und königlichen Weisheitsnamen bestanden hatte, trotzdem Salomo ihr einst in hochträchtiger Verfassung zugelaufen war, worauf er vier gesunde Pinscher zur Welt brachte.
Die Vögel vollführten einen gewaltigen Lärm. Denn Finken und Blaumeisen, Rotkehlchen und Hänflinge, Grasmücken und andere noch scharten sich auf dem Altan um freihängenden – dadurch der Sperlingskonkurrenz enthobenen – Speck, sowie einen Napf mit Wasser, das wenige glimmende Kohlen in der Topfscherbe darunter vor dem Zufrieren schützten. An der Altantür aber stand die Hausfrau und warf überdies, fröhlich, emsig Körnerfutter hinaus.
Salomo trug seine richtiggehende Uhr im Leibe: nach der hatte man längst beim Morgenfrühstück zu sitzen. Glücklicherweise für ihn zog der Herr des Hauses jetzt seine aus der Westentasche: ins Zimmer tretend, gab er Salomos stummem Tadel entrüsteten Ausdruck.
»Na, Salomo, was sagst du dazu?! Über der Tochter Vogelvieh vergisst die Anneliese uns, ihre beiden hungrigen Hauptspatzen?«
Schon in einer Stunde musste er unterwegs sein in die gynäkologische Klinik der Stadt. »Eine Pedanterie, sich nicht an den Frühstückstisch setzen zu wollen ohne seine Frau!« meinte er selber oft, aber er meinte auch: »Ärzte, diese Überbeschäftigten, müssten an einigen schönen Pedanterien festhalten, sonst würden sie unversehens wieder zu Junggesellen.«
So holte er sich denn die Frau weg, um hinabzugehen in die unteren Wohnräume, wobei er seinen Arm durch den ihren schob. Anders – so wie es ehedem noch Mode gewesen, als sie einander fanden – hätte es sich weit schlechter gemacht: um ein so beträchtliches Stück war er kleiner gewachsen als sie.
Salomo folgte ihnen auf dem Fuß. In der Messstabe, vor deren Fenstern große Bäume verschneite Zweige wiegten, hatte er beim grün glasierten Kachelofen seinen Thron, einen umgestülpten Korb mit darauf befestigtem Kissen, denn Salomo saß gern hoch und übersah die Lage und nicht zum wenigsten den Esstisch, der ihm schon morgens hocherfreulichen Anblick bot: wo reichlicher Imbiss des Hausherrn wartete, der an den Wochentagen erst abends Zeit fand zum Mittagsmahl daheim.
Anneliese hatte sich bereits gesetzt – da kehrte sie sich plötzlich um zum Manne, der neben ihr stand. Sie fasste nach seinem Arm, drückte ihr Gesicht daran, es unwillkürlich senkend. Als er sich niederbeugte und es zu sich emporhob, standen ihre Augen in Tränen.
»Lieselieb!« sagte er nur, aber der Kosename, der einzige, mit dem er sie rief seit ihrer Brautzeit, klang wie Bitte und Mahnung zugleich. Da schwieg sie von dem, was sie weinen machte.
Ein Tag des Gedenkens – der Geburtstag ihres dritten Kindes, das ihnen vor Jahren starb. Leise hatte er gehofft, sie würde sich nicht sogleich daran erinnern, als er vorhin ihr morgenhelles Gesicht gesehen – draußen im Vogelschwarm.
Seit der Trauer um Lotti ging Anneliese nur noch in grauen oder braunen Kleidern umher. Und doch sah er an ihrer blonden, kraftvollen Frauenerscheinung die frohen Farben am liebsten.
Neben den beiden Gedecken lag die Frühpost. Er reichte Anneliese den Brief, den er während des Wartens am Tisch gelesen hatte.
»Lies!« sagte er. »Lauter Gutes. Gitta schon auf dem Rückweg von den Verwandten, von ihrer ›Examen-Belohnung‹, wie sie es im Brief stolz nennt. Trifft also wohl noch vor Balduin ein. Der allerdings sollte vielleicht noch mal kurz fortgehen – nach Weihnachten. Denn offenbar ist dies Erholungsheim gerade das Richtige für ihn gewesen. Nicht umsonst rühmten die Kollegen mir den leitenden Direktor so sehr.«
Anneliese griff lebhaft nach dem Brief, sie bemerkte:
»Gestern, bei Professor Läuer, da sprachen sie auch so angenehm über unseren Balder. Ganz eingenommen hat er die alten Schulpäpste durch den Übereifer, womit er sein Abiturium nachholte! Jetzt begreifen sie's, dass du ihn zugabst, den kostspieligen Hausunterricht, für ihn, den schlechtesten ihrer Schüler! Der nun doch noch der jüngsten Studenten einer wird! Ich saß und tat beide Ohren auf und labte mich.«
»Ja, ja. – Aber nun?! Warum labt er sich nicht an dem, was er hinterdrein mit so wütender Energie bei sich selbst durchgesetzt hatte? Warum im Handumdrehen wieder der Ekel daran? – Das ist nicht nur Überarbeitung. Ja – wenn der Junge stetig auszuschreiten verstünde anstatt hin und wieder zu fliegen.«
Man konnte sehen, wie die fröhliche Nachricht von der Tochter für den Augenblick zurücktrat vor der Sorge um den Sohn. Die Falten im bartlosen Gesicht vertieften sich, das sich ohnehin bereits reichlich durchfurcht ausnahm. Dennoch wirkte der ganze Mensch auch jetzt jung. Die Augen an ihm blickten jung, und auf wen sie sich richteten, an dessen Jugend schienen sie sich zu wenden.
Anneliese war ganz bei Gittas kurzem Brief, aber auch der unerwartet sorgenvolle Ton kam ganz bis zu ihr, und er riss sie förmlich fort davon, rief ihre eigne Hoffnungsbereitschaft zur Antwort auf.
»Ach, Frank, lass gut sein! Wer weiß –: vielleicht lernt mancher nur spät und schwer gehen, der einmal zu hohem Flug bestimmt ist –«
Eine Spur von Überschwänglichkeit klang mit – klang aus dem Gewählten, Geschwellten der Worte.
Und nicht nur aus den Worten. Ihr über die Teetasse gebeugtes Gesicht verriet es – diese verräterische Haut der rötlichen Blondinen, bei der man die Blutwellen kommen und gehen sieht selbst in der leisesten Erregung. Auf diesem Farbenspiel, das gewissermaßen noch weiterredete in die Stille zwischen ihnen, ließ der Mann den Blick ruhen. Und auf den beinahe mattvioletten Schatten, die das wellige Haar dazu am Stirnansatz warf und hinten über dem Nacken – was ihm immer von neuem so gut gefiel. Er meinte manchmal, es sei das allererste gewesen, was ihm an Anneliese aufgefallen war, als sie einander entgegentraten.
Seine Frau prüfte nur flüchtig die übrige Post, las eine Karte.
»Also Helmold geht wirklich fort. – Wird dir fehlen unten in deiner Klinik. – Ob auf so lange, wie er denkt? Ich glaube: er kommt wieder!«
Das pfiffige Gesicht, womit sie diese Behauptung aussprach, nach dem Pathos von soeben, machte ihn lachen.
»Oh Kupplerinnen! Selbst du!« antwortete er und stopfte sein Pfeifchen mit Türkentabak. »Aber ich fürchte sogar, als Backfisch schwärmtest du wirklich für Marlittsche Reckengestalten mit goldblonden Bärten. Daher vielleicht.«
»Helmold hat mehr als blonden Bart und lange Beine. Und sollte Herr Doktor Frank Branhardt nicht selber den größten Narren an ihm gefressen haben?« fragte sie fröhlich. »Manchmal scheint er mir dir über deine leiblichen Kinder zu gehen – jedenfalls schon ›ein Sohn‹ zu sein.«
Branhardt konsultierte nochmals seine Uhr und erhob sich. »Frauenlogik! Eben darum! Darum soll er sich jedenfalls noch ganz gehörig Wind um die Ohren blasen lassen, ehe er den Kopf in die Schlinge steckt. Wird mal ein erstklassiger Chirurg! Unsinn, sich so früh zu binden.«
Auf diese Ansichtsäußerung lachte Anneliese über das ganze Gesicht. Sie stand auf, und etwas von übermütiger Herausforderung, ihrer sonstigen Art sichtlich Fernliegendes, verfing sich in den Klang der Worte, mit denen sie dem Mann zum Abschied ihren Kuss gab.
»Frank, du Armer! Dass du dich gar so früh binden musstest!«
Ihre Augen kreuzten sich mit den seinen in der gleichen, plötzlich hochschlagenden Erinnerung und Wärme. In beiden Menschen erstand der gleiche stolze Wunsch: Wie wir es gehabt, geradeso möge es unsern Kindern zuteilwerden!
Ungern trennten sie sich.
Während Branhardt aber durch den Garten ging, dachte er bei sich: Vielleicht würde ja sein Interesse an dem jungen, tüchtigen Helmold nicht dermaßen väterlich groß sein, wenn er am eigenen Sohn einen bessern Erben der eigenen Tüchtigkeit erhoffen könnte. Oder täuschte er sich am Ende darüber nur? Sooft hatte er heiß ersehnt, Schüler, Söhne, Jünglinge um sich zu haben, denen er mitteilen, abgeben, schenken dürfte. Ihm fehlte es an Zeit an allen Ecken und Enden, auch für einen akademischen Lehrstuhl. Er musste lächeln: hundert Söhne sollte Lieselieb haben ...
Und doch ging es ihm vor allem um den einen – oh ja, das fühlte er schon, dass es sein einziger leiblicher war. Zum Greifen deutlich tauchte Balduins Jungengesicht vor ihm auf, die stumpfe Nase, die Sommersprossen. – Es hatte der Mutter zarten Farbenton, ihr Rotblond auch. Doch war's nicht erst der Umweg über Anneliese, wodurch es Branhardt Zug um Zug lieb ward.
Im Weitergehen stellte er sich vor, wie er dem Jungen die Hand um die Schultern legte, wie er »wir« von ihm und sich sagte.
Anneliese war indessen hinuntergestiegen zu den Wirtschaftsräumen des in den Berg eingebauten Untergeschosses. Beim Fensterchen an der Treppenbiegung blieb sie stehen: über den Vordergarten weg sah sie die Landstraße hinab zur Stadt eine kleine, untersetzte Gestalt gehen, die rasch und ruhig ausschritt.
Wie hatten sie doch miteinander glücklich gescherzt – nicht einmal Erwähnung getan hatten sie ihrer: Lottis. Die Lebenden allein behielten Recht – es fiel ihr aufs Herz.
Mein süßes Kind, mein Liebling: es ist dein Tag! dachte Anneliese.
Sie stand, die Stirn ans kleine Fensterglas gedrückt. Branhardts Gestalt wurde ferner, undeutlicher, entschwand hinter den kahlen Bäumen der Allee.
Gesund und rotwangig wie ein Apfel, so war Lotti acht Jahre alt geworden. Dann ein Sturz aus der Schaukel; Rückenverletzung, Qualen, Streckbett und endlich erlösend: der Tod.
Wenn Menschenkraft Anneliese durch diese Zeit hindurchgeholfen hatte, so war es die ihres Mannes gewesen und sein Beispiel. Litt er auch wie sie, er gab sich nicht wie sie der Trauer hin um das tote kleine Mädchen. Den Blick, der dem Kinde nachschauen wollte, hielt er unentwegt auf die Lebenden gerichtet, die ihn nicht missen konnten, und noch heute lag es daran – lag an seinem Kampf mit Unvergessenem, wenn er Lottis Tag zu vergessen schien.
Aber sein Tagewerk war auch so, dass es wohl vieles zurücktreten lassen konnte. Auch der Alltag muss so unalltäglich sein können, dachte Anneliese bei sich.
Da ging sie still an ihre häuslichen Pflichten.
Neben den Küchenräumen befand sich unten noch eine Miniaturwohnung nach dem abfallenden Garten hinaus: drin hauste ein sehr nützliches Ehepaar, Herr und Frau Lüdecke, sie, um die Küche, er, um den Garten zu versorgen, obschon er einst, als selbständiger Gärtner, bessere Tage gesehen. Frau Lüdecke kränkte an den veränderten Verhältnissen seltsamerweise am meisten der Umstand, dass ihr Mann im gleichen Hause arbeitete wie sie, weil sie es reizvoll gefunden haben würde, ihn feierabends abzuholen oder ihm mittags den Esstopf zuzutragen, wie andere Frauen tun. Herr Lüdecke war gutmütig: des Sommers, bei extra schönem Wetter, tat er ihr den Gefallen und speiste etwas romantisch im allerentferntesten Gartenwinkel, wo eine Bretterbude mit Gerät stand. Abends aber, besonders bei Mondschein, spazierten sie dann immer noch ein wenig wie Liebesleute, und wenn ihnen solche begegneten, errötete Frau Lüdecke sogar im Dunkeln. Denn an ihr war nach fast zehnjähriger, kinderloser Ehe eine wunderbar zähe Bräutlichkeit haftengeblieben, und wenn Herr Lüdecke ihr Küchenholz kleinmachte oder den Wäschekorb trug, nahm sie das noch entgegen wie einen Minnedienst.
Die Nachricht von »Herrn Balderchens« Heimkehr zum Universitätsstudium stieß bei Frau Lüdecke auf größte Wärme, Studenten in Wichs waren ihr Höchstes. Und auch dass Gitta zurückkam, schien ihr an der Zeit. Wer konnte wissen, wie lange man sie noch behielt. »Ach! Gittachen einmal im Brautkranz! Herr Lüdecke sieht die Myrtenstöcke schon immer so an.«
Aus lauter Besorgnis, man könnte ihren Mann nach seiner Verschlechterung kurzweg »Lüdecke« titulieren, hatte seine Frau sich so daran gewöhnt, ihn ihrerseits als Herrn Lüdecke zu betonen, dass sie selbst in ihren inwendigen Gedanken kaum noch davon abging.
Vielleicht fiel Anneliese eine fatale Ähnlichkeit auf die Nerven zwischen Frau Lüdeckes Zukunftsschwärmereien für die Kinder und ihren eigenen am Frühstückstisch. Schauten sie nicht auf einmal wie Bilder von Konfektschachteln: »Braut im Kranz«, »schmucker Student«? Nicht so ausführlich wie sonst hörte sie Frau Lüdeckes Morgenunterhaltung an, da unten in der kleinen Behausung mit den Tüllgardinen und dem Kanarienvogel, wo alles fast unnatürlich blank und neu blieb, als habe es eben erst den Laden verlassen, oder als sei Herr Lüdecke von Asbest. Seine Frau vermerkte es auch übel, als Anneliese zu bald sich nach ihrer tiefer stehenden Nebenbuhlerin im Dienst des Hauses, nach Frau Baumüller, umsah, die außen auf einer kurzen Leiter stand und Fensterglas klar rieb.
Frau Baumüller kam alle Morgen aus dem Dörfchen Brixhausen, das jenseits des Bergwaldes lag, und blieb tagsüber, worauf sie noch Speise mit heimbekam, denn das tat not. Sie besaß zehn lebendige Kinder und einen Leib, der es nicht mehr der Mühe wert hielt, sich zurückzuziehen: fast in jedem Jahr gebar sie und begrub auch ein Kleines – erst letzter Tage das letzte. Gesund geboren, starb es den übrigen nach, um die sich nie jemand recht kümmerte.
Als Anneliese sie wegen des kleinen Begräbnisses ansprach, fuhr sie sich zunächst mit dem Fensterwischtuch nach den Augen, hielt unterwegs jedoch inne und rieb kräftig weiter. Weinen, das war nicht nötig hier, wo man sie kannte.
Ihre Philosophie dabei hatte stets denselben Wortlaut: »Mit die Kleinen war's nicht anders, und die Großen kam's zugute.« Ja: mütterlich froh im Herzen, tiefbefriedigt, dass kein Neuangekommenes nun einstweilen ihren Kindern das Brot vom Mund wegessen werde, blickte sie von ihrer Trittleiter zu Anneliese herab – so weiblich stattlich sogar – in ihrer gebärtüchtigen Mächtigkeit eine nicht enden könnende, sich selbst im Wege stehende Kraft.
Gitta, die ein Patent auf Träume hätte nehmen können, hatte einmal geträumt, die Baumüllers fräßen jedes Mal ihre kleinsten Kinder, davon würden sie derb und drall.
Sämtliche Söhne und Töchter waren Anneliese wohl vertraut, sie half die älteren versorgen, die jüngeren ernähren und auch noch die toten begraben. Ihre Beziehung zu den Hilfskräften ihres Haushalts ging wesentlich weiter, als unter ihren Bekannten üblich war; von diesen wohnte sie entfernt, enthielt sich wegen der Zeitknappheit ihres Mannes jeden Verkehrs und fand anstatt dessen in die Dörfer der Umgegend manchen Zugang von Baumüllers oder Lüdeckes aus: was ihr wertvoll vorkam.
Bei Frau Baumüllers Worten zog Anneliese der Kleinsten Schicksal das Herz weh zusammen; sie sah die paar Nächstjüngsten vor sich mit ihren grauen, greisenhaft ergebenen Gesichterchen.
Sie sah den Zug von Kindern – ungezählter, fremder, geliebter, vergessener – die allein, vor der Zeit, ins große Dunkel zurückgehen aus Not. Dabei stand noch immer unverrückt vor allen ihren Sinnen Lotti.
Anneliese stieg noch einmal hinab in das Erdgeschoß. Dort war neben der Lüdeckeschen Wohnung und unterhalb einer kleinen Holzveranda ein heller Raum, die sogenannte Truhenstube, die nur Schränke und Truhen beherbergte und alles, was dem täglichen Gebrauch nicht mehr oder noch nicht diente. Von beidem – Altem und Neuem – entnahm Anneliese den Schubfächern und tat es in einen Handkorb zusammen, und als sie zu Wäsche und warmem Zeug auch noch Spielzeug hinzulegte, da war es Altes – und Neugebliebenes dennoch.
Bisher hatte sie's nicht weggeben mögen – aber nun sollte Lotti mit ihr gehen und beschenken.
Seit den Geburtstagen der Kinder hatte Anneliese die schöne Sitte angenommen, mit ihnen zugleich Bedürftigen aufzubauen. Die Kinder selbst beteiligten sich eifrig daran, nicht selten mit dem Geld für manches, was vorher auf dem Wunschzettel gestanden. Warum setzte es aus an Lottis Tag? Weil es kein Dankopfer mehr sein konnte der Eltern an ewig unbekannte Mächte? Aber wohnte denn diesem Tage nicht unverlierbar sein ewiges Geschenk inne? Immer, für immer, bedeutete er Besitz, nicht Verlust nur.
Aus diesem Zug der Kinder, die ins Dunkle gingen, rettete die Liebe die geliebtesten sich zurück, dass sie stehenblieben, ewig unversehrt.
Nicht darum allein waren die Kleinen der Baumüllers tot, weil sie gestorben waren.
Anneliese hatte den Weg eingeschlagen ins Dörfchen Brixhausen jenseits des Bergwaldes, von woher die Arbeitsfrauen mit ihren Rückenkiepen zum Tagewerk in die Stadt kamen.
Draußen begann es zu schneien. Aus der Stadt unten hatten sich Spaziergänger eingefunden mit vergnügten Gesichtern und vom lange erwarteten Schneewetter wie elektrisiert; erwachsene Menschen bewarfen einander mit Schneebällen, ein sonst ganz vernünftig aussehender alter Herr in großem Kragenmantel sang mit Innigkeit: »Trara, trara, trara! Der Winter, der ist da!« Jeder fühlte sich stolz, geehrt und erhoben, weil er weiß wurde und niemand wissen konnte, ob er nicht morgen wieder schwarz sein würde. Man ging wie zu einer Maskerade. Wie eine Verhüllte fühlte auch Anneliese sich. Ein Querpfad durchschnitt die bergan sich windenden Waldstege kurz und steil. Da oben ward es stiller. Tief verschneit lagen unter ihr die Hänge. Ruhiger, breiter Flockenfall darüber, ohne Wind, fast ohne merkbaren Frost. Geisterhaftes Hineingreifen in die reglose Luft wie mit weißen Fittichen, die alles hinwegtrugen aus ihr, was nicht höchste Reinheit war. Es schien: wenn das noch anhielte, dann öffneten die Wolken sich bald, und herniederstiege vom Himmel der große, weißeste Hauptengel selber.
Anneliese schritt langsam in ihrem Schneeflockenmantel. Der Hängekorb war umfangreich und drückte schwer den Arm.
Da lag vor ihr das Dörfchen, fast hinweggelöscht vom Wetter.
Von diesem Gang würde sie heute Abend ihrem Manne erzählen können! dachte sie, wie an etwas Schönes.
Zwar hörte sie, wie er mahnte – am meisten durch sein Beispiel – nicht sich zu schwächen in Trauer, nicht dem Toten nachzugehen. Und sie gab ihm Recht. Aber wäre das nicht ein Armutszeugnis an Leben, wenn es nur tapfer wäre und nicht auch reich, und geizen müsste mit seiner lebendigsten Schenkkraft? Und von seinem Überfluss – von dem durfte doch wohl auch Lotti empfangen – wie die Ärmeren empfingen hier aus diesem Korb.
Dies dachte Anneliese, als sie, ihren Korb am Arm, zum ersten Mal ganz allein ging, auf einem Weglein zur Freude, das sie sich selbst erfand.
So stieg sie durch die ruhige Schneelandschaft hinunter in das Dörfchen Brixhausen.
Zweites Kapitel
Wenn Branhardt abends heimkam, klang ihm schon eine Strecke vor dem Hause Musik entgegen.
Er freute sich eines jeden Males, wo er so empfangen wurde, und er wusste manchen Grund dafür. Vor ihrer Verheiratung, die seine Frau schon in ihrem siebzehnten Jahre schloss, hatte sie sich zur Musikvirtuosin ausbilden wollen, und ihr Mann empfand sehr wohl, dass die frühe Gebundenheit Anneliese von einer schönen Entwicklung abhielt. Wohl trat er niemals fordernd gegen etwas auf: doch sie, gegen sich selber, tat das . Vielleicht aus Furcht, dass gar zu weit die Seele sich ihr verlieren könnte – zu weit fort vom Pflichtenkreis eines materiell sehr beengten und daher strengen Lebens, in das sie beide ziemlich lange Zeit hindurch gebannt blieben.
Als deshalb Anneliese, zögernd erst, dann immer länger und ernsthafter, ihren damaligen Stutzflügel wieder in Gebrauch nahm – als sie, von Jahr zu Jahr unbekümmerter und voller, den Unterstrom ihres inneren Lebens musikalisch freigab, da galt ihm das einer köstlichen Liebeserfahrung gleich: einer endgültig gefestigten Gebundenheit aneinander – einem Lautwerden gleichsam alles dessen, was sie und Branhardt verband. Annelieses Musik: das war noch einmal Annelieses Vermählung.
Trat Branhardt abends ins Haus, dann nahm er gewöhnlich gleich den Weg ins noch unerleuchtete Wohnzimmer; mit seinem leichten, nie lauten Gang kam er fast unmerklich, blieb fast unmerklich in einem der tiefen Sessel, aus denen er sich nicht weit heraushob. Dies war ihm das liebste Ausruhen, das er kannte.
Selbst unmusikalisch, auch durch Zeitmangel dem Hören von Musik ferngehalten, wurde er mit ihr nahezu ausschließlich durch Anneliese vertraut. Deshalb wirkte so vieles daran auf ihn allmählich wie eine Wesensäußerung Annelieses selbst. Dass Musik ihm in gewisser Weise ebenso viel von seiner Frau erschloss wie diese von jener, darin bestand eigentlich der musikalische Reiz für ihn.
Und Anneliese lernte immer mehr und besser, sich auch noch anders, als er wusste, dessen zu bedienen: auf solchem Wege bis zu ihm zu gelangen mit manchem, was ihm sonst Überschwänglichkeit geheißen hätte. Sie verbrauchte einen starken Gefühlsschwung und war frisch und froh genug, um ihn sicher zu bewältigen. In ihres Mannes Schweigen, während der Flügel sprach, genoss sie nicht ohne seine Schalkhaftigkeit ein wortloses Ihn-Überreden, sein besiegtes Sie-Umfangen.
Rief dann Frau Lüdecke mit überbehutsamem Türöffnen zum Mittagsmahl und blickte in der unvermittelten Helle der Messstabe Branhardt auf seine Frau, dann lag auf ihrem Gesicht jedes Mal das Herzensfreudige, Lebenleuchtende, das noch die schwermütigste Musik darüber zu breiten pflegte.
Und einem solchen Gesicht gegenüber erzählte es sich noch einmal so gut von des Tages Mühe und Arbeit.
Mit der ihr eigenen Unbedingtheit vergötterte Anneliese ihres Mannes Beruf, verwechselte ihn gewissermaßen mit ihm selbst; ob er nicht am Ende auch einen andern hätte ergreifen können, das hatte längst keinen Zugang mehr in ihren Vorstellungskreis. Zudem verknüpfte ja sein Berufsleben sich gleichzeitig mit seinem Eheleben so sehr, dass in allen entscheidenden Vorkommnissen der Frauenschaft oder Mutterschaft die Autorität des Mannes von der des Arztes sich nicht mehr trennen ließ. Und gern legte Anneliese sich die Dinge so zurecht, als ob in Branhardts ärztlichem Dasein wiederum etwas Feinstes, Menschlichstes ihm erst als eine Frucht erwachse ihres persönlichsten, gegenseitigen Verhaltens.
Jetzt, während der Abwesenheit der Kinder, konnte ihre Unterhaltung sich noch unbehinderter als sonst ergehen. Dennoch vermissten sie Tag für Tag »ihre beiden«, wenn sie sich so gegenüber saßen zu zweien, gerade wie einst als junge, kinderlose Leute.
Nach der Mahlzeit, als sie noch bei Tisch verweilten, meinte Branhardt deshalb einmal:
»Was groß wird, rückt aus! Kleiner Nachwuchs tät uns eigentlich not, Lieselieb! Sieht man so eine wie dich, denkt man sich am liebsten: ein Volk von Söhnen sollte sie umstehen!«
Anneliese schwieg. Dankbar froh war auch sie gewesen, als sie vor einigen Jahren noch einmal ein Kind erwartete. – Zwillinge waren es, die dann infolge unglücklicher Lageverwicklung unter entsetzlichen Leiden der Mutter tot zur Welt gebracht wurden.
Trotzdem sie sicherlich nicht nervenschwach heißen konnte, blieb ihr von jener einzigen ernsthaften Erkrankung ihres gesunden Lebens ein unverwindbarer Eindruck zurück. Andererseits freilich hatte dieses Geschehnis erst sie mit einem Schlage eingereiht ihnen allen, denen Branhardt sein Leben widmete, und sie in schweren Krankenerfahrungen ihrem Mann auf eine ganz neue Weise verbunden.
Sie unterdrückte einen Schauer. »Da es doch nicht mehr möglich sein könnte, Frank –«
Fragend blickte er sie an: »Wie denn, nicht mehr möglich?«
»Seit damals.«
»Ja, damals! Aber seitdem – bist ja doch immer noch jung – glaubst 's wohl gar nicht mehr, weil du die Großen hast! Jung bist du und in blühender Kraft. Verzichten tut da nicht gerade not.«
Sie stützte die Arme auf, zuseiten des Gesichts, um es ihm zu entziehen, und sah vor sich hin auf das weiße Tischtuch. Verzichten nannte er das! Hätte er – er also wirklich wünschen können – er, der sie so entsetzlich, unmenschlich leiden gesehen – ja, als Arzt notgedrungen leiden gemacht. War sie denn feige – war er brutal in seinen Wünschen? Liebte er sie denn nicht zu sehr für eine solche Wiederholung – genügte nicht schon ein wenig, klein wenig, sorgende Liebe dazu?
Branhardt warf einen halben Blick auf sie, die, den Kopf noch auf die Hände gestützt, schweigend dasaß. Vielleicht kam ihm eine Ahnung von dem, was in ihren Gedanken umging. Er sagte rasch:
»Ein vereinzelter Unglücksfall, einer unter zehntausenden, dergleichen ist doch in keiner Weise ausschlaggebend! Daran darfst du überhaupt gar nicht mehr zurückdenken – nur voraus! Eine so Tapfere wie du: tapfer würdest du immer wieder sein – dafür kenn' ich dich doch! Die geborene Mutter, Lieselieb: und das ist ausschlaggebend.«
Sie hatte aufgeblickt – aber auch ohne hinzublicken, sah sie, wie er da vor ihr stand – in seinem Ton, seiner Haltung, so frei und überzeugt. Nicht an den Worten lag das Überzeugende, sondern an weit unmittelbarer Überredendem – ja, beinahe Körperlichem, an ein paar Bewegungen, einer Sicherheit, die wie Anmut wirkte – Anmut bei aller Unbeträchtlichkeit der etwas kleinen, gedrungenen Gestalt.
Noch ehe er ausgeredet hatte, ja noch während etwas in ihr sich auflehnte gegen seine Worte und ihre Seele sich zu verbergen trachtete vor ihm, wusste sie dennoch: schon gab sie ihm recht – schon stand sie bereit, mit zu wünschen mit ihm, inbrünstig zu wünschen alles, was aus seinem Leben das ihre werden ließ.
Wenige Minuten später sprach man von Andrem. Branhardt vergaß bald das kurze Gespräch. Wenn ihm in den nächsten Tagen sich etwas hätte aufdrängen können, so wäre es nur dies gewesen, dass aus der Musik im dämmerdunklen Wohnzimmer noch mehr Musik zu ihm sprach als sonst.
Branhardt pflegte sich abends nach Tisch in seine Zimmer zur Arbeit zurückzuziehen, wenn er nicht telefonisch abgerufen wurde, was oft geschah, oder wenn nicht etwas Besonderes vorlag. Eigentlich stand fest, dass er dann nur noch ganz kurz zum Tee zu Frau und Kindern ins Wohnzimmer käme. Meistens aber geriet er in eine aussichtslose Klemme zwischen diesem Grundsatz, an dessen Durchsetzung ihm was lag, und seinem Temperament, das sich in den lebhaftesten Anteil an allen Familienvorkommnissen verstrickte.
Zu zweien war das besser: sie glitten dann unwillkürlich in die alte Gewöhnung von früher hinein, auch abends im Studierzimmer neben der Bibliothek zusammen zu bleiben und dort auch den Tee zu nehmen. Und während Anneliese an ihrer eigenen Lampe mit ihrer eigenen Arbeit bei ihm saß, konnte Branhardt sich an freien Abenden bis in die Nacht hinein in Theoretisches vertiefen, wozu er in dem ganz von praktischen Forderungen erfüllten Tagesleben nicht gelangte.
Anneliese hatte ihr Nähzeug beiseite getan und sich ein Buch mitgebracht von Balduins Bücherbord in seiner Schlafkammer oben. Einen Dichter, den sie sonst weder las noch auch zu kennen sich sehnte; war ihr der Sohn aber fern, dann trieb es sie bisweilen, zu tun, was er selbst etwa täte, um sich so gemeinsam mit ihm zu beschäftigen.
Manche Stellen gewährten ihr Genuss um hoher sprachlicher Schönheiten willen, vieles erschien ihr fremd – anderes wiederum erinnerte sie eigentümlich an ihren Balder selber, mit seinem ungleichen, unbeherrschten, den Eltern Sorge bereitenden Wesen.
Gitta, die groß war in Namenerfindung, hatte ihn wegen seiner starken Stimmungsschwankungen schon in der Kindheit nie anders benannt als den Prinzen Nimm-von-mir oder den Kaspar Habenichts. So lange her also schon bestand dies Aufflackern und Verglühen, Alleskönnen und Nichtsvermögen ...
Von wem hatte er Krankhaftes?! Sie dachte an ihre Familie, an Branhardts. – Sein Vater, oben an der Nordsee, war als Landarzt hochbejahrt gestorben; die Mutter, eine dunkle Schweizerin aus dem Tessin, starb früh an einem toten Kinde, aber seine Erinnerungen an sie waren lauter Heiterkeit und Schönheit.
Als der Abendtee gebracht wurde und Anneliese ihn bereitete, bemerkte sie unvermittelt:
»Entsinnst du dich der alten Briefschaften, die ich nach dem Tode meiner Mutter vor ein paar Jahren aus Kurland empfing? – Da waren solche, wo vom Leiden des Großvaters die Rede war – ich las das wohl nie recht durch. – Du weißt, er starb in geistiger Umnachtung.«
»Ja. Infolge eines Absturzes in den Keller, als er Wein holen ging, oder so etwas. – Gehirnerschütterung. – Warum denn?«
Branhardt erhob sich, nahm seinen Tee, erblickte dabei Balduins aufgeschlagenes Buch und erriet unschwer den Gedankengang seiner Frau.
»Weißt du, Lieselieb, selten haben Kinder gesundere Eltern und Voreltern hinter sich als unsere beiden. – Und nun euer Leben gar, generationenlang im köstlichen Landfrieden, in eurem kurländischen Winkel da! Mit den Majoraten, die so viele Geschwister arm lassen, habt ihr's euch dort dumm eingerichtet, aber den Landfrieden, den hast du noch auf dir, Geliebte. Und ich kann ihn gut brauchen!«
Er sprach heiter, stimmte auch Anneliese so. Den Kopf gegen das Polster ihres Korbsessels drückend, meinte sie nur:
»Gitta, die hat ja auch noch ein kleines Stück Landruhe abbekommen – wenigstens sofern man eine Vorstadt vor der Hauptstadt so nennen kann. – Manchmal wünsch' ich aber: wär' nur auch der Balder uns noch dort geboren worden, am Waldrand, bei Kiefern und Heide, anstatt in der besseren, bequemeren Wohnung! Anstatt inmitten der Stadt, zwischen Kasernen und Kliniken, Lärm und Staub. Standen die Fenster offen, um ein wenig Sommer zu ihm hereinzulassen, und sausten die Elektrischen um die Ecke, dann zuckte er im Schlaf. Das seh' ich noch sooft vor mir, wenn er nervös ist. Und selbst du warst es damals – Jahre der gehetztesten Überbürdung waren's ja – darum allein zogen wir ja herein.«
Branhardt fuhr sich über die steil gebaute Stirn, über der das kurzgeschorene Haar immer weiter zurückwich, ohne über diesen steilen Stirnansatz täuschen zu können, der sich sooft fest abgrenzte, als wolle er sich sein Recht wahren, nicht erst von der Jahre Gnaden da zu sein.
»Ein Mensch gleich dir, ein so harmonisch in sich ausgeglichener – und ein Sohn wie Balduin, eingerechnet alle seine Fehler wie Vorzüge: das ist freilich ein Problem. In jedem neuen Menschenkind ist eben so viel Neues, Fremdes, davon unser Fleisch und Blut nicht weiß – und was doch wir selber weitergeben, mit blinden Händen, schuldlos, letzten Endes verantwortungslos. – Da ist ein Unberechenbares uns unzugänglich. Eine Schranke, errichtet zwischen den Generationen. – – Kinder gehen in jedem Fall und in jedem Sinn weiter, als unser Bund mit ihnen reicht.«
Er begab sich an seine Arbeit, blätterte jedoch zerstreut. Stand wieder auf, ging hin und her mit seinen leichten Schritten, als ob das Gespräch ihn noch nicht gleich losließe. So dauerte es eine Weile, bis er wieder festsaß am Schreibtisch.
Anneliese bewegte noch die Frage in ihrem Herzen:
Gehen die Kinder weiter als unser Bund mit ihnen –? Wenn man ihnen aber folgt? Würde eine Mutterseele davon verwundet und gesprengt? Und warum auch nicht? Und sie dachte weiter:
Schuldlos an ihnen sein, letzten Endes verantwortungslos? Ach, was hilft das, wo man liebt?!
Stunden verrannen, die Nacht rückte vor, ohne dass Branhardt aufstand. Seine Kraft zur Sammlung, »Geschenk ausgezeichneter Nerven«, wie sie sagten, neideten Kollegen ihm oft. Gelang es einmal, dass er bei einer Sache bleiben durfte, dann fand er ein Ende nur schwer.
Anneliese hatte nicht selten solche Nächte neben ihm zugebracht, und besonders im ersten Jahrzehnt ihrer Ehe. Sie waren nicht so wie in Gesellschaft eines Bücherwurms, der sich vergräbt. Nein, oft hatten sie einen lebendigen Kampf bedeutet, weil seine Natur darauf ausging, das Leben in voller Ganzheit zu umfassen und sich zu jeder Art von Einseitigkeit nur zwang. Auf vieles verzichten, was zu solcher Ganzheit zu gehören schien, um vom gegebenen Punkt aus umso fruchtbarer allseitig zu wirken: das spielte sich in Branhardts Seele vor den feinen Augen seiner Frau wie ein tiefmenschliches Drama ab, mit Siegen und Niederlagen.
Der Schauplatz: dies Studierzimmer, blieb fast immer derselbe, denn dessen ursprüngliche Einrichtung hatten sie durch allen Wechsel mit sich genommen wie die Schnecke ihr Haus. Und im allerersten Haus, dort an der Stadtgrenze vor dem Föhrenwald, repräsentierte es auch fast die Gesamtwohnung; gegenüber lag nur noch das Schlafzimmer, die Küche aber war erhoben zu einer allerliebsten kleinen Messstabe, darin Anneliese am Herde waltete.
Entsann Anneliese sich dieser engen Behausung zu zweien, so lag für sie dennoch etwas darüber von einem fast feierlichen Alleinsein. Tagsüber hielten Branhardt berufliche Pflichten in der Umgegend und an Instituten der Stadt von ihr entfernt; und beinahe war ihr das recht so. Beinahe bedurfte sie der Einsamkeit: so überstark ward ihr das Erlebnis ihrer Liebe. Gleich allzu feurigem Wein berauschte das Glück die kaum Erwachsene, von den Ihrigen Entfernte – brachte sie um alle Fassung. Ein Instinkt sagte ihr, dass er sie nicht ebenso beobachten dürfe, wie etwa sie seinen Berufs- und Entwicklungskämpfen zusah. Die vielen Stunden ganz mit sich allein in diesen Räumen, deren Enge Poesie geworden war, halfen ihr zur glückbereiten Sammlung durch ihrer Hände schlichte, grobe Arbeit. Ließen ihr Raum, auf ihre Frauenweise an sich selbst zu arbeiten – in jenem tiefen, zitternden Ernst einer, die ihr Haus nicht nur für sich, sondern für den Geliebten schmückt mit allem Kostbarsten, davon sie weiß – ihre Seele für ihn ruft und schmückt. – Nein: Flitterwochenglück war es nicht, für alle beide nicht, diese Glückesschwere.
Aus dem bescheidenen Vorstadtidyll am Waldrand, vor das gleichwohl nicht so sehr Turteltauben zu Wächtern geeignet schienen als ein Löwenpaar, erstand Gitta.
Annelieses Gedanken, gegen den Schlummer ankämpfend, verträumten sich. Wie kam das doch nur, dass dieser Vorstadtwald so schön sein konnte, soweit und still, trotz der Scherben und Papiere, die seinen Nadelboden verunreinigten, der Menschen und Räder, die ihn durchschwirrten? – Sie meinte ihn noch wahrzunehmen, den warmen Duft des Kiefernstandes, auf den ihre paar Fenster hinausgingen – das Herüberblinken der Riesenstadt – ihr dumpfes Brausen, und wie sich langsam, immer näher, Haus an Haus zu ihnen heranbaute – und doch immer noch unberührte Stille bestehen blieb, oft hart daneben: irgendwo friedvoll ruhend unter alten Bäumen oder auf letztem Wiesenland – gleich ahnungslosen Lämmchen dicht vor dem alles verschlingenden, sich nähernden Wolf. –
Als Branhardt spätnachts einmal an die Büchergestelle trat, sich etwas herauszugreifen, bemerkte er, dass seine Frau in ihrem Korbstuhl schlummerte. Den Kopf mit dem vollen rötlichen Haar gegen das Lederkissen der Rückenlehne gelegt, schlief sie fest, einen unnennbar beglückten, lieblichen Ausdruck auf den Zügen. Denn in ihrem Traum stand ein Wald im Märchenglanz. So wie er damals bisweilen gestanden hatte bei sinkender Sonne im Winter: ganz von Silber. Und sie wusste, dass es ein Wald ohne Ende sei.
Branhardt legte sein Buch aus der Hand. Ihr Gesicht, das nicht schön war und ohne die innige Inschrift der Seele in all den Jahren in das Banale hätte verblühen können, war so beredt für ihn. Wie in der Jugend noch, so stark und herzlich liebte er es, und dann auch noch anders als nur in der Jugend: denn was darauf zu lesen stand, das trug nun auch er, vielleicht in härteren Lettern, als gleiche Lebensinschrift in sich.
Waren sie einander doch gleich im innersten Bestreben: und so auch Geschwister geworden in irgendeinem Sinne.
Einen Augenblick blieb er vor ihr stehen, und mit einer tiefen Freude überkam ihn die Gewissheit: jeder Jugendglanz weniger auf diesem Gesicht, das ist nur wie ein Schleier mehr, der abfällt vom Antlitz einer Schwester.
Anneliese fühlte sich an der Schulter berührt.
»Lass mich im Wald!« murmelte sie.
»Dies ist kein Nachtschlaf für dich. Steh' auf, Lieselieb. Komm, ich helfe dir hinaufgehen.«
Niemand kam zurück. Die Lampen blieben brennen auf dem Schreibtisch und auf dem Nähtisch.
Morgens, kurz vor dem Hellwerden, als Frau Lüdecke sich zum Aufstehen rüstete, nahm sie sogleich den fahlen Lampenschimmer wahr über den verschneiten Gartenwegen. Missbilligend schüttelte sie ihren Kopf im weißen, vorn getollten Häubchen, das sie des Nachts trug, weil Herr Lüdecke sich vor Haaren fürchtete, die sie im Bett verlieren könnte. Und gegen Haare war Herr Lüdecke nun einmal empfindlich.
»Ach Gott, Gottchen, so ein Überstudierter, was der treibt! Herr Lüdecke, der dürfte mir das nicht, sich so zuschanden studieren!« entschied sie bei sich und eilte hinauf – mit sanftem Vorwurf anzuklopfen, denn geheizt musste nun werden. Sie wagte ja immer nur einen wortlosen Tadel und suchte ihn nur in den schlimmsten Fällen durch ihren Blick und einen Seufzer eindrucksvoll zu machen.
Als sie jedoch die Tür öffnete, war das Studierzimmer leer.
Frau Lüdecke behielt aber zeitlebens die heimliche Überzeugung, da habe sich jemand noch in letzter Minute vor ihrem vorwurfsvollen Blick gedrückt.
Drittes Kapitel
Mit roter Bandschleife am Hals, ungefähr auf der Grenze, wo er schon nicht mehr Terrier und noch nicht ganz Mops war, wurde Salomo zum Bahnhof geführt, und die Leute staunten ihm nach – was ihn freudig stimmte. Er hielt viel von roten Bandschleifen, und auch Gitta wollte ihn zu ihrem Empfang festlich sehen.
Anneliese sah im letzten Augenblick auch Branhardt an den Zug kommen – obgleich es zu einer Stunde war, wo er sich sonst kaum frei machen konnte – und obgleich es kaum möglich schien, über Salomos Gemütsbewegung hinweg Gitta in menschlicher Weise zu begrüßen.
Sie kehrte noch genauso zeitgemäß wunderschlank zurück, wie sie fortgegangen war, aber auch trotz ihres unfertigen, schmalen Wuchses in Aussehen und Bewegung von derselben, Branhardts Arztblick förmlich labenden Gesundheit wie immer. Ihm blieb nur gerade Zeit, das Gepäck abzuwarten und Frau, Tochter, Koffer und Salomo in einen Wagen zu verladen – doch hinterher sprang er auf einmal noch mit hinein.
Das war recht unvernünftig, denn jeder Schritt entfernte ihn weiter von den Kliniken. Allein – Gitta hatte es nun einmal an sich, die Leute leichtsinnig zu machen, fand Anneliese stets.
Dazu brauchte nicht einmal der Inhalt ihrer Mitteilungen ihn zu interessieren: in ihrem dritten oder vierten Jahr hatte er ähnlich hingenommen zugehört, wenn sie ihm aus umgekehrt vor die Augen gehaltener Zeitung mit Wichtigkeit vorlas – und nicht nur das, sondern später auch, wenn sie ihm wahrhafte Nichtsnutzigkeiten bekannte.
Anneliese sagte bisweilen: von dieser bedenklichen Seite habe sie selber ihn erst kennengelernt dadurch, dass sie ihm diese Tochter gab.
Zu Hause angelangt, als Gitta in ihrer kleinen Stube neben dem elterlichen Schlafzimmer oben den Hut ablegte, nahm Anneliese die einzige Veränderung wahr, die sich doch mit ihr zugetragen hatte: wieder war – zum wievielten Male schon – die Haarfrisur eine neue. Und das nichts weniger als üppige, etwas wellige dunkelblonde Haar fügte sich ganz merkwürdig allen Experimenten.
Gitta, im Geplauder mit der »Mumme«, wie die Mutter bei ihr hieß, fuhr beim Auspacken in der Stube herum, deren Fußboden, nicht sehr ästhetisch, schützende Lappen deckten, da er etwas verspätet gestrichen worden war. Gitta behauptete, ihre Frisur habe sie der Einhornreiterin auf dem »Schweigen im Walde« nachgemacht, das noch aus ihrer Kinderzeit an der Wand hing, in ihren Träumen eine Rolle spielte und bei Frau Lüdecke unausrottbar »Genoveva« hieß.
Auf dem Tisch darunter stand sonst ein goldener Wecker. »Der musste schleunigst zu Helmold zurückgebracht werden«, bemerkte Anneliese; »weißt du noch, wie er ihn dir lieh mit der scherzhaften Motivierung: ›Der gräulichen Langschläferin‹, weil du fast dein Examen verschlafen hattest? Nun reist Helmold wirklich ganz fort.«
»So?« äußerte Gitta etwas zerstreut, denn schon war sie mit ihren Gedanken wenig dabei; sie strebte aus der Stube, dem Hause hinaus. Sie musste mit Salomo in den Hühnerhof, das einzige Stück innerhalb der Wirtschaft, wofür sie sich ernsthaft interessierte. Max, der Hahn, kannte sie noch, er entstieg sofort seinem warmen Torfmull und krähte in Ekstase, die letzte seiner stolzen Schwanzfedern, die ihm von der Mauserung übriggeblieben, wie eine windschiefe Fahne schwenkend. Zwei Hennen aber, Lena und Margareta, fehlten! Gitta wusste, wo sie geblieben waren, zornrot lief sie hinein zu Frau Lüdecke.
Ja, Lena und Margareta waren Suppenhennen geworden. Gegen die überzähligen Hähnchen im Frühjahr musste man ebenfalls das Herz verhärten. Würde Gittachen nicht manchmal verreisen, so gäb's bald einen Hühnerhof von lauter Greisinnen und Knaben, was den Eiern unmöglich gut bekommen konnte. Es war gegen die Weltenordnung. – Frau Lüdecke hielt davon noch mehr als von Weltordnung.
Herr Lüdecke aber nicht. Er verbesserte es leise. Trotz der Baumschere, die er in der Hand hielt, denn er ging gerade die Hecken zu beschneiden, nahm er sich mit seinem gehaltenen Wesen und der goldenen Brille, die er ständig trug, fast wie ein Bankier aus, der Gartenliebhaber wird zu Entfettungszwecken.
Von Lüdeckes musste Gitta noch weiter hinabsteigen bis ins letzte Kellergeschoß, wo auf Holzgestellen das Obst lagerte. Auch dort musste sie jemanden wiedersehen: einen lieben Igel, der die Mäuse fraß. Aus diesem Grunde war er im Hause sehr wohlgelitten, obschon, was Gitta anbetraf, er anstatt dessen auch Mäuse hätte hervorbringen können. Er hieß Justus, und manchmal, nach Tisch, wurde er in den Kreis der Familie gezogen.
Und nach Justus kam der Garten dran: die Vogelbegrüßung. Von dem, was noch sichtbarlich durchs kahle Gezweig flog, konnte man ja die Meinung hegen, es stelle sich ein Gitta zu Ehren, die allwinterlich den Altan zum Schlaraffenland werden ließ; was weiterhin ins Undeutliche sich verlor – ein Tönchen, ein Flügelschlagen – gehörte vielleicht zur Insassenschaft des Berghausgartens gar nicht mehr, aber Gitta beargwöhnte es darum noch lange nicht als der Fremde Zuzuzählendes: lieber weitete sie dem Garten seine Grenzen.
Lange währte es deshalb, bis sie mit allen Begrüßungen zustande gekommen war. Es blieb Gittas Geheimnis, wo die Welt ihrer Hausgenossenschaft endete.