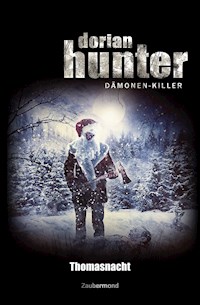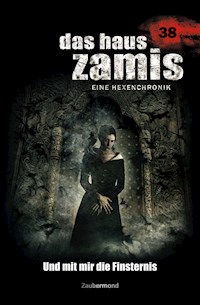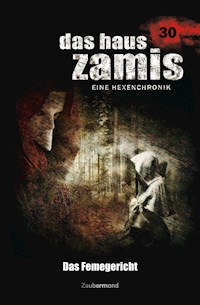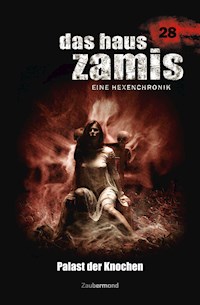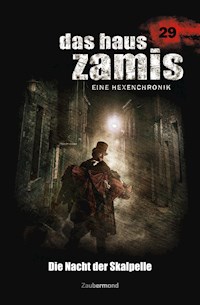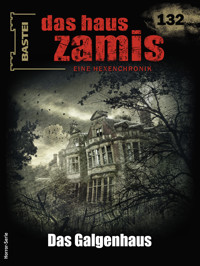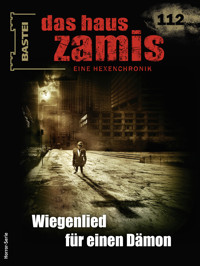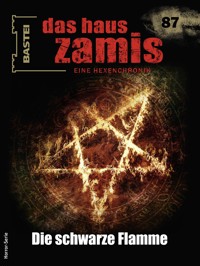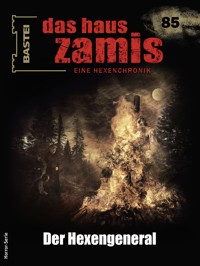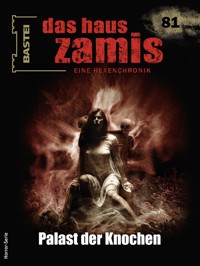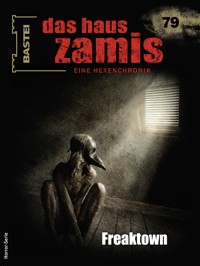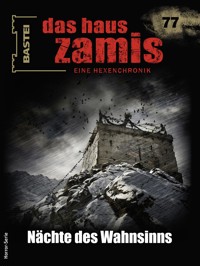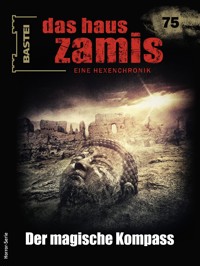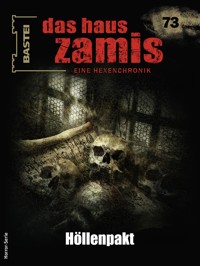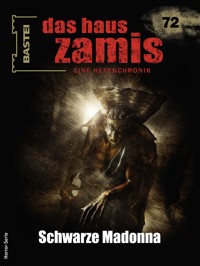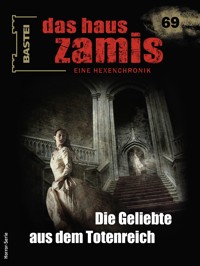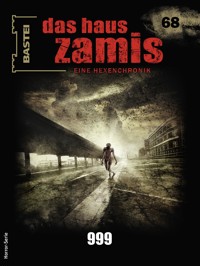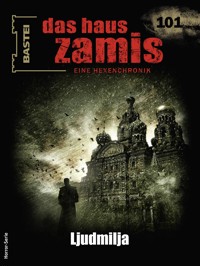
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In dem hübschen kleinen, mit filigranen Stelen verzierten Kuppelbau aus weiß schimmerndem Marmor hauste sie. Die uralte Ljudmilja, die man die älteste Hexe Russlands nannte.
Tagsüber bot die Urnenkammer einen friedvollen Anblick, doch bei Nacht offenbarte sich die wahre Natur des Gebäudes.
Blanke Schädel verschiedenster Form und Größe zierten die Spitzen des schmiedeeisernen Zauns. Die Augen der Schädel leuchteten in einem kalten, Unheil verkündenden Weiß.
Der Reliefbogen über dem Eingangstor erschien wie ein geöffneter Mund, die Gitterstäbe des Tores glichen den riesigen Zähnen eines urzeitlichen Monsters. Ein dumpfes, stetes Trommeln drang aus dem Inneren des Hauses hervor ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Was bisher geschah
LJUDMILJA
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
mystery-press
Vorschau
Impressum
Coco Zamis ist das jüngste von insgesamt sieben Kindern der Eltern Michael und Thekla Zamis, die in einer Villa im mondänen Wiener Stadtteil Hietzing leben. Schon früh spürt Coco, dass dem Einfluss und der hohen gesellschaftlichen Stellung ihrer Familie ein dunkles Geheimnis zugrundeliegt. Die Zamis sind Teil der Schwarzen Familie, eines Zusammenschlusses von Vampiren, Werwölfen, Ghoulen und anderen unheimlichen Geschöpfen, die zumeist in Tarngestalt unter den Menschen leben. Die grausamen Rituale der Dämonen verabscheuend, versucht Coco den Menschen, die in die Fänge der Schwarzen Familie geraten, zu helfen. Ihr Vater sieht mit Entsetzen, wie sie den Ruf der Zamis-Sippe zu ruinieren droht. So lernt sie während der Ausbildung auf dem Schloss ihres Patenonkels ihre erste große Liebe Rupert Schwinger kennen. Auf einem Sabbat soll Coco zur echten Hexe geweiht werden. Asmodi, das Oberhaupt der Schwarzen Familie der Dämonen, hält um Cocos Hand an, doch sie lehnt ab. Asmodi kocht vor Wut und verwandelt Rupert Schwinger in ein Ungeheuer.
Seitdem lässt das Oberhaupt keine Gelegenheit aus, gegen die Zamis-Sippe zu intrigieren. Michael Zamis sucht indes Verbündete unter den Oppositionsdämonen, die sich Asmodis Sturz auf die Fahnen geschrieben haben. Sein Unternehmen scheitert, und er wird von Asmodi zur Strafe in eine krötenartige Kreatur verwandelt. Während eines Schwarzen Sabbats wird Asmodi von Thekla Zamis vorgeführt. Aus Angst vor seiner Rache flüchten die Zamis vorübergehend aus Wien, kehren schließlich jedoch dorthin zurück. Asmodi erlöst Michael Zamis von seinem Freak-Dasein. Im Gegenzug soll Coco Asmodis missratenen Sohn Dorian Hunter töten. Es gelingt Coco, Dorian zu becircen – doch anstatt den Auftrag sofort auszuführen, verliebt sie sich in ihn. Zur Strafe verwandelt Asmodi Dorian Hunter in einen seelenlosen Zombie, der fortan als Hüter des Hauses in der Villa Zamis sein Dasein fristet.
In Wien übernimmt Coco ein geheimnisvolles Café. Sie beschließt, es als neutralen Ort zu etablieren, in dem Menschen und Dämonen gleichermaßen einkehren. Zugleich stellt Coco fest, dass sie von Dorian Hunter schwanger ist. Bald erhält das Café Zamis Besuch von Osiris' Todesboten. Sie überbringen die Nachricht, dass Coco innerhalb einer Woche sterben wird. Ebenso erhalten ihr Vater Michael und Skarabäus Toth die Drohung. Alle drei bitten Asmodi um Hilfe, müssen dafür jedoch das für sie jeweils Wertvollste als Pfand hinterlegen. So wird Coco ihr ungeborenes Kind entrissen. Mit Hilfe ihres Bruders Volkart gelingt es Coco, die Todesboten zu besiegen. Doch Asmodi gibt das Kind zunächst nicht wieder her. Erst soll Coco noch eine weitere Aufgabe für ihn erledigen. In seinem Auftrag reist sie nach Moskau, zusammen mit dem zwielichtigen Dämon Helmut von Bergen. Coco trifft dort auf Theodotos Wolkow, einen dämonischen Oligarchen, der in Besitz des Schwarzen Zimmers sein soll, und wird von ihm gefangen gesetzt. Ihr gelingt die Flucht, doch Wolkows Jagd auf sie und von Bergen ist eröffnet!
LJUDMILJA
von Catalina Corvo
Coco, Moskau
»Wohin als Nächstes?«, fragte ich meinen Begleiter, sobald wir ein paar Straßen zwischen uns und das Penthouse gebracht hatten. Wir waren beide von den Strapazen der Flucht gezeichnet. Ich keuchte, als wäre ich den New-York-Marathon gelaufen.
Mein Retter, Helmut von Bergen, lehnte an einer Hauswand und rang nach Atem. Das hinderte ihn leider trotzdem nicht an seiner üblichen Redseligkeit. »In meinem erfahrungsreichen, lasterhaften Leben habe ich natürlich überall auf der Welt Bekannte und Verbindungen«, erklärte er mir, von einzelnen Schnaufern unterbrochen.
Dabei zauberte der Fürst einen kleinen silbernen Flachmann aus der Hosentasche hervor. Nach ein paar kräftigen Schlucken reichte er die Flasche an mich weiter. Ein guter Cognac. Der Weinbrand wärmte meinen Magen und schenkte Kraft.
»Na bitte, endlich bekommst du wieder etwas Farbe.« Helmut musterte mich anerkennend. »Das ist mein Mädchen.«
1. Kapitel
Gerade noch hatte ich gedacht, dass wir Freunde werden könnten. Aber nicht, solange er wieder den Macho rauskehrte. Ich hätte ihm nur zu gerne erklärt, dass ich keineswegs sein Mädchen war und auch nicht vorhatte, es je zu werden. Aber dazu blieb keine Zeit.
Wolkow musste kochen vor Wut. Ich verspürte nicht das geringste Bedürfnis, ihm ein weiteres Mal in die Pranken zu fallen. Also blieb ich kurz angebunden, in der Hoffnung, dass das die Redseligkeit des Fürsten eindämmte. »Wohin also?«, fragte ich schlicht, sobald ich zu Atem gekommen war.
»Wir müssen uns in die Abgründe begeben.« Er zwinkerte mir süffisant zu. »In dunkle Tiefen zieht es uns hinab.«
Ich rollte die Augen. »Die Kanalisation etwa?« Na toll. Der Gestank würde erfahrungsgemäß noch zwei Duschen später in meinen Haaren kleben. »Was Exklusiveres hat der Herr Fürst nicht zu bieten? Und außerdem, was sollte Wolkow hindern, uns dort zu suchen?«
Helmut gab sich rechtschaffen entrüstet. »Ich muss doch sehr bitten! Meine Liebe.« Er bot mir mehr lässig als galant seinen Arm an. Widerwillig hakte ich mich unter, und wir schlenderten die Straße hinab.
Ich wusste, wie wir wirkten. Der alternde Geschäftsmann und seine blutjunge Schickse. Immerhin fielen wir damit im Stadtbild nicht auf. Wahrscheinlich wurde Helmut beneidet von all jenen, denen das Geld fehlte, eine hübsche, gierige Geliebte zu unterhalten. Natürlich genoss er die Aufmerksamkeit und spreizte sich an meiner Seite wie ein Pfau.
»Zweifellos habe ich etwas Besseres als eine rattenverseuchte Kloake zu bieten.« Generös tätschelte er mir die Hand, während ich mich unauffällig nach etwaigen Verfolgern umsah. »Aber um dorthin zu gelangen, werden wir ausnahmsweise mal kein Taxi nehmen.«
Grinsend steuerte er auf einen Metro-Eingang zu.
Gleich darauf standen wir auf der Rolltreppe, eingekeilt zwischen einer Großmutter, die zwei schmutzige, ausgebeulte Plastiktüten mit sich herumschleppte, und zwei Jugendlichen, die sich mit Energydrinks zuprosteten. Die sonderbare Mischung aus zu viel schweißübertünchendem Deodorant und urigem Parfum stach mir geradezu in die Nase. Gemeinsam mit dieser unangenehmen Wahrnehmung überkam mich im selben Augenblick das beklemmende Gefühl, dass wir beobachtet wurden.
Ich vertraute meiner Intuition. Schließlich hatte ich Situationen wie diese oft genug erlebt. Ich sah mich um und ließ den Blick über die stoische Menge auf der Rolltreppe schweifen. Doch keines der Gesichter erschien mir verdächtig. Auch meine magischen Sinne nahmen nichts wahr.
Das Licht der Straße verlor sich bereits über uns. Während wir in das Reich der Neonröhren eintauchten, da erkannte ich die Silhouette eines Raben am oberen Ende der Rolltreppe. Der Vogel hockte auf dem Mittelpart der Unterführung und starrte mir nach. Zumindest schien es so. Schon ein paar Sekunden später war ich nicht mehr so sicher. Hatte seine Aufmerksamkeit wirklich mir gegolten? Ich beobachtete das Tier, das inzwischen an etwas Unrat herumpickte. Es schien mir keine weitere Beachtung zu schenken. Vielleicht verfiel ich auch einfach nur einem Verfolgungswahn.
Wir rollten weiter hinunter in die Tiefe, und der Rabe verschwand aus meinem Blickfeld. Ein eiskalter Windzug stob uns aus dem heranrückenden Schacht entgegen. Meine Nackenhaare stellten sich auf, und ich rieb mir die Arme.
Dem Fürsten entging meine nervöse Anspannung nicht. »Such doch nicht so auffällig nach Verfolgern«, schnurrte er. »Damit ziehst du sie nur an.«
»Du nimmst Wolkow wohl auf die leichte Schulter.« Ich schüttelte den Kopf. »War dir die Flucht nicht schwer genug? Du glaubst wohl, er lässt uns so einfach gehen?«
Helmut zuckte mit den Schultern. »Wenn ich eins gelernt habe, dann, dass man sich über Dinge, die man sowieso nicht ändern kann, auch nicht allzu viele Gedanken machen sollte. Bis der alte Russki begriffen hat, was passiert ist, sind wir schon über alle Berge.«
»Allein, es fehlt der Glaube«, zitierte ich einen Klassiker.
Dann hatte die Rolltreppe ihr Ziel erreicht. Die träge Masse geriet in Bewegung, und auch wir folgten dem Strom der Menge.
Mein ungutes Gefühl ließ mich nicht los. Überall sah ich unliebsame Beobachter, ahnte ich feindliche Gedanken hinter verschlossenen Gesichtern und fürchtete drohende Gefahren. Hatte dieser Bettler uns nicht ein wenig zu lange angestarrt? War die Frau in dem Kioskhäuschen, die Zeitschriften und Schokoriegel verkaufte, nicht ein wenig zu neugierig?
Selbst als wir in den Zug stiegen, erschien mir der Ticketkontrolleur, der mit Worten und Gesten unsere Fahrkarten überprüfte, zu berechnend. Doch war auch er unmagisch. Und nichts deutete auf einen Zauber hin.
Helmut machte Witze darüber, dass ich mich nur auf die richtige Weise entspannen müsste, um mich besser zu fühlen. Er selbst werde selbstverständlich gerne dabei helfen.
»Natürlich hast du das Gefühl, dass dich alle anstarren.« Er lachte väterlich. »Weil es so ist. Schau dich doch an. Du siehst aus, als kämst du von einer seltsamen Mottoparty.«
Ich blickte an mir herab und begriff. Natürlich. Ich trug immer noch das Großmutterkleid, das Wolkow für mich ausgesucht hatte. Der altmodische Fummel hatte ganz schön gelitten.
Vielleicht hatte mein Begleiter recht, und ich war einfach nur paranoid. Er machte sich jedenfalls einen Spaß daraus, dass ich überall potenzielle Angreifer vermutete. »Wusstest du, dass es unzählige Legenden über die Moskauer U-Bahn gibt?«, wisperte er mir ins Ohr. »Da wäre die Legende von den Geisterarbeitern. Bei den Bauarbeiten für eine neue Linie kam es in den fünfziger Jahren zu einem Einsturz. Nicht wegen der sozialistischen Ingenieurskunst, wie man vielleicht vermuten könnte. Die soll nicht einmal ganz schlecht gewesen sein. Sondern wegen Fehlberechnungen über den Grundwassergehalt, hieß es. Manche sagen auch, die Arbeiter seien über die geheime Grabkammer Rasputins gestolpert.«
»Rasputins Grab?« Ich lächelte ironisch. »Ja, klar.«
»Egal wieso. Die Arbeiter starben im Tunnel. Und heute sollen sie angeblich hier irgendwo spuken. Manchmal erscheinen einzelne Bauarbeiter auf den Schienen und haben schon so manchem Zugführer einen Herzinfarkt verpasst. Oh, hier müssen wir raus.«
Wir waren nur eine Station gefahren. Aber anstatt sofort umzusteigen, warteten wir auf den nächsten Zug. Über uns hatten es sich ein paar Vögel zwischen den Neonröhren an der Bahnhofsdecke gemütlich gemacht. Sie huschten und flatterten aufgeregt umher. Ich ließ sie nicht aus den Augen, bis ich erleichtert feststellte, dass es nur Tauben waren.
Der Zug fuhr ein, und wir schlüpften hinter einer Gruppe schweigsamer Arbeiter in den Waggon. Die Männer ähnelten sich auf seltsame Weise. Ihre Jacken und Mützen unterschieden sich nur geringfügig, aber es waren vor allem ihre Gesichter, die alle dieselbe Müdigkeit ausstrahlten. Sie ließen eine halb volle Wodkaflasche herumgehen, die sich in Kürze leerte.
Obwohl die Männer unter sich blieben, schien die Gesellschaft meinem Begleiter nicht zu gefallen. Mit einem Stirnrunzeln stand er wieder auf, kaum dass der Zug in die nächste Station einfuhr.
»Auch nicht richtig?«, murrte ich. Trotzdem folgte ich ihm zurück auf das kalte Bahngleis. Nun, da mich die Rennerei nicht mehr warmhielt, fröstelte ich. Der russische Winter kroch auch auf die Bahnsteige des Untergrundnetzes hinab, und ich war für seinen kalten Atem schlecht gerüstet.
Helmut hob die Schultern. »Tut mir leid. Wir müssen uns wohl noch etwas gedulden.« Beim dritten Zug fiel mir auf, dass wir immer in den letzten Waggon stiegen. Und dass sich Helmut jedes Mal prüfend umsah, sobald wir das Abteil betraten. So als ob er jemand Speziellen suche. Aber als ich nachfragte, legte er nur beschwörend den Finger an die Lippen. »Wirst schon sehen, meine Hübsche.«
Mit solchen Versprechungen lotste er mich kreuz und quer durch die Unterstadt Moskaus, wie das weitverzweigte Bahnnetz manchmal genannt wurde. Besonders, da sich in den Bahnhöfen vor allem nachts jede Menge Gesindel tummelte. Obdachlose und Drogensüchtige, Trinker und Gangmitglieder ohne Zuhause schliefen in den Bahnhöfen oder Zügen, bis Polizei oder private Sicherheitskräfte die Unglücklichen mit unsanften Tritten hinausbeförderten.
Je länger unser Spiel dauerte, desto stärker leerten sich die Züge. Die Insassen änderten sich zum Schlechteren. Der Gestank intensivierte sich um ein Vielfaches, und die bittere Atmosphäre verbesserte mein Gefühl der ständigen Verfolgung nicht wirklich. Wir fuhren bereits Stunden hin und her. Mittlerweile war ein Großteil unserer Mitreisenden betrunken oder von anderen Mitteln berauscht. Ich musste verschiedene Kerle abweisen, die sich von mir für Geld eine schnelle Nummer erhofften. Einen schickte ich letztendlich mit Hypnose weg.
Ich sprach kaum noch mit Helmut. Er besaß immerhin den Anstand, angemessen verlegen zu sein. »Ich weiß auch nicht, warum es jetzt nicht funktioniert.« Ungeduldig fuhr er sich durchs schüttere Haar. »Sie sind alle weg.«
»Wer ist weg?«, fragte ich, nun mit gewisser Ungeduld. Aber Helmut hielt an seiner Geheimniskrämerei fest und winkte nur ab. »Wo stecken die, verflucht!«, murmelte er vor sich hin. Sein Plan schien gescheitert.
»Wir können nicht die ganze Nacht herumfahren«, versuchte ich es mit sanftem Zureden. »Vielleicht sollten wir uns irgendwo einmieten, um zumindest ein paar Stunden zu schlafen.«
Neben uns schnarchte lautstark ein Bettler. In seiner Hand lag eine halb leere Konservendose, deren bräunlicher Inhalt sich langsam über den Boden ergoss.
Die Qualität der U-Bahn Fahrt hatte wirklich nachgelassen. Die Züge kamen immer seltener. Außerdem hatte ich Hunger. Bei Wolkow hatte ich mir nicht gerade den Bauch vollgeschlagen. Meine letzte richtige Mahlzeit lag eine Weile zurück.
Helmut schüttelte den Kopf. »Du bist doch diejenige, die Angst vor Wolkow hat.« Er seufzte übertrieben genervt. »Suchst du nun ein sicheres Versteck oder nicht?«
»Ich würde es gern noch diese Nacht erreichen, wenn's geht«, erwiderte ich und gab mir nun auch keine Mühe mehr, meine schlechte Laune zu verbergen.
Helmut schwieg. Als die Lichter der nächsten Station den Zug empfingen, presste er die Lippen zusammen und gab sich einen sichtbaren Ruck. »Einen letzten Versuch machen wir noch«, beschloss er. »Diesmal gehen wir es anders an. Wenn das auch nicht klappt, sei's drum.«
Diesmal fuhren wir weiter als nur eine Station. Erst bei der Komsomolskaja der Ringlinie stiegen wir aus. Die Bahnstation war eine der wichtigsten Moskaus, erklärte mir Helmut knapp. Seine wortreiche, schmierige Galanterie war mit seiner guten Laune in der Kälte der Nacht erfroren. Ich bestaunte die Stuckdecke über uns. Goldmosaike und riesige Kronleuchter verliehen dem Bahnhof das Flair eines barocken Saals.
In der Komsomolskaja kreuzten sich mehrere wichtige Linien. Hier war immer was los. Selbst mitten in der Nacht fuhren noch regelmäßig Züge.
Helmut klapperte die einzelnen Gleise ab. Ich folgte ihm frierend. Ein kleiner Wärmezauber half mir immerhin, nicht haltlos zu zittern, aber ich wagte kaum, meine Magie ausgiebiger anzuwenden. Falls Wolkow magische Spione auf uns angesetzt hatte, wollte ich sie nicht unnötig auf mich aufmerksam machen.
Ein alter, magerer Bettler mit krummem Rücken und fleckiger Jacke, der tapfer selbst mitten in der Nacht auf einer schmutzigen Decke die Stellung hielt, erregte das Interesse meines Begleiters.
Er blieb vor dem schmutzigen Kerlchen stehen. Der Alte sah ihn halb erwartungsvoll, halb unterwürfig an. Helmut zog seine Börse und warf dem Mann einen Zwanzig-Euro-Schein vor die Füße. Vermutlich mehr Geld, als er je im Leben gesehen hatte. Euro war eine beliebte Währung im Schwarzmarkt. Ein kleines Vermögen. Doch bevor der arme Tropf die Banknote greifen konnte, stand ein lackierter Schuh auf seiner Hand. Der Bettler stöhnte und begann zu jammern und zu keifen.
»Sei still«, schnauzte Berger in akzentbehaftetem Russisch. »Sag mir, wo heute Nacht der Sonderzug fährt.«
Der Mann schüttelte den Kopf. »Was soll das?«, lamentierte er. »Ich weiß nichts. Versprochen. Ich weiß nichts.« Er machte nicht einmal Anstalten sich zu wehren. Wie ein Hund, der wusste, dass er so oder so verprügelt wurde. »Loslassen bitte. Ich habe keine Ahnung. Ich bin nur ein armer alter Mann!«
»Schrei nicht so laut.« Helmut sah gar keine Veranlassung, aufzuhören. Er trat sogar noch fester zu und drehte seinen Fuß langsam auf der knochigen Hand des Alten. »Du weißt bestimmt, welchen Zug ich meine. Der, der mich zu Vladimir bringt. Und nun sag schon.«