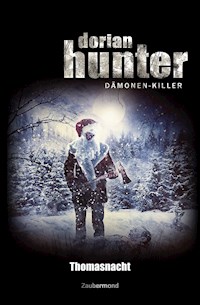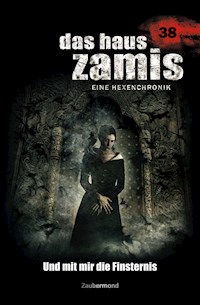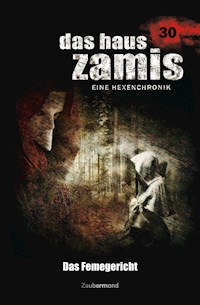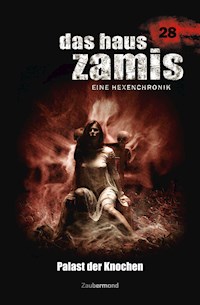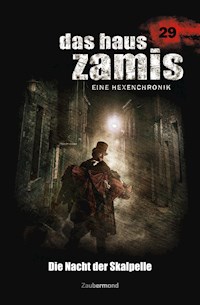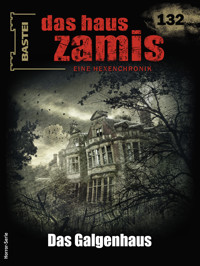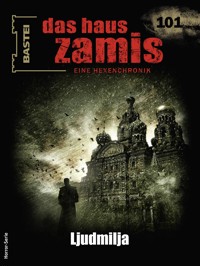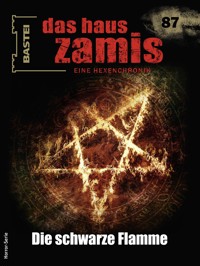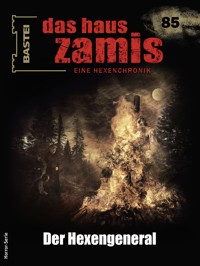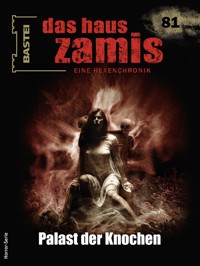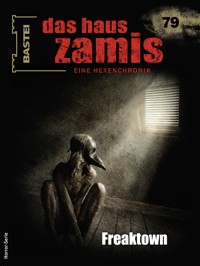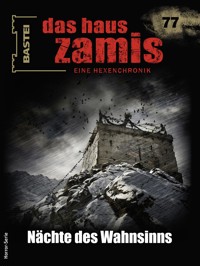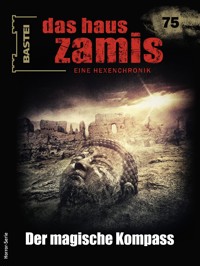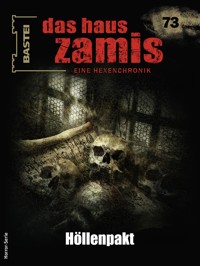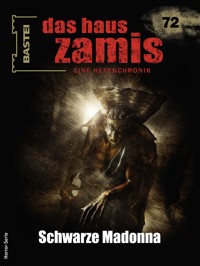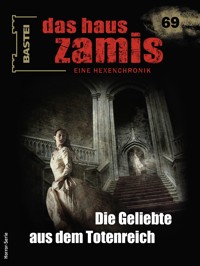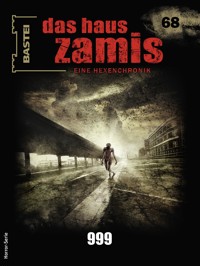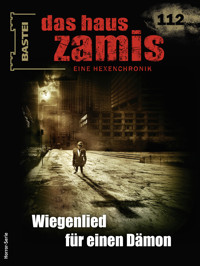
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sobald ich die Augen aufschlug, sah ich Rebeccas Körper auf dem Sofa. Sie sah blass und halb tot aus, aber ich erkannte, dass sich ihr Brustkorb schwach hob und senkte. Noch atmete sie. Ich konnte nur hoffen, dass Mama Wédos Geist noch in ihr lebte. Am Fußende der Couch saß der widerliche Schleimbeutel Ernest. Vor ihm stand eine Kinderwiege. Er schaukelte sie sanft und blubberte leise etwas vor sich hin, das wahrscheinlich ein Kinderlied sein sollte. Nun war die Geburt also vollzogen. Ich ahnte, dass mir nur noch wenig Zeit blieb, um sowohl Rebeccas Körper als auch Mama Wédos Seele zu retten. Da Ernest ganz in das Wiegenlied versunken schien und gerade sonst niemand anders im Raum war, machte ich mich heimlich daran, meine Fesseln zu lösen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Was bisher geschah
WIEGENLIED FÜR EINEN DÄMON
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
mystery-press
Vorschau
Impressum
Coco Zamis ist das jüngste von insgesamt sieben Kindern der Eltern Michael und Thekla Zamis, die in einer Villa im mondänen Wiener Stadtteil Hietzing leben. Schon früh spürt Coco, dass dem Einfluss und der hohen gesellschaftlichen Stellung ihrer Familie ein dunkles Geheimnis zugrundeliegt.
Die Zamis sind Teil der Schwarzen Familie, eines Zusammenschlusses von Vampiren, Werwölfen, Ghoulen und anderen unheimlichen Geschöpfen, die zumeist in Tarngestalt unter den Menschen leben. Die grausamen Rituale der Dämonen verabscheuend, versucht Coco den Menschen, die in die Fänge der Schwarzen Familie geraten, zu helfen. Ihr Vater sieht mit Entsetzen, wie sie den Ruf der Zamis-Sippe zu ruinieren droht. So lernt sie während der Ausbildung auf dem Schloss ihres Patenonkels ihre erste große Liebe Rupert Schwinger kennen. Auf einem Sabbat soll Coco zur echten Hexe geweiht werden. Asmodi, das Oberhaupt der Schwarzen Familie der Dämonen, hält um Cocos Hand an, doch sie lehnt ab. Asmodi kocht vor Wut und verwandelt Rupert Schwinger in ein Ungeheuer.
Seitdem lässt das Oberhaupt keine Gelegenheit aus, gegen die Zamis-Sippe zu intrigieren. Während eines Schwarzen Sabbats wird Asmodi von Thekla Zamis vorgeführt. Aus Angst vor seiner Rache flüchten die Zamis vorübergehend aus Wien, kehren schließlich jedoch dorthin zurück. Asmodi verlangt von Coco, seinen missratenen Sohn Dorian Hunter zu töten. Es gelingt Coco, Dorian zu becircen – doch anstatt den Auftrag sofort auszuführen, verliebt sie sich in ihn. Zur Strafe verwandelt Asmodi Dorian Hunter in einen seelenlosen Zombie, der fortan als Hüter des Hauses in der Villa Zamis sein Dasein fristet.
In Wien übernimmt Coco ein geheimnisvolles Café. Sie beschließt, es als neutralen Ort zu etablieren, in dem Menschen und Dämonen gleichermaßen einkehren. Zugleich stellt Coco fest, dass sie von Dorian Hunter schwanger ist. Coco, Michael und Toth bitten Asmodi um Hilfe gegen die Todesboten, müssen dafür jedoch das für sie jeweils Wertvollste als Pfand hinterlegen. So wird Coco ihr ungeborenes Kind genommen.
Mit Hilfe von Cocos Bruder Volkart gelingt es, die Todesboten zu besiegen. Doch Asmodi gibt den Fötus zunächst nicht wieder her. Mit Hilfe ihres neuen Liebhabers Damon Chacal gelingt es Coco schließlich, das ungeborene Kind zu finden und es im Totenreich zu verstecken. Danach trennt sie sich wieder von Chacal, wird jedoch bald von Albträumen heimgesucht, in denen Chacal und auch sie als grausame Hexe vorkommen. Coco will all das hinter sich lassen. Ein Anruf ihrer Freundin Rebecca kommt ihr da gerade recht. Rebecca lädt Coco zu sich nach New York ein ... Doch Rebecca ist offenbar nicht mehr die Alte. Sie steht unter dem Einfluss der dämonischen Vanderbuilds. Als Coco bei der Voodoo-Priesterin Mama Wédo um Hilfe ersucht, fährt die Priesterin in Rebeccas Körper. Coco fürchtet um das Leben des Kindes, zumal Rebeccas Körper immer schwächer wird. Sie benötigt Blut ...
WIEGENLIED FÜR EINEN DÄMON
von Catalina Corvo
Vergangenheit
New York glich einem Nachthimmel voller Sternschnuppen. Blitzte irgendwo ein neuer Stern auf, raunte die Meute ehrfurchtsvoll seinen Namen. Selbsternannte Astrologen prophezeiten diesem oder jenem Liebling der Massen eine glänzende Zukunft, aber oftmals war das neue Himmelsjuwel nicht mehr als ein verglühender Meteor.
Der neueste Stern der Saison hieß Etienne Dechaud. Ein drittklassiger Maler aus der französischen Provinz, dessen Biografie allerdings ein paar erstklassige Skandale verzeichnete. Drogen, Frauen und der blutjunge Sohn einer ungarischen Gräfin.
Derzeit tourte er mit einer Bilderserie durch die berühmtesten Galerien New Yorks. Zwölf Ölbilder mit Namen »Kopfsturm«, die er letzten Sommer in einem Sanatorium gepinselt hatte, nachdem seine aus Paris stammende Frau von einer Brücke gesprungen war. Die Presse hatte monatelang kaum ein anderes Thema gekannt.
1. Kapitel
Selbst an den Dämonenfamilien ging der Klatsch nicht spurlos vorüber. Dechaud war zwar selbst nur ein gewöhnlicher Sterblicher, aber er hatte einige Gönner in der Schwarzen Familie.
»Sie ist gar nicht gesprungen.« Die junge Dämonin Jennifer Ashworth kicherte gehässig. Sie kam aus einer unbedeutenden Sippe, hatte aber offensichtlich vor, in den Rängen der Schwarzen High Society aufzusteigen. Seit einigen Wochen lud sie sich regelmäßig selbst zum Tee in meine Wohnung im Dakota ein.
Ich ließ sie gewähren. Jedoch nur, weil Jennifer stets die teuersten Plätzchen aus einer vornehmen, französischen Bäckerei mitbrachte. Manchmal war ein wenig mehr darin als einfach nur Zucker und Teig.
»Angeblich haben ein paar Werwölfe aus der Grasswoodsippe Spaß mit ihr gehabt und sind dabei über die Stränge geschlagen«, plapperte meine Besucherin fröhlich weiter. »Meinst du, der alte Dechaud ist deswegen ins Sanatorium geflüchtet? Jetzt scheint er sich ja wieder nach draußen zu wagen.« Die junge Dämonin zupfte ihre weißen Spitzenhandschühchen zurecht, dann prüfte sie, ob das schicke rote Hütchen noch auf ihrer perfekt gewellten brünetten Mähne saß.
Ich zuckte nur die Achseln. Gelangweilt blätterte ich in einer Modezeitschrift, die kaum inhaltsvoller war als Jennifers gepudertes Köpfchen. »Ist das wichtig?«, fragte ich und gab mir kaum Mühe, mein Desinteresse zu verbergen.
Als sie den Blick hob, fiel mir wieder einmal Jennifers Nase auf. Sie war zu groß und zu lang für das ansonsten puppenhafte Gesicht und ließ die englische Herkunft der jungen Frau erkennen. Jennifer hasste ihre Nase und tat alles, um von ihr abzulenken. Ihre Kleider waren freizügig und schrill, die Lippen blutrot geschminkt, das Haar stets vollendet frisiert, und man sah sie selten ohne modischen Zigarettenhalter in den schlanken Fingern.
Aber sie konnte sich so mondän geben, wie sie wollte, sie blieb letztlich doch bloß das Mädchen aus der englischen Provinz. Wahrscheinlich war sie genau deswegen so darauf versessen, ihre Freunde immer mit dem neuesten Großstadtklatsch zu versorgen.
»Natürlich ist das wichtig«, verkündete sie stolz. »Denn heute findet bei Grims and Rhys eine Vernissage zu Kopfsturm statt. Und rate mal, wer zwei Karten hat und seine beste Freundin mitnehmen möchte.« Mit triumphalem Lächeln nahm sich Jennifer ein Trüffelbiskuit. »Insider sagen, es könnte das Ereignis des Monats werden. Und es werden auch einige angesehene Mitglieder der Schwarzen Familie anwesend sein.« Die junge Dämonin zwinkerte vielsagend. Das bedeutete, dass sich die Junggesellen der besser gestellten Familien wohl in Acht nehmen mussten.
Ich überlegte kurz, ob mich diese angeblich so angesagte Veranstaltung interessierte, kam zu einem Nein, nickte aber trotzdem. Denn leider, so musste ich mir schließlich eingestehen, hatte ich auch nichts Besseres vor.
Nachdem ich Asmodi wieder günstig gestimmt hatte, hatte er schnell wieder das Weite gesucht. Immerhin war er mir noch so sehr verfallen, dass er mir das schicke Domizil in New Yorks begehrtestem Luxus-Appartementhaus überlassen hatte.
Aber bereits nach den ersten Wochen erwies sich das Leben in New York als erstaunlich langweilig. Ich konnte tun und lassen, was ich wollte. Und genau da lag das Problem.
In den ersten Wochen und Monaten war mir die riesige Stadt wie eine eigene bunte Welt erschienen. Wie eine große Zuckerstange, die verführerisch duftete und ebenso gut schmeckte.
Aber selbst die wohlschmeckendste Süßigkeit verging einem, wenn man sie zu oft genoss. Asmodis standesgemäße, luxuriöse Bleibe verlor ihren Reiz, wenn man sich Tag für Tag darin aufhielt. Trotz der schönen Aussicht und des Komforts war in den vergangenen Wochen eine gewisse Langweile eingezogen, die wie ein unangenehmer Geruch am Teppich klebte. In Ermangelung besserer Bekanntschaften versauerte ich mit einer geltungssüchtigen Langweilerin wie Jennifer Ashworth.
»Gehen wir hinterher wenigstens noch auf einen Sabbat?«, hakte ich sicherheitshalber nach.
Jennifer nickte eifrig. Meine zögerliche Zusage zauberte ein zufriedenes Glitzern in ihre Augen. »Aber sicher. Da findet sich bestimmt irgendwas. Ich höre mich mal um.«
»Tu das.« Ich lehnte mich zurück und genoss es, das weiche, kühle Leder des blutroten Tudorsofas an meinem Rücken zu spüren. »Du kannst mich dann gegen acht Uhr abholen.«
Ich beachtete Jennifer nicht weiter. Mein Blick verfing sich an der japanischen Seidenmalerei neben dem Kabinettschrank. Sie zeigte eine Geisha, deren Augen ein eigentümliches Eigenleben besaßen und einem stets zu folgen schienen. In mondlosen Nächten waren die Lippen der Geisha geöffnet, und ein dünnes Rinnsal Blut tropfte daraus hervor. Doch wenn man einen Finger hineintauchte, verätzte es die Haut.
Eine kleine verfluchte Spielerei, die Asmodi mir kurz nach seiner Ankunft in New York geschenkt hatte.
Jennifer besaß zwar nicht das geringste Feingefühl, aber nach einigen Augenblicken bemerkte sie doch, dass ihre Anwesenheit nicht mehr erwünscht war. Mit einer gemurmelten Entschuldigung zog sie sich zurück.
Ich verabschiedete sie mit einem nachlässigen Wink. Die kleine Schleimerin würde schon früh genug wieder auftauchen.
Als die Wohnungstür hinter Jennifer ins Schloss fiel, durchzuckte ein gehässiger Gedanke meinen Geist. Die kleine Ashworth glaubte, mit einer Dämonin wie mir an ihrer Seite Eindruck zu schinden und sich wichtigmachen zu können? Da war doch eine kleine Lektion angebracht, die das hässliche Ding in seine Schranken verwies.
Gemächlich schlenderte ich zum Kleiderschank und warf ein paar vielversprechende Kleidungsstücke aufs Bett. Ein bestickter Traum aus schwerer, chinesischer Seide, hochgeschlossen aber eng anliegend wie eine zweite Haut entlockte mir schließlich ein Lächeln. Der Schlitz im Rock bis knapp übers Knie war gewagt und würde die biederen Kunstliebhaber aus ihren steifen Anzügen und die Damen aus ihren ebenso steifen Korsetts springen lassen.
Die Ashworth-Schlampe würde vor Neid erblassen.
Ein paar Stunden später ging der Plan auf wie ein Hefekuchen in der Mittagssonne. Jennifer konnte ihren Neid kaum verbergen. Vor allem, da die exotische Schönheit des chinesischen Kleids neue Verehrer in Scharen anzog.
Stets folgte mir irgendein junger Schnösel. Selbst ernannte Kunstliebhaber und Söhne reicher Väter rissen sich um die Gelegenheit, mir jeden Wunsch von den Augen abzulesen.
Ein attraktiver Vampir mit glutvollen Augen und einem rumänischen Adelstitel erhielt schließlich den Zuschlag. Ich erlaubte ihm, mich am Arm durch die Galerie zu führen und den Anschein zu erwecken, als ob die Ausstellungsstücke tatsächlich irgendjemanden interessierten.
Die Gespräche, die ich von den anderen Grüppchen aufschnappte, drehten sich allerdings hauptsächlich um angesagte Bälle und wo man den restlichen Abend verbringen würde. Auch mein adretter Begleiter beschwor mich, ihn zu einem Sabbat zu begleiten, der noch am selben Abend im Keller der Metropolitan Oper stattfinden würde. Ausgerichtet von einer einflussreichen Dämonenfamilie, die an der Stiftung des Gebäudes vor einigen Jahren beteiligt gewesen war. Häufig vergnügte sich die Dämonenwelt in den labyrinthischen Kellerräumen, während oben das Ensemble Wagner und Debussy auf die Bühne brachte.
Die langweilige Vernissage wurde erst einigermaßen unterhaltsam, als die Sektkorken knallten und der Maler selbst einen flamboyanten Auftritt hinlegte.
Unter mystischen Trommelklängen und bei gedämpfter Beleuchtung schien er wie ein Zauberkünstler aus einem seiner Bilder hervorzutreten. Die Ohs und Ahs der Kunstwelt und jener, die sich dafür hielten, waren ihm sicher. Zwar durchschauten mein Begleiter und ich das Kunststück schnell als Zaubertrick, aber dennoch hob sich die Stimmung unter den Anwesenden deutlich.
Der Alkohol tat sein Übriges. Nachdem sich der Champagnerfluss in die Gläser ergossen hatte, trocknete er auch nicht so schnell wieder aus. Ein paar Bilder und Hunderte von Dollar wechselten die Besitzer, Dechaud machte geistreiche, beinahe witzige Bemerkungen, Brillanten glitzerten an Damenhälsen, Männer lachten gedämpft und zitierten tote Philosophen.
Ein Mann mit einem Daguerreotypie-Apparat machte Bilder von den Gästen. Auch ich musste für ihn stillhalten, bis das Bild im Kasten war. Danach roch mein Kleid nach dem Phosphor der künstlichen Blitze, die der Assistent des Daguerrographen abgebrannt hatte.
Ich musste ein Gähnen unterdrücken. Schließlich winkte ich Jennifer zu mir. Zu dritt verließen wir die dröge Feier. Mein Galan bestellte ein Droschkentaxi. Gemeinsam fuhren wir zur Metropolitan.
Dort war die Gesellschaft bunter und wesentlich ausgelassener. Schon auf den breiten Treppenstufen vor dem ausladenden Haupteingang erkannte ich neben den regulären Opernbesuchern eine Gruppe von niederen Dämonen, die ein paar ahnungslose aufgetakelte Mädchen mit berechnendem Charme auf die Party lockten. Sekt, dem Drogen beigemischt waren, spielte dabei eine nicht unwesentliche Rolle.
»Hoffentlich knallt hier noch was«, murmelte Jennifer. »Sonst geht das als langweiligster Abend des Jahrtausends in die Geschichte ein.«
»Du wolltest auf die dämliche Vernissage«, erwiderte ich spitz. »Außerdem bist du mir noch etwas schuldig, weil ich dich dahin begleitet habe.«
Mittelalterlich anmutende Fackeln tauchten das Kellergewölbe unter dem Opernhaus in unruhiges, fahles Licht.
Immerhin hatten sich die dämonischen Gastgeber einiges einfallen lassen. In einem hohen Saal, der wahrscheinlich für sperrige Bühnenrequisiten gedacht war, hatte man eine Holzbühne eingerichtet. In gewisser Weise stellte sie ein verzerrtes Abbild der Bühne oben im Erdgeschoss dar.
Die dunkelroten Samtvorhänge glänzten feucht. Ein charakteristischer, süßer Geruch ging von ihnen aus. Die »Farbe« war frisch und noch nicht getrocknet. Rote Schlieren färbten den Holzboden der Bühne dunkel.
Im Gebälk ließen sich dort, wo die Scheinwerfer saßen, die Umrisse grotesk gebogener menschlicher Körper erkennen.
Erst als ein Großteil der erwarteten Gäste eingetroffen war und in kleinen Grüppchen um winzige runde Tische Platz genommen hatte, erkannte ich den eigentlichen Sinn und Zweck der Konstruktion am Gewölbehimmel.
Blutstropfen sprühten wie ein sommerlicher Regenschauer auf die Bühne und ins Publikum. Eine metallene mechanische Apparatur aus Zahnrädern und Holzbalken quetschte die menschlichen Opfer buchstäblich aus. Perfide langsam, sodass sie auf kunstvolle Weise ausbluteten. Im selben Augenblick wurde es dunkel im Raum. Gleichzeitig glitt der Vorhang hoch und enthüllte schlanke, kaum verhüllte Tänzerinnen.
Die Damen trugen nichts außer sich windenden Schlangen am Leib. Sie wiegten sich in hypnotischer Verzückung hin und her. Wie Priesterinnen einer geheimnisvollen indischen Gottheit tanzten sie sich im dunklen Regen mehr und mehr in Ekstase und bogen ihre Körper zu unmöglichen Posen und Verrenkungen.
An den Nachbartischen erklangen die ersten wohligen Seufzer. Anscheinend gaben sich nicht alle mit reinem Zuschauen zufrieden. In der Finsternis des Parkettsaals erkannte ich bebende, von Lust ergriffene Leiber, während auf der Bühne die Nummer wechselte.
Ein Zwitterwesen in seltsamer Kleidung, halb Anzug, halb Abendkleid, grellweiß geschminkt, mit prallen roten Lippen, vollführte einen langsamen, ritualistisch wirkenden Tanz mit sich selbst.
Schlaglichter tauchten die Bühne teils in grelles Licht, teils in tiefen Schatten. Der Tänzer oder die Tänzerin erschien mal als Mann oder als Frau, und nach einer Weile beschlich mich das Gefühl, eigentlich zwei androgynen Wesen beim Liebesspiel zuzusehen.
Ein die Sinne berauschender Anblick, der auch bei mir seine Wirkung nicht verfehlte. Als mein schöner Rumäne seine Hand auf meinen Oberschenkel legte, ließ ich ihn gewähren. Willig erwiderte ich seinen leidenschaftlichen Kuss.
Doch bevor seine munteren Hände mehr als nur meine Beine erkundeten, trat ein in den schwarzen Frack eines Totengräbers gekleideter Ansager auf die Bühne.
Er verneigte sich mit übertriebener Geste. Seine Haut war weiß geschminkt wie die eines Pierrots, die Augen schwarz umrandet. Er sprach mit seltsam schnarrender Stimme, als habe er irgendetwas in der Speiseröhre stecken.
Mit einem hintergründigen Lächeln kündigte er den nächsten Akt an. »Gladiatoren der Lüfte! Eine einzigartige Trapeznummer. Wer als Letzter noch in der Luft ist, gewinnt unermessliche fünftausend Dollar. Wer jedoch verfrüht herunterfällt, wird ... nun ja ...« Ein kehliges Lachen füllte die Redepause. »... ausscheiden.«
Die weiße Schminke ließ die Gesichtszüge verschwinden und das Lächeln boshaft erscheinen. »Jedem Teilnehmer ist eine Waffe erlaubt. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie, wie Ihnen unsere Vorstellung einen Einblick in die wahre Natur der menschlichen Seele erlaubt. Sehen Sie, was allein der Zauber von fünftausend Dollar möglich macht. Piraten, die hier mitten im schönen New York um einen sagenhaften Schatz kämpfen.«
Sein gekünsteltes Auftreten erinnerte mich an meine noch nicht lange zurückliegende Zeit beim Zirkus. Ich hatte schon genug dämonische Vorführungen gesehen und begann mich zu langweilen.
Mit halbem Auge sah ich den Vorgängen auf der Bühne zu. Über uns im Gebälk wurden Seile und ein Trapez ein Stück weit herabgelassen. Natürlich immer noch so hoch, dass ein Sturz ins Publikum tödlich sein konnte. Und unangenehm für den, der darunter saß. Aber das verlieh der bisher eher unspektakulären Nummer seinen Reiz.
Die Artisten, die sich schließlich von oben in das Gewirr aus Seilen herabschwangen, waren, soweit ich das auf den ersten Blick beurteilen konnte, gewöhnliche Menschen.
Sie waren wie Piraten gekleidet. Jeder von ihnen trug eine Waffe bei sich. Manche hatten sich einen Dolch zwischen die Zähne geklemmt, andere benutzten Krummsäbel oder verließen sich auf mittelalterlich erscheinende Kurzschwerter.
An den Seilen turnend hieben und traten sie aufeinander ein. Als der erste Kombattant schreiend ins Publikum stürzte, wurde das Spektakel wirklich sehenswert.