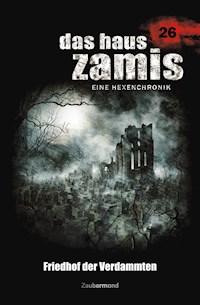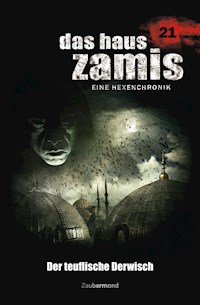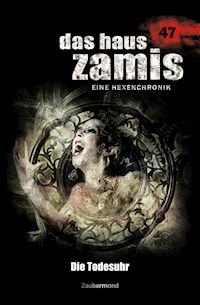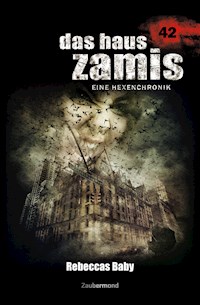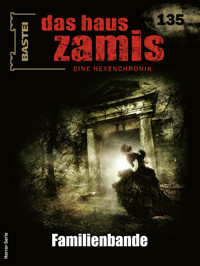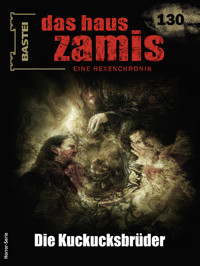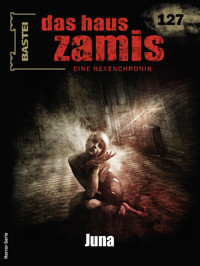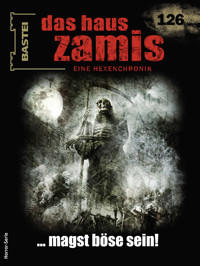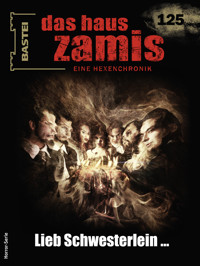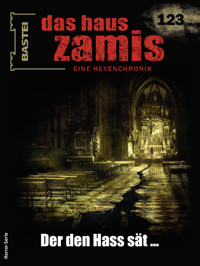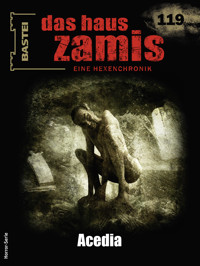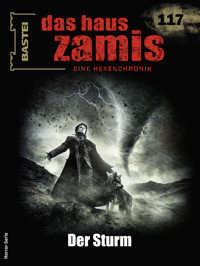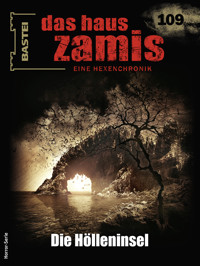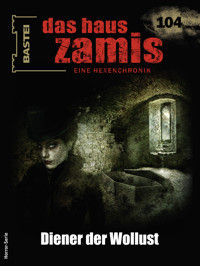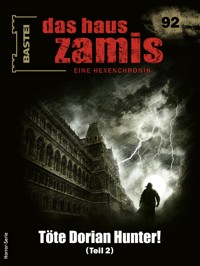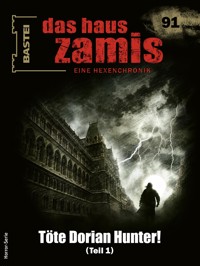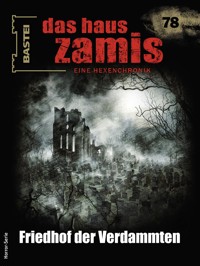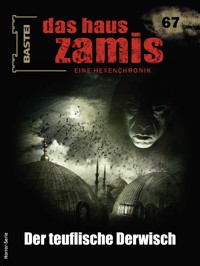
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Das Haus Zamis
- Sprache: Deutsch
Oh ja, sie tanzten. Sie bewegten sich im Kreis, immer schneller, immer gieriger. Sie summten, sie raunten, sie schrien, sie rezitierten die unheiligen Worte. Eine hoch über dem Parkett kopfüber hängende Frau wurde vom Schlächter geopfert. Ein Schwall klebrigen Blutes ergoss sich über die Häupter der Tänzer. Sie tanzten weiter, als wäre nichts geschehen.
Der Kopf der Frau polterte zu Boden. Dann die Arme, schließlich ein Teil ihres Rumpfes, bevor die langen Schläuche des Gedärms aus dem Restkörper glitten und in die Blutlache platschten. Die weißen Gewänder der Tänzer färbten sich rot, ihr feines Schuhwerk saugte sich voll mit der dicksämigen Flüssigkeit. Sie ignorierten es, sie machten weiter. So, wie es das Ritual vorschrieb.
Asmodi weiht Thekla Zamis in seinen Plan ein, den Oppositionsdämonen entgegenzukommen: Die Welt soll in zwei Machtbereiche aufgeteilt werden und Wien als neutrale Zone fungieren. Thekla soll als Vermittlerin auftreten - gemeinsam mit einem teuflischen Begleiter ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Was bisher geschah
DER TEUFLISCHE DERWISCH
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
mystery-press
Vorschau
Impressum
Coco Zamis ist das jüngste von insgesamt sieben Kindern der Eltern Michael und Thekla Zamis, die in einer Villa im mondänen Wiener Stadtteil Hietzing leben. Schon früh spürt Coco, dass dem Einfluss und der hohen gesellschaftlichen Stellung ihrer Familie ein dunkles Geheimnis zugrundeliegt. Die Zamis sind Teil der Schwarzen Familie, eines Zusammenschlusses von Vampiren, Werwölfen, Ghoulen und anderen unheimlichen Geschöpfen, die zumeist in Tarngestalt unter den Menschen leben.
Die grausamen Rituale der Dämonen verabscheuend, versucht Coco den Menschen, die in die Fänge der Schwarzen Familie geraten, zu helfen. Ihr Vater sieht mit Entsetzen, wie sie den Ruf der Zamis-Sippe zu ruinieren droht. So lernt sie während der Ausbildung auf dem Schloss ihres Patenonkels ihre erste große Liebe Rupert Schwinger kennen. Aber das Glück ist nicht von Dauer. Auf einem Sabbat soll Coco zur echten Hexe geweiht werden. Asmodi, das Oberhaupt der Schwarzen Familie der Dämonen, hält um Cocos Hand an, doch sie lehnt ab. Asmodi kocht vor Wut und verwandelt Rupert Schwinger in ein Ungeheuer.
Seitdem lässt das Oberhaupt keine Gelegenheit aus, gegen die Zamis-Sippe zu intrigieren. So schickt Asmodi den Dämon Gorgon vor, der Wien und alle seine Bewohner zu Stein erstarren lässt – und die Stadt komplett aus dem Gedächtnis der Menschheit löscht. Nur Coco kann im letzten Augenblick entkommen, allerdings hat sie jede Erinnerung an ihre Herkunft verloren ... Kurz darauf findet sie sich jedoch in einer Vision in Wien wieder und steht ihrer versteinerten Familie gegenüber. Nach und nach gewinnt sie ihre Erinnerung zurück und fühlt sich mehr denn je verpflichtet, etwas gegen Gorgons Fluch zu unternehmen.
In einer Bibliothek auf Schloss Laubach in Deutschland stößt Coco auf die Dämonenvita ihres Vaters. Bisher wusste sie nur, dass ihr Vater einst aus Russland nach Wien emigrierte. Aus der Dämonenvita erfährt sie, dass er zuvor über Jahre hinweg seinen Halbbruder Rasputin bekämpft hat. Asmodi versucht, Coco das Buch zu entreißen, doch er kommt zu spät. Mit Hilfe der Vita gelingt es Coco, Gorgons Bann zu brechen und Wien zu retten.
In der Folge baut Michael Zamis seine Kontakte zu den Oppositionsdämonen aus, die sich Asmodis Sturz auf die Fahnen geschrieben haben. Als Cocos Mutter Thekla von Michaels Liaison mit einer Kämpferin des Widerstands erfährt, tötet sie diese. Es kommt zum Bruch mit den Oppositionsdämonen, die Coco ungefragt ein »Permit« verpassen – ein magisches Tattoo in Form eines zweiköpfigen Adlers. Einst werde ihr dieses Permit Schutz gewähren ... Doch Coco und auch ihr Bruder Georg wollen sich nicht länger instrumentalisieren lassen. Georg reist mit Coco auf die Insel Sylt, wo Georg seine grausamen »Lehrjahre« verbringen musste. Auch hier stoßen sie auf Anhänger der Oppositionsdämonen, können sie aber vernichten. Auf der Rückfahrt erreicht sie die Nachricht, dass ihre Mutter Thekla verschwunden ist ...
DER TEUFLISCHE DERWISCH
von Michael M. Thurner
O ja, sie tanzten. Sie bewegten sich im Kreis, immer schneller, immer gieriger. Sie summten, sie raunten, sie schrien, sie rezitierten die unheiligen Worte.
Eine hoch über dem Parkett kopfüber hängende Frau wurde vom Schlächter geopfert. Ein Schwall klebrigen Blutes ergoss sich über die Häupter der Tänzer. Sie tanzten weiter, als wäre nichts geschehen.
Der Kopf der Frau polterte zu Boden. Dann die Arme, schließlich ein Teil des Rumpfes, bevor die langen Schläuche des Gedärms aus dem Restkörper glitten und in die Blutlache platschten.
Die weißen Gewänder der Tänzer färbten sich rot, ihr feines Schuhwerk saugte sich voll mit der dicksämigen Flüssigkeit. Sie ignorierten es, sie machten weiter. So, wie es das Ritual vorschrieb.
Er saß da und sah ihnen zu. Sein Bäuchlein wackelte wie Gelee, als er zu lachen begann.
1. Kapitel
Mit einer Handbewegung befahl er dem Schlächter, zwei weitere Frauen zu töten, und dann den Esel. Das halbwahnsinnige Geschöpf, das er vor langer Zeit am Straßenrand aufgegabelt und geduldig auf seine Aufgabe vorbereitet hatte, hüpfte mit weiten Sätzen von einem Opfer zum nächsten. Die beiden Opfer baumelten hin und her. Manchmal schlugen sie gegeneinander und versuchten dann, sich an den Händen zu greifen; als könnten sie Kraft daraus schöpfen, dass sie nicht alleine den Weg in die Dunkelheit gehen mussten.
Immer rascher schlugen die Trommeln, immer drängender wurden die Melodien der Oud-, Nay- und Zurnas-Spieler, die gegeneinander um die Vorherrschaft in diesem Spektakel aus Tanz, Musik und Schändung spielten.
Er ließ zu, dass die Erregung über ihn kam. Ahnungen von dämonischen Gesichtern erschienen zwischen den unheiligen Anafis, üble und verlockende Gerüche breiteten sich im Saal aus.
Er raffte Innereien und Gedärme an sich, wühlte in ihnen umher, riss sich die letzten Kleidungstücher vom Leib und tat, wonach ihm gierte.
Der teuflische Derwisch tat es in Vorfreude auf die Wonnen, die ihn erwarteten.
Bald.
Coco
»Wir gehen spazieren. Zieh dich an und komm!«
Verwirrt folgte ich der Aufforderung, die einem Befehl gleichkam. Ich zog die Regenpelerine über und schlüpfte hinter Vater durch die Tür. Ich blinzelte, geblendet vom jähen Wechsel der schummrigen Dunkelheit im Inneren der Villa Zamis zu Tageslicht. Wie immer, wenn ich unser Domizil in der Ratmannsdorfgasse verließ.
Es nieselte, der Himmel war grau und wolkenverhangen. Kiesel knirschten unter den schweren Tritten meines Vaters, Michael Zamis. Er öffnete das schmiedeeiserne Gartentor und murmelte ein paar Worte, die die üblichen Schutzzauber neutralisierten.
Ich eilte an seine Seite, tunlichst darauf bedacht, weder durch Worte noch durch Gesten einen seiner gefürchteten Wutausbrüche zu provozieren. Schweigend folgten wir der von Kastanien gesäumten Allee, bis wir die Abzweigung hügelan erreichten. Vater betrat den schmalen Weg. Zwischen Büschen ging es hoch, vorbei an Wiesenflecken links und rechts, die die Menschen bei besserem Wetter bevölkerten. Der Rote Berg ... ein beliebtes Naherholungsgebiet der Hietzinger.
Ich hörte Kindergeschrei. Trotz des schlechten Wetters hatte sich eine Meute Zehn- bis Zwölfjähriger um das rostbehaftete Gestänge versammelt, das irgendwann einmal ein Fußballtor gewesen war. Die Burschen rangelten und traten und schimpften, kämpften mit unglaublicher Vehemenz um den Lederball.
Ein kräftiger Junge traf den Ball so unglücklich, dass die Kugel hoch durch die Luft auf uns zuflog. Das Leder platschte vor den Füßen meines Vaters in eine breite Pfütze. Schlammiges Wasser spritzte nach allen Seiten; es traf den Saum seines Ledermantels und hinterließ einige wenige Spuren.
»'tschuldigung!« rief einer der Burschen. Er kam herangeeilt. »Der Herbie wird's halt nie lernen. Er hat's nicht mit Absicht gemacht.« Er war nass und schmutzig; von den Sportschuhen hoch über die dünnen, blassen Beinchen, über die viel zu weite Sporthose und das flatternde Leibchen bis hin zum Gesicht, in dem Schlamm vermengt mit Grashalmen klebte.
»Schon gut«, sagte ich rasch. »Ist ja nichts passiert.«
»Und ob etwas passiert ist!« Vater trat auf den Jungen zu, der soeben den Ball aus der Pfütze fischte. »Ich verabscheue das Geschrei und Getue von euch Bälgern, das sinnlose Gedrängel um einen Ball, euren Spieltrieb ...«
Noch bevor ich ihn daran hindern konnte, streckte Vater eine Hand aus und stach mit dem Zeigefinger in den Ball. Er zerplatzte mit lautem Knall. Die davonfliegenden Einzelteile verwandelten sich in lederhäutige Fledermäuse, die sich augenblicklich auf den Jungen stürzten. Er rannte davon, hin zu seinen Freunden, die ebenfalls zum Ziel wilder Angriffe der dämonischen Flattertiere wurden. Die Burschen kreischten und schrien, schlugen verzweifelt um sich. Meist vergebens. Lange, dünne Krallen zogen tiefe Furchen in Hände und Gesichter, rissen den Kindern Haut und Fleisch vom Leib ...
Ich musste einschreiten, rasch! Auch wenn mein Tun wieder einmal Ärger mit Vater nach sich ziehen würde. Ich stellte mich zwischen ihn und die Kinder, konzentrierte mich und kämpfte gegen seinen so spielerisch abgerufenen Wandlungszauber an. Es kostete mich viel, viel Kraft, bis meine gemurmelten Worte Wirkung zeigten und die Fledermäuse zu dem wurden, was sie eben noch gewesen waren: Fetzen von Leder und Kautschukmasse, die langsam zu Boden schwebten.
Ein Hypnosezauber war notwendig, um die blutenden Kinder an Ort und Stelle zu bannen. Ich eilte zu ihnen, begutachtete rasch ihre Wunden.
Die meisten ließen sich mithilfe meiner schwarzen Künste beseitigen; was übrig blieb, so pflanzte ich den Jugendlichen ein, würden sie auf Schürfwunden während des Spiels zurückführen.
Ich beendete mein Werk und befahl ihnen, nach Hause zu gehen. Sie liefen davon, ohne sich noch einmal umzudrehen. Sie würden sich an ein wildes Spiel erinnern, das in eine Massenrauferei ausgeartet war.
Böses ahnend wandte ich mich meinem Vater zu. Schon oft genug hatte ich seine kräftige Hand – und Schlimmeres – zu spüren bekommen, wenn ich etwas angestellt hatte, das seiner schwarzen Seele widersprach.
»Was liegt dir so sehr an den Menschen?«, fragte er. Seine Stimme klang ungewohnt. Nachdenklich, melancholisch.
»Du brichst deine eigenen Regeln«, antwortete ich mit klopfendem Herzen. »Du hast uns gelehrt, so wenig Aufmerksamkeit wie möglich zu erregen; besonders in der Nähe der Villa.«
»Mag sein.« Mehr kam ihm nicht über die Lippen. Er drehte sich um, winkte mir neuerlich, ihm zu folgen, und stapfte weiter den Hügel hoch.
»Die Menschen meinen, dass diese Erhebung seinen Namen eisenhaltigem Gestein verdankt«, sagte er nach einer Weile. »Woher sollten sie auch von Ritualen der Schwarzen Familie wissen, die in seinem Inneren über Jahrhunderte hinweg abgehalten worden waren? Es müssen zig tausend Menschen gewesen sein, die hier ihr Leben ließen und mit ihrem Blut dem Erdreich des Roten Berges seine Färbung gaben.«
»Und deshalb ...«
»Ich wusste es nicht, als ich mich hier ansiedelte. Ich erfuhr es ... später. Heute bin ich froh darüber. Die Villa der Zamis profitiert von dieser bedeutsamen Kraftquelle.«
Wir erreichten den Waldrain und blickten hinab auf die Stadt. Die Regenwolken verzogen sich; erste Sonnenstrahlen tasteten über einstöckige Villen, die meist im seit Jahrhunderten besonders beliebten »Schönbrunner Gelb« gestrichen waren.
Wir standen schweigend da, er wie ich in Gedanken versunken. Vater zog seine Schuhe aus und grub mit nackten Füßen eine Mulde, die sich bald mit Sickerwasser füllte. Wie ein Baum, der seine Wurzeln ins Erdreich trieb, um Kraft zu gewinnen.
»Deine Mutter ist mir wichtig«, sagte er nach einer Weile mit einem widerwilligen Unterton. »Ich muss erfahren, wo sie sich derzeit aufhält.«
Deswegen hatte er mich auf diesen Spaziergang befohlen?!
»Ich tue mein Bestes«, meinte ich vorsichtig.
»Sie ist die Tochter Asmodis, und sie ist meine Frau«, fuhr er fort, ohne auf meine Worte zu achten. »Sie ist Feind, sie ist Frau, sie ist Familie. Wäre sie nicht stets an meiner Seite gewesen, hätte ich diese Stadt niemals zu meinem Eigentum machen können«, offenbarte er mir.
Langsam, stockend begann Michael Zamis zu erzählen. Ich merkte ihm an, wie schwer es ihm fiel, sich mir zu öffnen. Seine Worte blieben spröde; nur ab und zu konnte ich so etwas wie Emotionen erahnen.
Ich setzte mich ins nasse Gras und lauschte mit klopfendem Herzen. Nach jenem Teil aus Vaters Jugend, die ich mir aus seiner Dämonenvita erlesen hatte, öffnete sich mir nun ein neues Kapitel seiner Vergangenheit. Ich ließ mich in seine Erzählung ziehen, trieb dahin, fand mich alsbald im Wien des Jahres 1937 wieder, während ich meinte, unter meinem Körper die gequälten Schreie der Ermordeten vom Roten Berg zu spüren, zu hören, zu schmecken ...
Michael Zamis, 1937
Michael Zamis lüpfte den Hut. Er grüßte nach links und rechts. Dieser Tag war seiner. Er hatte Vytlacyl, einen der vielen aus Böhmen zugewanderten Dämonen, in einem gehässig geführten Kampf besiegt und ihm am Grund der Donau ein feuchtes Grab bereitet.
Damit, so überlegte Michael zufrieden, gab es kaum noch ernst zu nehmende Konkurrenten, die ihm die Vorherrschaft als oberster Dämon von Wien streitig machen konnten.
Er zupfte den Schnurrbart zurecht. Einen gibt es noch, dachte er, während er weitere Huldigungen von Mitgliedern der Schwarzen Familie entgegennahm, die, zwischen staunenden Menschen verteilt, entlang der Kärntner Straße ausharrten.
»Fahr langsamer!«, befahl er Ernst, seinem Chauffeur. »Ich möchte mir die Gesichter dieser Würmer genauer ansehen. Ich möchte wissen, wem ich vertrauen kann und wem nicht.«
140 Pferdestärken heulten auf. Dann hatte Ernst den schweren Dieselmotor des Maybach SW 38 in den Kriechgang gezwungen. Schwerfällig blubbernd rollte die Spezialanfertigung dahin, die dem österreichischen Linksverkehr angepasst war. Michael Zamis wurde von den unwissenden Menschen entlang der Straße ob des luxuriösen Wagens bewundert – und von den Dämonen respektvoll gegrüßt.
Militärmusik erklang. Voraus, nahe der Kirche zu Sankt Stephan, marschierten wieder einmal die Mitglieder einer vielköpfigen Kapelle der Vaterländischen Front auf und ab. Rufe erschallten, Hände wurden zum Gruß erhoben. »Front Heil!«, hörte Michael Zamis, und »Heil Schuschnigg!« Überall zeigten sich Kruckenkreuze, die offiziellen Symbole dessen, was als Austrofaschismus bezeichnet wurde.
»Ausweichen!«, befahl Michael Zamis. »Ich will mit den Politischen nichts zu tun haben; zumindest heute nicht.«
Die Politischen ... Alles heutzutage war Politik. Und Partei. Und Staat. Und Gehorsam. Vor allem Gehorsam ...
Das offizielle Österreich grenzte sich durch übertrieben autoritäres Gehabe von der Deutschen Gefahr ab; doch ein nicht zu unterschätzender Teil der Bevölkerung sehnte insgeheim den Einmarsch Adolf Hitlers herbei.
Michael Zamis verstand die Menschen nicht. Sie drehten an Rädern von Mechanismen, die sie noch längst nicht verstanden hatten – und sie schadeten somit den Plänen der Schwarzen Familie. Vorboten des Krieges zeigten sich bereits allzu deutlich am Horizont. Kriegsdämonen, Geschöpfe, die selbst ihm zuwider waren, lungerten in den Straßen umher. Ihre unsichtbaren Peitschen pfiffen durch die Luft; sie verbreiteten Neid, Missgunst und Wut. Nicht mehr lange, so befürchtete Michael, und es würde zu einer Katastrophe kommen, die nicht im Sinn der Schwarzen Familie sein konnte ...
Ernst machte reichlich Gebrauch von der silbrigen, fein ziselierten Hupe. Er vertrieb die Passanten aus den Seitengassen. Sie hüpften nach links und rechts, um in breitem Wiener Dialekt zu schimpfen – und gleich darauf ehrerbietig die Hüte zu lüpfen. Der Maybach, fast fünf Meter lang, machte gewaltigen Eindruck.
Eine Tramway der Linie 59 kreuzte ihren Weg. Soeben umrundete sie laut kreischend den Donnerbrunnen, die Endstation ihrer Schleife, um sich gleich darauf wieder in Richtung Jagdschlossgasse in Hietzing in Bewegung zu setzen. Ernst wich der Elektrifizierten geschickt aus und ließ den Wagen in eine Parklücke rollen. »Wir sind da, Herr«, sagte der wölfische Dämon.
»Leider.«
Michael Zamis hatte heute einen Sieg errungen – und musste dennoch um seine Freiheit fürchten. Denn Asmodi spielte böse Spiele. Der Herrscher über die Schwarze Familie hatte sich bereits kurz nach dem Ende des Zweikampfs in Andeutungen ergangen, die ihn das Schlimmste fürchten ließen.
Ernst dämpfte die aromatisierten Jungfernhäutchenkerzen aus, die das Wageninnere mit einem anregenden Geruch erfüllt hatten, und öffnete ihm die Türe. Michael Zamis trat ins Freie. Er witterte und spürte eine vage Feindseligkeit. Er war es gewohnt, von einer derartigen Aura umgeben zu sein. Viele der in Wien ansässigen Dämonen neideten ihm seinen Erfolg.
»Die Luft ist rein«, meinte Ernst, dessen Spürnase weitaus besser als die seine war.
»Geh voraus!«, befahl ihm Michael. »Halt mir das Menschengewürm vom Leib.«
Ernst versiegelte den Maybach mit routinierten Bewegungen und setzte sich in Bewegung. Von untersetzter Statur, schien er kaum einen ernst zu nehmenden Gegner abzugeben. Doch Michael Zamis wusste nur zu gut, was in dem haarigen Energiebündel steckte.
Durch die Dorotheergasse erreichten sie den Graben. Einige Marktstandler priesen ihre Waren an – Früchte, Gemüse, Kurzwaren –, Wanderhändler zogen, breite Bauchläden vorgeschnallt, ihre Kreise. Fiaker trieben ihre Schindmähren an, ein Ottakringer Bierkutscher fluchte in einem Ton, der selbst Dämonenohren schmerzte. Kurzum: Es herrschte das übliche vormittägliche Durcheinander.
»Dort vorne warten sie«, sagte Ernst und bahnte Michael Zamis den Weg.
Ja, da waren sie. Die Grabennymphen. Die hübschesten Huren Wiens; von der Obrigkeit geduldet, von den Mitgliedern gutbürgerlicher Kreise gerne und oft zu einem »Kaffeetscherl« oder mehr eingeladen. Die Hotels und Absteigen in der Naglergasse – nomen est omen – hatten rund um die Uhr Betrieb.
Michael Zamis fasste einige der Damen ins Auge, deren dämonische Ausstrahlung deutlich spürbar war.