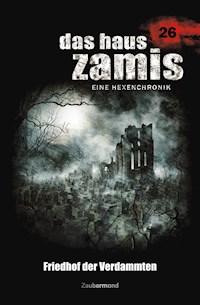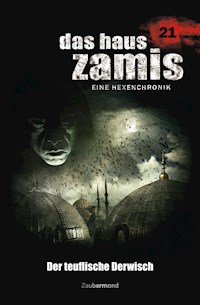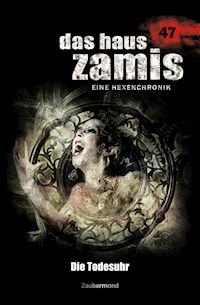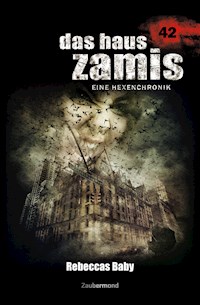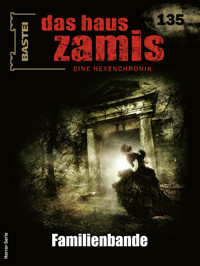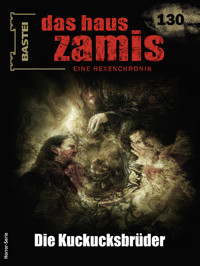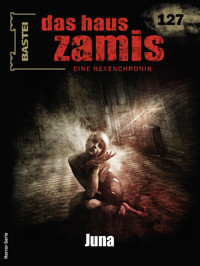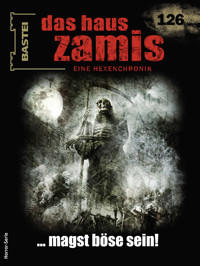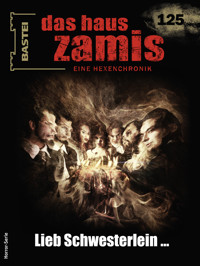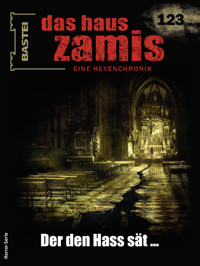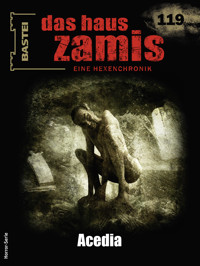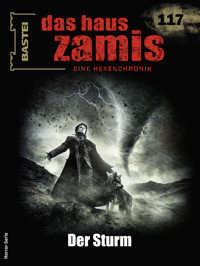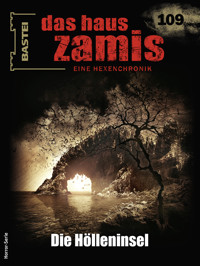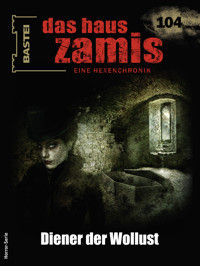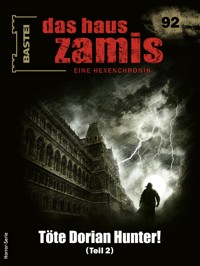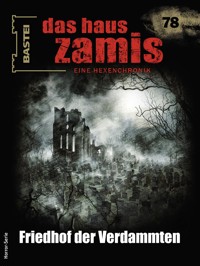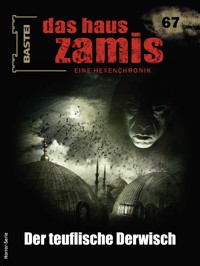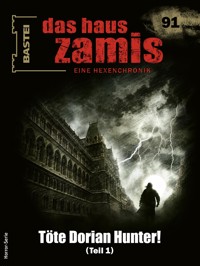
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Das Haus Zamis
- Sprache: Deutsch
»Dorian Hunter ist auf dem Weg hierher«, sagte mein Vater. »In einer Stunde ist er am Flughafen. Mach dich auf den Weg!«
»Vater, ich habe eine Frage ...«
»Du sollst keine Fragen stellen, sondern zuhören und tun, was ich dir sage!«, schnappte er. »Du weißt ganz genau, was davon abhängt, dass du deine Arbeit zu Asmodis Zufriedenheit erledigst.«
»Ja, Vater.« Ich ließ mir weitere Informationen geben und legte dann auf. Ich kannte diesen Ton nur zu gut. Mein Vater war nervös.
Ich stoppte ein Taxi. Der Fahrer würde einige Vorschriften brechen müssen, damit wir den Flughafen erreichten, bevor Hunters Flugzeug landete ...
Michael Thurner schildert die legendäre erste Begegnung zwischen Dorian Hunter und Coco Zamis in einem packenden Zweiteiler! Die Geschichte, die wir aus DORIAN HUNTER Band 2, "Das Henkersschwert" kennen, wiederholt sich - aber ganz anders, als wir sie kennen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Was bisher geschah
TÖTE DORIAN HUNTER! (1)
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
mystery-press
Vorschau
Impressum
Coco Zamis ist das jüngste von insgesamt sieben Kindern der Eltern Michael und Thekla Zamis, die in einer Villa im mondänen Wiener Stadtteil Hietzing leben. Schon früh spürt Coco, dass dem Einfluss und der hohen gesellschaftlichen Stellung ihrer Familie ein dunkles Geheimnis zugrundeliegt. Die Zamis sind Teil der Schwarzen Familie, eines Zusammenschlusses von Vampiren, Werwölfen, Ghoulen und anderen unheimlichen Geschöpfen, die zumeist in Tarngestalt unter den Menschen leben. Die grausamen Rituale der Dämonen verabscheuend, versucht Coco den Menschen, die in die Fänge der Schwarzen Familie geraten, zu helfen. Ihr Vater sieht mit Entsetzen, wie sie den Ruf der Zamis-Sippe zu ruinieren droht. So lernt sie während der Ausbildung auf dem Schloss ihres Patenonkels ihre erste große Liebe Rupert Schwinger kennen. Auf einem Sabbat soll Coco zur echten Hexe geweiht werden. Asmodi, das Oberhaupt der Schwarzen Familie der Dämonen, hält um Cocos Hand an, doch sie lehnt ab. Asmodi kocht vor Wut und verwandelt Rupert Schwinger in ein Ungeheuer.
Seitdem lässt das Oberhaupt keine Gelegenheit aus, gegen die Zamis-Sippe zu intrigieren. Michael Zamis sucht indes Verbündete unter den Oppositionsdämonen, die sich Asmodis Sturz auf die Fahnen geschrieben haben. Als Cocos Mutter Thekla von Michaels Liaison mit einer Kämpferin des Widerstands erfährt, tötet sie diese. Es kommt zum Bruch mit den Oppositionsdämonen, die Coco ungefragt ein »Permit« verpassen – ein magisches Tattoo in Form eines zweiköpfigen Adlers. Letztlich einigen sich Asmodi und Nocturno und teilen in der Charta Daemonica die Herrschaftsbereiche unter sich auf. Michael Zamis jedoch wird in eine krötenartige Kreatur verwandelt. Coco bittet um Gnade für ihren Vater und willigt ein, Nocturno zu begleiten – ohne seine wahren Gründe zu kennen. Nocturno glaubt, mit Coco eine »Geheimwaffe« zu besitzen, die ihm zur Rückkehr ins centro terrae verhelfen könnte – was ihm schließlich auch gelingt.
Coco sowie Rebecca und Georg, die sich an Cocos Fersen geheftet haben, finden sich in Wien wieder – doch der Banshee Peter hat Georgs Körper in Besitz genommen. Während eines Schwarzen Sabbats wird Asmodi von Thekla Zamis vorgeführt. Aus Angst vor seiner Rache flüchten die Zamis aus Wien. Während Thekla verzweifelt versucht Verbündete zu gewinnen, sind ihnen die Verfolger dicht auf den Fersen. Adalmar befindet sich in Begleitung der Feuerdämonin Amber Luna, um auf Lanzarote den Kontakt zu ihrer mächtigen Familie herzustellen. Er hofft sie als Verbündete gegen Asmodi zu gewinnen. Am Ende reisen alle ohne Ergebnisse zurück nach Wien. Der Grund: Michael Zamis hat sich in seiner Freakgestalt ebenfalls auf den Weg dorthin gemacht. Schließlich erlöst Asmodi Michael Zamis von seinem Freak-Dasein. Allerdings verlangt er dafür eine Gegenleistung: Coco soll einen Mann töten, der in Wien erwartet wird. Sein Name lautet – Dorian Hunter ...
TÖTE DORIAN HUNTER! (1)
von Michael M. Thurner
»Hunger!«, brüllte der Gast, »füttert mich gefälligst! Bringt mir Fleisch, frisches Fleisch! Ich möchte es von langen, schweren Knochen reißen, samt Sehnen und Knorpeln, möchte das Mark aussaugen! Ich werde mit den Beinen beginnen, während das Fleisch noch lebt und zappelt. Das schafft diesen ganz besonderen Geschmack nach Frische, nach Leben!«
Er war mit schweren Ketten an die Wand gefesselt, wie in all den Nächten, seitdem der Gast auf Wunsch – oder auf Geheiß! – von Asmodi bei uns einquartiert worden war.
Er riss und zerrte daran, und unter anderen Umständen hätte sich der Koloss mit dem absurd kleinen Kopf gewiss längst losgerissen. Doch Vater und Adalmar hatten vorgesorgt und einen ausreichend starken Zauber gewoben, um den Gast zu halten.
»Ich möchte reinbeißen, in die Hauptschlagader, sodass das Blut spritzt, ja, dass es wie eine Fontäne spritzt! Wisst ihr, was das für ein Gefühl ist? Wenn man es richtig angeht, kann man binnen weniger Sekunden zwei, drei Liter Blut saufen ...«
1. Kapitel
Er hielt inne, wirkte mit einem Mal ein wenig nachdenklich: »Andererseits ist es dann viel zu rasch zu Ende mit dem Fleisch. Es verliert den Geschmack. Wehrt sich nicht mehr, hat keine Schmerzen.«
Vater betrachtete den Gast nachdenklich. Er murmelte eine Beschwörung und sorgte für eine weitere Verstärkung der magischen Ketten, bevor wir den Kellerraum verließen und die Tür hinter uns sicher verschlossen.
»Bringt mir Fleisch!«, hörten wir den Mann wieder losbrüllen, so laut, dass seine Stimme selbst das Holz der eichenen Tür durchdrang. »Bringt es im Ganzen! Ich werde es filetieren, zerbeißen, zerkauen, mich an ihm laben! Ich werde so lange fressen, bis es mir besser geht, bis ich wieder Kraft habe. Ich fühle mich schwach, so schwach! Füttert mich! Gehorcht dem Willen Asmodis! Er möchte, dass ich gut behandelt werde, dass es mir gut geht! Ich bin sein Sohn, und ich habe es verdient, wie ein Herrscher versorgt zu werden.«
Die Tirade endete.
Ich hörte, wie der Gast etwas hochwürgte, ein schlecht verdautes Stück Mensch. Womöglich Innereien, die ihm nicht so gut mundeten. Eine Raucherlunge, eine Säuferleber, eine krebsbefallene Prostata. Er hatte zwar einen eisernen Magen, bezeichnete sich selbst aber auch als »Feinschmecker«.
Er war ein widerwärtiger Zeitgenosse, und ich hätte ihn gerne sterben gesehen. Doch Asmodi hätte uns, den Angehörigen der Familie Zamis, die Schuld am Ableben seines Sohnes geben. Alle Hoffnungen, vom Fürst der Dunkelheit endlich einmal in Ruhe gelassen zu werden, wären dahin gewesen.
Wir wären das Ziel weiterer rachelüsterner Verfolgung, wie wir sie während der letzten Jahre ausreichend mitgemacht hatten.
Wir gingen den schmalen, gemauerten Gang entlang. Zwischen den Ziegelsteinen quoll rote Erde hervor. Es handelte sich um den blutgetränkten Humus des Roten Bergs, in dessen unmittelbarer Nähe die Villa Zamis vor langen Jahren angelegt worden war.
»Ich verhungere!«, hörte ich den Gast uns nachrufen, »bringt mir endlich, wonach mir dürstet! Fleisch von menschlichem Abschaum! Von Mördern, Vergewaltigern, Kinderschändern. Liefert mir die Ärsche der ältesten Huren und ich verzeihe euch, dass ihr mich nicht selbst auf die Jagd gehen lasst. Macht schnell, macht schnell!«
Die Stimme wurde kaum leiser, während wir uns entfernten; ganz im Gegenteil. Echos begleiteten uns. Magische Echos. Sie sandten andere, hypnotisch wirkende Nachrichten aus. Der Gast war zornig, und der Zorn machte ihn stark. Er wollte uns beeinflussen, wollte uns dazu bringen, ihm zu gehorchen.
Vater vollführte einige Handbewegungen, die Stimme wurde leiser. Ich fühlte, wie der Druck in meinem Kopf geringer wurde und ich wieder frei denken konnte.
»Er ist widerlich!«, sagte ich.
»Er ist unser Gast.« Vater wandte sich mir zu. Er wirkte zornig. »Denk daran, Coco, dass letztlich du am ganzen Unglück der Familie Zamis Schuld trägst. Hättest du dich nicht dem Herrn der Schwarzen Familie verweigert, wäre es niemals so weit gekommen, dass wir einem seiner Bastarde Quartier gewähren müssen.«
Das war eine billige Rechnung, und Vater wusste das. Doch auch er war genervt vom ewigen Gebrülle des Gastes, das nur dann für eine Weile aufhörte, wenn man ihn fütterte.
»Was macht ihn eigentlich so hungrig?«, fragte Georg mit krächzender Stimme.
»Der Zorn«, antwortete Vater. »Er giert nach diesem einen und ganz bestimmten Opfer. Solange er den Kerl nicht in die Finger bekommt, wird er uns weiter tyrannisieren.«
»Weiß man schon, wann dieses Opfer nach Wien kommt?«
»Womöglich übermorgen. Ich erwarte stündlich weitere Informationen von Skarabäus Toth.«
Toth, der Schiedsrichter der Schwarzen Familie. Auch er mischte also in diesem bösen Spiel mit. Er beobachtete und lauerte wie eine Spinne im Netz, zog da und dort an einem Faden, verfütterte kleine Häppchen an andere, kleinere Artgenossen – und achtete darauf, stets das beste Stück der Beute abzubekommen.
Was auch immer er diesmal für eine Rolle spielte: Wir konnten sicher sein, dass er seine eigenen Interessen verfolgte.
Ein letztes Mal hörten wir den Gast brüllen. Dann stiegen wir die Treppe hoch, verschlossen den Zugang zum Keller, versiegelten ihn magisch und befahlen dem Hüter des Hauses, der kruden Gestalt, sein besonderes Augenmerk auf diese Tür zu richten.
Wie hatte der Hüter einstmals geheißen?
Rupert Schwinger. Ein unschuldiger Dorfjunge war er gewesen, der das Pech gehabt hatte, sich in mich zu verlieben und dafür bestraft zu werden. Ich hätte Mitleid für ihn spüren müssen. Doch es kam nur noch selten vor, dass ich mich an Ruperts Rolle in meinem Leben erinnerte. So ungern ich es Vater gegenüber zugeben würde: Ich vergaß. Gutes und Böses, beide Seiten eines ereignisreichen Lebens, verschmolzen allmählich miteinander.
Steckte doch mehr dunkles Blut in mir, als es mir recht sein sollte? Oder hatte die Tatsache, dass ich seit den Ereignissen in England über eine Schwarze Seele verfügte, etwas mit meiner momentanen Gemütsverfassung zu tun?
»Du gehst auf die Jagd, Adalmar«, wies Vater meinen ältesten Bruder an. »Besorg dem Gast, was er benötigt. Achte auf Diskretion, wie immer.«
Adalmar nickte. Er schlüpfte wortlos in seinen weiten Mantel und zog die Kapuze über, sodass man die Konturen seines Gesichts kaum mehr wahrnehmen konnte. Nur noch der dunkle Bart und die prägnante, spitze Nase waren zu erkennen.
Mein Bruder würde die ihm aufgetragene Arbeit zu Vaters Zufriedenheit erledigen. Er arbeitete ruhig und effizient. Suchte nach einem Opfer, nach einem Außenseiter der Gesellschaft, belegte ihn mit einem magischen Bann und brachte ihn hierher, um ihn in den Keller zu führen und den Gast freizulassen.
Mich schauderte bei dem Gedanken, was dort unten während der letzten zehn Tage alles geschehen war. Von manchen Menschen hatten wir nicht einmal mehr Knochen gefunden. Aus Darmsaiten und primitivem Werkzeug hatte sich der Gast eine Kette gefertigt, die Nacht für Nacht länger wurde. An ihr hingen verschiedenfarbige Augäpfel und Backenzähne, Zehennägel und verschrumpelte Brustwarzen.
»Ich bin froh, wenn es bald vorüber ist«, sagte ich zu Vater, nachdem Adalmar die Villa verlassen hatte.
»Ich ebenso«, meinte er zu meiner Überraschung. »Er schlachtet grundlos und ist völlig enthemmt. Es ist kein Wunder, dass man ihm in seiner Heimat Sizilien derart zugesetzt hat.«
»Weißt du mehr über seine Vergangenheit, Vater?«
»Ich kenne bloß Gerüchte. Ich erzähle sie. Morgen. Damit ihr wisst, womit wir es wirklich zu tun haben.« Er sah mich an. Mit Blicken aus glänzenden, dunklen Augen musterte er mich. »Du musst deine Rolle gut spielen, Coco. Andernfalls wird uns Asmodi weiterhin Probleme bescheren.«
»Ich weiß, Vater.« Ich wandte mich ab und wollte auf mein Zimmer gehen, oben im ersten Stock, blieb aber dann noch einmal stehen. Ich erinnerte mich einer Frage, die ich seit Tagen stellen wollte, die ich aber immer wieder vergessen hatte. Seltsam. »Wie heißt unser Gast eigentlich?«, fragte ich.
»Bruno«, sagte er. »Bruno Guozzi.«
Ich wusste nicht, was mich in dieses schmuddelige kleine Café führte, das neben all den mondänen Kaufhäusern, Boutiquen, Schmuckgeschäften, Buchhandlungen, esoterischen Läden und Restaurants auf der Mariahilfer Straße die Jahrzehnte überdauert hatte.
Die Fassade stammte wohl aus den Fünfzigern des vorigen Jahrhunderts. Die rosafarbene Neonschrift flackerte unruhig. Aus dem »Espresso Rosi« war ein »spres R si« geworden, eine der Röhren brummte unruhig. Das Holz der Schwingtür war abgehauen, der messingfarbene Kugelgriff schmutzig und blind.
Das Lokal wirkte widerlich – und dennoch lockte es mich. Es war so ganz anders als das, was man auf dieser Pracht- und Einkaufsstraße erwartete.
Ich war zeitig am Morgen aufgestanden und hatte zugesehen, wie Adalmar unserem Gast das »Frühstück« gebracht hatte. Die Schreie waren bis in den ersten Stock getönt. Sie wollten und wollten nicht enden. Ich hatte einen Mantel übergeworfen und war in den kalten Novembermorgen hinausgestolpert, um ausnahmsweise mit der Straßenbahn zu fahren und mit müde dreinschauenden Pendlern den Weg Richtung innere Bezirke zu nehmen.
Orientierungslos war ich durch die Stadt geirrt, hatte Auslagen betrachtet, all das Glänzen und Glitzern, um mich dann hier wiederzufinden, an der Kreuzung Mariahilfer Straße/Neubaugasse, unweit der U-Bahn-Station.
Es roch seltsam im Inneren des Espresso Rosi. Nach Zimt und etwas Süßlichem, das ich nicht identifizieren konnte.
Drei Männer standen an der Bar, allesamt ließen sie ihre Nasen in Biergläser hängen. An einem der runden Tische entlang der Wandverglasung rechts von mir saß ein älteres Pärchen. Die beiden stritten ohne sonderlichen Nachdruck miteinander, auf eine Art und Weise, die auf jahrzehntelange Routine schließen ließ.
Ein Bild erregte meine besondere Aufmerksamkeit. Nur noch die obere Hälfte war erkennbar, der Rest war unter den Spiegelkacheln verborgen. Doch was ich sah, berührte mich irgendwie. Die Malerei war zwischen hölzernen Rahmen ... gefangen.
Sie zeigte einen unmäßig dicken Mann, der an einem Tisch saß und von einer reich gedeckten Tafel aß. Eine Frau links von ihm brachte einen Braten, ein Kumpan soff aus einem tönernen Krug. Das Bild zeigte eine mittelalterliche Szene. Ganz gewiss handelte es ich um kein Original. Die Farben waren viel zu kräftig, und das Haus, in dem das Espresso Rosi untergebracht war, stand gewiss nicht länger als zweihundert Jahre.
Ich meinte, mich an etwas zu erinnern, an etwas, das weit in der Vergangenheit lag. Doch es wollte und wollte mir nicht einfallen.
»Was soll's sein?«, fragte mich der Mann hinter der Bar, ein älterer, kräftig wirkender Kerl mit einer Kippe im Mund.
»Einen Orangensaft«, antwortete ich geistesabwesend.
»Gibt's nicht. Bekommst einen Apfelsaft.« Er schulterte sein verdrecktes Serviertüchlein, langte unter die Bar und brachte eine kleine Flasche hervor, deren Form seltsam alt wirkte. Womöglich lagerte sie hier bereits seit Jahrzehnten.
»Karl mag keine Fremden«, raunte mir eine der Barfliegen neben mir zu. »Er unternimmt alles, um sie so rasch wie möglich wieder loszuwerden.«
»Und warum?«, fragte ich ebenso leise. »Er lebt schließlich von seinen Gästen.«
»Keiner weiß, wovon Karl in Wirklichkeit lebt; ganz gewiss nicht von dem, was er im Rosi verdient.« Der alte Mann kicherte und entblößte gleichmäßige, aber vom Rauchen gelbbraun verfärbte Zahnreihen. »Man munkelt, dass nächtens im Keller unsaubere Geschäfte ablaufen.«
»Halt's Maul, Tschick!«, fuhr Karl den Alten an. »Es geht das Fräulein nichts an, was hier geschieht – und dich erst recht nicht!« Er knallte mir die Flasche vor die Nase, verlangte unverschämt viel Geld dafür und zog sich dann in den hintersten Winkel des Espressos zurück, um es sich auf einem gegen die Wand gelehnten Stuhl bequem zu machen, Arme und Beine zu überkreuzen und die Augen zu schließen.
»Lass dich von ihm bloß nicht ärgern, Pupperl.« Mein Nachbar an der Bar kicherte erneut. »Was bist du eigentlich für eine? Es kommen selten mal Fremde ins Rosi. Gehst du anschaffen?« Er legte mir die zittrige, von Altersflecken bedeckte Rechte auf den Oberschenkel und betätschelte mich. »Hm, saftig und prall. Genauso mag ich's! Ich mach zwar gerade eine Durststrecke durch, und mein Portemonnaie ist nicht sonderlich gut gefüllt – aber einen Zwanziger bist mir schon wert, Pupperl.«
Ich schlug die Hand beiseite und wollte den Alten mit einem Fluch belegen, der ihn die nächste Viertelstunde auf die Toilette verbannen würde – aber es gelang mir nicht. Ich war zerstreut und müde, belastet von den Geschehnissen in der Villa Zamis. »Greif mich noch einmal an, und ich verdreh dir deine Nüsse«, sagte ich ruhig. »Mit oder gegen den Uhrzeigersinn. Was auch immer dir lieber ist.« Ich ließ die langen Fingernägel mehrmals gegeneinander klimpern und lächelte den Alten auf unmissverständliche Art und Weise an.
»Hab schon verstanden, Pupperl. Man kann ja nicht alles haben im Leben.« Er nahm die Abfuhr hin, ohne mit der Wimper zu zucken.
Die beiden Männer neben ihm, die meine Worte zweifelsohne ebenfalls gehört hatten, warfen mir scheue Blicke zu, kümmerten sich aber gleich wieder um ihre Biergläser. Das Pärchen verließ das Lokal, weiterhin lauthals diskutierend. Beide trugen jeweils drei Einkaufstüten, die mit Lumpen gefüllt waren. Karl, der Wirt, kümmerte sich nicht weiter darum. Er döste vor sich hin, und ich meinte, ein Schnarchen zu hören.
Einmal mehr fragte ich mich, was das Espresso Rosi auf der Mariahilfer Straße zu suchen hatte.
Draußen, durch rauchgelb verfärbte Vorhänge und lange nicht mehr gewaschene Glasscheiben nur vage erkennbar, huschten Menschen vorbei. Gut angezogene, elegante Frauen und Männer. Manche waren gut gelaunt und schmissen ihr Geld in luxuriösen Kaufhäusern raus, andere wirkten hektisch, so als seien sie auf der Suche nach irgendeinem Schnäppchen.
»Sieh sie dir bloß an, diese Lemminge.« Der Alte nahm einen neuen Anlauf, mit mir ins Gespräch zu kommen. »Sie rennen umher, ohne Plan und Ziel. Ohne zu wissen, was sie benötigen und wie sie es bekommen können. Es gibt nicht viele Leute, die das Rosi inmitten dieses ziellosen Treibens finden. Du musst eine Geschichte haben, Pupperl, sonst hättest du's niemals geschafft.«
»Und was hast du für eine?«
Der Alte hustete angestrengt. »Ich hab ein paar Dinge getan, die nicht ganz astrein waren«, antwortete er mit überraschender Ehrlichkeit. »Ich hab einige Jahre am Felsen ausgefasst, und als ich wieder freigekommen war, trieb es mich durch die Stadt, kreuz und quer. Ich wusste nicht, wo ich hin sollte. Bis ich auf einmal das Schild vom Rosi sah und ganz genau wusste, dass ich hierher gehörte.«
Am Felsen ... so sagten die Insassen zur Vollzugsanstalt Krems-Stein, in der Lebenslängliche und Schwerverbrecher verwahrt wurden. Mein Gesprächspartner hatte ganz gewiss einiges auf dem Kerbholz, wenn er in Stein eingesessen war. »Und wenn du nicht im Espresso bist – was machst du dann?«
»Nichts. Ich warte, bis es wieder aufsperrt.«
So roch er auch, der alte Mann, den Karl Tschick