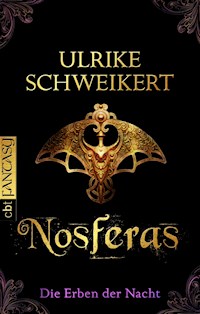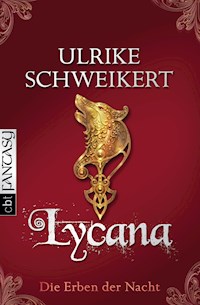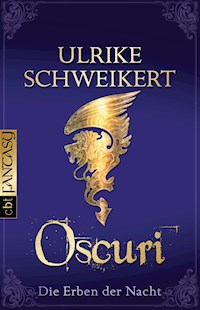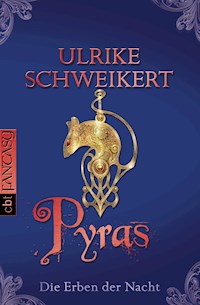9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Peter von Borgo
- Sprache: Deutsch
Wien im 19. Jahrhundert. Auf den prunkvollen Bällen am kaiserlichen Hof wird der Vampir András Báthory von den Damen umschwärmt. Doch ihn verlangt es nach geistreicher Unterhaltung, wie er sie in den Gemächern der klugen Gräfin von Traunstein findet. Dort lernt er die hübsche Pianistin Karoline kennen und beginnt, bei ihr Unterricht zu nehmen. Doch Karoline hütet ein dunkles Geheimnis. Da wird eine Adlige ermordet aufgefunden, und alles deutet darauf hin, dass in der Stadt ein weiterer Vampir sein Unwesen treibt. Er scheint es auf Báthory abgesehen zu haben und auf alle, die ihm nahe stehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 634
Veröffentlichungsjahr: 2010
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Titel
Widmung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
Epilog
Danksagung
Impressum
ULRIKE SCHWEIKERT
Roman
Für Margareta Blankenbach und Gigolo – Chakira und ich danken für die inspirierenden Ausritte – und für meinen geliebten Mann Peter Speemann
Prolog
Stille senkte sich über das Paradeisgartel, wie die Wiener diesen Ort noch immer nannten, obwohl die Löwelbastei samt Kaffeehaus und dem ursprünglichen Garten längst abgebrochen worden waren und der neue Park an dieser Stelle nun Volksgarten hieß.
Die Nacht war längst hereingebrochen, und mit dem fliehenden Tageslicht verließen auch die letzten Spaziergänger eiligen Schrittes den Garten. Hatten die gelben Strahlen der Nachmittagssonne zumindest die Illusion von Wärme verbreitet, so fuhr der Wind nun winterlich kalt um die Büsche und Bäume, die ihre sorgsam gestutzten Äste kahl in die Höhe reckten.
In Cortis neuem Kaffeehaus, das in einem anmutigen Halbrund erbaut worden war, erhoben sich die letzten Gäste, falteten ihre Zeitungen zusammen, legten einige Kreuzer auf den Tisch und ließen sich in ihre warmen Mäntel helfen. Die Serviererin knickste, der Wirt stand mit stolz erhobenem Haupt an der Tür, grüßte jeden mit Namen und gab ein paar persönliche Worte mit auf den Heimweg.
Mit gesenktem Haupt und hochgezogenen Schultern hasteten die späten Besucher davon. In dieser Nacht vermissten sie die herrliche Aussicht nicht, hinüber zum Schwarzenbergpalais, der kuppelgekrönten Karlskirche und bis zur Donau hinunter, die man einst vom Balkon des alten Kaffeehauses und von der Mauer der aufragenden Bastei hatte genießen können.
»Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen, und beehren Sie uns morgen wieder«, rief der Kaffeehausbesitzer zum letzten Mal in die Dunkelheit. Die Flammen der Gaslaternen spiegelten sich in seinem tiefschwarzen Haar und auf seinem ebenso prächtigen dunklen Schnurrbart.
Es war ein offenes Geheimnis, dass Pietro Corti Kaiser Franz wertvolle Spionagedienste im Krieg gegen Napoleon geleistet hatte. Dafür war der Familie des Italieners das Privileg erteilt worden, die alleinige Kaffeehausgerechtigkeit erst im Paradies- und später im Volksgarten auszuüben. Und das tat er mit Stolz und überaus erfolgreichem Geschäftssinn. Wobei die kalten Tage des Winters natürlich nicht zu den einträglichen zu zählen waren. Im Frühling und Sommer dagegen gehörte es geradezu zum guten Ton, sich im Paradies zu treffen, zwischen Jasmin und Flieder zu plaudern, zu flirten oder beim Flanieren seinen Gedanken nachzusinnen. Dann kredenzte Herr Corti neben seinen Kaffee- und Gebäckkreationen vielerlei Arten von Gefrorenem und die süßen Getränke, die junge Damen so sehr liebten: Mandelmilch und Orangeade, Punsch und natürlich Limonade. Seine besten Tage waren natürlich die, wenn Joseph Lanner mit seinem Orchester aufspielte. Wenn er seine Lieblingskompositionen »Der Schnellsegler«, »Flüchtige Lust« oder den »Paradies-Soiree-Walzer« zum Besten gab, konnte es schon angehen, dass sich mehr als tausend Menschen im Park zwischen der geschleiften Löwel- und der ebenfalls abgetragenen Burgbastei drängten: in bester Laune und mit gesegnetem Durst!
Pietro Corti schloss hinter dem letzten Gast die Tür. »Resi, wisch dort drüben noch die Tische ab«, wies er das hübsche brünette Serviermädchen an, während er sich daranmachte, die Gaslichter herunterzudrehen. Eine Lampe nach der anderen erlosch, bis nur noch ein paar einsame Sterne das Paradiesgärtchen erleuchteten, die ab und zu zwischen den Wolken auftauchten, ehe sie von ihnen wieder verschluckt wurden.
»Ich geh dann, Herr Corti. Sie können hinter mir die Tür absperren«, rief Resi in Richtung Küche, wohin der Kaffeehausbetreiber verschwunden war.
»Ja, ist recht. Bis morgen und sei pünktlich!«
»Aber natürlich!«, antwortete das Serviermädchen, und es klang ein wenig gekränkt. »Ich wünsche eine gute Nacht.«
Eisige Luft umschloss sie, sobald sie die Tür aufschob. Resi schlang ihren Schal und den Umhang enger um sich. Er war viel zu dünn für eine Januarnacht in Wien und bot nur unzureichend Schutz gegen den eisigen Wind, der wie Nadelspitzen in die Haut drang. Wenigstens lag kaum mehr Schnee auf den Wegen, so dass er ihr heute nicht die Schuhe und Strümpfe durchweichen würde.
Resis Gedanken eilten durch die nächtliche Stadt voraus zu der Gasse, die noch immer nach dem aufgegebenen Chorfrauenkloster, der Himmelspforte, benannt war. Dort, in einem der Zinshäuser, bewohnte sie mit ihrem alten Großvater zwei Zimmer mit einer kleinen Küche unter dem Dach. Wie immer würde er noch wach sein und auf sie warten, und sie würde ihm eine schöne, heiße Schokolade wärmen. Und sich selbst auch, schwor sich Resi, deren Zähne aufeinanderschlugen. Sie dachte an die Glut im Ofen und die Wärme, die sie schon bald umgeben würde, als ein Schatten neben einem entlaubten Fliederbusch ihre Aufmerksamkeit erregte.
Ohne es eigentlich zu wollen, blieb sie stehen und wandte sich dem Schemen zu. Was war das? Resi verließ den Weg und trat ein paar Schritte über den erstarrten Rasen. Der Schatten verdichtete sich zu einer Gestalt. Einer menschlichen Silhouette. Resi machte noch ein paar Schritte.
Warum eigentlich? Ihr war kalt, und es interessierte sie gar nicht, wer in der Winternacht zu dieser Zeit hier noch unterwegs war. Sie wunderte sich über ihre Entscheidung, die gar nicht die ihre zu sein schien. Es fühlte sich an, als würden ihre Füße von einer fremden Macht gelenkt.
So ein Unsinn!
Resi kniff die Augen zusammen. Es musste ein Mann sein, so groß wie es war. Mehr konnte sie nicht erkennen. Ein weiter Umhang verhüllte die Gestalt, deren Gesicht unter der Krempe des ausladenden Huts im Dunkeln lag.
Resi ging noch zwei Schritte weiter, obgleich sie eigentlich zum Weg zurückkehren wollte. Es schien plötzlich noch kälter zu werden, dennoch schlugen ihre Zähne nicht mehr aufeinander. Eine seltsame Starre bemächtigte sich ihrer Glieder. Sie blieb stehen. Ihre Arme hingen leblos herab, ihr Blick blieb starr auf die seltsame Gestalt gerichtet, die nun kaum drei Schritte entfernt vor ihr stand. Sie hatte sich bisher noch nicht bewegt. Nun jedoch schälte sich eine bleiche Hand aus dem Mantelstoff. Schlanke Finger mit langen, spitzen Nägeln krümmten sich.
»Komm noch ein wenig näher, mein Kind«, flüsterte ein kalter Windhauch in ihr Ohr. »Hierher zu mir!«
Das war das Letzte, was Resi wollte. Es drängte sie davonzulaufen, nach Hause zu ihrem Großvater, in die Geborgenheit ihrer kleinen Dachwohnung, zu einer tröstenden Tasse Schokolade, und dennoch folgte sie dem Drängen der fremden Gestalt, bis sie vor ihr stand. Die Wolken, die der Wind über den Himmel jagte, hatten sich verdichtet, dennoch schied sich nun ein Gesicht vom Schatten der Hutkrempe. Bleich war es, ja, fast durchsichtig, als würde es von innen her leuchten. Noch unheimlicher jedoch waren die Augen, die in einem tiefen Rot zu glühen schienen. Aber es ging keine Wärme von ihnen aus. Resi konnte den Ausdruck nicht deuten. Sie wusste nur, dass zu Recht Todesangst ihre Brust umklammerte und ihr den Atem nahm.
Langsam hob die Gestalt die Hand. Eisig legte sie sich auf ihre Wange und strich ihr bis zum Kinn. Einer der spitzen Fingernägel fuhr die Kontur ihrer Lippe nach. Er war so scharf, dass ein Blutstropfen hervorquoll und warm über ihre Haut herabperlte.
»Sehr schön«, sagte der eisige Windhauch. Die dünnen, fast farblosen Lippen öffneten sich und ließen weiß blitzende Zähne sehen. Es war kein Lächeln, das Resis Herz hätte beruhigen können. Wenn überhaupt möglich, vertiefte es den Schrecken noch.
Vielleicht war es dieser Augenblick, der Resi die Gewissheit offenbarte, dass sie in dieser Nacht nicht nach Hause gehen würde. Nein, dass sie niemals wieder heimkehren würde. Armer Großvater!
Warum versuchte sie nicht, vor diesem unheiligen Wesen zu fliehen? Weil sie wusste, dass sie keine Chance hatte, ihm zu entkommen? Weil es sie mit seinem Blick in Fesseln schlug, fester, als jedes Seil es hätte tun können? Es war ihr, als könne sie das Band spüren, das sich um ihr Herz zusammenzog, das unter seinen letzten, verzweifelten Schlägen schmerzte.
»Ich habe auf dich gewartet«, sagte das Wesen.
Was war es? Ein Mensch ganz sicher nicht. Was dann? Ein Dämon der Hölle, der für Satan die Seelen der Menschen raubte und dessen Aufgabe es war, sie im Fegefeuer zu martern?
Nein, nicht im Fegefeuer, korrigierte Resi ihren Gedanken. Das Fegefeuer war nur eine vorübergehende Qual, um seine Sünden, die man hier auf der Erde begangen hatte, zu büßen, doch dann folgte die Erlösung. Und den Rest der Ewigkeit durfte man in Gottes Herrlichkeit zubringen.
Von diesem dämonischen Wesen, das sie mit kaltem Lächeln abschätzend begutachtete, war keine Erlösung zu erwarten. Arme Seele!
Eine seltsame Ruhe überkam sie, obgleich sie hätte zittern müssen, auf die Knie fallen und um Gnade wimmern. Resi starrte in die roten Augen, das Letzte, was sie sehen würde, ehe es sie vernichtete. Nein, das war kein Wesen, das sich von Tränen würde erweichen lassen. Das Einzige, was ihr noch blieb, war, sich in Würde hinzugeben.
»Bewundernswert!«, sagte es leise, als habe es jede Regung ihres Geistes verfolgt. »Obwohl ich gestehen muss, dass Angst dem Blut ein Prickeln verleiht, das nicht zu verachten ist. Und der Duft von Angstschweiß erst! Er bringt mich in Wallung, und das steigert den Genuss. Lass es dir gesagt sein! Nun gut, ich bin niemand, der Mut verachten würde.«
Der vornehme Plauderton verstärkte noch die Absurdität der nächtlichen Szene. War dies gar nur ein Albtraum, aus dem man in seinem eigenen Schweiß gebadet, aber voll Erleichterung am Morgen erwachte?
»Nein, bedaure, du wirst nicht mehr erwachen«, zerstörte das unheimliche Wesen den aufkeimenden Hoffnungsschimmer.
Resi öffnete die Lippen. Sie wusste nicht, woher sie die Kraft nahm zu sprechen, doch plötzlich fand sie ihre Stimme wieder.
»Heilige Jungfrau, erbarme dich meiner, hilf mir, steh mir bei, im Kampf gegen das Böse der Hölle!«
Das dämonische Wesen – oder was immer es war – stieß einen ärgerlichen Laut aus. Mit einem einzigen Griff zerfetzte es ihr die Schließe des Mantels und den Kragen ihres Kleides. Resi nahm noch das Aufblitzen langer, spitzer Zähne wahr und dann einen Schmerz, der zu tief ging, um durch einen Aufschrei Linderung zu finden.
Der Mund presste sich wie Eis gegen ihren Hals, dagegen schien ihr eigenes warmes Blut, das ihr über Hals und Dekolleté rann, ihre Haut zu verbrennen. Das Wesen trank gierig. Saugte ihr Leben in sich ein.
Für einen Moment trat der Mond hinter den Wolken hervor, strich über Resis Wangen und spiegelte sich in den weit aufgerissenen Augen, aus denen das Leben schwand, noch ehe das untote Geschöpf ihr mit einem letzten brutalen Biss die Kehle herausriss.
Es war der Schrei eines wilden Tieres, der sich in die kalte Winternacht schwang, als es seine tote Beute zu Boden fallen ließ. Ohne Resi noch einen letzten Blick zu gönnen, stieg es über den Körper hinweg und verschwand in Richtung Hofburg.
Sacht sank Schnee auf das Mädchen herab, dessen Augen weit aufgerissen in den Himmel starrten, als hoffe es noch immer auf göttliche Hilfe, die es erretten würde. Doch das Einzige, was der Himmel ihr schickte, war ein kaltes Leichentuch, das lautlos ihren blutig zerfetzten Körper einhüllte, bis kein Blut mehr zu sehen war.
Erst am nächsten Tag, als der Kaffeehausbesitzer bereits seit zwei Stunden zornig in seinem Etablissement auf- und abgeschritten war und über die Unzuverlässigkeit der Mädchen lamentiert hatte, stöberten die beiden Jagdhunde eines Rittmeisters des kaiserlich-königlichen Husarenregiments Nr. 10 die Tote auf. Fassungslos stand der junge Mann da, in seinen schwarzen Stiefeln, den engen roten Hosen und dem blauen Dolman – der Uniformjacke mit den goldenen Schnüren –, den grünen Tschako mit dem Federbusch auf dem Kopf, und starrte wie betäubt auf die Tote herab. Dem Husaren war der Tod schon oft begegnet, doch ihn hier im Paradiesgärtchen mitten in Wien auf so scheußliche Weise anzutreffen, darauf war er nicht vorbereitet gewesen. War das nicht die Resi? Das hübsche Serviermädchen aus Cortis Kaffeehaus?
Scharf rief er die Hunde zurück, die sich an dem toten Mädchen zu schaffen machten. Mit einem raschen Blick in die Runde vergewisserte er sich, ob nicht einer der Militärpolizisten oder ein Polizeiwachtmeister auf Patrouille unterwegs war.
Nein, natürlich nicht. Wenn man ihrer bedurfte, waren sie nicht zur Stelle. Der Rittmeister ließ sich auf die Knie nieder und strich ein wenig unbeholfen den Schnee aus dem erstarrten Gesicht. Dann fiel sein Blick auf ihren Hals. Waren das etwa Abdrücke von Zähnen? Bei allen Engeln des Himmels! Was für eine Bestie trieb hier in Wien ihr Unwesen?
Der Rittmeister sprang auf und rannte zum Kaffeehaus, wo er einen der Kriminalkommissäre gemütlich bei seiner Zeitung und einer schönen Tasse Kaffee vorzufinden hoffte.
1. Kapitel
Fürstin Therese Josepha Kinsky
Durchlaucht, es wird dunkel!«
»Das sehe ich. Hältst du mich für blind?«, fuhr die Dame den jungen Mann an, der sich hinter ihr auf dem schmalen Sitz ihres Phaetons festklammerte, heldenhaft darum bemüht, den neutralen Gesichtsausdruck zu wahren, wie es sich für einen Groom gehörte, der seine Herrschaft auf einer Ausfahrt begleitete. Als die Dame jedoch die Peitsche über den vier feurigen Füchsen schwang und die Tiere nacheinander in Galopp fielen, so dass die Kutsche gefährlich zu schlingern begann, stand in seiner Miene nur noch nackte Angst.
»Durchlaucht!«
Es war eines dieser leichten Gefährte, die in England bei den jungen, sportlichen Gentlemen beliebt waren.
»Was ist?«, rief die Dame ungehalten, während sie sich mit der langen Peitsche mühte, das linke Vorauspferd dazu zu bewegen, seinen Schritt dem der anderen anzugleichen. Die Dame, genauer gesagt Fürstin Therese Josepha Kinsky, eine geborene Gräfin von Freudenthal, fluchte leise, als die Spitze ihrer Peitsche das falsche Pferd berührte und dieses mit einem Satz die hochrädrige Kutsche erneut ins Schwanken brachte. Der Pferdeknecht stieß einen Schrei aus und suchte nach einem besseren Halt, doch der schmale Sitz ohne Geländer hatte nicht viel zu bieten.
»Lassen Sie uns umkehren«, flehte er. »Es ist noch ein weiter Weg durch die Hauptallee zurück. Es wird schnell dunkel, und außer uns scheint niemand mehr im Prater unterwegs zu sein.«
»Deshalb habe ich diese Zeit ja gewählt, Dummkopf«, gab die Fürstin unwirsch zurück. »Diese vier Füchse passen wundervoll zusammen. Es war ein guter Kauf, auch wenn sie noch ein wenig ungestüm sind und sich erst aufeinander einstellen müssen. Es sind ganz prachtvolle Tiere! Mit meinem neuen Phaeton werde ich bei der Osterfahrt Aufsehen erregen, aber nur, wenn ich bis dahin das Gespann mit sicherer Hand zu lenken verstehe! Glaubst du, ich will mich zum Gespött der Gesellschaft und des Volkes machen? Daher muss ich die Zeit nutzen, die mir bleibt, ohne Zuschauer zu üben und meine Fahrkünste zu perfektionieren. Wann sonst, als an einem Winterabend, ist die Praterallee einmal verlassen?«
»Und wenn Sie einen Unfall erleiden?«, wagte der Groom zu widersprechen. »Das wäre dem Fürsten nicht recht«, fügte er mutig hinzu.
Seine Herrin schnaubte durch die Nase. »Dem Fürsten!«, sagte sie, hielt dann aber inne. Dass es ihr egal war, was ihr Gatte für gut befand und was er über ihre Vorhaben dachte, ging den Groom nichts an. Die Dienstboten klatschten ohnehin schon genug, da musste sie ihnen nicht noch Wasser für das Geklapper ihrer Mühlen liefern.
Bei dem Gedanken an ihren Gatten kniff Therese missmutig die Lippen zusammen. Er scherte sich nicht um Konventionen – soweit sie ihn selbst betrafen – und auch nicht um Höflichkeit. Warum sollte sie Rücksicht nehmen? Oh ja, sie kannte seine Antwort, ohne dass sie sie hören musste. Er war ein Mann, ein Fürst des alten, böhmischen, hoffähigen Adels, noch dazu mit einem stattlichen Vermögen, der es sich wohl leisten konnte, zu tun und zu lassen, was ihm beliebte. Es stand weder dem Volk noch der Gesellschaft an, über sein Verhalten zu urteilen. Sie jedoch war eine Frau. Ob Fürstin oder nicht, das war in diesem Fall unerheblich. Nichts war unangenehmer als eine Frau, die einen Skandal heraufbeschwor. Und nichts hasste der Fürst mehr als die Unannehmlichkeiten eines Skandals – zumindest wenn sie sein eigenes Haus betrafen. Ansonsten taugten Skandale durchaus, Langeweile zu vertreiben, und als amüsanter Gesprächsstoff für eine abendliche Gesellschaft.
Etwas riss sie abrupt aus ihren unerfreulichen Gedanken. Ein großer Schatten, der zwischen den Kastanienbäumen entlanghuschte. Was war das?
Anscheinend hatte nicht nur die Fürstin den Schatten erspäht. Die Pferde wieherten erschreckt auf. Unwillkürlich zog Therese die beiden Zügelpaare an, von denen sie eines in der Rechten, das andere in der Linken hielt. Der plötzliche Ruck brachte das Gespann noch mehr durcheinander. Die vorderen Pferde bäumten sich auf, die Lederriemen des Geschirrs ächzten.
Der Groom stieß einen warnenden Schrei aus, aber das Unglück nahm bereits seinen Lauf. Obwohl die Fürstin ihren Fehler sofort erkannte, war es schon zu spät. Der huschende Schatten und der unvermittelte Ruck ließen bei den Pferden nur noch die Reaktion zu, die ihr Instinkt ihnen eingab: Und dieser befahl blinde Flucht vor der drohenden Gefahr.
Die vier Füchse rasten die Praterhauptallee hinunter. Immer wieder versuchten sie nach unterschiedlichen Seiten auszubrechen und dem Geschirr zu entfliehen, das sie zusammenkettete. Der Phaeton schlingerte gefährlich. Der Pferdeknecht schrie, dieses Mal in unverhohlener Todesangst. Seine Hände krallten sich um den Sitz, fanden aber keinen Halt mehr. Als die Räder auf eine Unebenheit des Weges stießen – es mochte ein Stein oder auch eine Mulde gewesen sein –, machte der Wagen einen Satz, und der Groom wurde in hohem Bogen hinausgeschleudert. Therese hörte, wie er auf dem Weg aufschlug, und sein Wehklagen, das hinter ihr verklang.
Sie selbst ließ keinen Laut über ihre fest zusammengepressten Lippen. Für weibisches Gejammer war jetzt nicht die Zeit. Sie musste irgendwie zu den noch immer panisch fliehenden Pferden durchdringen. Die Peitsche war ihren Händen entglitten, und nun hätte sie bei dem Schlag beinahe noch die linken Zügel verloren. Behutsam nahm sie die durchhängenden Riemen auf. Den Rücken gegen die gepolsterte Lehne gepresst, die Sohlen der Stiefel gegen das vordere Brett gestemmt, mühte sie sich, das Gleichgewicht zu wahren, während die Kutsche weiter auf das Lusthaus am Ende der Allee zuraste. Unvermittelt schlingerte das Gefährt zur anderen Seite. Die Pferde schienen sich darauf geeinigt zu haben, den Hauptweg zu verlassen und rechts auf die Wiese auszubrechen. Die riesigen Speichenräder der Vorderachse flogen ein wenig versetzt über die Kante am Rand des Weges. Therese wurde erst zur einen, dann hart zur anderen Seite geschleudert. Es gelang ihr noch, die erste Bewegung auszugleichen, doch der zweite Stoß hätte sie fast vom Sitz geworfen. Sie griff nach der Seitenlehne, um den Schwung abzufedern, und sah entsetzt, wie die linken Zügel aus ihrer Hand rutschten. Aus einem Reflex heraus ließ sie ihren Fuß unter dem langen Kutschiermantel hervorschnellen. Der Riemen schlang sich um ihren Stiefel. Der Phaeton jagte nun über die Wiese. Er sprang in immer wilderen Sätzen. Fürstin Kinsky beugte sich vor, um die Zügel aufzunehmen, als die Sitzbank ihr einen derben Stoß versetzte und sie zur Seite warf.
Therese spürte, wie sie das Gleichgewicht verlor. Schon konnte sie das winterlich braune Gras unter den fliehenden Rädern auf sich zukommen sehen. Es dauerte sicher nicht länger als einen Wimpernschlag, und dennoch erkannte Therese mit erschreckender Klarheit, dass sie nun stürzen und es vermutlich ihr Leben kosten würde. Nicht nur, dass das Gefährt besonders hoch gebaut und das Tempo halsbrecherisch war. Die Zügel umschlangen noch immer ihren Knöchel und würden sie gnadenlos mit sich reißen. Doch statt die Lider zu schließen und sich mit einem letzten Gebet Gottes Gnade zu ergeben, riss sie die Augen trotzig auf. Hilflose Wut überschwemmte sie.
Da war er wieder. Der Schatten. Der sie und die Pferde erschreckt hatte. Und dann fühlte sie zwei Hände. Zwei eisenstarke kalte Hände. Schon im Fallen rissen sie ihren Körper hoch. Zurück auf den Wagen. Als würde sie nicht mehr wiegen als eine Stoffpuppe.
Es ging zu schnell und war zu verwirrend, als dass Therese es in diesem Moment hätte begreifen können. Erst später in der Nacht und am anderen Tag, als sie Muße hatte, über den Vorfall nachzudenken, löste sich die Sequenz in einzelne Bilder auf. Allerdings blieb der Vorfall auch dann unbegreiflich. Schlichtweg unmöglich. Und dennoch musste es so geschehen sein. War sie etwa nicht noch am Leben und erfreute sich ohne jede Verletzung bester Gesundheit?
Fürstin Kinsky grübelte unentwegt und versuchte das Rätsel zu ergründen, ohne ihm auf die Spur zu kommen. Es war einfach nicht erklärbar und dennoch wahr.
Unvermittelt saß ein Mann auf dem Kutschbock des Phaetons, riss die Fürstin mit starker Hand hoch, löste den Zügel von ihrem Fuß, nahm ihr den anderen aus der Rechten und fing die noch immer galoppierenden Pferde ein. Sie gehorchten augenblicklich, als wäre nichts geschehen, und trabten in bewundernswertem Gleichklang zurück zur Allee. Vor dem nächtlich verlassenen Lusthaus am Ende der Praterpromenade hielt der Fremde den Wagen an. Die Pferde standen ruhig im Schein des Mondes da, als wären sie aus Stein gemeißelt.
Therese schüttelte den Kopf, als müsse sie den Rest von Schläfrigkeit vertreiben, den ein intensiver Traum in schweren Gliedern zurücklässt. Nein, sie hatte nicht geträumt, und sie war auch nicht von den roten Speichenrädern ihres neuen Gefährts zu Tode gequetscht worden.
»Sie können mich jetzt loslassen«, sagte sie zu dem Fremden mit so viel Würde in der Stimme, wie sie in dieser Situation aufbringen konnte. Eine Fürstin war eine Fürstin, ganz gleich, ob sich ihre Frisur bei der wilden Fahrt gelöst hatte und ihr Haarsträhnen wild nach allen Seiten abstanden, ihre Wange ein blutiger Kratzer zierte, ihr Mantel von Schlammspritzern bedeckt war und ihr elegantes Kutschierkleid einen Riss aufwies. Therese bediente sich der ausdruckslosen Miene des hohen Adels, der es über Generationen geübt hatte, sich durch nichts aus der Fassung bringen zu lassen.
Die kalte Hand, die sie wie eine Eisenklammer umschlossen hatte, löste sich. Der Fremde rückte ein Stück zur Seite – soweit es die Enge des Gefährts eben zuließ.
»Ihr Diener, Durchlaucht. Sind Sie wohlauf?«, sagte er mit wohlklingender, tiefer Stimme, die eine sorgfältige Erziehung verriet. Ein Mann von Adel? Vielleicht. Jedenfalls ganz sicher kein Wildhüter oder einfacher nächtlicher Wanderer.
»Ja, durchaus, dank Ihrer Hilfe«, gab sie zurück. »Ich kann zwar noch nicht begreifen, wie Ihnen dieses Meisterstück gelungen ist, jedenfalls haben Sie mir das Leben gerettet, und dafür danke ich Ihnen auf das Herzlichste.«
Sie war froh, dass ihre Stimme so fest klang und ihre Hand nicht zitterte, als sie sie ihrem Retter reichte. Innerlich dagegen bebte sie in der Erkenntnis der Gefahr, in der sie gerade noch geschwebt hatte.
Er wirkte völlig ungerührt. Sein Atem ging ruhig und gleichmäßig. Doch als er nun die Hand hob und mit dem Zeigefinger die Blutstropfen berührte, die aus dem Riss in ihrer Wange quollen, zitterte seine Hand. Rasch zog er sie zurück und reichte ihr stattdessen ein fein besticktes Taschentuch, mit dem sie sich über die Wange fuhr, die an der Stelle, an der er sie berührt hatte, noch kälter schien als der Rest ihres Gesichts. Mit der anderen hielt er noch immer die Hand fest, die sie ihm gereicht hatte, und hauchte nun einen Kuss auf das weiche Leder ihres ruinierten Handschuhs.
»Ist es nicht jede Mühe wert, einer Dame in Nöten einen Dienst zu erweisen, Fürstin Kinsky?«
»Sie kennen mich?«, wunderte sich Therese.
»Das Zaumzeug der Pferde ziert Ihr Wappen.«
Ein Teil in ihr fragte sich, wie er das in der Dunkelheit hatte erkennen können, doch sie vergaß es, weiter darüber nachzudenken, als sie erwiderte: »Dann sind Sie im Vorteil. Ich weiß bisher nicht, mit wem ich es zu tun habe.«
»Mein Name ist András.«
Sie hatte das Gefühl, dass er es dabei belassen wollte, doch als sie fragend die Brauen zusammenschob, fügte er nach einigem Zögern hinzu: »András Petru Báthory«.
»Ein ungarischer Name?«, überlegte die Fürstin laut, doch der Mann an ihrer Seite ging nicht darauf ein. Stattdessen schlug er vor, in die Stadt zurückzufahren.
Nachdem sich ihr Herzschlag beruhigt und die Wallungen des Blutes abgeflaut waren, spürte die Fürstin die Kälte durch Mantel und Kleid dringen. Daher stimmte sie seinem Vorschlag zu. Sie streckte die Hände fordernd aus, ihr Retter jedoch ignorierte sie und behielt die Zügel locker in der Linken. Noch immer standen die Pferde reglos da, als seien sie zu Eis erstarrt. Nur der Wind spielte in den langen, rötlichen Mähnen.
Fürstin Kinsky räusperte sich vernehmlich. Auch dieses Signal überhörte der Mann an ihrer Seite. Sein Blick war auf die Tiere gerichtet. Therese schwankte zwischen Ärger und Neugier. Wollte er ihr nun demonstrieren, wie er mit einem Viererzug zurechtkam? Gut, sollte er sein Glück bei ihren jungen Füchsen versuchen, mit denen man noch viel arbeiten würde müssen, bis sie zu einem dieser harmonischen Gespanne wurden, denen jeder Passant bewundernd auf der Straße nachsah. Dann sollte er einmal zeigen, was er konnte!
»Nun gut, Herr Báthory, fahren wir zurück, und sehen wir, was aus meinem armen Groom geworden ist.«
Sie sah genau auf seine Hände. Noch immer lagen die Zügelpaare schlaff in seinen Fingern. Eine Peitsche hatten sie nicht mehr. Therese konnte kaum erahnen, dass er die Lippen bewegte. Ein weicher, dunkler Ton, und die Pferde zogen an. Ruhig und gleichmäßig, nicht so wild und unrhythmisch, wie sie es unter ihrer Hand getan hatten. Wieder ein Ton, ein wenig höher als zuvor, und sie fielen in Trab. So fuhr er den Wagen die Allee zwischen den kahlen Kastanienbäumen entlang, saß entspannt neben ihr, die Zügel locker in seinem Schoß, die Pferde scheinbar nur mit seinem Blick und ein paar Tönen im Zaum haltend. Erstaunlich. Beneidenswert. Unglaublich!
»Ist das dort vorn Ihr Pferdeknecht, Durchlaucht?«
Ihr Retter deutete auf eine Gestalt, die am Rand der Allee in ihre Richtung hinkte.
»Ja, das ist der gute Johann. Ihm scheint – dem Himmel sei es gedankt – nicht viel zu fehlen.«
Ihr Begleiter nickte. »Ja, das Glück muss ihm hold gewesen sein. Das war ein harter Sturz, bei dem er sich alle Knochen hätte brechen können.«
Das konnte Báthory nur vermuten. Wie hätte er Zeuge dieses Sturzes sein und – nur wenige Augenblicke später – vorn auf der Wiese am Lusthaus die Pferde aufhalten können?
Der Fremde hielt den Phaeton genau neben dem Knecht an, ohne dass sich eine seiner Hände auch nur bewegt hätte.
»Durchlaucht!«, rief der Groom . »Sind Sie unversehrt? Heilige Jungfrau, ich danke dir! Ich dachte schon, der Wagen müsse sich überschlagen, als die Pferde so mit Ihnen davonjagten. Durchlaucht, Sie hätten heruntergeschleudert werden und sich den Hals brechen können!«, rief er und schloss schaudernd die Augen. »Was hätte der Herr dazu gesagt?«
Therese spürte, wie ein Lächeln ihre Lippen zucken ließ, und sie war in Versuchung, ihren Knecht zu fragen, welcher Teil seiner schaurigen Vorstellung ihn mehr erschreckte: der mögliche Tod seiner Herrin oder die Rüge, die der Fürst ihm erteilen würde, dass er dieses Abenteuer nicht verhindert hatte. Natürlich sprach sie ihre Gedanken nicht aus. Stattdessen forderte sie Johann auf, in den Wagen zu steigen, dass man endlich den Heimweg fortsetzen könne. Der Groom warf dem Unbekannten einen neugierigen Blick zu, wagte aber nicht zu fragen.
Erstaunt sah Therese ihr verstohlenes Lächeln im Gesicht ihres Begleiters gespiegelt, so als habe er ihre Gedanken aufgefangen und teile das Amüsement.
Was für ein unsinniger Einfall!
Rasch wandte sie ihren Blick wieder ab und betrachtete kritisch Johanns zerrissenen Mantel, unter dem eine nicht minder ruinierte Livree zu sehen war. Vermutlich hatte er sich auch einige Schürfwunden und schmerzhafte Prellungen zugezogen, doch so wie es schien, war er bei dem Sturz ohne Knochenbrüche davongekommen. Vielleicht konnte man ja den ganzen Ausflug ohne Aufheben beenden, und niemand musste davon erfahren. Allen voran der Fürst, nach dessen Kommentaren sie sich nicht gerade sehnte.
So hing Fürstin Therese Josepha Kinsky schweigend ihren Gedanken nach, während András Petru Báthory den Wagen durch die Josephvorstadt lenkte. Sie rollten am Ufer des Donauarms entlang, querten die Ferdinandsbrücke und passierten dann das Tor, das sie in die Stadt führte. Der Klang der Räder hallte durch die zu dieser Zeit nahezu menschenleeren Gassen. Zwei Männer der kaiserlich-königlichen Militärpolizei standen vor der Schranke und betrachteten den Wagen mit gerunzelter Stirn, doch da András die Pferde vorschriftsmäßig nur im kleinen Trab gehen ließ, seit sie das Tor passiert hatten, entspannten sich ihre Mienen wieder. Aber selbst wenn er die Kurve in die Wipplinger Straße in halsbrecherischem Galopp genommen hätte, hätten sich die Polizisten mit einem ärgerlichen Stirnrunzeln begnügt. Zumindest wenn sie das Wappen erkannt hätten.
Die Wiener Polizei hatte ihre liebe Not mit den oft rücksichtslos dahinpreschenden Fiakern und vor allem mit den Privatkutschern und ihren hohen Herrschaften. Während sie die Ersteren gern und häufig anhielten und mit Strafen bedachten, durften die Mitglieder der Gesellschaft sich vor solchen Übergriffen in Sicherheit wähnen.
Mit einem leicht schlechten Gewissen musste Therese vor sich selbst bekennen, dass auch sie zuweilen der Versuchung nicht widerstehen konnte, in flottem Tempo durch die engen Gassen zu kutschieren. Ihr Retter neben ihr schien in dieser Nacht dagegen entschlossen, sie keinem weiteren Nervenkitzel auszusetzen. Er schwieg noch immer, während er den Phaeton seinem Ziel entgegensteuerte. Therese wunderte sich nicht, dass er nicht fragte, wohin er sie bringen sollte. Jeder in Wien wusste, dass die Freyung zu einer der vornehmsten Adressen gehörte, weil hier das Palais Harrach zu finden war und vor allem das prächtige Palais des Fürsten Kinsky.
András Petru Báthory fuhr den Wagen vor dem von zwei steinernen Atlanten gestützten Tor vor. Therese erwartete schon fast, dass die vier Füchse auf den Punkt anhielten, ohne dass sie eine Regung ihres Begleiters hätte wahrnehmen können.
Johann sprang von seinem Sitz und humpelte zu seiner Herrin, aber natürlich war der fremde Kavalier schneller und reichte ihr seine eisige Hand. Die Kälte drang durch das Leder und ließ die Fürstin erschaudern. Weshalb trug er auch in solch einer Winternacht keine Handschuhe?
»Durchlaucht, darf ich mich empfehlen?«, fragte er, und wieder fiel ihr auf, wie betörend seine tiefe Stimme klang. War er ein Sänger der Oper? Bei dieser Stimme könnte sie sich das gut vorstellen, ansonsten passte sein Auftreten eher nicht zu einem Künstler der Musik- und Theaterwelt.
»Sie dürfen«, erwiderte Therese.
»Und Sie sind auch bestimmt wohlauf?«
»Gewiss. Und ich erlaube Ihnen, sich morgen nach meinem Befinden zu erkundigen.«
War seine Miene bisher unbeweglich gewesen, zuckte nun ein Lächeln um seine ungewöhnlich bleichen Lippen, das sie nicht zu deuten wusste.
»Es wird mir eine Ehre sein, Durchlaucht.«
Machte er sich etwa über sie lustig? In seiner Stimme war nichts davon zu hören, und dennoch kam ihr die Ehrerbietung nicht echt vor. Natürlich hatte er ihr das Leben gerettet, aber wer war er, dass er sich so etwas herausnahm? Irgendein dahergelaufener Ungar oder Böhme oder sonst so etwas? Er müsste sich geschmeichelt fühlen, dass sie ihn einlud, in ihrem Haus vorzusprechen! Therese fühlte den Wunsch, wie ein ungezogenes Mädchen zornig mit dem Fuß aufzustampfen.
Sein Lächeln wurde noch eine Spur breiter. Therese sah misstrauisch zu ihm auf. Er konnte ihre Gedanken nicht erahnen. Nein, das war ganz und gar unmöglich! Für einen Moment trafen sich ihre Blicke. Seine Augen waren tiefschwarz, doch im Licht der Laterne vor dem Haus schimmerten sie rötlich. Therese senkte den Blick und ärgerte sich darüber, dass nicht er es gewesen war, der das tat. An seiner Verbeugung war allerdings nichts auszusetzen, und nun bedauerte sie es fast, dass er sich entfernte und gemessenen Schrittes über den Platz davonging, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Die Fürstin gab sich einen Ruck und wandte sich an ihren Groom, der noch immer abwartend dastand, das Gesicht zu einer Grimasse des Schmerzes verzogen.
»Bring die Kutsche weg und versorge die Pferde. Das ist alles für heute.«
Er verbeugte sich ein wenig steif. »Ja, Durchlaucht.«
»Und wenn dein Bein morgen nicht besser ist, dann lass mir Bescheid geben. Konrad soll dir morgen zur Hand gehen, sag ihm das.«
Die Fürstin wandte sich zur Tür, die aufgerissen wurde, noch ehe ihre Hand sich dem Klopfer näherte. Der Butler hatte die Ankunft der Kutsche längst bemerkt und war hinuntergeeilt, um zu öffnen. Natürlich hatte er hinter der Tür gewartet, bis sie sich von ihrem Begleiter verabschiedet hatte, um im rechten Moment bereit zu sein. Dem Personal entging einfach nichts.
Therese wusste nicht, ob sie sich über so viel Aufmerksamkeit freuen oder ärgern sollte.
»Guten Abend, Lorenz«, grüßte sie den Butler, der schon Jahrzehnte im Dienst ihres Mannes stand.
»Ich hoffe, der Abend ist zu den guten zu zählen, Durchlaucht«, sagte der Butler mit einer Spur von Missbilligung in der Stimme, als sein Blick an ihr herabwanderte. »Soll ich Vesna rufen lassen, dass Sie Ihnen behilflich sein kann, die Spuren ihres – äh – Ausfluges zu beseitigen?«
Therese sah an sich herunter, während der Butler ihr aus ihrem Kutschiermantel half. »Ja, das wird wohl nötig sein. Schick sie zu mir. Ich nehme lieber den direkten Weg in meine Gemächer!« Die Fürstin durchschritt das Portal und trat in die von Pfeilern geteilte, dreischiffige Torhalle.
»Ich fürchte, ich muss mir ein neues Kleid bestellen«, murmelte sie, als sie auf die Prachttreppe zustrebte.
»Wie gut, dass der Fürst noch nicht zurück ist!« Das waren die ersten Worte der Kammerfrau, als sie ihre Herrin zu Gesicht bekam.
»Ist er um diese Zeit doch nie«, entgegnete die Fürstin ein wenig schroff. »Wann wäre er jemals vor Mitternacht vom Kartentisch aufgestanden? Die einzigen Festlichkeiten, die er frühzeitig verlässt, sind Familienfeiern!«
Die Kammerfrau schwieg, wie es sich gehörte, doch ihre Miene sprach Bände. Sie half ihrer Herrin aus den ruinierten Kleidern und erlaubte sich nur einen kleinen Seufzer, als sie den Riss im Mantel begutachtete. Sie reichte die Kleider der Zofe weiter. Dann machte sie sich daran, der Fürstin das Gesicht zu säubern und den blutigen Kratzer so gut es ging mit Puder zu verdecken. Obwohl sie sicher vor Neugier fast platzte, fragte sie nicht und kämmte stattdessen die noch immer blonden Locken aus, um sie anschließend frisch aufzustecken.
Fürstin Therese Josepha Kinsky betrachtete ein wenig abwesend ihr Gesicht im Spiegel. Nein, das war nicht mehr die pralle Jugend mit ihrer rosigen, straffen Haut, die ihr entgegensah. Die Jahre hatten Spuren hinterlassen und die ersten Falten um Augen und Mund eingegraben. Zwar war die Fürstin groß von Gestalt – fast ein wenig zu groß für eine Frau – und noch immer schlank. Dennoch enthüllte das unbarmherzige Tageslicht, dass die vierzig eine Weile schon hinter ihr liegen mussten. Nur im schmeichelnden Schein von Kerzen, wenn ihr Haar golden ihr Gesicht umrahmte, Puder und Rouge ein paar Jahre kaschierten und die grauen Augen mit den dunklen Wimpern voller Lebenslust funkelten, konnte man die schöne junge Frau noch immer sehen, die einst der Stolz ihres Vaters, des Grafen von Freudenthal, gewesen war – und mit deren Hilfe er eine lukrative Verbindung zu dem mächtigen Fürstenhaus Kinsky hatte knüpfen können. Wobei neben ihrer Schönheit durchaus auch ihre Mitgift sie zu einem attraktiven Handelsobjekt gemacht hatte.
Das waren die beiden Dinge, die bei einem Mädchen zählten. Nun ja, der gute Name natürlich auch, aber ein heller Geist und ein wacher Verstand waren eher nebensächlich oder gar störend. Reichte es doch, wenn sie liebreizend lächeln und bei Tisch mit Gästen Konversation treiben konnte, ja und vielleicht noch ein wenig Klavier spielen und ein nettes Aquarell pinseln. Das waren die Talente einer Frau, die gebraucht wurden, neben ihrer Hauptaufgabe, Kinder zu gebären – vordringlich natürlich Söhne.
Ein bitterer Zug trat in ihre Miene, und nun sah man ihr ihre bald fünfzig Jahre deutlich an. Erschreckt versuchte Therese den unschönen Zug zu vertreiben, ein Lächeln wollte ihr jedoch nicht gelingen. Ihr Blick traf den ihrer Kammerfrau.
»Ist alles in Ordnung? Sie haben sich doch nicht etwa verletzt?«
Die Fürstin schüttelte den Kopf. »Nein, mir ist nichts passiert. Es war knapp, aber es ist alles gut gegangen, weil …« Sie legte den Kopf schief. Nun erhellte ein echtes Lächeln ihre Züge und verlieh ihnen ein inneres Leuchten. »Es war so etwas Ähnliches wie ein Wunder.«
»Dem Himmel sei gedankt. Die Engel des Herrn haben ihre Hand über Euch gehalten«, murmelte die Kammerfrau, die im Gegensatz zu ihrer Herrin tief gläubig war.
Therese wiegte den Kopf hin und her. »Dass er ein himmlischer Retter war, möchte ich bezweifeln.«
Sie warf der Zofe, die neugierig zu ihnen herüberstarrte, einen strengen Blick zu. Hastig beugte sich das Mädchen wieder über den Mantel und bürstete weiter den Staub aus den Fasern. Sicher jedoch nicht weniger aufmerksam, auf dass ihr ja kein Wort entgehe.
Therese unterdrückte einen Seufzer und begann von Belanglosem zu sprechen. Nach einer Weile jedoch hielt sie inne und fragte unvermittelt: »Vesna, sagt dir der Name Báthory etwas? Er ist ungarisch, nicht wahr? Ich habe ihn schon gehört, aber ich komme einfach nicht mehr darauf, in welchem Zusammenhang.«
»Báthory? Die Fürsten Báthory?«, wunderte sich die Kammerfrau. »Sie sind Magyaren, ja, doch nicht aus dem ungarischen Stammland. Sie waren über lange Zeit die Fürsten von Siebenbürgen oder Transsilvanien, wie man es auch nennt. Heute gibt es kein Fürstentum Siebenbürgen mehr. Der Kaiser setzt seit mehr als einhundert Jahren einen Gouverneur in Transsilvanien ein. Die Familie ist aber noch immer sehr angesehen und nennt einige Grafschaften ihr Eigen.«
Die Fürstin sah ihre Kammerfrau mit gehobenen Augenbrauen an. »Du erstaunst mich wieder einmal, liebe Vesna. Du bist, wie immer, eine unerschöpfliche Quelle des Wissens.« Doch die Kammerfrau war noch nicht fertig.
»Ein Báthory, Graf von Brasov, hat vor kurzem das Palais an der Hofburg erstanden, das dem Bankier Fries gehörte, dem Unglücklichen. Fanny hat mir davon erzählt. Sie war Zofe bei der Reichsgräfin Fries.«
»Ach!«, rief die Fürstin. »Und ich weiß genau, dass meine Hutmacherin mir sagte, irgendein böhmischer Baron habe es erworben. Ich weiß ja, dass sie den Klatsch über alles liebt, aber dann soll sie wenigstens zuhören, sich die Dinge genau merken und sie dann korrekt weitergeben!«
»Dann wäre es kein Klatsch mehr, Herrin«, wagte die Kammerfrau anzumerken.
Therese schnaubte durch die Nase. Eine Weile schwieg sie, dann ließ sich ihre Neugier nicht länger bezwingen.
»Und was weißt du noch?«
»Über den Bankier Fries und das Palais?«
Nein!, wollte die Fürstin protestieren. Über den Grafen András Petru Báthory von Brasov natürlich! Was interessierte sie ein Bankier und sein Haus? Aber sie sagte es nicht. Stattdessen blieb sie stumm und tat so, als würde sie den Worten ihrer Kammerfrau lauschen, während sie ihren eigenen Gedanken nachhing. Sie wanden sich und nahmen immer neue Wege, doch dann kehrten sie in Schleifen stets zu der einen Frage zurück: Warum interessierte sie dieser junge Graf überhaupt?
Nun ja, immerhin hat er mir das Leben gerettet, sagte sie sich. Und er ist ein Meister des Kutschierens, von dem man vielleicht den ein oder anderen Kniff lernen könnte.
Sie wusste, dass das nicht der Grund war, als Rechtfertigung reichte es jedoch für den Moment aus.
2. Kapitel
András Petru Báthory
Hat jemand vorgesprochen, während ich weg war?«
»Nein, Durchlaucht.« Der Butler verzog keine Miene.
Obwohl man ihr ihre Enttäuschung sicher ansah, erdreistete sich Lorenz nicht, zu fragen, wen sie zu sehen erwarte. Die Fürstin trat von der Torhalle in das prachtvoll überkuppelte Vestibül und drückte ihrer Zofe den Muff in die Hände.
»Ist der Fürst noch im Haus?«, fragte sie den Butler, während sie die Hutnadel löste, die das Kunstwerk auf ihrem Kopf befestigte.
»Seine Durchlaucht hat das Haus vor etwa einer halben Stunde verlassen, um sich mit den anderen Herren vom Jockeyclub zu treffen«, gab der Butler Auskunft.
»Wenigstens eine gute Nachricht«, murmelte sie so leise, dass es die Dienerschaft nicht hören konnte. Dennoch gab sich die Fürstin nicht der Illusion hin, dem Personal könnte selbst das kleinste Detail der Differenzen zwischen ihr und ihrem Gatten verborgen bleiben. Es war schon viel gewonnen, wenn sie außer Haus nicht darüber klatschten. Und auch darüber war sie sich nicht bei allen sicher. Lorenz und Vesna waren zuverlässig, aber die anderen? Die Zofe, die Köchin und die Küchenmädchen, die Lakaien und Stallknechte? Nein, für ihre Verschwiegenheit würde die Fürstin die Hand nicht ins Feuer legen.
Therese unterdrückte einen Seufzer, raffte ihre Röcke und stieg die langgezogene Treppe hinauf, deren Gewölbe ein mächtiger Herkules pflichtschuldig auf den Schultern trug. Sie zog sich in ihren Salon zurück, der zwar kleiner, aber nicht minder prächtig war und besser geheizt als die großen Repräsentationsräume, und ließ sich ein Kipferl mit reichlich Butter und Kaffee bringen. Dann nahm sie auf dem einzigen bequemen Sessel neben dem Ofen Platz. Es hatte schon wieder zu schneien begonnen. Falls sie den Einfall erwogen hatte, das Haus vor dem Abend noch einmal zu verlassen, so verwarf sie ihn in diesem Moment wieder. Es gab nichts, das es lohnte, bei diesem Wetter auszugehen, wenn der Wind die Flocken durch die Häusergassen trieb und eisig unter die Röcke fuhr. Schade. Sie hätte – ganz zufällig – am Palais Fries vorbeischlendern können.
Dumme Gans!, schalt sie sich. Das wäre der rechte Eindruck, wenn er sie dabei sehen würde. Oder sollte sie besser »ertappen« sagen? Außerdem, was sollte an diesem schäbigen Palais wert sein, betrachtet zu werden? Nun, da es ihr in der Nacht immer wieder in den Sinn gekommen war, stand ihr das Haus auch wieder deutlich vor Augen:
Das Palais Fries musste vor mehr als fünfzig Jahren an Stelle des königlichen Frauenklosters errichtet worden sein. Jedenfalls Jahre bevor sie das erste Mal als Kind nach Wien gekommen war. Schlicht war das einzige Wort, das ihr zu der Fassade des Palais einfiel. Es lag der großen Hofbibliothek direkt gegenüber, und sein geradezu grässlich moderner Baustil hatte damals die Gemüter erhitzt. Nun erinnerte sich die Fürstin an eine Episode, die ihre Mutter ihr erzählt hatte. Der Architekt Hetzendorf von Hohenberg fand seine nur von den Fensterachsen gegliederte Hauptfassade in ihrer Einfachheit elegant. Mit dieser Meinung stand er allerdings allein da. Die Kritik von allen Seiten konnte ihn nicht kaltlassen, und so gestaltete er zumindest das Portal ein wenig repräsentativer und stellte ihm je zwei Karyatiden, die einen gesprengten Giebel trugen, zu jeder Seite.
Nun ja, der Bauherr war eben nur ein Bankier gewesen, auch wenn seine Familie in den Reichsgrafenstand erhoben worden war.
Ah, sein Einfluss macht sich bemerkbar, ließ sich eine gehässige Stimme in ihrem Innern vernehmen. Die Fürstin erschrak. Sie wollte nicht so arrogant werden, wie ihr Gatte und viele Mitglieder der Gesellschaft es waren.
Therese wusste nicht viel von Graf Johann von Fries, doch man sagte über ihn, er sei ein guter Geschäftsmann gewesen, der durch die Einführung des Maria-Theresia-Talers als Handelsmünze zu einem der reichsten Männer Österreichs geworden war. Sein Tod umrankte ein dunkles Geheimnis. Was hatte Vesna gestern gesagt? Sein Leichnam sei im Vöslauer Schlossteich aufgefunden worden. Niemand konnte sich den Vorfall erklären. Ein Unfall? Mord oder gar Selbstmord? Damals jedenfalls ging es seinem Bankhaus noch prächtig.
Therese sinnierte einige Augenblicke über den rätselhaften Tod des Bankiers nach, ehe sie sich gedanklich den Erben zuwandte.
Fries’ Söhne waren beide Kunstliebhaber – Förderer, Sammler und Verschwender. Sie veranstalteten Konzerte und Soireen. War ihre Mutter, die Gräfin Freudenthal, nicht einst bei einem solchen Konzert gewesen? Es musste bald vierzig Jahre her sein, doch nun erinnerte sich Therese an ihre Worte und daran, dass der Bankier ein Förderer Beethovens gewesen war, der daraufhin irgendeine seiner Symphonien dem Gönner Moritz von Fries gewidmet hatte. Und dann war das Bankhaus plötzlich bankrottgegangen, und das Palais musste verkauft werden. Das war schon eine Weile her, und mehr als ein Jahr hatte das Palais leer gestanden. Nun also war der neue Eigentümer in Wien eingetroffen.
Mit solchen Überlegungen schlich der Nachmittag dahin. Die goldene Uhr im großen Salon schlug zu jeder Stunde und steigerte ihren Unmut mit jedem weiteren Schlag, bis sie sich erhob und gereizt auf- und abzugehen begann. Was bildete sich dieser Graf eigentlich ein? Hatte sie ihm nicht deutlich zu verstehen gegeben, dass er heute vorsprechen sollte? Wie konnte er es wagen, ihre Wünsche zu ignorieren? Es wurde bereits dunkel, und die Diener gingen durchs Haus, um die Kerzen in den Leuchtern zu entzünden.
»Durchlaucht?« Die Zofe knickste artig. »Vesna schickt mich. Sie hat Ihr Gewand für heute Abend zurechtgelegt. Möchten Sie sich umkleiden lassen?«
»Ich weiß nicht, ob ich heute ausgehe«, gab die Fürstin missmutig zurück.
»Aber das Diner bei der Gräfin Trauttmannsdorf!«, rief die Zofe entsetzt.
»Ich habe Kopfschmerzen.«
Die Zofe blieb unschlüssig im Salon stehen. »Soll ich den Lorenz schicken? Ich meine, dass man der Gräfin Trauttmannsdorf Bescheid gibt, da es nun eine Tischdame zu wenig sein wird.«
»Ja, er soll ein Billet rüberbringen lassen«, sagte die Fürstin und blieb dann allein im Salon zurück. Nur der Butler kam kurz herein und erkundigte sich, was sie – nun da sie so unerwartet zu Hause blieb – zu Abend zu essen wünsche.
Im Haus war es ruhig. Ihr Gatte hatte sich den ganzen Tag noch nicht blicken lassen, was ihr nicht unrecht war. Bald wurde das Essen aufgetragen, und sie ging hinüber in das kleine Speisezimmer, wo sie lustlos in den Gerichten herumstocherte. Schon begann sie es zu bereuen, nicht zu den Trauttmannsdorfs gegangen zu sein. Langweiliger konnte ein Abend nicht werden, selbst wenn sie sich wieder zwischen einem fast tauben Greis und einem alten Offizier als Tischherrn wiederfinden würde.
»Ein Herr mit Namen Báthory bittet vorsprechen zu dürfen und sich nach Ihrem Befinden zu erkundigen.«
Die Worte des Butlers ließen sie von ihrem Stuhl auffahren. Die Fürstin hatte schon zwei Schritte in Richtung Tür getan, als ihr auffiel, wie unangebracht dieses Verhalten war. Lorenz ließ sich wie immer nichts anmerken. Therese blieb mitten im Zimmer stehen. Sie würde hinaufgehen und sich umkleiden lassen. Sollte er ruhig auf sie warten! Das hatte er verdient.
Anderseits war es zu viel der Ehre, für ihn ein neues Kleid anzulegen. War er das wert, nachdem er sie den ganzen Tag versetzt hatte, und nun zu einer Stunde auftauchte, da er annehmen musste, dass sie bereits im Theater oder bei einer Gesellschaft sein würde?
»Soll ich dem Herrn ausrichten, dass Sie sich nicht wohlbefinden?«, wagte der Butler anzuregen.
Für einen Moment war die Fürstin versucht, den Vorschlag anzunehmen, doch ihre Neugier war stärker.
»Nein, danke Lorenz. Du kannst ihn in den grünen Salon führen. Ich komme gleich nach.«
»Wie Sie wünschen, Durchlaucht«, antwortete der Butler. Und obwohl in seiner Stimme und an seiner Verbeugung nichts auszusetzen war, hatte Therese das Gefühl, er würde diese Anordnung missbilligen.
Und wenn schon. Lorenz war ihr Butler, und es ging ihn nichts an, was seine Herrschaft tat oder nicht tat. Therese nahm wieder auf ihrem Stuhl Platz, trank – zumindest äußerlich gelassen – zwei Tassen Kaffee und erhob sich dann, um den späten Besucher zu empfangen.
»Durchlaucht!«
András hatte am Fenster gestanden und in den vorderen Hof hinabgesehen. Nun, als der Butler die Fürstin meldete, drehte sich der Besucher um und kam leichtfüßig auf sie zu, um ihr die Hand zu küssen.
»Graf Báthory von Brasov, wenn ich recht informiert bin?«, sagte die Fürstin ein wenig kühl.
Ein Lächeln erhellte die wie aus Porzellan gemeißelten Züge. Hier im von zahlreichen Leuchtern üppig erhellten Salon kamen sie ihr unnatürlich bleich vor, wie sie es bisher nur bei einigen Damen erlebt hatte, die geradezu panisch das Tageslicht scheuten. Herren dagegen, die zumindest ein wenig sportlich waren und gerne kutschierten oder ausritten, trugen stets eine gesunde Gesichtsfarbe zur Schau. Und so wie sie seine Künste auf dem Kutschbock erlebt hatte, gehörte er ganz sicher nicht zu der Sorte, die sich nur in einem geschlossenen Gefährt umherkutschieren ließen.
»Ah, Durchlaucht, Sie haben sich über mich informiert.«
Therese schauderte, als seine Fingerspitzen sie berührten. Sie waren so eisig wie in der Nacht zuvor.
»Ich hatte ja genug Zeit dazu«, gab sie spitz zurück.
Sein Lächeln vertiefte sich noch eine Spur. »Sie zürnen mir, weil ich nicht eher vorgesprochen habe?« Die Fürstin beließ es bei einer wegwerfenden Handbewegung.
»Nun jedenfalls bin ich hier, Ihr gehorsamer Diener, und muss mich besorgt fragen, ob Sie nicht doch bei Ihrem kleinen Abenteuer Schaden genommen haben?«
Obwohl an der Wahl seiner Worte nichts auszusetzen war, konnte sie in seiner Stimme nicht die Spur von Besorgnis erkennen. Nein, es klang eher ein wenig nach Spott.
»Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung?« Unwillkürlich fuhr ihre Hand zu dem von Puder sorgfältig bedeckten Kratzer an ihrer Wange.
»Nein, nein, keine Sorge, Ihre Erscheinung ist makellos. Ich frage mich nur, ob Sie sich zu unwohl fühlen, um an diesem Abend einer Gesellschaft beizuwohnen.«
»Hatten Sie gehofft, mich nicht anzutreffen, und wollten nur kurz Ihre Karte abgeben? Und nun stehle ich Ihnen völlig unerwartet Ihre kostbare Zeit«, sagte sie in bewusst sarkastischem Ton.
»Es hätte mich nicht abgehalten, zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorzusprechen, bis es mir vergönnt ist, Ihnen von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen.«
Wieder lauerte der Schalk hinter seinen Worten.
Therese fühlte, wie sich Missmut in ihr auszubreiten begann. Und auf diesen Mann hatte sie den ganzen Tag ihre Gedanken verschwendet und gar die Gesellschaft bei den Trauttmannsdorfs abgesagt?
Sie ärgerte sich am meisten über ihr eigenes Verhalten, das ihr nun plötzlich unangemessen kindisch erschien. Sie war Therese Josepha Kinsky! Eine Fürstin, bei Hof und in der Gesellschaft angesehen. Und er? Ein Graf aus Siebenbürgen, aus der Provinz, neu in Wien, und er wagte es, über sie zu spotten?
Der Graf ließ seine dunklen Augen durch den Salon wandern. Sie hatte bewusst nicht den größten gewählt, ihn zu empfangen, doch wie alle Räume in diesem Trakt war auch dieser kostbar ausgestattet und mit ausgewählten Möbelstücken versehen. Dennoch hatte sie das Gefühl, er wäre gelangweilt. Konnte ihre Gestalt seinen Blick nicht länger fesseln?
Nun gut, sie hatte die vierzig deutlich überschritten, und er war vielleicht dreißig oder höchstens fünfunddreißig. So genau konnte sie das nicht sagen. Seine Haut war rein und weiß ohne Falten oder andere Spuren des Lebens, unschuldig wie die eines Kindes, die Züge jedoch durchaus markant und männlich. Das Haar schimmerte in tiefem Schwarz, die Augen schienen ebenso dunkel. Er war von großer, schlanker Gestalt. Erfreulich groß, stellte die Fürstin fest, die es leider gewohnt war, auf Diplomaten und Offiziere herabsehen zu können, deren Wachstum sich irgendwann von der Höhe in die Breite verlagert hatte.
Es wurde Zeit, dass sie ihn verabschiedete. Der Höflichkeit war Genüge getan, und er bemühte sich nicht, den Anstandsbesuch in die Länge zu ziehen. Erleichterung und Enttäuschung mischten sich, als sie ihm die Hand reichte. Sie hätte ihn gern gefragt, wann sie sich wiedersehen würden, doch ihr Stolz ließ sie die Worte zurückhalten. Außerdem zürnte sie ihm! Er würde sich ihre Gesellschaft erst verdienen müssen.
Draußen vor der Tür erklangen Stimmen. War ihr Gatte etwa zurück, um sich für eine Abendgesellschaft umzukleiden? Therese erkannte die Stimme des Butlers. Er sprach mit einem Mann, der jedoch ganz sicher nicht ihr Gemahl war. Wer konnte das um diese Zeit sein? Neugierig verließ sie zusammen mit Graf Báthory den Salon und wandte sich den Stimmen zu, die sie in einen kleinen Empfangsraum führten, in den der Butler sicher kein Mitglied der Gesellschaft gebracht hätte. Der Graf folgte ihr, obwohl sie ihn nicht dazu aufgefordert hatte.
»Was gibt es, Lorenz?«, fragte sie und hob die Augenbrauen, während sie den Fremden musterte. »Wer ist unser Besucher hier?«
Er war nicht schlecht gekleidet, ein Bürger, vielleicht ein Bankier oder Kaufmann, sicher nicht ohne ein ordentliches Auskommen, und dennoch fuhr er bei ihren Worten zusammen und sah sie mit dieser Mischung aus Trotz und Schuldbewusstsein an, der man sonst bei der Sorte Gesindel begegnet, das sich durch kleine Betrügereien und Diebstähle über Wasser hält.
Was die Fürstin jedoch noch mehr irritierte, war, im Gesicht ihres Butlers ähnliche Bestürzung zu sehen.
»Nun, was ist los? Wie ich höre, gibt es Differenzen, die ich sicher ausräumen kann.« Sie legte einen strengen Ton in ihre Stimme. Der Butler, den so leicht nichts erschrecken konnte, zog das Genick ein, und auch der andere Mann fühlte sich sichtlich unwohl in seiner Haut. Er griff hastig nach der Mappe, die er auf den Tisch gelegt hatte, und klemmte sie sich mit einer Miene unter den Arm, als wäre er bereit, sie unter Einsatz seines Lebens zu verteidigen.
Therese spürte den Grafen neben sie treten und sah kurz zu ihm auf. Sein Blick schien nun nicht mehr gelangweilt. Er wanderte von den beiden Männern zur Fürstin, vielleicht gespannt, wie sie mit dieser Situation umging.
»Wollten Sie das hier abgeben?« Die Hand fordernd nach der Mappe ausgestreckt trat die Fürstin einen Schritt vor. »Worum handelt es sich? Ich bin mir sicher, nichts geordert zu haben.«
»Es ist für seine Durchlaucht«, beeilte sich der Fremde zu versichern, der sich noch immer nicht vorgestellt hatte. »Persönlich. Gegen Bezahlung der in der Rechnung aufgeführten Gulden.«
»Der Fürst ist nicht im Haus.«
»Ja, das habe ich dem Herrn bereits gesagt, und daher wird er ein anderes Mal wiederkommen, wenn seine Durchlaucht zu Hause ist.«
Der Butler machte Anstalten, den Boten oder was immer er war aus dem Zimmer zu schieben.
»Lorenz, was soll das? Ich kann die Mappe für meinen Gatten entgegennehmen und die Rechnung bezahlen. Worum handelt es sich denn? Und was sind wir schuldig?«
Es war absurd und zugleich komisch, die bestürzten Gesichter der Männer zu sehen, die nun wie ertappte Schulbuben wirkten. Der Bote wich zur Tür zurück. Dabei fiel ein Blatt heraus und segelte zu Boden. Obwohl der Butler sich geradezu darauf stürzte, war die Fürstin schneller und riss es an sich.
»Es handelt sich um Drucke, farbige Drucke aus der Werkstadt von Peter Fendi? Mein Gatte hat sie bestellt? Oh, ich wusste nicht, dass er sich dieser Kunst zugetan fühlt. Mir haben Fendis Gemälde schon immer gut gefallen.
Lorenz, hol meine Geldbörse. Ich begleiche die Rechnung, dann muss er nicht noch einmal vorbeikommen. Und nun geben Sie mir die Zeichnungen.« Noch einmal streckte sie die Hand nach der Mappe aus.
Der Butler stieß einen erstickten Schrei aus. »Durchlaucht, bitte, tun Sie das nicht!«
Hinter sich hörte die Fürstin ein Geräusch, das ein unterdrücktes Lachen hätte sein können. Offensichtlich amüsierte sich Graf Báthory inzwischen prächtig.
Therese hatte das Gefühl, dass hier etwas vorging, von dem sie als Einzige ausgeschlossen blieb.
»Geben Sie mir diese Mappe!«, rief sie nun ernsthaft erzürnt, als sich eine kalte, weiße Hand auf die ihre legte. Überrascht sah sie zu Graf Báthory auf.
»Lassen Sie es gut sein, Durchlaucht, und glauben Sie mir, es ist besser, wenn der Herr die Bilder ihrem Gatten persönlich aushändigt und Sie den Vorfall einfach vergessen. Ja, das alles geht mich nichts an, und Sie finden meine Einmischung dreist und unverschämt. Ich sehe es in Ihrem Blick, dass Sie mir dies entgegenschleudern wollen. Dennoch bitte ich Sie, meinen Rat anzunehmen.«
Wenn es etwas gebraucht hatte, um ihren Entschluss zu festigen, dann war es diese ungebührliche Einmischung eines Fremden. Mit einem Ruck riss die Fürstin dem erschrockenen Boten die Mappe aus der Hand, legte sie auf den Tisch und klappte sie auf.
Die Spannung im Zimmer war spürbar wie das Kribbeln auf der Haut vor der Entladung eines Sommergewitters. Der Butler und der Bote zogen hörbar die Luft ein. Fürstin Kinsky sah auf die erste Zeichnung herab, hob das Blatt und betrachtete die nächste. Dann eine dritte. Ja, mit einem Mal konnte sie die seltsamen Reaktionen der Männer verstehen.
»Durchlaucht?« Der Butler unternahm einen halbherzigen Versuch, ihr die Mappe abzunehmen. Seine Stimme zitterte.
»Das ist … das ist …«, sagte die Fürstin und wandte sich dann den drei Männern zu, von denen zwei sie furchtsam anblickten, der dritte sie jedoch interessiert betrachtete.
»Das hat Peter Fendi gemalt?«, brach es ungläubig aus ihr hervor.
»Nein, ich glaube nicht«, gab Graf Báthory Auskunft. »Diese Zeichnungen stammen von einem in der Kunstwelt noch unbekannten Freund, der häufig in seinem Atelier anzutreffen ist.«
»Und Fendi lässt es zu, dass man dies seinem Namen zuschreibt?«, fragte die Fürstin empört.
Der Graf hob die Schultern. »Vielleicht ist es in beider Interesse?«
Therese wandte sich noch einmal den Zeichnungen zu, ließ sich auf einen Sessel sinken und blätterte sie eine nach der anderen durch. Als sie die letzte sinken ließ, fühlte sie, wie ihre Schultern zu beben begannen. Sie stützte die Ellenbogen auf das polierte Rosenholz und barg das Gesicht in den Händen.
»Durchlaucht!«, rief der Butler entsetzt. »Soll ich Ihnen etwas zu trinken bringen oder das Riechsalz?«
Fürstin Kinsky ließ die Hände sinken. »Etwas zu trinken ist immer gut«, stieß sie unter Kichern hervor. »Das Riechsalz allerdings wird nicht nötig sein.«
Dann konnte sie nicht mehr an sich halten. Sie warf den Kopf zurück und lachte schallend, dass ihr Tränen in die Augen traten. Ihr Butler erstarrte und riss die Augen auf. Er musste überzeugt sein, seine Herrin habe den Verstand verloren. Und auch der fremde Besucher schien einer Panik nahe. Nur András Petru Báthory betrachtete die Szene noch immer amüsiert.
Therese zog ein Spitzentuch aus ihrem Ärmel, tupfte sich die Augenwinkel und mühte sich, ihre Haltung zurückzugewinnen.
»Lorenz, bezahle den Boten aus meiner Börse und begleite ihn zur Tür.«
»Soll ich den Herrn Graf auch hinausbegleiten«, erkundigte sich der Butler steif.
Therese sah zu den nun vor Schalk blitzenden Augen auf und schüttelte den Kopf. »Nein, ich denke, Graf Báthory wird mir noch ein wenig Gesellschaft leisten. Du kannst Wein und Konfekt im Frühstückszimmer auftragen lassen.«
Für einen Augenblick sah es so aus, als wolle der Butler widersprechen, doch unter dem strengen Blick seiner Herrin erinnerte er sich daran, was ihm in seiner Stellung zustand. So verbeugte er sich knapp und führte den Mann hinaus.
Die Mappe unter dem Arm, ging die Fürstin voran ins Frühstückszimmer, wo sie all ihre Mahlzeiten einnahm, wenn ihr Gatte außer Haus weilte oder keine Gäste zum Diner geladen waren. Sorgsam breitete sie die Drucke auf dem Tisch aus und trat dann einen Schritt zurück. Die Hände in die Hüften gestützt, die Brauen ein wenig zusammengeschoben, betrachtete sie die Werke, die eines gemein hatten: Sie zeigten alle mehr oder minder bekleidete Paare – die entscheidenden Partien jedenfalls allesamt entblößt – in lustvoller Umarmung, wollte man es harmlos ausdrücken. In beginnendem Vollzug des geschlechtlichen Akts traf die Sache wohl genauer, wobei der Zeichner stets darauf geachtet hatte, die dazu notwendigen Körperteile mehr als deutlich darzustellen, auch wenn die Paare dadurch zuweilen eine seltsam verrenkt wirkende Körperhaltung einnahmen, was fast ein wenig grotesk wirkte.
Therese beugte sich über eines der Werke und schüttelte langsam den Kopf. Sie hatte wohl davon gehört, dass solche Bilder in Männerkreisen kursierten, hatte bisher jedoch keines davon zu Gesicht bekommen.
»Das ist typisch für die männliche Fantasie: Der Mann ist übertrieben großzügig von der Natur ausgestattet, und das Weib lächelt beglückt von seinen Gaben!«, sagte sie abfällig.
Vielleicht hatte sie die Anwesenheit des Grafen beim Anblick der Bilder vergessen, oder ihr war in diesem Augenblick nicht bewusst, dass sie ihre Gedanken laut aussprach. Erst sein verhaltenes Lachen hinter ihr machte ihr bewusst, was sie gesagt hatte. Erschrocken fuhr sie herum.
»Graf, vergessen Sie, was ich gesagt habe!«
»Warum, Durchlaucht? Es entspricht durchaus der Wahrheit, und was wahr ist, darf ausgesprochen werden, oder nicht? Zumindest in den eigenen Wänden, in denen man nicht Graf Sedlnitzky und seine Zensur fürchten muss.« András Petru lächelte liebenswürdig, doch Therese fühlte noch das Erschrecken der eigenen Unschicklichkeit. Wie konnte ihr so etwas passieren?
»Ich bitte Sie, ersparen Sie mir die Peinlichkeit, diese Worte vernommen zu haben. Ich muss völlig vergessen haben, was sich schickt. Ich bin untröstlich!«
András Petru hob abwehrend die Hände. »Halten Sie ein, Durchlaucht! Zerstören Sie mit Ihren Beteuerungen nicht den erfrischenden Eindruck, der Sie von all den Damen der Gesellschaft unterscheidet, die ich seit meiner Rückkehr nach Wien getroffen habe.«
Therese betrachtete ihn misstrauisch. Er schien dies durchaus ernst zu meinen. Hielt er sie für leichtfertig? Er sollte spüren, dass man sich an ihr leicht die Zähne ausbeißen konnte! Sie war keine der leichtlebigen Adelsdamen, die sich von einem amourösen Abenteuer in das nächste stürzten, eine Spur von Skandalen hinter sich herziehend.
»Sie verwechseln mich, Graf«, sagte sie daher steif. »Mein Name ist weder Gräfin Caroline Szécheni noch Gräfin Gabriele Saurau!«
»Ah, la beauté coquette und la beauté du diable «, rief er aus. »Die wahren Heldinnen des großen Wiener Kongresses. Lange ist es her, dass in Wien so schön gefeiert und leichtfertig verschwendet wurde. Doch Sie tun den Damen Unrecht, wenn Sie ihnen diese Namen vorwerfen, die die Herren ihnen in der berauschenden Laune der Feste zugedacht haben. Fürstin Auersperg war in diesem Jahr die Favoritin des Zaren – er hat sich sogar ihretwegen duelliert – und Gräfin Zichy, la beauté céleste, die Auserwählte des Preußenkönigs, aber ich versichere Ihnen, es fiel kein Schatten auf ihre Tugend!«
»Sie sagen das gerade so, als seien Sie dabei gewesen«, wehrte Fürstin Kinsky ab. »Wie alt sind Sie? Falls Sie während des Kongresses in Wien weilten, können Sie kaum mehr als ein Knabe gewesen sein.«