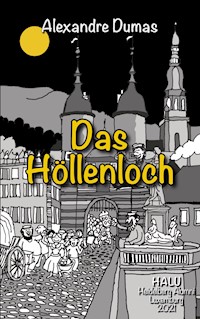
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Das Höllenloch" ist der erste Band eines zweiteiligen Romans von Alexandre DUMAS, dem Älteren, der in den Jahren 1850 und 1851, mit dem Titel "Dieu dispose" (Gott lenkt), zum ersten Mal als Feuilleton-Roman in der Zeitschrift "L'Événement" erschienen ist. Der Roman erzählt die äußerst düstere Geschichte zweier ungleicher Brüder in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, zur Zeit der deutschen Befreiungskriege. Der vorliegende erste Band spielt integral in Heidelberg und Umgebung. Die Geschichte erfährt gegen Ende des Bandes ein tragisches, wenn auch provisorisches Ende. Im zweiten Band wird sie, fünfzehn Jahre später, in Paris wieder aufgenommen und dort auch zu Ende geführt. Über die eigentliche Intrige hinaus, interessiert im ersten Band besonders Dumas' Beschreibung der Sitten und Gebräuche an der Universität, die er schon in seinen Reiseberichten beschrieben hatte und die er hier voll in den Erzählstrang mit einfließen lässt. Mit der vorliegenden Übersetzung möchten die Herausgeber besonders diesen Aspekt des wenig bekannten Romans, nicht ohne ein gewisses Augenzwinkern, in Erinnerung rufen. Aus diesem Grunde findet der Leser im Anhang zusätzlich zum Roman, die Übersetzung jener Teile aus den Reise-Impressionen Dumas', die das studentische Leben in Heidelberg betreffen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort
TEILI DAS HÖLLENLOCH
1 Ein Lied im Gewitter
2 Was da erschienen war
3 Morgen im Mai - Tag der Jugend
4 Fünf Stunden in fünf Minuten
5 Blumen und Pflanzen misstrauen Samuel
6 Vom Vergnügen zum Getöse, die sich, für manche, widerstreiten
7 Fuchscommerz
8 Wo Samuel fast erstaunte
9 Wo Samuel fast gerührt ist
10 Das Spiel von Leben und Tod
11 Credo in Hominem ...
12 Der Leibfuchs
13 Lolotte
14 Duell mit Wein
15 Triumph eines Tropfens über acht Eimer Wasser
16 Duell zu viert
17 Engelsgebet, Feen-Glücksbringer
18 Zwei Arten, die Liebe zu betrachten
19 Die Nonne der Wälder
20 Das Höllenloch
21 Die gelehrten Blumen
22 Drei Wunden
23 Beginn der Feindseligkeiten
24 Der Tugendbund
25 Überraschungssieg
TEIL II DAS DOPPELTE SCHLOSS
26 Improvisation in Stein
27 Für wen das Schloss gebaut wurde
28 Gegen wen das Schloss gebaut wurde
29 Der Feind vor Ort
30 Samuel als Arzt
31 Wer dieses Schloss gebaut hat
32 Beleidigung der Pflanzen und des Kindes
33 Die Frage ist gestellt
34 Zwei Versprechen
35 Das doppelte Schloss
36 Die Höhle des Löwen
37 Der Liebestrank
38 Trichters Herz- und Geldleiden
39 Was konnte er schon gegen drei ausrichten!
40 Der Verruf
41 Die Vorsicht der Schlange und die Kraft des Löwen
42 Fluch und Umzug
43 Mysterium einer Nacht und einer Seele
44 Mit dem Verbrechen darf man nicht spielen.
45 Christiane hat Angst
46 Gaudeamus igitur
47 Der Bürgermeister Pfaffendorf
48 Punsch im Wald
49 Programme, die nicht lügen
50 Wo Trichter und Fresswanst den Höhepunkt erreichen
51 Ein Feuerwerk in mehrerer Hinsicht
52 Generalprobe
53 Die Räuber
54 Manchmal fehlt es der Tugend an Geschick
55 Wo die Fatalität ihren Lauf nimmt
56 Alles hat seinen Preis
57 Frau und Mutter
58 Die Nacht des Abschieds
59 Klingelzeichen
60 Das Schicksal hilft Samuel
61 Der Krupp
62 Die Versuchung der Mutter
63 Die andere Hälfte des Unglücks
64 Die Frage
65 Napoleon und Deutschland
66 Samuel will Josua nachahmen80
67 Die Zange des Schmerzes
68 Trichter trunken vor Angst
69 Das Gift
70 Wo Samuel erblasst
71 Selbstmord und Neugeburt
72 Die Straße nach Paris
73 Das Höllenloch
ANHANG
Anmerkungen
Sitten und Gebräuche deutscher Studenten
Die Universitäten Deutschlands
Reisen an die Ufer des Rheins
Vorwort
Dieses Buch ist die deutsche Übersetzung des ersten Bandes eines wenig bekannten Romans von Alexandre Dumas. Der Roman wurde ursprünglich in der Zeitschrift l’Événement, in Form eines vierteiligen Feuilleton-Romans mit dem Titel Dieu dispose abgedruckt.1 Der erste Teil, mit Namen Prologue, Le Trou de l’Enfer, erschien in der Ausgabe vom 28. Juni 1850. Ein Jahr später, nach insgesamt 137 Kapiteln, wurde der Roman in der Ausgabe vom 16. Juni 1851 abgeschlossen. Schon im Dezember 1850 wurden die ersten beiden Teile des Romans in Buchform veröffentlicht und mit dem Titel Le Trou de l’Enfer (»Das Höllenloch«) in der Bibliographie de France eingetragen. Die beiden letzten Teile folgten im Januar 1851 in einem zweiten Band mit dem Titel Dieu dispose (»Gott lenkt«). Diese Vorgehensweise bewirkte, dass ein an sich zusammenhängender Roman plötzlich zwei verschiedene Titel trug, eine Untugend, die auch in den folgenden Jahren immer wieder wiederholt wurde und für Verwirrung sorgte. Allerdings unterscheiden sich die zwei Bände sowohl örtlich als auch zeitlich voneinander. So spielt Band I in den Jahren 1810-1811 in Heidelberg und Umgebung und schließt ab mit einem tragischen, aber offenen und provisorischen Ende der Erzählung. Band II nimmt die Erzählung im Paris der 1830er Jahre wieder auf und führt sie zu Ende. Thematisch stehen im ersten Band die Intrigen des Hauptprotagonisten Samuel Gelb, unter Einbezug der Heidelberger Studentenschaft im Vordergrund, während im zweiten Band die deutschen Freiheitskämpfe und die 1829er Revolte gegen Karl X eine größere Rolle spielen.
Die Idee, den Roman vom Französischen ins Deutsche zu übersetzen, kam uns, Anfang 2021, anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Heidelberg Alumni International. Wie schon vermerkt, spielt der erste Band in Heidelberg und Umgebung. Die Universität, mit ihren Studenten, ihren Sitten und Gebräuchen am Anfang des 19. Jahrhunderts, nimmt eine große Rolle ein. Dazu der historische Kontext, mit den deutschen Freiheitsbewegungen gegen Napoleon, sowie die literarische Einbettung der Erzählung in die deutsche Romantik, alles Gründe, die uns das Buch für eine Übersetzung ins Deutsche interessant erscheinen ließen. Soweit wir feststellen konnten, gab es zu diesem Zeitpunkt keine deutsche Ausgabe auf dem Markt. Nachdem wir unsere Rohübersetzung schon zu Ende gebracht hatten, stießen wir allerdings auf eine integrale deutsche Übersetzung des Romans aus dem Jahre 1850, mit dem Titel »Gott lenkt«2. Der deutsche Übersetzer, W. L. Wesché, lebte seit 1842 in Paris, kannte Dumas und hat viele seiner Werke ins Deutsche übersetzt. Seine Übersetzung ist insofern von besonderem Interesse, als sie fast zeitgleich mit der Erscheinung des Originals veröffentlicht wurde und, anders als das französische Original, in einem einzigen Buch zusammengefasst wurde.
Für die vorliegende Veröffentlichung haben wir uns, wie seinerzeit bei der Erstveröffentlichung in Buchform, für eine Herausgabe in zwei Bänden entschieden. Dieser erste Band beschränkt sich demnach auf die ersten beiden Teile des Romans, Le Trou de l’Enfer (»Das Höllenloch«) und Le Château double (»Das doppelte Schloss«). Wie auch bei anderen Veröffentlichungen gibt das erste Kapitel dem Band den Namen: »Das Höllenloch«.
Für die Übersetzung benutzten wir den Original-Text der o. g. Feuilleton-Ausgabe sowie verschiedene elektronische Versionen des französischen Originaltextes, die, frei zugänglich, im Internet3 zur Verfügung gestellt werden. Daneben nutzten wir eine, 2008 bei Phébus erschienene, von Claude Schopp4 sachkundig zusammengestellte und mit zahlreichen Fußnoten und Kommentaren versehene Druckversion.
Für die Illustrationen ließen wir uns von den sehr schönen Zeichnungen von J. A. Beaucé und Lancelot, in einer Version des Romans aus dem Jahre 1860, inspirieren.5
1 Ausgaben der Zeitschrift vom 28. Juni 1850 bis 16. Juni 1951 (Cf. https://www.retronews.fr/titre-de-presse/evenement-1848-1851)
2 Leipzig, 1850/1851, Verlag Christian Ernst Kollmann, Wien, bei Wittenecher, Sigel und Kollmann.Vgl Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Ludwig_Wesché
3 z. Bsp.: https://www.dumaspere.com, https://www.ebooksgratuits.com/
4 Dumas, Alexandre, Le Trou de l’Enfer, Dieu dispose, Hrsg. Schopp, Claude, Phébus libretto, 2008
5 Dumas, Alexandre, Le trou de l’enfer, publiziert von Dufour et Mulat, Lécrivain et Toubon, Librairies, 1860 (digitized by Google)
TEIL I
DAS HÖLLENLOCH
1 Ein Lied im Gewitter
Wer waren die beiden Reiter, verirrt zwischen den Schluchten und Felsen des Odenwalds, während der Nacht vom 10. Mai 1810, ihre besten Freunde hätten sie aus vier Fuß Entfernung nicht erkannt, so schwarz war die Nacht. Vergebens hätte man am Himmel einen Mondstrahl, das Flimmern der Sterne gesucht: Der Himmel war finsterer als die Erde, und die schweren Wolken, die vorbeizogen, sahen aus wie ein umgestürzter Ozean, der die Welt mit einer neuen Sintflut bedrohte.
Eine verschwommene Masse, die sich an dunklen Hängen entlang bewegte, das war alles, was selbst das geübteste Auge in der Dunkelheit von den beiden Reitern hätte erkennen können. Zuweilen ein ängstliches Wiehern, übertönt vom Pfeifen des Sturms in den Tannen, ein paar Funken von den Hufeisen der stolpernden Pferde, das war alles, was man von den beiden Weggefährten sehen und hören konnte.
Das Gewitter kam immer näher. Große Staubwolken blendeten die Reisenden und ihre Reittiere. Im Herzen des Orkans bogen sich knarrend die Äste; klagendes Geheul jagte durch das Tal, schien dann, von Fels zu Fels springend, den wankenden, wie vor dem Zusammenbruch stehenden Berg hochsteigen zu wollen; – und jedes Mal, wenn sich eine solche Wasserhose von der Erde zum Himmel erhob, sprangen die Felsen aus ihrem steinernen Bett und polterten mit Krach in die Tiefe und die uralten Bäume, entwurzelt, lösten sich von ihrem Grund und stürzten sich, verzweifelten Tauchern gleich, kopfüber in den Abgrund.
Nichts ist schrecklicher als die Zerstörung in der Dunkelheit, nichts ist erschreckender als ein Geräusch im Schatten. Wenn das Auge die Gefahr nicht einschätzen kann, wächst die Gefahr ins Unendliche und die entsetzte Einbildung sprengt alle Grenzen des Möglichen.
Plötzlich legte sich der Wind, das Getöse verstummte, alles blieb still, nichts bewegte sich; die Natur hielt die Luft an und wartete auf einen Neuausbruch des Gewitters.
In dieser Stille hörte man die Stimme eines der beiden Reiter:
»Um Gottes Willen, Samuel, welch unglückliche Idee, Erbach zu dieser Stunde und bei diesem Wetter zu verlassen. Wir logierten in einem wunderbaren Gasthaus, dem besten, das wir seit unserer Abreise von Frankfurt vor acht Tagen hatten. Du hast die Wahl zwischen deinem Bett und dem Sturm, zwischen einer ausgezeichneten Flasche Hochheim und einem Wind, gegen den der Scirocco und der Mistral milde Lüftchen sind, und du wählst den Sturm und den Wind!« … »Hoo! Sturm!«, unterbrach sich der junge Mann, um sein Pferd im Zaum zu halten, »Hoo!«, und fuhr fort, »Wenn wir wenigstens zu einem charmanten Rendezvous unterwegs wären, wo wir gleichzeitig die Morgenröte und das holde Lächeln einer Geliebten antreffen würden! Aber die Geliebte, die wir antreffen werden, ist eine alte Schachtel, die man die Universität Heidelberg nennt. Das Rendezvous, das uns erwartet, ist wahrscheinlich ein Duell auf Leben und Tod. Auf jeden Fall sind wir erst für den 20. vorgeladen. Oh! Je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr finde ich, dass wir total verrückt sind, nicht dageblieben zu sein, trocken und geschützt. Aber so bin ich; ich gebe dir immer nach; du gehst voraus und ich laufe dir hinterher!«
»Nun beschwere dich auch noch, dass du mir folgst!«, antwortete Samuel mit einem leicht ironischen Unterton, »Wo ich es doch bin, der dir den Weg zeigt. Wäre ich nicht vor dir her geritten, du hättest dir schon zehn Mal das Genick gebrochen beim Sturz den Berg hinunter. Nun stemme dich in deine Steigbügel, da versperrt eine Tanne den Weg!«
Es war eine Weile ruhig und man hörte, wie beide Pferde nacheinander über den Baum sprangen.
»Hoo«, sagte Samuel und drehte sich um zu seinem Freund.
»Siehst du, mein armer Julius!«, sagte er.
»Siehst du!«, sagte Julius. »Ich beschwere mich weiterhin über deine Starrköpfigkeit, und ich habe recht: anstatt den Weg zu nehmen, den man uns angibt, nämlich dem Flüsschen Mümling zu folgen, welches uns geradewegs zum Neckar geführt hätte1, nimmst du eine Abkürzung, die du zu kennen vorgibst, obwohl ich mir sicher bin, dass du niemals in dieser Gegend gewesen bist. Ich wollte einen Führer nehmen.« »Ein Führer! Wofür? Ich kenne den Weg!« »Ja, du kennst ihn so gut, dass wir uns jetzt im Gebirge verloren haben, wir wissen weder wo der Norden noch der Süden ist, wir kommen weder vor- noch rückwärts. Und jetzt müssen wir uns bis zum Morgen auf Regen gefasst machen, und welchen Regen! … Hier fallen schon die ersten Tropfen … Nun lach, du, der über alles lacht, wie du wenigstens immer behauptest.«
»Und weshalb sollte ich nicht lachen?« sagte Samuel. »Ist es nicht lachhaft, einen großen Jungen von zwanzig Jahren zu hören, Student in Heidelberg, der sich beschwert wie eine Hirtin, die ihre Herde nicht rechtzeitig im Stall hat? Lachen! Welch großer Verdienst läge darin! Ich kann etwas Besseres, lieber Julius, ich werde singen.«
Und in der Tat begann der junge Mann mit einer rauen und vibrierenden Stimme die erste Strophe eines bizarren, uns unbekannten Liedes zu singen, das wohl improvisiert war, der Situation aber wenigstens Rechnung trug.
»Ach, der Regen schert mich nicht! Himmels Schnupfen bloß, nicht mehr Gegen bitt’res Tränenmeer Wenn das Herz an Schwermut bricht.«2
Kaum waren das letzte Wort und die letzte Note von Samuels Lied verklungen, als ein gewaltiger Blitz die Wolkendecke, mit der das Gewitter den Himmel überzog, vom einen zum anderen Ende des Horizonts aufriss und die beiden Reiter mit einem grellen und unheimlichen Licht anstrahlte.
Beide schienen gleich alt, so zwischen neunzehn und einundzwanzig Jahren, darauf beschränkte sich ihre Ähnlichkeit.
Der eine, wahrscheinlich Julius, elegant, blond, blass, mit blauen Augen war mittelgroß, aber wohlproportioniert. Man hätte ihn für den jungen Faust3 halten können.
Der andere, wahrscheinlich Samuel, groß und schlank, mit seinen grauen Augen, seinem schmalen spöttelnden Mund, seinen schwarzen Augenbrauen und Haaren, seiner hohen Stirn und seiner hervorstehenden und spitzen Nase schien wie das lebende Abbild von Mephisto.
Beide trugen einen kurzen, dunklen Gehrock, der an der Hüfte mit einem Lederriemen zugeschnürt war. Außerdem bestand ihre Kleidung aus Strumpfhosen, weichen Stiefeln und einer weißen Kappe mit einem Kettchen.
Aus den paar Worten von Julius ging hervor, dass sie beide Studenten waren.
Überrascht und geblendet vom Blitz, zuckte Julius zusammen und schloss die Augen. Samuel hingegen hob den Kopf und kreuzte einen ruhigen Blick mit dem Blitz.
Dann wurde es wieder stockdunkel.
Der Blitz war kaum erloschen, als ein kräftiger Donnerschlag ertönte und in fortlaufenden Echos bis tief in den Berg zu vernehmen war.
»Mein lieber Samuel«, sagte Julius, »ich glaube es wäre besser, wenn wir jetzt hier Halt machten. Wir könnten den Blitz anziehen.«
Aber Samuel lachte nur und gab seinem Pferd die Sporen, das in einer Wolke von Funken und Steinsplitter galoppierend davonstob, während der Reiter sang:
»Ach was mich der Blitz auch schert! Streichholzfeuer der Chemie, Bist, bizarrer Zickzack, nie Düst’ren Blickes Feuer wert?«
Er legte so ein paar hundert Schritte zurück, schwenkte dann abrupt um und galoppierte auf Julius zu.
»Um Gottes willen!« schrie dieser, »bleib doch ruhig Samuel, was soll dieses Husarenstück? Ist das jetzt der Moment zum Singen? Pass auf, dass Gott deine Herausforderung nicht annimmt!«
Ein zweiter Donnerschlag, schrecklicher und lauter noch als der erste, ertönte über ihren Köpfen.
»Dritte Strophe!« sagte Samuel. »Ich bin ein privilegierter Jäger: der Himmel begleitet mein Lied und der Donner singt den Refrain.«
Und, nachdem der Donner lauter gegrollt hatte, sang Samuel umso lauter:
»Auch du Donner scherst mich nicht! Sommers Husten auf Gedeih, Was bist du gegen den Schrei Einer Liebe die zerbricht?«
Da der Donner aber diesmal Verspätung hatte, rief er, zum Himmel emporschauend:
»Aber, aber! Wo bleibt der Refrain! Donner, du hast den Einsatz verfehlt!«
Aber statt des Donners war es der Regen, der Samuels Aufforderung nachkam und begann sich in Strömen zu ergießen. Bald mussten Donner und Blitz nicht mehr provoziert werden und sie folgten aufeinander, ohne Unterbrechung. Julius empfand jenes Unbehagen, gegen das auch der Tapferste sich nicht wehren kann, wenn er der Allmacht der Elemente ausgesetzt ist: die Hilflosigkeit des Menschen gegenüber dem Zorn der Natur gab ihm ein flaues Gefühl im Magen. Samuel hingegen strahlte. Eine wilde Freude leuchtete in seinen Augen; er stellte sich in die Steigbügel, schwenkte seine Mütze, als ob er die Gefahr vor ihm flüchten sähe und sie zurückrufen wollte; froh zu spüren, wie die nassen Haare ihm ins Gesicht schlugen, lachend, singend, glücklich.
»Was sagtest du vorhin, Julius?«, fragte er übertrieben freundlich. »Du wolltest in Erbach bleiben? Du wolltest diese Nacht verpassen? Spürst du denn nicht die wilde Lust, im strömenden Regen zu galoppieren, mein Lieber? Gerade weil ich dieses Wetter erhoffte, habe ich dich mitgenommen. Ich war den ganzen Tag mit den Nerven am Ende, aber das hier hat mich beseelt. Es lebe der Orkan! Wieso zum Teufel spürst du nicht dieses Fest! Passt dieses Gewitter nicht fantastisch zu den Gipfeln und Abgründen hier, zu diesen Trümmern und Ruinen? Bist du 80 Jahre alt, dass du alles reglos und leblos habenwillst wie dein Herz? Auch du hast deine Leidenschaften, so beherrscht du auch bist. Also lass den Elemente die ihren! Ich bin jung; mein zwanzigstes Lebensjahr singt tief in meinem Herzen, eine Flasche Wein brodelt in meinem Hirn, und ich liebe den Donner. König Lear nannte den Sturmseine Tochter4, ich nenne ihn meine Schwester. Bange nicht um uns, Julius, ich lache nicht über den Blitz, ich lache mit dem Blitz. Ich verachte ihn nicht, ich liebe ihn. Das Gewitter und ich sind zwei Freunde. Es würde mir kein Leid antun, ich bin seinesgleichen. Die Menschen glauben, es sei bösartig, aber sie sind naiv! Gewitter sind notwendig. Dies ist der Moment, ein bisschen Wissenschaft zu betreiben. Diese gewaltige elektrische Kraft, die grollt und blitzt, tötet und zerstört hier und dort, nur um das gesamte pflanzliche und tierische Leben zu vermehren. Ich bin ein Gewitter-Mensch. Jetzt ist der Moment gekommen, ein bisschen zu philosophieren. Ich selbst würde zweifellos das Böse benutzen, um zum Guten zu gelangen5, den Tod benutzen, um Leben zu schaffen. Es kommt nur darauf an, dass ein höherer Zweck diese extremen Taten beseelt und das tödliche Mittel mit dem Nutzen des Resultats rechtfertigt.«
»Sei still, Samuel, du verleumdest dich!«
»Du sagst Samuel, als ob du sagtest: Samiel! Abergläubisches Kind! Da wir in der Kulisse des Freischütz6 reiten, stellst du dir vor, ich sei der Teufel, Satan, Beelzebub oder Mephistopheles, und dass ich mich in eine schwarze Katze oder einen Pudel verwandeln würde? Oh, Oh? Was ist denn das hier!?«
Dieser Aufschrei entfuhr Samuel, nachdem sein Pferd plötzlich gescheut und sich erschrocken auf das von Julius zurückgeworfen hatte.
Der Weg barg eine Gefahr, ohne Zweifel. Der junge Mann beugte sich zu der Seite, wo die Gefahr zu vermuten war, und wartete auf einen Blitz. Er brauchte nicht lange zu warten. Der Himmel brach auf, ein Feuerstrahl zog quer über den Himmel und beleuchtete die Gegend.
Die Straße war von einer tiefen Kluft gespalten, der Blitz schlug in die Wände einer Schlucht und erlosch, bevor die beiden jungen Leute die Tiefe erahnen konnten.
»Das ist aber ein großartiges Loch!« meinte Samuel und lenkte sein Pferd näher an den Abgrund heran.
»Pass doch auf!« schrie Julius.
»Mein Gott, ich muss mir das aus der Nähe ansehen!« entgegnete Samuel.
Er stieg vom Pferd, warf Julius den Zaum zu, näherte sich neugierig dem Abgrund und beugte sich hinüber.
Sein Blick konnte die Dunkelheit aber nicht durchdringen, also stieß er ein Stück Granit den Abgrund hinunter.
Er horchte, hörte aber nichts.
»Gut!«, sagte er, »mein Stein ist wohl auf weichen Grund gefallen, denn er hat nicht das leiseste Geräusch gemacht.«
Kaum hatte er das gesagt, als ein lautes Geklapper in der dunklen Tiefe ertönte.
»Ah! Der Abgrund ist tief«, sagte Samuel. »Wer zum Teufel kann mir sagen, wie man dieses Loch nennt?«
»Das Höllenloch!«, antwortete von der anderen Seite des Abgrunds eine klare und ernste Stimme.
»Wer antwortet mir da«, rief Samuel, erstaunt und sogar ein wenig erschreckt, »ich sehe niemanden!«
Ein neuer Blitz erleuchtete den Himmel und auf dem Weg gegenüber der Spalte erblickten die beiden jungen Leute eine seltsame Erscheinung.
2
Was da erschienen war
Ein junges Mädchen, aufrecht stehend, mit zerzaustem Haar, die Beine und Arme nackt, um ihr Haupt eine schwarze, vom Wind aufgeblähte Haube, mit kurzem rötlichem Rock, der im Schein des Blitzes hellrot aufleuchtete, von einer seltsamen und wilden Schönheit, an ihrer Seite ein gehörntes Tier, das sie an einer Leine führte.
Daswar die Vision, die den beiden jungen Männern am anderen Rand des Höllenlochs erschienen war.
Der Blitz erlosch und damit auch die Erscheinung.
»Hast du gesehen, Samuel?«, fragte Julius, etwas verunsichert.
»Zum Teufel! Gesehen und gehört.«
»Weißt du, wenn es intelligenten Menschen erlaubt wäre, an Hexen zu glauben, könnten wir ohne Weiteres denken, gerade eine gesehen zu haben?«
»Aber das ist eine Hexe«, rief Samuel, »das möchte ich doch hoffen! Du hast gesehen, dass da nichts fehlt, nicht einmal der Ziegenbock! Auf jeden Fall ist sie hübsch: He! Kleine!«, rief er nochmal.
Und er horchte, wie er es getan hatte, als er den Stein in den Abgrund rollen ließ. Aber auch jetzt erhielt er keine Antwort.
»Beim Höllenloch!«, sagte Samuel, »das kann mir niemand falschmachen.«
Er zügelte sein Pferd, schwang sich in den Sattel und umrundete, ohne auf Julius’ Warnungen zu hören, in einem Satz galoppierend den Abgrund. Augenblicklich war er an der Stelle, wo das Mädchen erschienen war; doch mochte er noch so viel suchen, er konntenichts mehr erblicken: weder das Mädchen noch das Tier, weder die Hexe noch den Ziegenbock.
Samuel war keiner, der sich so schnell zufrieden gab: er inspizierte den Abhang, durchforschte Gebüsch und Dornengestrüpp, erkundete seinen Weg, hin und zurück. Aber schließlich, nachdem Julius ihn gebeten hatte, seine vergeblichen Durchsuchungen aufzugeben, schloss er sich wieder seinem Kameraden an, mürrisch und unzufrieden: er war einer jener Geister, die gewöhnlich jeden Weg bis ans Ende, jeder Sache auf den Grund gehen, und bei denen der Zweifel nicht Träumereien, sondern Ärger hervorrief.
Sie machten sich wieder auf den Weg.
Die Blitze zeigten ihnen den Weg und boten ihnen ein wunderbares Spektakel. Immer wieder erglühte der Wald, oben auf dem Berg und tief unten im Tal, in purpurroter Farbe, und der Fluss zu ihren Füßen erschien kalt wie Stahl.
Julius hatte seit einer Viertelstunde nicht mehr gesprochen, und Samuel lästerte ganz allein gegen die letzten abklingenden Donnerschläge, als Julius plötzlich sein Pferd anhielt und ausrief:
»Ha! Hier kommt was für uns.«
Und er zeigte Samuel eine heruntergekommene Burg, die sich zu ihrer Rechten erhob.
»Diese Ruine?«, fragte Samuel.
»Ja, dort wird es doch wohl eine Ecke geben, in der wir Schutz finden können. Wo wir das Ende des Unwetters oder zumindest des starken Regens abwarten können.«
»Ja, und unsere Kleider werden uns auf dem Rücken trocknen, und wir werden uns eine gehörige Lungenentzündung einhandeln, indem wir nass und untätig abwarten! Aber egal! Schauen wir, was diese Burg uns zu bieten hat.«
Mit wenigen Schritten waren sie am Fuß der Ruine; jedoch war es nicht so leicht hineinzugelangen. Die verlassene Burg war von Gestrüpp überwuchert. Der Eingang war versperrt mit Pflanzen und Gesträuchen, wie man sie oft an zerfallenem Gemäuer findet. Samuel trieb sein Pferd durch das Dickicht, wobei das arme Tier nicht nur die Sporen, sondern auch noch die Stiche der Dornen zu spüren bekam.
Julius’ Pferd trabte hinterher, und so befanden sich beide Freunde schließlich im Innern des Schlosses, sofern man bei zusammengestürzten, nach allen Seiten offenen Trümmern überhaupt noch von Schloss und Innerem reden konnte.
»Oh! Oh! um uns zu schützen, führst du uns her?«, sagte Samuel und schaute sich um, »mir scheint, dazu bräuchte es zumindest ein Dach oder eine Decke: leider gibt es hier aber weder Dach noch Decke.«
In der Tat war aus diesem ehemals vielleicht mächtigen und glorreichen Schloss mit der Zeit ein erbärmliches Skelett geworden; von den vier Wänden waren nur noch drei übrig, allerdings von übergroßen Fensterlöchern durchbrochen; die vierte war bis zum letzten Stein zusammengefallen.
Die Pferde stolperten bei jedem Tritt;Wurzeln drückten die Steinplatten hoch und schossen an mehreren Stellen durch die Spalten, als ob es die dreihundert Jahre lang vergrabene Vegetation über die Zeit hinweg geschafft hätte, mit ihren hartnäckigen und knotigen Fingern die steinerne Decke ihres Kerkers zu durchbohren.
Die drei Mauern neigten und hoben sich unter den heftigen Windstößen. Alle Arten von Nachtvögeln tummelten sich in dieser offenen Halle und hießen jeden Atemzug des Orkans und jedes Donnerrollen willkommen, mit furchtbarem Gejohle, aus dem das Gekreische des Adlers, dessen Schrei der Stimme eines Menschen, den man gerade umbringt, ähnelt, hervorstach.
Samuel beobachtete alles mit dieser seiner eigenen Art zu beobachten.
»Also gut! Wenn es dir beliebt, hier bis zum Morgen zu warten, soll es auch mir recht sein. Wir sind hier wunderbar aufgehoben, fast so wie unter freiem Himmel, und wir haben darüber hinaus den Vorteil, dass der Wind hier weit zorniger tobt. Genauer gesagt, wir befinden uns hier im Trichter des Sturms. Und Mist, diese Raben und diese Fledermäuse sind als Zutaten wahrlich nicht zu verschmähen. Diese Unterkunft gefälltmir. He! Schau mal! diese Eule, der Vogel des Philosophen, die ihre scharfen Augen auf uns richtet, ist sie nicht die anmutigste der Welt. Außerdem werden wir uns brüsten können, durch einen Speisesaal galoppiert zu sein.«
Und indem er dies sagte, gab Samuel seinem Pferd die Sporen und warf es in Richtung der fehlenden Wand; aber kaum hatte es zehn Tritte getan, als das Pferd so heftig aufbäumte und sich um sich selbst drehte, dass es den Kopf voll ins Samuels’ Gesicht rammte.
Im selben Moment erschallte eine Stimme:
»Halt! Der Neckar!«
Samuel neigte den Kopf.
Er hing fünfzig Meter über dem gähnenden Abgrund. Bei der Wendung hatten die beiden Vorderhufe des Pferdes einen Halbkreis ins Leere gezogen.
Der Berg sank an dieser Stelle abrupt in die Tiefe; die Burg war über dem Abgrund errichtet worden, was ein Teil der Stärke ihrer Position ausmachte. Ein Blattwerk von Kletterpflanzen verlief, wie eine am rauen Granit befestigte Girlande, so dass es aussah, als ob die alte, über Jahrhunderte entwurzelte und dem Abgrund, in den sie zu fallen drohte, zugeneigte Burg nur noch von einer dünnen Schlinge aus Efeu zurückgehalten werde. Ein Schritt weiter und es war der Tod des Reiters und des Pferdes.
Deshalb zuckte das Pferd bei hochgestellter Mähne, dampfenden Nüstern und schäumendem Maul mit allen Muskeln zusammen, zitterte an allen Gliedern.
Aber Samuel, ruhig oder eher skeptisch wie gewohnt, fühlte sich von der Gefahr, die er gerade gelaufen war, zu bloß einer Überlegung inspiriert:
»Nanu! Die gleiche Stimme!«, sagte er.
In der Stimme, die gerufen hatte: »Halt!« hatte Samuel die Stimme des jungen Mädchens, das ihm schon den Höllenschlund benannt hatte, wiedererkannt.
»O!«, rief Samuel aus, »dieses Mal werde ich dich erwischen, selbst wenn du das bist, was ich dich beschuldige zu sein, nämlich eine Hexe dritten Grades.«
Und er warf sein Pferd herum in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war.
Aber auch diesmal konnte er niemanden erblicken, so viel er auch suchte, und der Blitz ihm leuchtete.
»Komm, komm Samuel!«, sagte Julius, der jetzt nichts dagegen hatte, aus diesen Ruinen voller Gekrächze, Fallen und Abgründe zu verschwinden; »Komm, lass uns weiterziehen! Haben sowieso schon genug Zeit verloren!«
Samuel folgte ihm, sich umschauend mit einer Enttäuschung, die die Dunkelheit ihm ermöglichte zu verbergen.
Sie fanden auf ihren Weg zurück und ritten weiter: Julius, ernst und schweigsam; Samuel, lachend und fluchend wie einer von Schillers Räubern7.
Eine Entdeckung machte Julius wieder Hoffnung. Beim Verlassen der Burg entdeckte er einen Pfad, der, wenn auch schon ziemlich abgenutzt, in eher leichtem Gefälle zum Fluss hinabführte. Ohne Zweifel führte dieser begehbare und, wie es schien, auch benutzte Pfad zu einem Dorf oder zumindest einer Wohnsiedlung.
Aber auch eine halbe Stunde später noch war ihre einzige Begegnung der Fluss, an dessen steilem Ufer sie entlang ritten, seinem tosenden Lauf aufwärts folgend. Nicht die Spur irgendeiner Unterkunft.
Während all dieser Zeit fiel der Regen mit gleicher Heftigkeit. Die Kleider der beiden Reiter waren durchnässt; die Pferde waren erschöpft von der Anstrengung. Julius konnte nicht mehr weiter; sogar Samuel verlor langsam an Frische.
»Zum Teufel!«, rief er aus, »es fängt an langweilig zu werden, seit mehr als zehn Minuten haben wir weder Blitz noch Donner gehabt. Dies ist bloß noch ein purer Regenschauer. Das ist wahrlich ein schlechter Scherz des Himmels. Ich akzeptiere gerne eine große Aufregung, aber nicht diese lächerlich kleine Unannehmlichkeit. Der Orkan verspottet mich auf seine Weise: ich fordere ihn heraus mich mit seinem Blitz zu erschlagen, er verpasst mir bloß einen Schnupfen.«
Julius antwortete nicht.
»Pass auf!«, sagte Samuel, »ich will es mit einer Beschwörung versuchen.«
Und mit lauter und feierlicher Stimme fügte er hinzu:
»Im Namen des Höllenlochs, aus dem wir dich kommen sahen! Im Namen des Ziegenbocks, deines besten Freundes! Im Namen der vielen Raben, Fledermäuse und Eulen, die uns seit unserer glücklichen Begegnung mit dir begleitet haben! Liebe Hexe, die du schon zweimal mit mir geredet hast, ich flehe dich an! Im Namen des Höllenlochs, des Ziegenbocks, der Raben, der Fledermäuse und der Eulen, Erscheine! Erscheine! Erscheine! und sage uns, ob wir uns in der Nähe einer menschlichen Behausung befinden.«
»Wenn Sie sich verirrt hätten«, ertönte aus dem Schatten heraus die klare Stimme des jungen Mädchens, »hätte ich Sie gewarnt. Sie sind auf dem richtigen Weg; folgen Sie ihm noch weitere zehn Minuten und Sie werden zu Ihrer Rechten, hinter einem Lindenhain, auf ein gastfreundliches Haus stoßen. Auf Wiedersehen!«
Samuel hob den Kopf in Richtung der Stimme und erblickte eine Art Schatten, der zehn Fuß über seinem Kopf entlang der Bergwand zu schweben schien.
Er spürte instinktiv, dass das Mädchen gleich verschwinden würde.
»Halt!«, rief Samuel, »ich habe noch eine Frage an dich.«
»Welche?«, fragte es und blieb am Ende eines Felsens, dessen Spitze zu schmal schien, als dass selbst der Fuß einer Hexe dort hätte Halt finden können, stehen.
Er schaute sich um, wie er zu ihr hochsteigen könnte; aber der Pfad, auf dem die beiden Reiter sich bewegten, war in den Felsen geschlagen. Es war ein Weg für Menschen; die Hexe aber wandelte auf einem Ziegenpfad.
Nachdem er festgestellt hatte, dass er das hübsche Mädchen nicht auf Pferdefüßen erreichen konnte, wollte er es zumindest mit der Stimme versuchen.
Zu seinem Freund gewendet meinte er:
»Na gut! mein lieber Julius, ich habe dir vor einer Stunde die Vorzüge dieser Nacht aufgezählt: den Sturm, meine Jugend, den Wein des alten Flusses und Hagel und Donner! ich habe die Liebe vergessen! Die Liebe, die alle anderen beinhaltet, die Liebe, die wahre Jugend, die Liebe, der wahre Sturm, die Liebe, die wahre Trunkenheit.«
Dann, nachdem er sein Pferd zu einem Sprung näher an das Mädchen heran getrieben hatte, sagte er:
»Ich liebe dich! reizende Hexe. Liebe du auch mich und wir werden ein schöne Hochzeit feiern. Ja, sofort. Wenn Königinnen sich vermählen, werden die Wasserfontänen aufgedreht und Kanonenschüsse abgefeuert. Bei unserer Hochzeit lässt Gott es regnen und schießt Donnerschläge. Ich sehe, dass du einen echten Ziegenbock mit dir führst, und ich halte dich für eine Hexe, aber ich nehme dich. Ich gebe dir meine Seele, gib du mir deine Schönheit!«
»Sie sind gottlos und mir gegenüber undankbar«, sagte das Mädchen und verschwand.
Samuel versuchte noch einmal ihr zu folgen, aber der Hang war definitiv nicht zu bezwingen.
»Na komm, komm jetzt«, forderte Julius ihn auf.
»Und wo willst du, dass ich hingehe?«, entgegnete Samuel schlecht gelaunt.
»Na zu dem Haus, das sie uns angegeben hat.«
»Gut! du glaubst ihr also?«, meinte Samuel. »Und sollte das Haus existieren, wer sagt dir, dass dort, wohin die ehrliche Person verspätete Reisende hingeleitet, kein Halsabschneider lebt?«
»Hast du nicht gehört, was sie zu dir gesagt hat, Samuel? Undankbar ihr gegenüber und gotteslästerlich.«
»Dann lass uns gehen, da du es willst«, gab der junge Mann nach. »Ich glaube es nicht, aber wenn es dir Freude bereitet, dann gebe ich vor, zu glauben.«
»Schau da, du böser Geist!«, rief Julius zehn Minuten später.
Und er zeigte seinem Freund den Lindenhain, von dem das Mädchen gesprochen hatte. Ein Licht, das durch die Äste drang, ließ sie hinter den Bäumen ein Haus erkennen. Die zwei ritten unter den Linden durch und erreichten das Gitter des Hauses.
Julius hob die Hand zur Klingel.
»Du klingelst dem Halsabschneider?«, fragte Samuel.
Julius ging nicht drauf ein und klingelte.
»Ich wette«, sagte Samuel, indem er seine Hand auf den Arm des jungen Mannes legte, »ich wette, es wird das Mädchen mit dem Ziegenbock sein, das uns aufmachen wird.«
Die Vordertür wurde geöffnet und eine menschliche Gestalt trat mit einer Blendlaterne an das Gitter, wo Julius klingelte.
»Wer Sie auch sind«, bat Julius die Person, die auf ihn zukam, »berücksichtigen Sie die Zeit und die Situation, in der wir uns befinden; wir ziehen jetzt seit mehr als vier Stunden durch Abgründe und Stürme; geben Sie uns Asyl für die Nacht.«
»Kommen Sie herein«, rief eine Stimme, die die jungen Leute kannten.
Es war jene des Mädchens vom Weg zur Burgruine und vom Höllenloch.
»Siehst du«, sagte Samuel zu Julius, der sich eines Zusammenzuckens nicht erwehren konnte.
»Was ist dies für ein Haus?«, fragte Julius.
»Nun, meine Herren! Wollen Sie nicht eintreten?«, fragte das Mädchen.
»Aber sicher, bei Gott!«, antwortete Samuel. »Ich trete sogar ein in die Hölle, wenn die Pförtnerin hübsch ist.
3
Morgen im Mai - Tag der Jugend
Als Julius am nächsten Tag in einem wunderbaren Bett aufwachte, benötigte er einige Zeit, um zu verstehen, wo er sich befand. Er öffnete die Augen. Ein fröhlicher Sonnenstrahl, der sich durch den geöffneten Fensterladen stibitzt hatte, sprang munter, voller lebendiger Atome auf einem weißen, blank geputzten Holzparkett. Eine lebhafte Melodie eines Vogelkonzerts ergänzte das Licht.
Julius sprang aus seinem Bett. Er schlüpfte in einen bereitgelegten Morgenmantel sowie in Pantoffel und begab sich zum Fenster.
Kaum hatte er Fenster und Fensterladen geöffnet, wurde das Zimmer von Gesang, Sonnenstrahlen und Wohlgerüchen überflutet. Vor der Wohnung lag ein lieblicher Garten, voll mit Blumen und Vögeln. Hinter dem Garten durchquerte und belebte der Neckar das Tal. In der Ferne bildeten die Berge den Horizont.
Und über alldem, der strahlende Himmel eines schönen Maimorgens. Und in alldem, diese Lebensfreude, von der in dieser Jahreszeit die Luft erfüllt ist.
Das Gewitter hatte die letzte Wolke weggefegt. Das Himmelsgewölbe bestand vollständig aus diesem tiefen, ruhigen Blau, das einen an das Lächeln Gottes gemahnt.
Ein unerklärliches Gefühl von Frische und Wohlbefinden befiel Julius. Der Garten, erneuert und gedüngt durch diese Regennacht, war voll von Lebenssaft. Spatzen, Grasmücken und Distelfinken, glücklich darüber dem Unwetter entkommen zu sein, verwandelten jeden Ast in ein Orchester. Die Regentropfen, von der Sonne angestrahlt, um sie zu trocknen, machten aus jedem Grashalm einen Smaragd.
Eine Weinrebe rankte sich spielerisch über Kreuz empor und versuchte ins Zimmer zu gelangen, um Julius einen Freundschaftsbesuch abzustatten.
Aber plötzlich sah und hörte Julius nichts mehr: Weinrebe, Vögel, Tau im Gras, Gesang in den Blättern, Berge in der Ferne, der herrliche Himmel; alles war weg.
Eine junge und reine Stimme hatte sein Ohr berührt. Er hatte sich vorgebeugt und im Schatten einer Heckenkirsche die lieblichste Menschengruppe entdeckt, die man sich erträumen kann.
Ein junges Mädchen, kaum fünfzehn Jahre alt, hielt auf ihrem Schoß einen ungefähr fünfjährigen Jungen und brachte ihm das Lesen bei.
Das junge Mädchen war von außergewöhnlicher Zierlichkeit. Die blauen Augen verrieten Sanftheit und Intelligenz, der Kopf war so reich mit weißblonden Haaren übersät, dass der Hals fast zu zart schien, ihn zu tragen, dazu eine wundervolle Reinheit der Gesichtszüge; alles unzulängliche Ausdrücke, um die Lichtgestalt zu beschreiben, die Julius erschienen war. Vor allem ihre Jugendlichkeit war überwältigend. Ihre ganze Person war eine Ode an die Unschuld, eine Hymne an die Reinheit, eine Strophe an den Frühling. Es bestand eine unaussprechliche Harmonie zwischen diesem jungen Mädchen und dem Tagesanbruch, zwischen dem Blitzen ihrer Augen und dem Tau im Gras.
Es war der Rahmen und das Bild.
Was sie vor allem charakterisierte, war ihre Anmut. Ohne schmächtig zu wirken, besaß sie eine lebendige und gesunde Ausstrahlung.
Sie war nach deutscher Art gekleidet: ein weißes und enges Korsett umfasste ihre Taille; ein ebenfalls weißer, unten geschmückter Rock, der kurz genug war, um einen lieblichen Fuß bis zum Knöchel sichtbar werden zu lassen, fiel entlang ihrer Hüften und ergoss sich in einer durchsichtigen Flut.
Der kleine Junge auf ihrem Schoß, rosig und wach unter seinen schwarzen Locken, nahm seinen Leseunterricht sehr aufmerksam und ernst. Er nannte die mittleren Buchstaben des Alphabets, indem er sie mit dem Finger verfolgte. Die Buchstaben waren viel größer als seine Finger. Nach jedem Buchstaben hielt er inne und hob dabei verunsichert den Kopf, um sich bei seiner Lehrerin zu vergewissern, dass er sich nicht geirrt hatte. Bei einem Fehler wiederholte sie und er begann erneut. Wenn alles gut war, lächelte sie und er fuhr fort.
Julius konnte sich nicht satt sehen an diesem lieblichen Bild. Diese göttliche Menschengruppe an diesem göttlichen Ort, diese Kinderstimme inmitten des Sprechgesangs der Vögel, die Schönheit des jungen Mädchens in der Schönheit der Natur, dieser Frühling des Lebens im Leben des Frühlings bildeten zusammen mit den heftigen Eindrücken der Nacht einen solchen Kontrast, dass er vor lauter Rührung in eine süße Anbetung verfiel.
Plötzlich schreckte er hoch, da ein Kopf den seinen berührte. Samuel war ins Zimmer getreten und hatte sich auf den Zehenspitzen genähert, um zu sehen, was sich Julius mit so viel Aufmerksamkeit anschaute.
Julius forderte ihn mit bittender Geste auf, keinen Lärm zu machen. Aber Samuel, wenig gefühlvoll, beachtete den Wunsch nicht und, da die Weinrebe ihn am Sehen hinderte, schob er sie beiseite.
Wegen des Raschelns der Blätter hob das junge Mädchen den Kopf und errötete leicht. Auch der kleine Junge blickte zum Fenster und vernachlässigte sein Buch, als er die Fremden sah. Er irrte sich bei fast jedem Buchstaben. Das junge Mädchen verlor etwas die Geduld, vielleicht eher, weil es sich wegen der Blicke genierte als wegen der Fehler des Kindes. Dann, nach einer Minute, schlug es lieblos das Buch zu, setzte seinen Schüler auf den Boden, erhob sich, ging unter Julius’ Fenster vorbei, beantwortete den an es gerichteten Gruß der jungen Leute und betrat mit dem Kind das Haus.
Verärgert wandte sich Julius an Samuel.
»Du hast sie erschreckt!«, warf er ihm vor.
»Ja, ich verstehe«, spottete Samuel, »der Sperber verängstigt die Lerche. Aber, du kannst dich beruhigen, diese Vögel dort sind gezähmt und kommen immer wieder. – Ach, du wurdest diese Nacht also nicht ermordet? Wenn man dem Schein trauen darf, lässt es sich in dieser Spelunke einigermaßen gut wohnen. Dein Zimmer ist nicht schlechter als meins, wie ich sehe. Außerdem hängt bei dir ein Stich mit der Geschichte des Tobias.«
»Mir scheint ich habe geträumt«, meinte Julius.
»Sehen wir uns die Ereignisse dieser Nacht an; die hübsche Tochter dieses hässlichen Bocks hat uns doch geöffnet, nicht wahr? Mit einem geheimnisvollen Zeichen hat sie uns empfohlen still zu sein; sie hat uns den Stall für unsere Pferde gezeigt; dann ging sie uns ins Haus voraus, hat uns im zweiten Stock zu diesen aneinander angrenzenden Zimmern geführt; sie zündete diese Lampe an und mit einem Knicks verschwand sie geschwind, ohne eine Silbe zu sagen. Mir schien es, Samuel, dass du wenigstens genau so überrascht warst wie ich. Allerdings wolltest du ihr nach, ich hielt dich zurück und wir entschieden uns, zu Bett zu gehen. Stimmt doch so?«
»Deine Erinnerungen«, erwiderte Samuel, »entsprechen genauestens der einfachsten Wirklichkeit. Und ich wette, dass du mir jetzt vergibst, dich gestern Abend in die Herberge geschleppt zu haben. Wirst du das Gewitter noch verleumden? Hatte ich Unrecht dir zu sagen, dass das Schlechte das Gute nach sich zieht. Der Donner und der Regen haben uns schon zwei ordentlich möblierte Zimmer eingebracht, den Genuss einer wunderbaren Landschaft und die Bekanntschaft eines jungen, exquisiten Mädchens, das wir allein aus Höflichkeit lieben müssen und das diese Liebe aus Gastfreundschaft erwidern muss.«
»Wieder Gotteslästerungen!«, sagte Julius.
Samuel wollte gerade eine spöttische Antwort geben, als die Zimmertür sich öffnete und eine alte Dienerin eintrat, die den zwei Freunden zusammen mit ihren getrockneten und gesäuberten Kleidern Brot und Milch zum Frühstück brachte.
Julius bedankte sich bei ihr und fragte, bei wem sie sich befänden. Die Alte antwortete, sie seien im Pfarrhaus von Landeck beim Pastor Schreiber.
Und da die gute Frau gesprächig schien, ergänzte sie unaufgefordert ihre Informationen, während sie das Zimmer aufräumte: »Die Frau des Pastors starb vor fünfzehn Jahren bei Fräulein Christianes Geburt. Dann verlor der Pastor auch noch vor drei Jahren seine älteste Tochter Margarete. Jetzt blieben ihm nur noch seine Tochter, Fräulein Christiane und sein Enkel Lothario, Margaretes Sohn.«
In dem Moment fuhr der würdige Pastor mit Christiane ins Dorf, da seine religiösen Pflichten ihn in die Kirche riefen. Aber er würde am Mittag zurückkehren, das heißt zum Mittagessen und dann seine Gäste sehen.
»Aber«, fragte Samuel, »wer hat uns gestern hier eingeführt?«
»Ah«, antwortete die Dienerin, »das ist Gretchen.«
»Gut; nun erkläret uns, wer Gretchen ist.«
»Gretchen? nun, die Ziegenhirtin.«
»Die Ziegenhirtin!«, rief Julius. »Das erklärt viele Dinge im Allgemeinen und den Bock im Besonderen. Und wo befindet sie sich gerade?«
»Oh! sie ist auf ihren Berg zurückgekehrt. Im Winter, oder wenn das Wetter im Sommer zu stürmisch wird, kann sie die Nacht nicht in ihrer Bretterhütte verbringen und dann kommt sie ins Pfarrhaus zum Schlafen, wo sie ihr Zimmer neben meinem hat, aber sie bleibt nicht lange. Sie ist eine eigenartige Kreatur. Sie erstickt zwischen den Wänden; sie braucht die frische Luft wie ihre Tiere.«
»Aber mit welchem Recht hat sie uns hier einquartiert?«, fragte Julius.
»Es ist nicht wegen eines Rechts, sondern aus Pflicht«, erwiderte die Dienerin, »und der Herr Pastor rät ihr jeden Tag, an dem er sie sieht, ihm jeden müden oder verirrten Reisenden zu bringen, dem sie begegnet, da es keine Herberge im Land gibt, und er sagt, dass das Pfarrhaus Gottes Haus ist und Gottes Haus das Haus von allen.«
Die Alte verschwand. Die jungen Leute frühstückten, zogen sich an und stiegen in den Garten hinab.
»Lass uns bis zum Essen spazieren gehen«, schlug Samuel vor.
»Nein«, erwiderte Julius; ich bin müde.«
Und er wollte sich gleich auf eine Bank im Schatten eines Geißblattes setzen.
»Müde!«, sagte Samuel. Du bist gerade aus dem Bett gestiegen.« Aber gleich lachte er lauthals.
»Ha! ja, ich verstehe; auf dieser Bank saß Christiane. Ha! mein armer Julius! So schnell!«
Julius erhob sich fassungslos.
»In der Tat«, fuhr er fort, »wir können auch gehen. Wir werden noch lange genug sitzen. Schauen wir uns den Garten an.«
Und er fing an über Blumen und die Anlage der Wege zu sprechen, so als hätte er Eile, das Gesprächsthema, das Samuel angeschlagen hatte, d.h. die Bank und die Tochter des Pastors, zu wechseln. Er konnte sich nicht erklären warum, aber Christianes Namen im spöttischen Mund von Samuel fing an, ihm unangenehm zu werden.
So gingen sie während einer guten Stunde. Am Ende des Gartens fand sich eine Obstwiese. Aber zu dieser Jahreszeit war diese auch ein Garten. Die Apfel- und die Birnbäume bestanden nur aus riesigen weißen und rosafarbenen Blumensträußen.
»Woran denkst du?«, fragte Samuel plötzlich Julius, der seit einiger Zeit vor sich hin träumte und kein Wort mehr sagte.
Wir wagen nicht zu behaupten, dass Julius’ Antwort ganz ehrlich war, als er endlich erwiderte: »An meinen Vater.«
»An deinen Vater! Und in welchem Zusammenhang denkst du an diesen berühmten Gelehrten, wenn ich dich bitten darf?«
»Eh! dass er vielleicht morgen um diese Uhrzeit keinen Sohn mehr hat.«
»Oh! mein Lieber, verfassen wir nicht unser Testament im Voraus, he?«, sagte Samuel. »Ich werde morgen wenigstens genauso in Gefahr sein wie du, glaube ich. Aber es reicht, wenn wir morgen daran denken. Du weißt nicht, bis zu welchem Punkt die Vorstellung den Willen zersetzen kann8. Daraus ergibt sich die Unterlegenheit der großen Geister gegenüber den Dummköpfen. Was uns betrifft, wollen wir das nicht akzeptieren.«
»Sei still!«, fing Julius wieder an. »Weder mein Wille noch mein Mut werden morgen wegen der Gefahr schwächeln.«
»Ich zweifle nicht daran, Julius. Aber stell deine verdrießliche Laune ab. Schau her, ich glaube der Pastor und seine Tochter kehren zurück. Schau! Schau! Auch dein Lächeln kehrt mit ihnen zurück. War es mit ihnen in die Kirche gegangen?«
»Witzbold«, sagte Julius.
Tatsächlich kamen der Pastor und Christiane gerade zurück. Christiane steuerte direkt auf das Haus zu; der Pastor beeilte sich zu seinen Gästen.
4
Fünf Stunden in fünf Minuten
Pastor Schreiber hatte die strenge und rechtschaffene Physiognomie eines deutschen Priesters, der es gewohnt war, das zu praktizieren, was er predigte. Er war ein Mann von etwa fünfundvierzig Jahren, somit noch jung. Sein Gesicht war geprägt von einer melancholischen und ernsten Güte. Die Ernsthaftigkeit erwuchs ihm aus seiner Funktion, die Melancholie aus dem Tod seiner Frau und seiner Tochter. Man spürte, dass er nicht darüber hinweggekommen war, und der stete Schatten des menschlichen Bedauerns kämpfte auf seiner Stirn mit der tröstenden Klarheit der christlichen Hoffnungen.
Er reichte den jungen Leuten die Hand, erkundigte sich wie sie geschlafen hatten und dankte ihnen dafür, freundlicherweise an seiner Tür angeklopft zu haben.
Einen Augenblick später läutete die Glocke zum Mittagessen.
»Lasst uns zu meiner Tochter gehen, meine Herren.« sagte der Pastor. »Ich zeige Ihnen den Weg.«
»Er fragt nicht nach unseren Namen,« flüsterte Samuel Julius zu. »Unnötig also, sie ihm zu sagen. Der deine ist vielleicht zu großartig für die Bescheidenheit der Kleinen und der meine zu hebräisch für die Frömmigkeit des guten Mannes.«
»Sei’s drum«, sagte Julius »geben wir uns als Prinzen und bleiben inkognito.«
Sie betraten den Speiseraum und trafen dort Christiane und ihren Neffen an. Christiane begrüßte die beiden jungen Leute mit Anmut und Schüchternheit.
Man setzte sich an einen viereckigen Tisch, der einfach, aber reichlich gedeckt war; der Pastor zwischen die zwei Freunde, Christiane ihm gegenüber, von Julius getrennt durch das Kind.
Die Mahlzeit war anfangs recht still. Julius, verlegen vor Christiane, schwieg. Christiane schien sich nur um den kleinen Lothario zu kümmern, den sie zu umsorgen schien, wie eine junge Mutter und der sie Schwester nannte. Die Konversation wurde so nur unterhalten durch den Pastor und Samuel. Der Pastor war glücklich Studenten zu empfangen.
»Auch ich war Studiosus«, sagte er. »Das Studentenleben war lustig damals.«
»Es ist etwas dramatischer jetzt« erwiderte Samuel, zu Julius hinschauend.
»Ah!«, fuhr der Pastor fort, »das war damals sicher die beste Zeit meines Lebens. Seither habe ich das Glück dieser Anfänge recht teuer bezahlt. Ich hoffte auf das Leben. Nun ist es ganz das Gegenteil. Oh! Ich sage das nicht, um sie traurig zu stimmen, meine jungen Gäste, ich sage es fast heiter, wie sie sehen. Auf jeden Fall wünsche ich, dass die Erde mich noch behält, bis ich Christiane glücklich im Hause ihrer Ahnen gesehen habe ….«
»Mein Vater!«…unterbrach Christiane im Ton eines zärtlichen Vorwurfes.
»Du hast recht, meine blonde Weisheit«, antwortete der Pastor, »lasst uns von anderen Dingen reden. Weißt du, dass, Gott sei Dank, der Orkan von letzter Nacht fast alle meine lieben Pflanzen verschont hat.«
»Sie sind Botaniker, mein Herr?«, fragte Samuel.
»Ein wenig« antwortete der Pfarrer mit einigem Stolz. »Sind Sie es vielleicht auch, mein Herr?«
»Gelegentlich,« bestätigte der junge Mann beiläufig.
Dann, während er den Pastor sich über seine liebsten Studien äußern ließ, enthüllte Samuel plötzlich, sozusagen, ein tiefgreifendes und unverschämtes Wissen und machte sich einen Spaß daraus den ehrenwerten Mann mit seinen neuen Einblicken und überraschenden Ideen in höchstes Erstaunen zu versetzen. Schließlich, ohne von seinem höflichen, kalten und etwas spöttischen Benehmen abzulassen und ohne den Anschein zu erwecken, es antasten zu wollen, machte er, durch die Überlegenheit seiner wirklichen Kenntnisse, die etwas oberflächliche und vor allem etwas veraltete Gelehrsamkeit des Pastors, zunichte.
Währenddessen begannen Julius und Christiane, die bis dahin, sich nur verstohlen beobachtend, stumm geblieben waren, ein wenig zutraulicher zu werden.
Lothario diente zunächst als Verbindung zwischen ihnen. Julius traute sich noch nicht Christiane selbst anzusprechen, richtete aber an das Kind Fragen, die Lothario nicht beantworten konnte. Das Kind fragte dann Christiane, die Lothario und somit auch Julius antwortete. Julius fühlte sich überglücklich, dass er so die Gedanken des Mädchens aus einem anmutigen und unschuldigen Munde erfahren konnte.
Beim Nachtisch waren die drei, dank dieser Direktheit und Offenheit, die den ganzen Reiz eines Kindes ausmachen, schon gute Freunde.
Daher spürte Julius sich beklemmt und runzelte die Stirn, als er, beim Wechsel zum Kaffeetrinken in den schattigen Garten, Samuel erblickte, der sich näherte und drohte, sie in ihrer gerade begonnenen zarten Vertrautheit zu stören. Der Pastor hatte höchst selbst alten Branntwein aus Frankreich holen wollen.
Ihm fehlte es nicht an Dreistigkeit, ihm, dem tüchtigen und sardonischen Samuel, und Julius sah entrüstet, wie er den Blick gelassen und selbstgefällig auf der reizenden Christiane ruhen ließ und sagte:
»Wir möchten Sie noch um Verzeihung bitten, Fräulein, dass wir heute Morgen den Unterricht, den Sie Ihrem Neffen erteilten, dummerweise unterbrochen haben.«
»Oh!« antwortete sie, »der war sowieso beendet.«
»Ich konnte meine Überraschung nicht zurückhalten. Bedenken Sie, dass wir gestern nahe dran waren, angesichts ihrer Kleidung, ihres Ziegenbocks und der Blitze, das Mädchen, das uns hierhergeführt hat, für eine Hexe zu halten. Unter diesem Eindruck schliefen wir ein, und heute Morgen, beim Öffnen unseres Fensters, finden wir den Ziegenbock verwandelt in ein reizendes Kind, und die Hexe …«
»War ich!« unterbrach Christiane lebhaft, mit fröhlicher und auch etwas spöttischer Schnute.
Dann drehte sie sich zu Julius, der eine reservierte Miene zur Schau trug, und fragte: »Haben auch Sie, mein Herr, mich für eine Hexe gehalten?«
»Also! Aber«, stotterte Julius, »es ist nicht natürlich, so hübsch zu sein.«
Christiane, die bei Samuels Worten gelächelt hatte, errötete bei den Worten von Julius.
Aus Bange, zu viel gesagt zu haben, wandte Julius sich eiligst wieder dem Kinde zu.
»Lothario, möchtest du, dass wir dich mit zur Universität nehmen?«
»Schwester«, fragte Lothario Christiane, »was ist eine Universität?«
»Das soll der Ort sein, wo man alles lernen kann, mein Kind«, gab der Pastor, der gerade zurückkam, heiter zur Antwort.
Das Kind drehte sich ernst zu Julius:
»Ich brauche nicht mit Ihnen zu kommen da ich meine Schwester als Universität habe. Christiane weiß alles, mein Herr: sie kann lesen, schreiben und französisch, musizieren und italienisch. Ich werde sie nie verlassen, niemals im Leben.«
»Ach! Sie sind glücklicher als wir, mein kleiner Mann«, sagte Samuel,« denn jetzt ist für uns die Stunde zu gehen, Julius.«
»Wie das!«, rief der Pastor aus, »sie gestehen mir nicht mindestens diesen Tag zu! Sie werden nicht mit uns zu Abend essen!«
»Tausend Dank!«, entgegnete Samuel, »aber unsere Anwesenheit in Heidelberg, heute Abend, ist unerlässlich.«
»Ach wo! abends gibt es weder Unterricht noch Appell.«
»Nein, aber es ist eine noch bedeutsamere Pflicht, die nach uns verlangt, Julius weiß es wohl.«
»Schließenwir einen Kompromiss«, sagte der Pastor. »Heidelberg ist nur sechs oder acht Meilen von Landeck entfernt. Um Ihre Pferde sich erholen und die Hitze des Tages sinken zu lassen, können Sie sehr wohl erst in vier Stunden aufbrechen. Sie werden noch vor der Dunkelheit in der Stadt sein, ich versichere es Ihnen.«
»Unmöglich. Wegen der Pflicht, die uns dort ruft, sollten wir eher vor der Zeit dort sein, nicht wahr, Julius?«
»Wirklich?« murmelte Christiane halblaut, ihren reizenden blauen Blick auf Julius hebend.
Julius, der bis dahin geschwiegen hatte, konnte dieser sanften Frage nicht widerstehen.
»Komm schon, Samuel«, sagte er, »lass uns die Gunst unserer vortrefflichen Gastgeber nicht enttäuschen. Wir können Punkt vier Uhr aufbrechen.«
Samuel bedachte Julius und das junge Mädchen mit seinem fiesen Blick.
»Du willst es? Nun gut!« sagte er mit einem spöttischen Lächeln zu Julius.
»Recht so!« rief der Pastor, »und hier dann das Programm des Tages: ich werde Ihnen, bis drei Uhr, meine Sammlungen und meinen Garten zeigen, meine Herren. Dann werden wir, meine Kinder und ich, Sie bis zur Kreuzung von Neckarsteinach begleiten. Ich habe einen geschickten und kräftigen Burschen, der Ihnen Ihre Pferde dorthin bringen wird. Sie werden sehen! Die Straße, die Ihnen bei Nacht und Gewitter so schrecklich schien, ist in der Sonne herrlich. Und wir werden dort drüben sicherlich Ihrer angeblichen Hexe begegnen. Schließlich, ein bisschen ist sie es wirklich, aber auf die christlichste Art der Welt; sie ist ein keusches und heiliges Kind.«
»Ah! Ich würde sie gerne auch bei Tag wiedersehen«, fuhr Samuel fort. »Lasset uns zu hrem Herbarium gehen, mein Herr«, sagte er zum Pastor und stand auf.
Und, nahe an Julius vorbeigehend, flüsterte er ihm ins Ohr: »Ich werde den Vater beschäftigen und mit ihm ein Gespräch über Tournefort9 und Linné10 anknüpfen. Bin ich hilfreich genug?«
In der Tat, er nahm den Pastor in Beschlag und Julius war einige Augenblicke mit Christiane und Lothario allein. Sie fühlten sich jetzt dicht beieinander wohler; sie wagten, sich anzuschauen und miteinander zu sprechen.
Der Eindruck, den Christiane morgens auf Julius gemacht hatte, grub sich immer tiefer bei ihm ein. Nichts Frischeres und Lebendigeres als dieses sanfte Antlitz, von dem sich, wie in einem offenen Buch, alle jungfräulichen Gemütsregungen ablesen ließen. Christianes Blick war rein wie Quellwasser und ließ auf dem Grunde ein entzückendes und rechtschaffenes Herz erkennen. Schönheit und Güte, es war ein Charakter so klar wie dieser Maitag.
Durch die Anwesenheit von Lothario war die zärtliche Unterhaltung so unschuldig wie gelöst. Christiane zeigte Julius ihre Blumen, ihre Bienen, ihren Hühnerstall, ihre Musik, ihre Bücher, das heißt ihr ganzes ruhiges und einfaches Leben. Dann sprach sie ein wenig über ihn selbst.
»Wie«, fragte sie ihn einmal, »können Sie, der so friedlich und sanft scheint, einen so spöttischen und überheblichen Freund haben?«
Sie hatte sehr wohl bemerkt, dass Samuel sich heimlich über die Gutmütigkeit ihres Vaters lustig machte, und er war ihr sofort unsympathisch gewesen.
Julius dachte, dass Goethes Margarete in der wunderbaren Gartenszene11 über Mephisto etwas recht Ähnliches sagte. Jedoch war er bereits der Meinung, dass die Margarete von Faust mit seiner Christiane nicht vergleichbar sei. Während sie sich unterhielten, bemerkte er, dass sich hinter der Naivität und der Anmut des jungen Mädchens ein Kern von Vernunft und Stärke verbarg, der zweifellos der Traurigkeit einer Kindheit ohne Mutter geschuldet war. Hinter dem Kind erahnte man schon die Frau.
Beide konnten eine naive Anwandlung von Überraschung nicht unterdrücken, als der Pastor und Samuel bei ihrer Rückkehr ihnen mitteilten, es sei drei Uhr und Zeit, sich auf den Weg zu machen.
Fünf Stunden sind für die glückliche und vergessliche Uhr des ersten Herzklopfens immer fünf Minuten.
5
Blumen und Pflanzen misstrauen Samuel
Es war daher notwendig, sich auf den Weg zu machen. Aber gut, sie konnten ja noch eine Stunde zusammen verbringen. Als er darüber nachdachte, war Julius glücklich. Er hatte vor, das Gespräch mit Christiane unterwegs fortzusetzen; aber daraus wurde nichts. Christiane spürte instinktiv, dass sie Julius nicht zu nahe kommen sollte. Sie nahm den Arm ihres Vaters, der sein Gespräch mit Samuel fortsetzte. Julius wurde traurig und ging hinter ihnen her.
Sie erklommen einen reizenden Hang in einem reizenden Wald, wo die Sonnenstrahlen durch den lichten Schatten brachen. Die gelassene Stimmung des Nachmittags wurde durch die lieblichen Klänge der Nachtigall unterstrichen.
Julius, wir sagten es, hielt sich abseits, schon verärgert über Christiane.
Er versuchte eine andere Methode: »Lothario, komm schau mal«, rief er dem netten Kind zu, das neben Christiane ging, an ihrer Hand hängend und drei Schritte für einen machte.
Lothario lief zu seinem neuen, zwei Stunden alten Freund. Julius zeigte ihm eine Libelle, die gerade auf einem Busch gelandet war, schlank, zitternd, prächtig. Das Kind stieß einen Freudenschrei aus.
»Schade«, sagte Julius, »dass Christiane sie nicht sehen kann!«
»Schwester«, rief Lothario, »komm schnell!«
Und da Christiane nicht kam, weil sie ahnte, dass es nicht das Kind war, das sie rief, lief Lothario zu ihr, zog sie an ihrem Kleid, zwang sie, den Arm ihres Vaters loszulassen, und führte sie triumphierend zum Busch.
Die Libelle war weg – aber Christiane war gekommen.
»Du hast mich umsonst gerufen«, sagte Christiane und kehrte zu ihrem Vater zurück.
Julius probierte diesen Trick mehrmals. Er ließ Lothario alle Schmetterlinge und Blumen auf der Straße bewundern und bedauerte immer, dass Christiane nicht da war, um deren Schönheit zu genießen. Jedes Mal lief Lothario sofort zu Christiane und sie musste wohl oder übel kommen, er bestand darauf. So missbrauchte Julius das Kind, um dem jungen Mädchen einige Sekunden Zusammensein zu Dritt abzugewinnen. Es gelang ihm auch, sie dazu zu bringen, aus den kleinen Händen von Lothario, seinem unschuldigen Komplizen, eine prächtige rosa blühende Heckenrose anzunehmen.
Doch Christiane kehrte immer zu ihrem Vater zurück.
Sie konnte Julius, wegen seiner Begierde und seiner Beharrlichkeit, aber nicht böse sein: musste dieses anmutige junge Mädchen nicht doch gegen ihr eigenes Herz ankämpfen, um nicht zu bleiben?
»Hören Sie«, sagte sie beim letzten Mal in einem kindlichen Ton, der ihn entzückte, »ich wäre wirklich unhöflich, wenn ich nur mit Ihnen reden würde, und mein Vater wäre überrascht, wenn ich nie in seiner und in Ihres Freundes Nähe wäre. Aber Sie werden bald zurück sein, nicht wahr? Wir werden wieder mit meinem Vater und Lothario spazieren gehen; und wenn Sie möchten, werden wir das Höllenloch und die Burgruine Eberbach besuchen; – großartige Sehenswürdigkeiten, Herr Julius, die Sie nachts nicht sehen konnten, die Sie tagsüber mit Freude sehen werden, und diesmal werden wir uns unterwegs unterhalten, das verspreche ich Ihnen.«
Sie kamen an der Kreuzung an. Die Pferde, die der kleine Diener des Herrn Schreiber bringen sollte, waren noch nicht angekommen.
»Lasst uns ein paar Schritte nach drüben gehen,« sagte der Pfarrer, »und vielleicht treffen wir Gretchen in ihrer Hütte.«
Tatsächlich erblickten sie bald das kleine Ziegenmädchen. Seine Hütte stand auf halber Höhe des Hügels, geschützt durch den Felsen. Um Gretchen herum grasten ein Dutzend Ziegen, rastlos, furchtlos, kletterten überall hin, wo es Vertiefungen gab und liebten nur das Unkraut, das in deren Böden wuchs; eben echte Vergil-Ziegen – hängen am Felsen und grasen den bitteren Ginster12.
Am helllichten Tag war Gretchen noch seltsamer und hübscher als im Licht des Blitzes. Eine dunkle Flamme erhellte ihre schwarzen Augen. Ihr Haar, schwarz wie ihre Augen, war mit bizarren Blumen verflochten. In diesem Moment hockte sie da, das Kinn in der Hand und wie von einer fesselnden Beschäftigung gepackt. In ihrer Haltung, ihrer Frisur, ihrem Blick hatte sie viel von einer Zigeunerin, ein wenig von einer Verrückten.
Christiane und der Pfarrer kamen zu ihr. Sie schien sie nicht zu sehen.
»He!«, sagte der Pfarrer, »was heißt das, Gretchen? Ich komme vorbei und du läufst mir nicht entgegen wie sonst? Du willst also nicht, dass ich dir für die Gäste danke, die du mir letzte Nacht gebracht hast?
Gretchen stand nicht auf und seufzte. Dann sagte sie mit trauriger Stimme:
»Sie tun gut daran, mir heute zu danken; morgen werden Sie mir vielleicht nicht mehr danken.«
Samuel warf der Ziegenhirtin einen sarkastischen Blick zu.
»Es scheint, es tut dir leid, uns hingebracht zu haben?«, sagte er.
»Sie besonders«, antwortete sie. »Aber auch er«, fuhr sie fort und schaute dabei Christiane mit einem Ausdruck schmerzlicher Zuneigung an, »auch er hat kein Glück gebracht ...«
»Und wo hast du das gesehen?«, fragte Samuel, immer noch kichernd.
»In der Tollkirsche und dem getrockneten Kleeblatt.«
»Ach!«, sagte Samuel zum Pfarrer, »Gretchen studiert auch Botanik?«
»Ja«, antwortete Christianes Vater, »sie behauptet, in den Pflanzen die Gegenwart und die Zukunft lesen zu können.«
»Ich glaube«, sagte die Ziegenhirtin ernst, »dass die Kräuter und Blumen, die nicht, wie die Menschen, Schlechtes angerichtet haben, würdiger sind als wir, dass Gott zu ihnen spricht. Aufgrund ihrer Unschuld wissen sie alles. Ich habe viel mit ihnen zusammengelebt und sie haben mir schließlich einige ihrer Geheimnisse erzählt.«
Und Gretchen fiel zurück in ihre dumpfe Apathie. Trotzdem, so benommen sie auch wirkte, fuhr sie fort, so dass jeder sie hören konnte, als ob sie allein wäre und zu sich selbst spräche:
»Ja, es ist der böse Fluch, den ich unter das Dach, das mir teuer ist, gebracht habe. Der Pastor hat meine Mutter gerettet, Gott bewahre, dass ich seine Tochter nicht ins Verderben stürze. Meine Mutter irrte durch die Gegend, lebte von ihrer Wahrsagerei, sie trug mich auf dem Rücken, ohne Ehemann und ohne Religion, hatte niemanden auf Erden noch im Himmel. Der Pastor nahm sie auf, ernährte und erzog sie. Dank ihm starb sie als Christin. Und nun! Mutter, siehst du wie ich dem, der deiner Seele das Paradies und deiner Tochter Brot geschenkt hat, danke, indem ich ihm Unglücksmenschen brachte. Elend und undankbar, das bin ich! Ich hätte sie erkennen müssen, an der Art wie ich ihnen begegnet bin. Ich hätte ihnen misstrauen müssen, nach dem was ich sie sagen hörte. Der Sturm hat sie gebracht, und sie brachten den Sturm.
»Aber beruhige dich doch, Gretchen«, sagte Christiane leicht verärgert. Du bist heute wahrlich unvernünftig. Hast du Fieber?«
»Mein Kind«, sagte der Pfarrer, »ich habe dir schon oft gesagt, dass du nicht immer so allein leben sollst.«
»Allein, nein! Gott ist mit mir«, antwortete Gretchen.
Und sie stützte den Kopf mit einer Art verwirrter Niedergeschlagenheit in beide Hände.
Dann redete sie weiter:
»Was geschehen muss, wird geschehen«, sagte sie. »Nicht er mit seiner vertrauensvollen Güte, nicht sie, mit ihrem Taubenherz, nicht ich mit meinen mageren Armen können das Schicksal abwehren. Vor dem Teufel werden wir drei so schwach sein, wie es der kleine Lothario wäre. Und ich bin nicht diejenige, für die es am wenigsten schlimm sein muss. Ah! es wäre besser, nicht vorauszusehen, was nicht verhindert werden kann. Wissen bringt nur Leiden.«
Als sie diese Worte beendet hatte, stand sie abrupt auf, warf den beiden Fremden einen wilden Blick zu und kehrte in ihre Hütte zurück.
»Arme Kleine!«, sagte der Pfarrer. »Sie wird ganz sicher verrückt, wenn sie es nicht schon ist.«





























